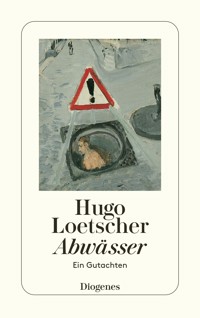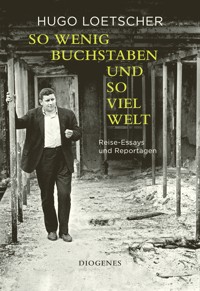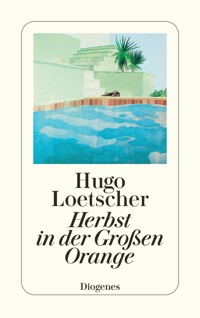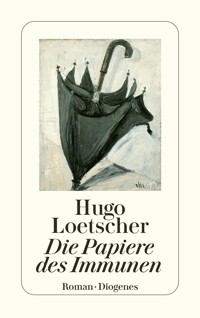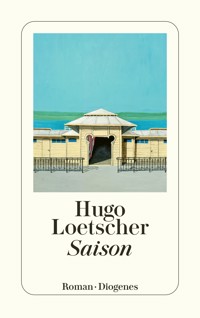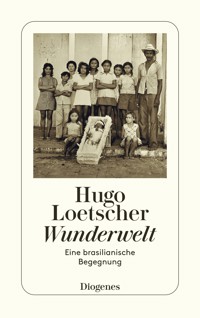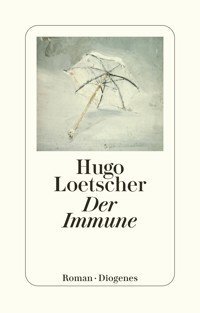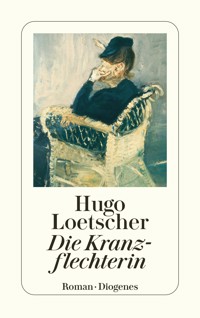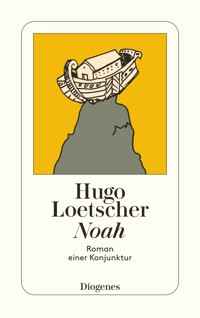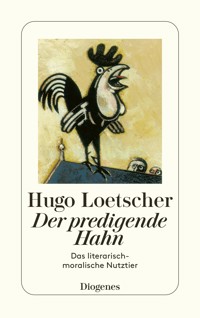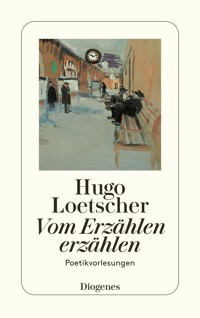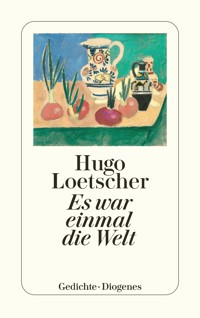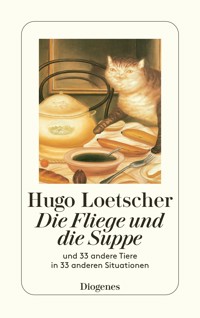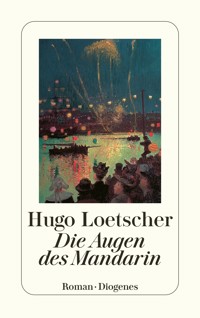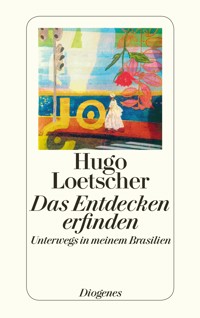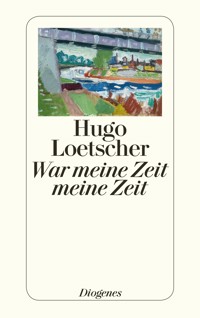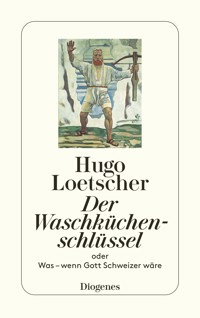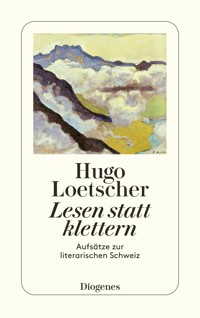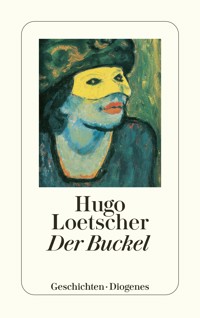
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neunzehn Geschichten, darunter zahlreiche unveröffentlichte, von einzigartiger Vielfalt. Ein Thema kehrt immer wieder in den knapp fünfzig Jahren ihres Entstehens: »Der Buckel« steht für den lädierten Menschen, den Ausgestoßenen und Benachteiligten. Geschichten von wunderbarer Präzision und abgründiger Leichtigkeit, die in Pointen von oft aphoristischer Erkenntnisschärfe gipfeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hugo Loetscher
Der Buckel
Geschichten
Diogenes
Ein Sommer mit Figuren
Der Zwerg
Madame Juliette schimpft. Sie sagt, man dürfe einen nicht dreißig Jahre leben lassen und dann in eine Klinik schicken. Da hätten sie ihn besser gleich abgetrieben. Aber was will man, sie kennt die Familie, der Vater des Zwerges trinkt und ist gewalttätig, er hat es von seinem Vater, der auch gewalttätig war, und weiter zurück erinnert man sich nicht, aber man kann es sich ausrechnen: Man springt mit der Natur nicht um, wie man will; eines Tages kommt der Zwerg, und eines Tages lassen sie ihn holen.
Und Madame Giraud fragt sich auch, sie hätte es nie gedacht. Noch gestern sei der Zwerg bei ihr gewesen, gottlob sei keine Kundschaft in den Laden gekommen. Der Zwerg habe sich in einen Empire-Sessel gesetzt. Das erlaube sie nur den besten Käufern. Und der Zwerg habe ihr seine Hand hingehalten. Sie liebe es nicht, wenn sich herumspreche, daß sie aus der Hand liest. Aber wie hätte sie dem Zwerg das übelnehmen wollen, jetzt, da sie ihn sogar geholt haben, ihm seien die Finger zu einer Faust zusammengewachsen, wie hätte sie aus solchen Linien Schicksal ablesen sollen.
Doch Madame Juliette meint, es sei alles vorauszusehen gewesen. Sie besorgte damals den Abwasch beim Vater des Zwerges, und der habe gleich, nachdem seine Frau im Kindbett starb, eine andere ins Haus genommen und gleich danach geheiratet, nicht einmal Allerseelen gingen sie ans Grab. Im Krieg sei er auch nicht eingezogen worden und habe sogar die Tabaklizenz erhalten. Hätten die kein schlechtes Gewissen gehabt, sie hätten das Kind anfänglich nicht auf diese Weise verwöhnt: Sie erinnert sich genau, wie sie das Kind unter einer Spitzendecke verbargen und sagten, es sei zurückgeblieben, aber eines Tages habe das Kind die Decke zu Boden gestrampelt, habe sich aufgesetzt und den Buckel gezeigt. Das sei eben mit Zwergen so, wohin die auch gingen, sie blieben immer Zwerge.
Madame Giraud sieht noch genau, wie er die Straße hinunterrannte. Immer diese blauen Hemden, die er trug. Aber nicht in Richtung Meer sei er verschwunden, sondern in den Hügeln habe er sich versteckt. Nach drei Tagen war er wieder da, er habe ihr zwar nicht gesagt, wo er gewesen sei, er habe erklärt, er sei aus Hunger zurückgekommen, einzig aus Hunger.
Madame Juliette kannte den Zwerg gut. Sie hat zwei Söhne, die kommen über Weihnachten und im Sommer hierher, und der aus Marseille bringt seine Familie mit. Die Söhne sind mit dem Zwerg aufgewachsen, aber der Zwerg sei nicht mitgewachsen. Sie werde ihrem Sohn aus Marseille schreiben, daß sie den Zwerg geholt haben, sonst bringe er ein Geschenk mit. Jeden Tag habe sie der Zwerg aufgesucht, immer am Nachmittag in der Zimmerstunde, sie wasche seit Jahren im Nachtklub ab und bringe nach Hause, was auf dem Teller liegenzulassen eine Sünde wäre, und der Zwerg habe ihr immer aus der Zeitung vorgelesen, weil sie ihn einmal darum bat; der Zwerg wollte sich erkenntlich zeigen. So habe er immer am Nachmittag vorgetragen, was sie am Morgen schon längst selber im Nice Matin gelesen habe, so viel zu tun gebe es am Vormittag nicht, daß sie nicht zwischendurch an eine Zeitung käme.
Dumm sei er nicht gewesen, lobt Madame Giraud. Er hätte das Zeug dazu gehabt, Schulen zu durchlaufen, und arm sei der Vater weiß Gott nicht. Aber man wisse, wie Kinder sind. Im Grunde sei es grausam, einen Zwerg in eine Schule zu stecken. Mit dem Bäcker sei es auch nicht gegangen. Sie habe verstanden, daß die Leute erschraken, als ihnen ein Zwerg das Brot brachte, obwohl es noch viele Orte mit einem Zwerg gebe, mit richtig schrecklichen Zwergen, und die hole auch niemand ab. Ein Glück, daß er am Abend die Backstube aufräumen durfte; nie habe es der Zwerg abgeschlagen, für sie einen Botengang zu tun. Im Grunde hätte er nur darauf gewartet. Was hätte er sonst schon getan, an irgendeiner Mauer gesessen und eine Eidechse gejagt.
Niemanden habe er gestört, ereiferte sich Madame Juliette. Nie habe man von einem Fremden eine Klage gehört, daß er sich auf der Terrasse aufhielt oder auf der Mauer saß und den Männern zuschaute, wie sie Boules spielten. Im Gegenteil, die Männer hätten sich über die Zwischenrufe gefreut, und sie luden ihn auch einmal ein mitzuspielen. Aber man spiele Boules nicht nur mit den Armen, sondern mit dem ganzen Körper, denn die Arme, die seien nicht kurz gewesen am Zwerg, einzig die Beine, die, ja die seien kurz gewesen, aber schließlich sei er ein Zwerg gewesen. Niemanden habe er gestört, und nun hätten sie ihn doch geholt. Er habe schon weite Hemden getragen, als sie noch nicht Mode waren, und nie sei er vor dem Restaurant seines Vaters gesessen, nicht einmal außerhalb der Saison.
Madame Giraud lacht. Was ihr der Zwerg nicht alles erzählt hatte, als er im Zirkus gewesen sei. Jeden Abend wollte er nach Nizza gehen. Nur weil es dort Zwerge gebe, die auf Kugeln tanzten, ganz wild sei er gewesen und habe behauptet, im Zirkus gebe es Gleichberechtigung – oh, wenn der Zwerg einmal anfing, seine Gedanken auszubreiten. Sie habe sich manchmal überlegt, ob es vielleicht doch nicht richtig gewesen war, ihn in den Zirkus zu lassen, selbst wenn er kein Künstler war. Programme hätte er verkaufen können. Aber sie verstehe den Vater, er sei nun einmal der beste Rôtisseur am Ort.
Nie, protestierte Madame Juliette, nie hätte sie sich ihr Kind wegnehmen lassen. Man wisse doch, was sie in der Klinik mit einem anstellen. Ganz ruhig werde der Zwerg sein, weil sie ihm Spritzen geben. Madame Bruy kam auch nicht mehr zurück. Und nur, weil sie sich ein wenig unwohl fühlte? Den ganzen Bauch hätten sie ihr geöffnet, vom Nabel bis zur linken Brust, gut, das mag vorkommen bei einer Frau von fünfundfünfzig Jahren, aber trotzdem.
Sie werden am Zwerg lernen, beschwichtigte Madame Giraud, und es wird andern zugute kommen. In solchen Fällen sei es viel besser, dumpf zu sein. Sie wolle nicht sagen, daß es ein Idiot besser habe als ein Zwerg. Nun sei es beim Zwerg ja auch nicht so eindeutig gewesen. Sicherlich, sie hätte ihn nicht abholen lassen, aber wenn sie ihn abholen, dann muß schon etwas sein, denn einfach abholen könnten sie einen ja nicht, auch wenn man nur ein Zwerg sei. Als er gestern bei ihr saß, da habe er mit ängstlichen Augen gefragt, ob es stimme, daß er nervös sei. Und ob. Aber sie habe ihn beruhigt: Alles, was er brauche, sei eine Schlafkur, eine kleine Schlafkur, in einem weichen weißen Bett.
Es ist möglich, fährt Madame Juliette fort, daß es vom Trinken kommt. Überall rote kleine Autos zu sehen ist sicher nicht normal. Aber das komme nur vom Trinken. Und wenn die anfangen wollen, alle die einzusperren, die trinken, dann wäre es vernünftiger, Kliniken für Abstinenten zu bauen, das käme billiger. Sie habe sich auch gewundert, daß der Zwerg zu trinken begann. Vor einem Jahr schon, aber sicher seit Frühjahr. Er, der sonst immer vor den Bistros saß, begleitete plötzlich die Männer in die Bars, und die Männer stellten ihn auf einen Barstuhl, und er habe auf die Theke geklopft mit seiner Faust, sie sei einmal zusammengefahren, so habe es gedröhnt.
Sie sei erst dazugekommen, wie der Zwerg am Boden lag, stellt Madame Giraud fest. Jedenfalls wisse man jetzt, woher das Geld gekommen sei. Sie habe trotzdem Mitleid gehabt, wie der Zwerg mitten in den Scherben lag. Wer hätte gedacht, daß er Milchflaschen stahl und mit dem Pfandgeld die andern einlud. Aber so was komme immer raus. Die Kinder hätten den Zwerg nur zum Spaß gejagt, und schon sei er gestolpert, und die Flaschen, die er unter dem Hemd trug, hätten einen Scherbenregen ergeben, nicht nur an den Händen habe der Zwerg geblutet, das seien mindestens vier Flaschen gewesen. Sie habe gleich gedacht, daß etwas geschehe, als der Vater dazukam und zuschaute, wie der Zwerg die Scherben sammelte und sie in der Hosentasche versteckte, obwohl so viele um ihn standen. Sie verstehe, daß man einen Sohn strafe, aber der Vater hätte es bei einer Ohrfeige lassen können und nicht noch mit dem Fuß treten müssen, mitten ins Gesicht. Sie sei überzeugt gewesen, der Zwerg schlage zurück, und sie habe sich gewundert, wie der Zwerg sich auf die Zehenspitzen stellte und dem Vater seine Faust entgegenhielt und »Krüppel« schrie.
Nachdem der Zwerg sich unter der Treppe verkrochen hatte, habe sie ihn nicht mehr gesehen. Von dort hätten sie ihn heute früh geholt.
Madame Juliette fügt bei, sie sei am Fenster gestanden. Sie sei wachgeworden, weil sie ein Auto hörte, und habe bereits eine Schüssel mit Wasser bereitgehalten, um die Ruhestörer zu vertreiben. Aber dann habe sie alles beobachtet. Zu dritt seien sie gekommen, und sie hätten den Zwerg aus dem Verschlag herausgezerrt. Die Nacht sei voll Leuchtwürmer gewesen und laut vom Gequake der Frösche, dann aber habe der Zwerg geschrien: Sie hatten ihm den Mund zu spät gestopft.
Der Oberst
Der englische Oberst hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg hierher zurückgezogen. Er liebte Frankreich, einmal, weil Frankreich seit dem Zweiten Weltkrieg in irgendeinem Teil seiner Besitzungen noch Krieg führte. In einem solchen Land wollte er sich nach einer militärischen Karriere zur Ruhe setzen.
Er gründete einen Klub und nannte ihn »subitisme«. Die Mitglieder verband die beschworene Bereitschaft, auf jede Frage sofort – »subitement« – eine Antwort zu finden, gleichgültig welche, nur rasch, deutlich und ungehemmt. Die Statuten wurden im Eisschrank des ›Manoir‹ aufbewahrt, um dem Klub die Frische zu erhalten.
Von Zeit zu Zeit ließ der Oberst sich nach Nizza chauffieren. Mit dem Stock in der Hand kommandierte er den Weg. Weswegen er alle kleineren Zufahrtsstraßen nach Nizza kannte. Dort löste er eine Karte für den Schlafwagen nach Paris. Nicht, daß er beabsichtigte, nach Paris zu reisen. Sobald sich die Fahrgäste im Schlafwagen daran machten, in ihre hergerichteten Couchettes zu schlüpfen, klopfte er an die Türen der einzelnen Abteile und erkundigte sich in englisch akzentuiertem Französisch: »Haben Sie nicht zufällig ein kleines Krokodil gesehen? Ich habe mein kleines Krokodil verloren.«
Ihn beschäftigte das Problem: Wie stiftet man mit einem Minimum an Worten ein Maximum an Unordnung? Seine Mutter war Schauspielerin gewesen; er selber hatte bei der Artillerie gedient, wo ihn hauptsächlich mathematische Fragen gefangennahmen. Hätte er zum Beispiel auf einem belebten Platz die Frage nach dem verlorenen Krokodil gestellt, wären die Leute sicherlich überrascht gewesen, aber die Hauseingänge, die Nebenstraßen, die Straßenbahnen und Autos hätten als Fluchtwege seinem Satz die größtmögliche Wirkung genommen. Daher entschied er sich für einen geschlossenen Raum, und zwar zunächst für ein Restaurant. Dort verstand man seine Frage falsch und empfahl ihm Schildkröte; wie er aber auf einem kleinen Krokodil beharrte, stürzten einige Gäste aus dem Lokal, der Besitzer und der Oberkellner setzten den Obersten vor die Tür. Dieser suchte in der Folge nach einem geschlossenen Raum, aus dem es unmöglich war, ihn hinauszuwerfen. Er dachte eine Zeitlang an einen Lift; aber dort hätte man seine Frage nicht geglaubt, obwohl er auf den ersten Blick so aussah, als ob er ohne weiteres ein Krokodil spazierenführen könnte. Er verfiel endlich auf einen Schlafwagen; hier waren die Bedingungen für seinen Satz die denkbar besten. Die beschränkte Zahl der Beteiligten wurde durch ihre Anteilnahme wettgemacht.
Natürlich hätten sich die Gefragten in den Nachbarwagen retten können; doch wußten sie nicht, ob nicht plötzlich das Krokodil im Gang erscheinen würde. Der Schlafwagenbetreuer protestierte: Auch kleine Krokodile dürften nicht in den Schlafwagen mitgenommen werden; aber er stand hilflos neben der Notbremse. Denn der Oberst bedeutete ihm, ein unerwarteter Ruck mache sein kleines Krokodil wild, es sei besser, die Ruhe zu bewahren, er wolle nur sein kleines Krokodil wieder haben, ob es nicht zufällig hinter dem Gepäck sei, und seine Augen suchten das Netz entlang. Jedermann tastete über sein Leintuch und prüfte das Kissen; Männer stellten sich vor Frauen und Kinder; wer schlief, wurde geweckt, Koffer wurden geschoben und Schoßhündchen unter den Arm genommen. Damen suchten in Handtaschen nach Tabletten. Indessen wimmerte der Oberst im Gang am Fenster. In Toulon stieg er aus: Vielleicht sei das kleine Krokodil in Nizza auf dem Bahnsteig geblieben; doch sei er nicht sicher, er entschuldige sich für die Nachfrage, er gehe nicht ohne Krokodil nach Paris, er wünsche schöne Reise und eine gute Nacht.
Am andern Tag fuhr er mit dem Autobus nach Lagues zurück und führte bis zur nächsten Suche nach seinem verlorenen Krokodil sein eingeteiltes Leben: Um halb neun ließ er sich mit einer Tasse Tee und einer Zeitung wecken. Als man ihn einmal vergaß und ihn das Zimmermädchen am Nachmittag im Bett fand, verlangte er seinen Frühstückstee und die Morgenzeitung. Denn die Zeitung bestätige ihm jeden Morgen von neuem, daß es mit der Ordnung der Welt nicht weit her sei und daß sich nichts geändert habe. Die Tatsache aber, daß man ihm eine Tasse Tee bringe, beweise hingegen, daß die Welt mindestens in einem Punkt noch in Ordnung sei – ohne diese Bestätigung weigere er sich aufzustehen.
Nach dem von ihm für sich aufgestellten Tagesbefehl, der an der Zimmertür hing und an dem sich lediglich das Datum änderte, begann er um neun Uhr fünfunddreißig seine Lektüre. Seine einzige Verbindung zu England waren Leserbriefe an die Times. Er behandelte darin Einzelheiten, welche die Länder betrafen, in denen er gedient hatte. Und um in seinen Briefen keine Fehler zu machen, las er entsprechende Bücher. Er war in diesen Ländern nie über die Garnisonsstadt hinausgekommen und hatte sich nur so weit bewegt, als es die Befehle erforderten. Daher packte ihn nach seiner Pensionierung eine leidenschaftliche Neugierde nach den Ländern, in denen er nahezu vierzig Jahre gelebt hatte. Er verschaffte sich Reiseführer, Landschaftsschilderungen und volkskundliche Literatur und wurde auf die pensionierten Tage hin ein vorzüglicher Kenner Indiens, Ägyptens und Somalias. Und wenn in der Times ein Artikel erschien, der eines der Länder betraf, las er ihn auf Nachlässigkeiten und Irrtümer durch, und fand er solche, schrieb er einen Leserbrief, der immer mit den Worten begann: »Ich, der ich das Klima dieses Landes kenne.« Er hatte der englischen Majestät ewige Treue geschworen; seine Majestät hatte ihn pensionieren lassen. Er stand nur noch im Dienste des französischen Weines. Um Viertel nach fünf begann seine tägliche Trinktour, sie war ebenso zeitlich wie räumlich festgelegt. Der Oberst hatte in seinem Hotelzimmer einen Plan von Lagues aufgehängt; darauf war jedes Bistro eingetragen und mit einer farbigen Stecknadel gekennzeichnet: seine Bereitschaftsstellungen; die Trinktour selber nannte er Inspektion. Und diese Inspektion führte ihn von seinem Hotel zum ›Manoir‹, vom ›Manoir‹ zu ›Chez Théo‹, von ›Chez Théo‹ in das ›Tabac‹, vom ›Tabac‹ zu ›Chez Eliane‹ und von ›Chez Eliane‹ zu ›Chez Jimmy‹ und von ›Chez Jimmy‹ zu ›Chez Suzy‹ und von ›Chez Suzy‹ zu ›Chez Peluche‹ und von ›Chez Peluche‹ nach Hause.
Er hatte diesen Weg festgelegt, indem er seiner Trunkenheit, die sich im Laufe des Abends steigerte, Rechnung trug. Es begann mit den Bistros, die tiefer als sein Hotel lagen, weil es nachher noch zu steigen galt, und es endete mit den Restaurants und Bars, die höher als sein Hotel lagen, so daß er in seinem Rausch nur noch bergab zu gehen hatte. Er hatte sich ausgerechnet, wie viele Gläser er sich auf seiner Inspektion bei jeder Stellung erlauben durfte, um am Ende wohl betrunken, aber nicht so schwer betrunken zu sein, daß er die Hoteltür nicht mehr gefunden hätte. Als er seine Selbstdisziplin einmal vergaß, setzte er sich zur Strafe für vier Tage auf Wasser; doch erließ er sich nach dem ersten Tag die Hälfte der Strafe wegen guter Führung.
Kam es trotzdem wieder vor, daß er vor dem Hoteleingang auf den Knien lag, und traf ihn jemand, dann tastete er den Boden ab und flüsterte, er suche sein verlorenes Krokodil.
Als er starb, da warteten seine Freunde einen Tag über das für das Begräbnis angesetzte Datum hinaus, doch es kamen keine Verwandten. Da holten sie den Sarg ab. Als letzten Wunsch hatte der Oberst geäußert, man möge ihn noch einmal in alle seine Stellungen tragen. So schulterten die Freunde den Sarg und gingen mit ihm vom Hotel zum ›Manoir‹, vom ›Manoir‹ zu ›Chez Théo‹ und von ›Chez Théo‹ ins ›Tabac‹ und vom ›Tabac‹ zu ›Chez Eliane‹ und von ›Chez Eliane‹ zu ›Chez Jimmy‹ und von ›Chez Jimmy‹ zu ›Chez Suzy‹ und von ›Chez Suzy‹ zu ›Chez Peluche‹ und von ›Chez Peluche‹ auf den Friedhof.
Nur inspizierte diesmal nicht der Oberst, sondern er lag steif draußen in seinem Sarg. Bei ›Chez Théo‹ und ›Chez Peluche‹ mußten sie den Sarg zur Hälfte über die Schwelle schieben, um den Verkehr nicht zu behindern, und der Sarg, der auf der Schwelle einen Augenblick zwischen Straße und Lokal zögerte, neigte sich zum Lokal. Die Trauernden tranken in ihren Schmerz hinein, und ihr Schmerz wuchs, je mehr sie den Toten hochleben ließen, und je mehr sie auf den Toten anstießen, um so fröhlicher wurden die Trauernden. Sie tranken auf Einladung des Obersten. Er hatte in seiner letzten Verfügung die Zahl der Gläser angegeben, welche jeder in einer der Stellungen zu sich nehmen sollte, genau ausgerechnet für den ganzen Weg bis zum Friedhof. Doch hatte der Oberst als Maßstab die eigene Trinkfestigkeit gewählt. So hätte er sich beinahe bei seiner letzten Inspektion verrechnet, weil er in jeder Stellung Trauernde verlor. Einige hielten durch, jene, die sich mit weniger als den vorgerechneten, befohlenen und testamentarisch zugesicherten Gläsern zufriedengaben. Dank der Ungehorsamen behielt der Oberst doch recht mit seiner letzten Berechnung: Er kam schwankend auf den Friedhof, wie er immer schwankend nach Hause gekommen war.
Das Saison-Paar
Anne-Marie kam diesen Sommer wie immer nach Saint Milaire, diesmal in Begleitung eines jungen Deutschen; er verbrachte mit ihr die Ferien und fuhr dennoch mit ihr wieder nach Paris zurück.
Er war abends spät in einem Pariser Bistro auf sie zugetorkelt und hatte sie zu einem Glas eingeladen. Anne-Marie bedeutete ihm, man fordere eine Dame nicht schlankweg zu einem Glas auf. Hingegen schlug sie ihm vor, er solle sie nach Hause begleiten und bei ihr frühstücken. Seither.
Er trug am linken Handgelenk ein silbernes Kettchen, auf dem »Gert« eingraviert war, weswegen er in Saint-Milaire »Gérard« hieß. Er gab über sich selbst die Auskunft, er sei Student. Anne-Marie verbesserte nie, er sei Kellner und besuche zweimal wöchentlich Sprachkurse bei der Alliance Française. Sie schwieg nicht aus Schonung, sondern sie wartete, bis er sich verhaspelte.
Nach einigen Tagen schon war Gérard zu Geständnissen gezwungen, die sich wiederholten, da er fortfuhr zu schwindeln. Anne-Marie ermunterte ihn zu Geständnissen, aus denen er nicht mehr herausfand, obgleich es immer weniger wurden, da der Kreis der Unbekannten kleiner wurde.
Die Geständnisse begannen gewöhnlich mit der Frage, wann der nächste Zug nach Paris fahre; dies an einem Ort, der dreißig Kilometer von der Bahnstation entfernt war. Und die Geständnisse endeten gewöhnlich mit dem halblauten Zusatz, daß er unglücklich sei.
Nie unterbrach sie ihn, wenn er von sich erzählte, obwohl sie überzeugt war, daß er mit Zwanzig kaum Wesentliches zu gestehen habe. Sie ließ ihn von seiner Flucht aus Mitteldeutschland berichten, forderte ihn auf, den Plan des Auffanglagers auf die Theke zu zeichnen, nickte, wenn er ins Glas hinein verkündete, er sei zum Architekten geboren, war aber empört, wenn Gérard seinen Konfessionsmonolog damit schloß, daß er unglücklich sei.
Sie drohte ihm, wenn er diesen Satz wiederhole, werde auch sie von ihrem Unglück erzählen. Sie strich ihm übers Haar und sagte, wer unglücklich sei, sei schlecht erzogen. Dabei lachte sie laut auf, hustete mit gestocktem Gekicher ins Lokal und rief: »Schau, wie bin ich schlecht erzogen« und prustete vor Lachen.
Auf die Frage alter Bekannter in Saint-Milaire, was sie denn so treibe, antwortete sie, sie werde an Weihnachten heiraten. Nicht Gérard, sondern einen Diplomaten, und sie fügte bei: keinen schwarzen. Nicht daß sie rassische Vorurteile gehabt hätte, aber sie wolle den Eindruck vermeiden, sie profitiere von der Konjunktur.
Sie vertrat die Ansicht, für eine Frau wie sie gebe es nur drei Möglichkeiten: reich, berühmt oder verheiratet zu sein. Da sie wie alle vermögenden Leute sich nicht reich vorkam und da sie noch nicht berühmt war, blieb ihr lediglich die Heirat. Da sie schon über dreißig Jahre alt sei, falle es allmählich auf, wenn sie sich nach Männern umsehe, als verheiratete Frau aber sei es ein leichtes, ohne Anstoß zu erregen in Gesellschaft Bekanntschaften zu eröffnen.
Gérard seinerseits pflegte zu sagen, er liebe Anne-Marie, jedoch nur »physiquement«. Sprach er das Wort »physisch« aus, spitzten sich seine Lippen, und das Wort kam wie ein Pfiff aus seinem Mund, und man konnte in der Aussprache den Ansatz zum deutschen Wörtchen »pfui« hören.
Anne-Marie war überzeugt, daß in jedem jungen Deutschen ein Siegfried stecke. Nicht daß sie ihn ausgeschickt hätte, einen Drachen zu töten, das konnte sie sich bei acht Wochen Ferien nicht erlauben. Doch verlangte sie von ihm, er solle eine glühende Zigarette auf dem Handrücken ausdrücken. Als er sich weigerte, warf sie ihm vor, er liebe sie nicht; als er es tat, lachte sie ihn aus. Grinsend zeigte Gérard seine Hand, wenn Anne-Marie seine Narbe vorführte. Biß er aus Langeweile am Schorf, legte sie ihm das als Untreue aus.
Ansonsten bräunten sie sich in der Sonne. Gérards Haut wurde rascher braun. Anne-Maries Haut verdunkelte sich fleckig und fetzig. Seitdem sie in der Schule das Wort »Mulattin« gehört hatte, hegte sie die Überzeugung, daß Mulattin für sie etwas Erstrebenswertes sei. Zu diesem inneren Wunsch kam ein äußerer Grund; eine dunkle Hautfarbe erlaubte ihr, ihre Lieblingsfarbe Violett zu tragen.
Der Alltag der Sommersaison wurde durch Robert gestört. Anne-Marie hatte von ihm noch vor kurzem eine Karte aus dem Militärdienst erhalten. Als er überraschend auftauchte, frohlockte sie; sie vermutete, er sei desertiert. Aber er war lediglich vorzeitig entlassen worden. Als ihn Gérard anstarrte, stellte sich Robert vor: »Ich bin der junge Mann vom letzten Sommer.«
Robert war entschlossen, Gérard umzubringen, doch Gérard folgte dem Gespräch nicht, und auch Anne-Marie half nicht erklären. Sie stellte sich vor Gérard. Nicht um ihn zu schützen, sondern aus logischen Gründen: »Wenn einer von uns dreien umgebracht wird, bin ich es.« Sie fühlte sich übergangen.
Robert willigte ein. Gérard nickte, als ihm die Änderung mitgeteilt wurde. Sie ertrugen sich, so wurde beschlossen. Es gab lediglich einmal einen Disput, weil Gérard Roberts Rasierwasser benutzte. Anne-Marie drängte auf Unterschiede.
In allem Frieden zog Robert einige Tage später drei Ortschaften weiter westlich die Küste hinunter. Er hatte sich im Militärdienst auf eine Weise benommen, daß er vor eine ärztliche Kommission geschickt worden war. Die linksintellektuellen Zeitschriften, die er abonniert hatte, waren für seine vorzeitige Entlassung nicht einmal notwendig gewesen. Er mußte sich eingestehen, daß er als junger Mann vom letzten Sommer nicht über die Lage der jetzigen Saison erstaunt sein durfte. Gérard trug ihm die Koffer bis zur Busstation.
Das war zu jenem Zeitpunkt, als Gérard nicht mehr einen Daumen ausstreckte, wenn er ein Bier bestellte, und nicht mehr den Zeigefinger dazu benutzte, wenn er zwei Bier verlangte. Der tägliche Umgang mit Anne-Marie hatte ihm klargemacht, er werde später in anspruchsvolleren Lokalen arbeiten.
Die beiden pflegten sich mit dem Wörterbuch zu streiten. Keiner beherrschte die Sprache des anderen in einer Weise, die ausführliche Beschimpfungen, und minutiöse Vorwürfe möglich gemacht hätte. Beide hielten sich für diesen Zweck an das Wörterbuch. Anne-Marie hatte dafür eigens einen zweiten Dictionnaire gekauft. Solange sie beide nur mit einem einzigen Wörterbuch gestritten hatten, in dem das Vokabular zur Hälfte französisch-deutsch und zur andern deutsch-französisch aufgeführt war, rissen sie sich das Buch aus den Händen. Es entstand ein neuer Streit, zu dem wiederum die Wörter fehlten. Dank zweier Wörterbücher blätterte jeder für sich. Anne-Marie bewahrte dabei die Ruhe. Sie wartete nachsichtig, bis Gérard ein Wort gefunden hatte, schlug das Wort nach, erzürnte sich, schlug ihrerseits ein Wort nach, um Gérard zu erzürnen – nur daß Anne-Marie sich gelegentlich erkundigte, ob die Aussprache richtig sei.
Diese Art zu streiten hatte einen offensichtlichen Nachteil. Zorn und Ausdruck deckten sich nicht. Der Zorn war jeweils um einige Grad gesunken, bis das entsprechende Wort gefunden war. Zudem war wegen des Konversations-Dictionnaires ein Großteil der Beschimpfungen ungenau. Oft, wenn der eine verzweifelt blätterte, erfaßte den anderen Mitleid, und er half ihm suchen. Anne-Marie hoffte auf eine Lösung, Zorn und Ausdruck zu synchronisieren; sie dachte an die Bekanntschaft mit einem Schweizer, der beide Sprachen beherrschte.
Dieser vermittelte denn auch, indem er die gegenseitigen Beschimpfungen simultan übersetzte. Diesen Schweizer lud Anne-Marie zu ihrem Fest ein. Als Französin und getaufte Katholikin feierte sie ihren Namenstag. Eigentlich hatte sie eine größere Einladung geben wollen. Dagegen hatte sich Gérard gewehrt, er einigte sich mit ihr auf den Schweizer als einzigen Gast. Aber Anne-Marie und der Schweizer unterhielten sich in französischem Tempo. Lachten die beiden, war Gérard überzeugt, sie lachten über ihn. Er drohte bei der Suppe, den Tisch zu verlassen, was er nach dem Kaffee tat.
Anne-Marie, erstaunt über soviel Folgerichtigkeit, war entschlossen, Gérard zu bestrafen. Der Schweizer war gleicher Meinung, er fragte: »Wie?«, und Anne-Marie meinte: »Schwer.« Während sie noch über wirkungsvolle Strafen berieten, fühlte sich Anne-Marie überraschenderweise müde, und beide verabschiedeten sich nach dem ersten Marc. Doch war es an diesem Sommerabend an einem Saisonort noch zu früh, um ins Bett zu gehen. So kam es, daß Anne-Marie beinahe den Schweizer gesehen hätte, als dieser sie entdeckte, wie sie vor einem Restaurant nach Gérard fragte.
Sie packte zu Hause Gérards Koffer und stellte ihn vor die Haustür. Aber Gérard kam durch den Kücheneingang ins Haus, um nicht Lärm zu verursachen. Als er am andern Morgen ein Hemd suchte, teilte ihm Anne-Marie mit: »Deine Sachen sind dort, wo sie hingehören: in deinem Pappkoffer unten vor der Haustür.« Gérard stieg ungläubig die Treppe hinunter, sie hörte, wie sich die Tür öffnete und dann wieder ins Schloß fiel. Sie horchte; da vernahm sie Gérards Schritte in der Halle. Er kam nicht mehr ins Schlafzimmer herauf. Die Lage wurde ernst. Anne-Marie besaß zwei Morgenröcke: einen kürzeren, mehr Baby-doll, und einen langen. Sie dachte ans Théâtre du Châtelet und an einen Auftritt von Edwige Feuillère und entschied sich für den langen Morgenrock. Von ihrem Schlafzimmer führte eine Treppe in die Halle, und der Morgenrock zog auf der Treppe eine Schleppe.
»Wo ist der Kaffee?« fragte Anne-Marie. Gérard stapfte zum Fenster, und Anne-Marie bemerkte, wie das Gummiband an seinem Pyjama locker auf der Lende saß; beinahe wäre sie auf ihn zugegangen und hätte ihn geküßt, da wiederholte sie die Frage nach dem Frühstückskaffee. »Nie, nie«, schrie Gérard. Anne-Marie sah sich bereits für den Rest ihrer Ferien selbst den Kaffee im Bistro nebenan besorgen. Da entschloß sie sich zur großen Geste; sie ging in die Knie, indem sie den Morgenrock um sich drapierte. Sie hätte Stoff unter die Knie nehmen sollen, denn die Fliesen waren kühl. »Alle Leute haben meinen Koffer gesehen«, rief Gérard. Doch Anne-Marie beschwichtigte ihn, daß um diese Zeit kaum Leute unterwegs seien. »Nie«, sagte Gérard mit verbissenem Mund, »du hast mich erniedrigt.« Anne-Marie horchte auf; das Wort »erniedrigt« hatte sie noch nie von ihm gehört. Da sah sie auf dem Teewagen den aufgeschlagenen Dictionnaire. »Ich habe verloren … verloren …«, flüsterte Gerard. Anne-Marie überlegte, was er verloren und was ihm hätte gestohlen werden können. Er blätterte im Wörterbuch und hielt unvermittelt inne: Er zeigte mit dem Finger auf eine Stelle: »Prestige«.
So zog sich der Alltag einer Sommersaison hin. Zur ersten Aperitifstunde gingen sie baden; zur zweiten Aperitifstunde waren sie zurück. Kein Ereignis, wenn Anne-Marie nicht geschrieben hätte. Eines Tages erhielt sie von einem Pariser Verleger einen Brief, der mitteilte, daß ihr Manuskript in einer Zeitschrift erscheine. Sie hielt den Brief jubilierend vor Gérards Gesicht, so nahe, daß er, selbst wenn er die Absicht gehabt hätte, den Brief zu lesen, nicht hätte lesen können. Er fand es selbstverständlich, daß Manuskripte gedruckt werden. Da zwang Anne-Marie Gérard, den Brief auswendig zu lernen; er wehrte sich, er verstehe den Brief gar nicht, aber Anne-Marie sagte, er habe schon oft Dinge auswendig gelernt, die er nicht begriffen habe, schließlich sei er in die Schule gegangen. Und waren die beiden unterwegs, blieb Anne-Marie plötzlich stehen, schob die Brille auf die Nasenspitze und erhob den Zeigefinger: »Mein Brief«, und Gérard begann als Barde ihres jungen Ruhmes zu rezitieren: »Wir bestätigen den Empfang Ihres Manuskriptes …«
Zum erstenmal gönnte sich Anne-Marie auf diese Nachricht hin Ferien. Bisher hatte sie einfach Ferien verbracht, weil es im Kalender einen Monat Juli und August gab, und sie war an die Côte gefahren, da ihre Familie stets an den Atlantik gefahren war. Nun aber war ihr Manuskript angenommen worden. Sie dachte daran, ihre große Pariser Wohnung aufzugeben und in ein billiges Hotel zu ziehen, sie wollte standesgemäß leben. Sie erkundigte sich bei Gérard, ob er mit ihr ein billiges Hotelzimmer teilen würde. Sie schwärmte davon, daß ihre Rocksäume zerschlissen sein würden. Und dann fuhr sie in der Ausmalung der Zukunft weiter: »Wir werden von Pommes frites leben, und du, du arbeitest von morgens bis abends für mich. Ich werde dich dafür in meinen nächsten Roman einbauen. Ich habe Erfolg und keine Einnahmen, und du machst mich mit deinen Prozenten vom Service glücklich.«
Gérard aber hatte inzwischen einer andern Bekannten in Paris geschrieben. Anne-Maries Urlaub ging bald zu Ende, und diese Bekannte schrieb einen Brief. Er begann mit dem Vorwurf, er solle ihr nicht eine offene Karte schicken, und endete mit der Zärtlichkeit, ihm sei alles verziehen, und sie