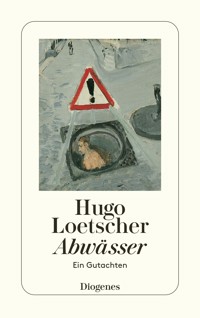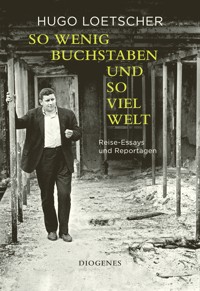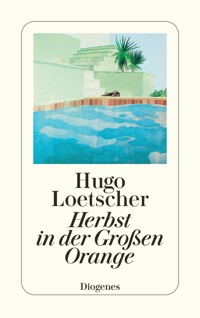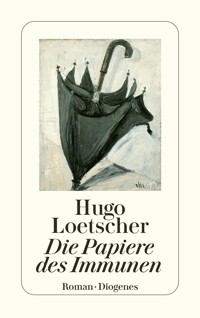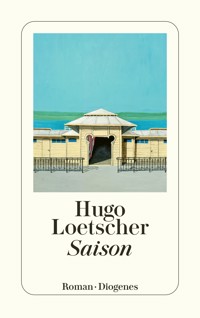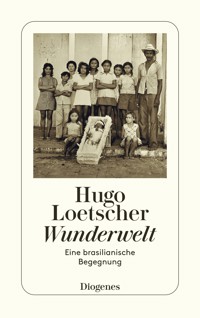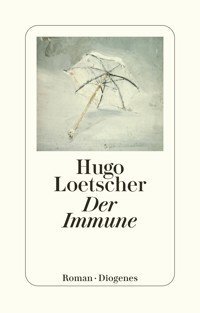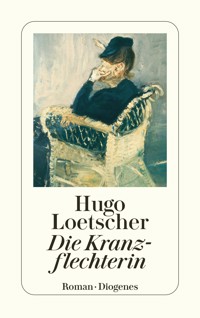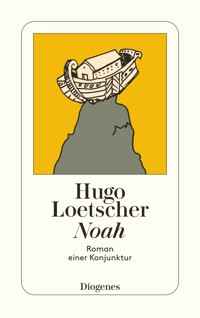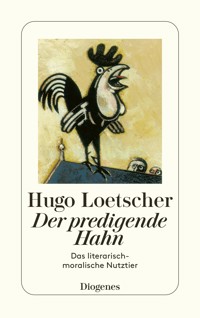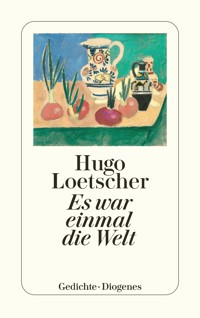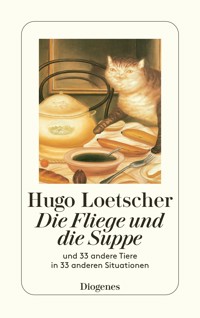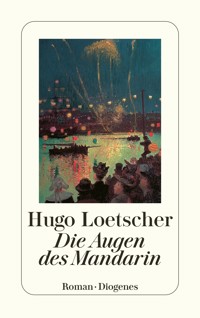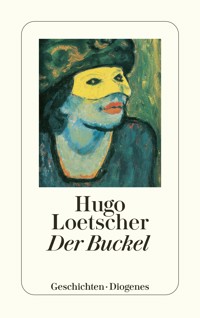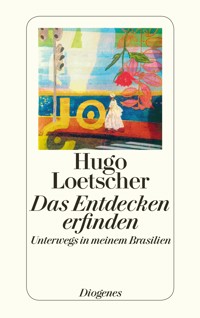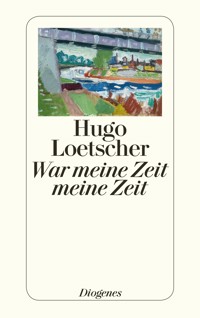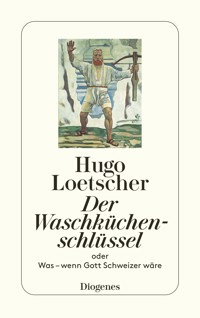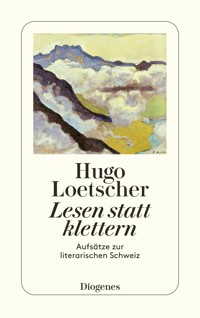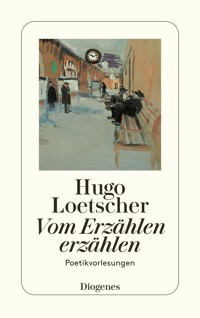
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
›Vom Erzählen erzählen‹ (diesen Titel gab Hugo Loetscher seinen Münchner Poetikvorlesungen aus dem Jahr 1988) ist ein faszinierender Selbstkommentar zu Hugo Loetschers Werk, gibt Einblick in die ›Werkstatt‹ eines Autors und ist nicht zuletzt ein Stück intellektuelle Biographie. Auch dort, wo Loetscher Theoretisches aufgreift, bleibt er ein Erzähler, so daß seine Vorlesungen auch ein Stück Literatur sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hugo Loetscher
Vom Erzählen erzählen
Poetikvorlesungen
Diogenes
Eine intellektuelle Visitenkarte
Hugo Loetscher war der erste Inhaber des Swiss Chair, der 1981 an der CUNY (City University of New York) gegründet wurde, betreut von Professor Rolf Kieser. Loetscher stellte seine Vorlesungsreihe »How Many Languages Does Man Need?« unter die Titel: »Switzerland – a Country of Four Cultures«, »How to Nail Down Reality?«, »How Many Latin Americas Are There?«, »The Limits of Verbal Expression«, »Latin America Reflected in My Work«, »The Many Languages in The Man with Immunity«. Ediert von Tamara S. Ewans, Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Vorsteherin der Doktorandenabteilung, erschien How Many Languages Does Man Need? als Pro Helvetia Lectureship 1 (The Graduate School and University Center. City University of New York. 1982). Die Antrittsvorlesung »A Swiss Writer in and beyond Switzerland« wurde zum ersten Mal auf deutsch in Das Hugo Loetscher Lesebuch (Diogenes Verlag, Zürich 1984) veröffentlicht.
Ein Schriftsteller in und außerhalb der Schweiz
Der Lehrstuhl heißt »Swiss Chair«. Ist mit dieser Bezeichnung so etwas wie schweizerische Repräsentanz gemeint?
Jemand, der vor kurzem die Schweiz in den USA repräsentierte und von dem ich ein Bild in amerikanischen Zeitungen sah, war »Miss Switzerland«. Ohne Zweifel gibt es zwischen ihr und mir Unterschiede. Nicht nur, weil sie ideale Maße besitzt, und nicht nur, weil sie auf einem Thron saß und ich an einem Pult zu stehen habe.
Nein, die Unterschiede sind grundsätzlicher Art. Sie hatte an ihrer liebenswerten Seite einen Käse. Damit demonstrierte sie, daß in meinem Land auch die weibliche Schönheit ihre Abrundung erst in Gemeinschaft mit einem Laib Käse erhält.
Ich habe in meiner, zugegeben, weniger lieblichen Seite keinen Käse. Hätte ich einen, wäre es zudem aus einem anderen Grunde, und sei es auch nur deswegen, um zu zeigen, daß die Löcher im Käse nicht die einzigen Fenster sind, durch die wir Schweizer in die Welt hinausschauen.
Es gibt nun einmal unterschiedliche Missionen. In meinem Falle sicher eine nicht minder verpflichtende, wenn ich an die ehrenwerte City University von New York denke und wenn ich das distinguierte Publikum vor mir im Auditorium sehe.
Als ich von diesem Lehrstuhl erfuhr und von meiner Chance, sein erster Inhaber zu sein, war ich verständlicherweise hoch erfreut. Allerdings war ich zugleich auch verlegen, da ich mich fragte, ob ich der richtige Mann dafür sei. Ich stellte mir die Frage aus verschiedenen Gründen.
Ist ein Schriftsteller überhaupt der richtige Mann? Und wenn ein Schriftsteller, warum einer wie ich? Zudem überlegte ich mir, ob ich überhaupt schweizerisch genug bin für einen »Schweizer Lehrstuhl«.
Ich muß nämlich zugeben, daß ich nie das Talent besaß, typisch zu sein. Schlimmer noch, ich verspürte nicht einmal die Neigung, es zu werden. Man ist typisch für die andern. Gewöhnlich für Fremde. Dies um so mehr, wenn die Fremden Touristen sind, und Fremde können Touristen sein, ohne je das Land zu besuchen.
In der Tat, ich fühle mich aus einem objektiven Grund nicht typisch, so enttäuschend das sein mag für meine amerikanischen Zuhörer. Aber ich kann es nicht richten, da ich nun einmal nicht von den Alpen komme, weder biographisch noch als Schriftsteller.
Dabei bin ich mir durchaus bewußt, daß es in meinem Land Alpen gibt, hoch schon in der Geographie und noch höher in der Psychologie, und an beiden Orten schwer vom Platz zu bewegen.
Genau wie die Alpen die ersten Kulissen für unsere Geschichte abgaben, so stehen sie auch am Anfang unserer Literatur.
Im achtzehnten Jahrhundert wurde das berühmte Gedicht »Die Alpen« veröffentlicht, ein langes Gedicht, denn wir haben Ketten von Bergen. Nach diesem Poem begann die Entdeckung der schweizerischen Natur als literarisches Motiv. Das hört sich logisch an und ist auch bekannt. Aber gewöhnlich übersehen wir, daß der Autor dieser Dichtung keineswegs von den Alpen stammte. Albrecht von Haller war ein Aristokrat, geboren in einem aristokratischen Bern; er hat in seinen späteren politischen Romanen die Überzeugung dargelegt, die beste Regierungsform sei eine aufgeklärte Aristokratie.
Als junger Mann hatte Haller Satiren über seine Vaterstadt geschrieben; später strich er die allzu beißenden Zeilen, und er erhielt als Entschädigung einen bescheidenen Staatsposten. Links zu beginnen und sich rechts einzurichten ist nicht so modern, wie einige annehmen mögen. Glücklicherweise unterdrückte Haller nicht auch die schönsten Verse in den Gedichten, die er neben »Die Alpen« verfaßte.
Die Alpen als Naturwunder, als Beweis für den Einfallsreichtum Gottes war die Erfindung eines Städters, der den größten Teil seines Lebens in der Stadt verbrachte, auch wenn er durch die Alpen wanderte, um einen unmittelbaren Eindruck zu gewinnen. Als junger Mann hatte er die Unschuld der Älpler und Sennen besungen; erst zu einem späteren Zeitpunkt räumte er diesem hartschaffenden Volk das unveräußerliche Menschenrecht auf Sünde ein.
Ein solcher Anfang war nicht eine Ausnahme. Im gleichen Jahrhundert brachte die Schweiz ihren ersten Bestseller-Autor hervor, dessen Werk von Paris bis Moskau applaudiert wurde. Salomon Gessner schrieb »Die Idyllen«, eine Sammlung kurzer Prosa-Stücke; in ihnen wurde die friedliche Welt von Schäfern geschildert, wo weder die Lämmer noch die Zicklein rochen, da sie alle den damals weit verbreiteten Rokoko-Spray benutzten.
Für diese bukolische Welt hatte der Autor kaum zeitgenössische Bauern als Vorlage benutzt. Nun war Salomon Gessner ebenfalls ein Stadtmensch, diesmal ein Patrizier aus Zürich. Er hat in aller Offenheit dargelegt, weshalb er die Bauern seiner Zeit nicht als Vorbild nehmen konnte: Bukolische Dichtung überzeuge in dem Maße, in dem man die Szenen in eine weit entfernte Welt verlege. So erlange man einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit; diese Szenen entsprächen den zeitgenössischen Bauern nie, denn diese seien gezwungen, die Früchte ihrer harten Arbeit an die Herrschenden abzuliefern, Armut und Unterdrückung hätten sie gemein und hinterhältig gemacht.
Seit Beginn sind in der Schweizer Literatur Alpen und Idyllen anzutreffen, die Alpen als Idealisierung und die Idyllen mehr als Motiv denn als Realität. Auf diese Weise fingen nicht nur eine eigene Literatur an, sondern auch eigene Widersprüche.
Seit Vergil gibt es eine europäische Tradition, Arkadien zu besingen, ohne dort gewesen zu sein. Innerhalb dieser Tradition findet sich eine schweizerische Spielart; über Arkadien zu singen, auch wenn der Sänger weiß, wie hart das Leben dort oben sein kann.
Die Alpen und die Idyllen wurden schweizerische Muster, aber es waren nicht die einzigen Spezialitäten, die wir zu bieten hatten.
Ende des letzten Jahrhunderts wurde in Paris die »Exposition Universelle« durchgeführt. Das Ausstellungsprogramm sollte ein weltweites Bild von Handwerk und Technik bieten, eine Weltgeschichte der menschlichen Arbeit. Eine einzigartige Gelegenheit für jedes Land, sich selber zur Schau zu stellen.
Die Schweiz faßte den Entschluß, offiziell und unter einer eidgenössischen Kommission, Pfahlbauten auszustellen. Unser Land mochte der Welt zeigen, wie die Vorväter unserer Vorväter bereits das Wohnungsproblem lösten, indem sie Pfeiler in den Ufergrund rammten und Hütten darauf stellten, und dies lange bevor die Ägypter ihre Pyramiden und die Griechen ihre Tempel errichteten.
Während andere Nationen die Gelegenheit benutzten, sich als moderne Staaten zu präsentieren, ging die Schweiz in die Prähistorie zurück. Nicht, daß die Schweiz nicht die Zeichen der Zeit erkannt hätte; denn das Land machte damals eben seine ersten erfolgreichen Erfahrungen mit der Industrialisierung.
Junge Schweizer Archäologen, die sich in unseren Tagen mit dem Sinn dieser Pfahlbauer-Ausstellung befaßten, verstanden eine solche Selbstdarstellung als Bekenntnis; durch sie würde eine verborgene Sehnsucht manifest, der Traum, eine Insel zu bauen, die mit dem Festland und dem Rest der Welt nur durch einen schmalen Steg verbunden ist, der zudem leicht verteidigt werden kann.
Sicher sind andere Interpretationen möglich. Aber es ist einmal mehr merkenswert, wie Realität und Image auseinanderklaffen. Ein solcher Graben mag nicht zufällig sein, er scheint einer Grundhaltung zu entsprechen, die nach wie vor lebendig ist, einer ausgeklügelten Naivität und einer berechnenden Bescheidenheit: nämlich als weniger zu erscheinen, als wir tatsächlich sind. Das könnte zusammenhängen mit der Fähigkeit des Bauern zu jammern; wenn nicht über einen tatsächlichen Hagel, dann wenigstens über einen möglichen. Es könnte aber auch mit einer puritanischen Tradition zu tun haben: nicht zu zeigen, was man hat, aber zu haben, da Gott es mit denen hält, die haben.
In diesem Zusammenhang mag es aufschlußreich sein, daran zu erinnern, daß das Wort »Heimweh« ein schweizerischer Beitrag zur deutschen Sprache ist. Der Ausdruck hielt eine Krankheit fest, welche junge Schweizer Söldner befiel, die in fremden Armeen für fremde Herren kämpften. Zu der Zeit war es im französischen Heer verboten, schweizerische Musikinstrumente zu spielen; kaum hörten die jungen Krieger solche Musik, begannen sie zu weinen. Sie waren aber nicht fürs Weinen bezahlt, sondern fürs Kämpfen.
»Heimweh« wurde jedenfalls ein Schlüsselwort, nicht nur für Schweizer, die im Ausland lebten, sondern auch für die zu Hause. Heimweh ist die Sehnsucht nach einer Schweiz, die nicht notwendigerweise existiert oder existiert hat.
Die Alpen, die Idyllen, die Pfahlbauten – das sind nicht nur Beispiele dafür, daß ein Land verschiedene Spezialitäten zu bieten hat, sondern auch eine Geschichte dieser Spezialitäten. In Übereinstimmung mit solchen Spezialitäten hat ein Land eben nicht nur ein Image, sondern auch eine Geschichte seines Images.
Jeder von uns kennt nur allzugut das lang anhaltende Bild der Schweiz als einem Land, wo die Leute in Trachten um die Alpen herum tanzen. Die Schweiz als ein Land ohne Probleme, zu ewigem Frieden verurteilt. Eine Vorstellung, für die eine Figur geschaffen worden ist: das bezaubernde Heidi in einer zauberhaften Natur.
Selbst als es sich herumsprach, daß wir Uhren produzieren und daß man in diesem Land neben den Alphütten Banken findet, nahm sich das alles noch so aus wie ein Heidi-Kapitel mehr. Heidi ist eine Fortsetzungsgeschichte: Heidi auf der Alp, Heidi in Frankfurt, Heidi wieder daheim und Heidi kann brauchen, was es gelernt hat, und das letzte, was es anscheinend lernte, war, an einem Bankschalter zu stehen und Kunden anzulächeln.
Ein Kollege von mir, Peter Bichsel, hat ein berühmtes Pamphlet verfaßt, Des Schweizers Schweiz; er hat darin dargelegt, wie wir Schweizer uns selber gerne sehen, nämlich mit den Augen unserer Touristen; er hielt fest, daß wir in einer Legende leben, die andere für uns gesponnen haben.
Wenn es zutrifft, daß andere die Legende gesponnen haben, dann trifft aber auch zu, daß wir ihnen das Garn dazu verkauft haben.
Wir brauchten die Legende für Freizeit und Feierabend. Während unserer Arbeitszeit aber bauten wir eine moderne Schweiz auf, ein hochindustrialisiertes Land. So taten wir alles, um während der Arbeitszeit zu zerstören, was wir am Feierabend mochten. Der Krach war nicht zu vermeiden.
Wie rasch sich ein Image ändern kann, erfuhren wir im Sommer 1980. Zürich, meine Heimatstadt, der ich bis anhin in ausländischen Zeitungen höchstens im Wirtschaftsteil begegnete, wurde plötzlich ein Thema für die Frontseiten mit Bildern von Tränengas-Einsatz und Jugend-Unruhen.
Das war verständlicherweise ein Schock, nicht nur zu Hause, sondern auch auswärts. Dort schien man zuweilen noch aufgebrachter zu sein, auch wenn die Erregung eine merkwürdige Mischung aus Schadenfreude und metaphysischem Kollaps war: Wo zum Teufel soll es auf der Welt noch Ordnung geben, wenn die auch in der Schweiz nicht mehr länger garantiert ist?
Zum ersten Mal waren es nicht die Alpen, sondern eine Stadt, die das Image der Schweiz prägte. Und es war nicht zufällig, daß Zürich diese Rolle spielte, Zürich, ein erstrangiger Finanzplatz, ein Wirtschaftszentrum, wo sich auch Massenmedien und kulturelle Aktivitäten konzentrieren, an schweizerischem Maßstab gemessen eine Metropole, die für die moderne Schweiz steht, was ihr die übrige Schweiz nicht ohne weiteres verzeiht.
Hält man sich diese Tatsachen vor Augen, kann es nicht mehr so völlig abwegig sein, nicht von den Alpen zu kommen, sondern aus einer Stadt, wie ich es tue, und gar aus Zürich – zugegeben, das mag weniger typisch sein, aber es hat dafür mit Realität zu tun.
So neu aber auch die Ereignisse sich ausnahmen, sie kamen keineswegs überraschend, wie einige glaubten oder vorgaben zu glauben. Um dies zu verstehen, machen wir am besten ein Sandkasten-Spiel.
Suchen wir einen Mann, der noch nie etwas von der Schweiz gehört hat, der aber lesen kann. Bringen wir ihn auf eine Robinson-Insel. Doch rüsten wir ihn aus mit einer vorfabrizierten Hütte, geben ihm genügend Nahrung und reichlich zu trinken, und dann, das ist der Punkt: Wir überlassen ihm eine Reihe von Büchern, die Schweizer Autoren in den letzten dreißig Jahren geschrieben haben. Nachdem wir diesen Mnan sich selber und seinen Büchern überlassen haben, wollen wir hoffen, daß er sich bald genügend langweilt und zu lesen beginnt. Auf alle Fälle befreien wir ihn erst, wenn er uns sagt, was für ein Land er in diesen Büchern widerspiegelt fand.
Mit aller Wahrscheinlichkeit wird unsere Testperson erwähnen, daß sie schon in den fünfziger Jahren auf einen Ausdruck wie »helvetisches Malaise« gestoßen sei, auf eine geistige Verfassung, die sich alles andere denn wohl fühlte. Er wird sicher Max Frisch gelesen haben, nicht nur in dessen Romanen und Theaterstücken, sondern auch dessen Reden und Kommentare, möglich, daß er sich den Satz gemerkt hat, daß Mangel an Phantasie nicht schon Ausweis für Realitätssinn ist. Sicher wäre unter den Autoren Friedrich Dürrenmatt gewesen, seine Oper einer Privatbank aus den sechziger Jahren und sein Besuch der alten Dame, ein Stück, in welchem eine Gemeinschaft bereit ist, Gerechtigkeit bis zu Mord zu üben, sofern wirtschaftlicher Aufschwung damit verbunden ist. Denkbar, daß unser Robinson mit dem Bleistift gelesen hat und im Buch eines Außenseiters wie Adrien Turel den Satz unterstrich: »Für gewisse Laster sind wir nicht zahlreich genug.« Oder daß er sich in dem Werk einer andern Randfigur wie Ludwig Hohl den Ausdruck notiert hat »voreilige Versöhnung«. Auch die Schweizer glauben daran, daß Politik ohne Kompromiß nicht möglich ist. Aber unserem Manne wäre aufgegangen, daß der Kompromiß in der Schweiz nicht ein Ergebnis, sondern ein Ausgangspunkt ist, so daß wir am Ende den Kompromiß eines Kompromisses haben. Zudem hätte er eine Reihe von kurzen Texten gelesen, die sich auf den ersten Blick wie Idyllen ausnahmen, sich aber am Ende als gebrochene Idyllen entpuppten. Doch wollen wir ihn nicht zwingen, noch mehr Namen und Titel aufzuzählen.
Auf alle Fälle hätte das Bild, das unsere Versuchsperson von der Schweiz gewonnen hat, nichts mehr mit der Plakat-Schweiz zu tun. Insofern wäre unser Gewährsmann auch nicht so überrascht von den jüngsten Ereignissen. Er fiele nicht aus allen vaterländischen Wolken wie mancher Politiker. Nun hätte er gegenüber schweizerischen Politikern den Vorteil, schweizerische Literatur gelesen zu haben.
Und ferner würde unser Gewährsmann diese jüngsten Ereignisse weder als die Morgenröte einer revolutionären Zukunft betrachten noch als das Ende einer Welt, die bis dahin intakt gewesen ist. Er hätte die Überzeugung gewonnen, daß man diese Vorkommnisse in einem umfassenderen und fundamentaleren Zusammenhang sehen muß, wobei er ohne weiteres zugäbe, daß diese Ereignisse natürlich photogen waren: eine zerbrochene Scheibe ist auf dem Bildschirm wirkungsvoller als ein Buch; aber ein Stein, mit dem man eine Scheibe einwarf, kann weggeräumt werden, ein Buch wegräumen ist schwieriger.
Die Literatur, die unser Mann las, spiegelte eine Auseinandersetzung wider, die sehr bald nach 1945 begonnen hatte. Zum Thema stand die Idee, die wir von uns selber gewonnen hatten, und es war eine Vorstellung, die aus der Verteidigung heraus konzipiert worden war, und somit ein idealistisches und stilisiertes Bild.
Ein Prozeß der grundsätzlichen Überprüfung war unvermeidlich. Eine Revision, die nicht nur die unmittelbare Gegenwart und Vergangenheit betraf, sondern auch unsere ganze Geschichte. Daraus resultierte ein breitangelegtes Umschreiben und Neu-Interpretieren.
Nun würde ich aber behaupten, daß ein solcher Revisionsprozeß nicht nur in der Schweiz stattfand. Ich sehe ihn vielmehr als Teil eines größeren internationalen Geschehens. Schauen wir uns in Europa um, werden wir leicht feststellen, daß andere Nationen einen ähnlichen Prozeß durchmachten oder nach wie vor daran sind, und dies oft unter schwierigen Umständen.
Großbritannien, ein einstiges Empire, ist eine Insel vor der europäischen Küste geworden. Frankreich ist nicht länger »la grande nation« mit »nous autres franç ais« und hat zudem eine Vichy-Vergangenheit. Deutschland hatte seine Teilung zu akzeptieren und muß mit seinem Nazi-Trauma leben. Spanien und Portugal konnten sich nicht länger im Namen des Faschismus als letzte Bastion des christlichen Abendlandes verstehen. Ideale und Idole wurden in Frage gestellt. Rußland, die Mutter des Sozialismus, erwies sich im besten Fall als Stiefmutter für die kleineren sozialistischen Länder, und Amerika, Gottes eigenes Land, mußte zur Kenntnis nehmen, daß auch andere Völker überzeugt sind, daß es Gott selber war, der ihre Länder schuf.
Seitdem es Völker gibt, gibt es auserwählte Völker, mindestens auf die eine oder andere Weise. »Auserwählt sein« kann heißen, sich verpflichtet fühlen, den andern das Glück zu bringen oder (was eher die schweizerische Variante ist) den Frieden in Stellvertretung für die andern zu leben.
Für die Schweiz wurde der Ausdruck »Sonderfall« geschaffen. Wenn »Sonderfall« heißt, daß dieses Land unverwechselbare Qualitäten und Eigenheiten hat, ist der Ausdruck ohne Zweifel gerechtfertigt, aber in der Hinsicht ist jedes Land ein Sonderfall.
Aber wenn unter »Sonderfall« verstanden wird, wie es geschieht, daß auf der einen Seite die Schweiz ist und auf der andern die Weltgeschichte, dann ist ein solcher Ausdruck äußerst fragwürdig, vor allem hat er nichts mit einer Schweiz gemein, deren Wirtschaft nur als Teil der Weltwirtschaft funktioniert. Wie jede andere Industriegesellschaft wird auch die unsere konfrontiert mit den Problemen des technischen Fortschrittes und dessen Folgen, seien es die Fragen der Energie, der Umwelt, der Interdependenz. Da gibt es einen Preis zu zahlen, auch wenn uns dafür eine harte Währung zur Verfügung steht.
Vor allem sollte die Vorstellung des »Sonderfalls« nicht zu purer Exotik führen. Einer der exotischsten Schweizer Orte, die ich kenne, ist in New York zu finden, im Versammlungssaal der Vereinigten Nationen. Dort, in einer Ecke zusammen mit dem Vatikan und Monaco, ist die Schweiz heftig damit beschäftigt zu beobachten. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Wenn wir uns schlecht aufführten, mußten wir zur Strafe in die Ecke stehen. In der UNO aber scheint es umgekehrt zu sein, da stehen die guten Buben in der Ecke, und es sind die bösen, die ständig reden und abstimmen.
Natürlich ist keine Revision möglich, ohne daß beliebte und geliebte Vorstellungen aufgegeben werden müssen. Da unsere Auseinandersetzung wegen wirklicher Probleme stattfindet, werden diese nicht gelöst, indem man die Auseinandersetzung unterdrückt oder diese als subversiven Akt diffamiert.
Dies trifft auch zu, obwohl zuweilen eine recht modische Kritikfreude an der Arbeit ist. Ich habe den Eindruck, daß manche dieser Kritiker nach wie vor von Helvetia, unserer schwergewichtigen Muse, geküßt wurden, so daß wir heute eine Art »negatives Jodeln« hören, in dem Sinne: Wenn wir schon nicht besser sind als die andern, wollen wir wenigstens viel schlechter sein. Aber ich befürchte, daß die Wahrheit schrecklicher ist, weil banaler. Ich würde sagen, daß unsere Fähigkeit, gut und schlecht zu sein, sich im großen Ganzen an den internationalen Durchschnitt hält.
Aber unbestritten, wir haben Probleme, und es werden neue folgen. Das kann nur die erschrecken, die meinen, die Schweiz habe ihre Probleme ein für allemal aus der Welt geschafft. Diese ehrenwerte Überzeugung aber würde das Land zur ewigen Stagnation verurteilen. Zum Beispiel hatte die älteste Demokratie, wie wir unser Land gerne bezeichnen, der Tatsache Rechnung zu tragen, daß es menschliche Wesen wie Frauen gibt, denen lange Zeit jedes politische Recht vorenthalten wurde. Gut, das konnte geändert werden und wurde auch geändert. Demokratie ist nun einmal nicht ein Ergebnis, so sehr die Schweiz mit Stolz demokratische Errungenschaften vorzeigen kann, sondern sie ist eine Bereitschaft und ein Wille, demokratische Antworten auf aktuelle und kommende Fragen zu suchen. Insofern hat die schweizerische Demokratie nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Zukunft – glücklicherweise, würde ich sagen, glücklicherweise für die jungen Schweizer, denn auch in der ältesten Demokratie fangen die Einwohner damit an, jung zu sein.
Wie immer auch an diesem Prozeß der Selbstkritik und Neu-Interpretation war ein Gutteil unserer Schriftsteller beteiligt, nicht alle in gleicher Weise und nicht alle mit gleicher Kompetenz, die einen mehr durch ihre Bücher wirkend und die andern mehr durch ihre Aktivitäten, die einen dem Engagement und die andern dem Trend verpflichtet.
Wenn wir uns dessen bewußt sind, wird meine Verlegenheit, von der ich eingangs sprach, gegenstandslos. Wir stellen fest, auch ein Schriftsteller kann durchaus das Rüstzeug mitbringen, wenn die Schweiz, wie bei diesem »Schweizer Lehrstuhl«, zum Thema steht.
So lautet die Frage also nicht mehr, ob ein Schriftsteller sich für diesen Lehrstuhl eignet, sondern, ob es auch ein Schriftsteller sein kann wie ich. Da allerdings kann die Antwort darauf nur eine persönliche sein. In dem Sinne erlaube ich mir eine intellektuelle Visitenkarte zu präsentieren: Ich bin unter folgenden meiner Bücher erreichbar.
Wie halten Sie es mit der Schweiz? Das ist eine Frage, der kaum ein Schweizer Schriftsteller entgangen ist oder entgehen wird, eine Frage, die sich nach seiner staatsbürgerlichen Verantwortung erkundigt. Ein solches Fragen ist leicht erklärbar, denn wir kennen eine Tradition solcher Verantwortlichkeit. Ich würde es die Gottfried-Keller-Tradition nennen. Dieser große Erzähler aus dem letzten Jahrhundert wurde eine paradigmatische Figur, nicht nur wegen seiner Werke, sondern weil er mit aller Entschiedenheit in der politischen Auseinandersetzung seiner Zeit Stellung bezog. Und nicht nur das, als Regierungsbeamter des Kantons Zürich gab er ein oft zitiertes Beispiel dafür ab, daß ein Autor neben dem Schreiben von Büchern ein durchaus nützlicher Mitbürger sein kann.
Ohne Zweifel gefällt eine solche Konzeption literarischer Existenz all den Lehrern, die über die Schulbücher herrschen. Sie hat auch in der Tat eine Literatur gefördert, in der man vor allem einmal die gute Absicht lobt, selbst wenn diese auf Kosten der schöpferischen Phantasie geht.
War nicht auch Heinrich Pestalozzi ein Schriftsteller? Der Mann, dem wir die Volksschule verdanken? Eine Schule, die jeder und zwar kostenlos besuchen kann, wohl einer der großartigsten Beiträge meines Landes zu einer demokratischen Gesellschaft. Aber indem Pestalozzi seine Romane in unverhohlen pädagogischer Absicht schrieb, scheiterte er als Schriftsteller. Wir können einem ähnlichen Fall auf höherem Niveau wieder begegnen, bei Jeremias Gotthelf, einem Pfarrer, der Bücher schrieb. Wenn Gotthelf in seinen Romanen und Erzählungen predigt, wird er langweilig. Aber glücklicherweise hat der Erzähler in ihm den Prediger überlistet, so daß wir in Gotthelf einen gewaltigen Fabulierer bewundern dürfen.
Doch trifft man in unserer Literatur auch eine ganz andere Tradition an, eine, der unser dritter Mann aus dem letzten Jahrhundert angehören würde, Conrad Ferdinand Meyer. Aber ich ziehe es vor, diese zweite Richtung nach einem andern Autor zu benennen, nach einem Klassiker aus unserem Jahrhundert, nämlich Robert Walser. Er vertritt den »reinen Poeten«, obwohl er hinterhältiger ist, als er selber zugeben würde. Als Schriftsteller ist er ein heimlicher Verführer, insofern gefährlich, da er ganze Generationen dazu verleitete, ihn zu imitieren.
Nach alldem können wir feststellen, daß es in der Brust eines Schweizer Schriftstellers zwei Träume gibt: so nützlich zu sein wie Gottfried Keller und so poetisch wie Robert Walser. Und diese beiden Träume werden nicht selten von ein und demselben Autor geträumt.
Jedenfalls wird ein Schweizer Schriftsteller nie der Frage entgehen, wie er es mit dem sozialen und politischen Engagement hält. Ich selber ertappte mich oft genug dabei, mein Schreiben zu rechtfertigen – als ob ich zuerst eine staatsbürgerliche Steuer bezahlen müßte, um damit eine Lizenz fürs schöpferische Schreiben einzulösen.
In meinem Falle konnte ich allerdings immer wieder auf meinen Journalismus verweisen; so sehr er auf der einen Seite zunächst eine Möglichkeit war, sein Leben zu verdienen, so sehr bot er auf der anderen eine Chance, zu aktuellen Problemen Stellung zu beziehen – manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Freiheit. Aber es sollte sich zeigen, daß für mich zusehends andere Themen Bedeutung erlangten, was mit meinen Reisen zusammenhing. Vorerst einmal Lateinamerika, und nicht nur Lateinamerika als solches, sondern als Teil der sogenannten Dritten Welt. Noch Mitte der sechziger Jahre, als ich über Lateinamerika zu schreiben begann, war bei uns die Information recht dürftig; es stellte sich die Aufgabe, an einem neuen Bewußtsein mitzuarbeiten.
Allerdings können wir im Augenblick einen Trend zu dem feststellen, was man unsere ureigenen Bedürfnisse nennt. Der wachsende Regionalismus mag als Reaktion gegen einen nicht minder wachsenden internationalen Konformismus verstanden werden. Aber dieser Regionalismus ist nicht frei von Resignation; er ist ein gefährlicher Rückzug auf sich selbst und bringt eine Dialektisierung der Probleme mit sich. Es könnte sich erneut als dringend erweisen, dafür einstehen zu müssen, daß etwas für uns nicht erst von Belang wird, wenn es sich unmittelbar vor dem eigenen Fenster abspielt – ganz abgesehen davon, daß unter Umständen unser eigenes Fenster von einem italienischen Gastarbeiter eingesetzt und die heimeligen Vorhänge in Taiwan genäht wurden.
Zudem hat in jüngster Zeit ein Thema wie »Heimat« die schweizerischen Autoren beschäftigt. Ein Thema, zu dem ich am besten mit den Erfahrungen hätte beitragen können, die ich außerhalb des Landes machte. Kommt man zurück (und ich komme regelmäßig zurück und tue es nicht ohne Freude) – man kommt nie als der zurück, als der man ging. Das macht es manchmal schwierig, Dinge als einzigartig zu nehmen, die es nicht sind oder nicht in dem angenommenen Maße. Nicht, daß man den Dingen ihren Wert nähme, aber man gibt ihnen einen anderen Stellenwert. Denn gleichzeitig ermöglicht eine solche Umwertung die Entdeckung dessen, was uns ausmacht, und so kann man seinem Land zu einem neuen unverwechselbaren Platz verhelfen, allerdings indem man es zu einem möglichen Heimatland unter andern Heimatländern anderer Völker macht.
Es nähme sich aber zu moralisierend aus, würde ich behaupten, ich hätte meine Reisen nur auf der Suche nach neuen Verantwortlichkeiten unternommen. Da war stets ein gutes Stück Abenteuer dabei, die intellektuelle Neugierde, was es heißt, daß für uns zum ersten Mal die Welt als Erfahrung und Konsequenz ein unteilbar Ganzes geworden ist.
Solche Entdeckungen können zu völlig entgegengesetzten Ergebnissen führen: Auf der einen Seite, im Falle von Lateinamerika, bestand die Chance, so etwas wie Experte zu werden. Aber nach meiner ersten Reise durch den Fernen Osten, eine Reise, die nicht nur von Land zu Land ging, sondern von Kultur zu Kultur und von Geschichte zu Geschichte – nach dieser Reise war mir klar, von wie vielen Kulturen ich allein in diesem Teil der Welt nie mehr als nur eine bescheidene Ahnung haben werde.
Aber ob die Entdeckungen mich zum Experten oder zum Analphabeten machten, was mich dabei immer wieder in Erstaunen versetzte, war die Erfahrung, wie viele Sprachen der Mensch spricht – und dies nicht linguistisch verstanden. Ein Staunen darüber, was dem Menschen alles zum Thema Mensch einfiel. Ein ambivalentes Staunen allerdings, da es sich in einer Welt vollzog, die mehrfach geteilt und hundertfach zerstritten ist, wo soviel Eigenständiges bedroht ist, sich aufgibt oder gnadenlos zerstört wird.
Schaut man zurück, neigt man dazu, auf eine Linie zu bringen, was man zufällig gelebt hat, als Fragment, oder sagen wir, von Ticket zu Ticket. Ich gehöre zu einer Generation, für die nach dem Zweiten Weltkrieg »Europa« eine hoffnungsvolle Parole wurde. In der Schule hatte ich gelernt, daß die Schweiz im Herzen Europas liegt. Aber es war in Wien, wo mir bewußt wurde, daß es ein slawisches Europa gibt. Meine Vorstellung von Europa hatte nur der einen Hälfte gegolten, die andere blieb mehr oder weniger »terra incognita«. Im westlichen Europa aber erlangten zwei Länder Bedeutung: Griechenland, wo Europa begann, und am andern Ende des alten Kontinentes, ebenfalls am Rand, Portugal, wo Europa endet, und dies nicht nur geographisch. Dort fing Europa sein atlantisches Abenteuer an. Ich überquerte zuerst den Südatlantik Richtung Südamerika, lernte dort, daß es verschiedene Lateinamerikas gibt; auf spanisch ist Amerika ein Plural, »las Americas«. Erst später überquerte ich den Nordatlantik in Richtung USA; wo Amerika ein Singular ist. Aber in Portugal begann nicht nur das atlantische Abenteuer Europas, sondern auch sein pazifisches. So folgte ich eines Tages den portugiesischen Spuren in Asien als eine Art Süßwasser-Portugiese; und eine innere Logik führte mich zur spanischen Entsprechung, zu den Philippinen; dort treffen sich West und Ost, aber West hat bereits eine doppelte Bedeutung, eine spanisch-europäische und eine angelsächsisch-amerikanische. Und noch später hatte ich das Glück, eine Zeitlang in Kalifornien zu leben, einmal mehr am Rande eines Kontinents, dort wo die USA aufhören, eine atlantische Nation zu sein, und wo sie zu einer pazifischen werden. Ich begann über diesen Pazifik nachzudenken, der den Atlantik entthronte, wie der Atlantik einst das Mittelmeer entthront hat – ein überraschendes Interesse für jemand, der einst am Zürichsee stand, der dem Kind damals so groß vorkam.
Reisen ist wie lesen – beginnt man einmal damit, hört es nie mehr auf. Nur wer zu Hause bleibt, weiß, wie die Welt ausschaut. Liest man nur ein Buch, kennt man die Wahrheit; liest man mehr als ein Buch, hört es nicht mehr auf, und man stellt fest, daß die Wahrheit eine Bibliographie hat.
Wie immer ich aber auch meinen Journalismus einsetzte, es war eine Arbeit, die ihre Rechtfertigung von außen erhielt, zumal ich mit einem legitimen Bedürfnis nach Information rechnen konnte. Eine entsprechende Rechtfertigung für Literatur gibt es nicht, wie edel oder aktuell auch immer die Motivation sein mag. Literatur steht für sich und ist ihre Rechtfertigung selbst.
Das heißt nicht, daß man als Schriftsteller außerhalb der gegebenen Bedingungen schreibt. Wenn ich sagte, daß ich aus einer Stadt komme, liegt es auf der Hand, daß diese Stadt sich in meinem literarischen Werk wiederfindet. Zum Beispiel in einem Buch wie Die Kranzflechterin. Allerdings war es nicht so sehr die ganze Stadt als die Arbeiterviertel, in denen ich aufgewachsen bin. Um diese Welt der Proletarier und Kleinbürger darzustellen, wählte ich eine Frau, die ihr Kind allein großzieht. Da sie die Unsicherheit von Liebe und Leben erfuhr, hält sie nach etwas Sicherem Ausschau, und sie entdeckt, daß das Zuverlässigste der Tod ist. In der Hinsicht hat auch tatsächlich noch nie jemand jemanden enttäuscht. So entscheidet sie sich, Totenkränze zu flechten, überzeugt, daß jeder einen Kranz verdient, und in der Hoffnung, daß sich auch jeder einen leisten kann.
Aber mein erstes Buch hieß Abwässer – ein Gutachten. Es spielt in einer anonymen Stadt, obwohl Zürich die Inspiration dazu lieferte. Ich erinnere mich, wie ich als Student auf eine Baustelle stieß, in einer riesigen Grube entdeckte ich ein System von Rohren. Diese kamen aus dem Hauptquartier der Polizei, dem Rathaus, einer Bibliothek, aus ehrbaren Häusern und auch solchen mehr des Vergnügens, und alle Rohre waren rostig und schmutzig und waren sich gleich. Ich entdeckte eine Welt, die verborgen unter unseren Füßen liegt, eine demokratische Welt, wo keiner dem andern was vormachen kann.
Mag sein, daß bei einem solchen Thema Schweizerisches mitspielte. Mein Land und meine Stadt sind berühmt dafür, vorbildlich sauber zu sein. Bis zu dem Grad, daß Fremde meinen, Straßenwischen sei bei uns ein Schulfach. Diese Sauberkeit kann aber zu falschen Vorstellungen führen, indem man sie mit Unschuld verwechselt. Saubersein aber heißt nur, gewaschen zu sein, und zwischen Saubersein und der Produktion von Schmutzwasser besteht eine Beziehung, wobei ich allerdings zögere, die Produktion von Abwässern als eine spezifische schweizerische Fähigkeit zu betrachten.
Und wenn ich an ein anderes Buch denke: Sollte Noah und seine Arche ein besonders schweizerisches Thema sein, da wir Schweizer nun einmal darauf versessen sind, uns zu retten? Allerdings wird es in einer kleinen Arche sein, wie es uns entspricht; aber sie wird groß genug sein, um wenigstens die einheimischen Gattungen zu retten. Aber Noahs Geschichte wurde zuerst nicht auf deutsch oder gar schweizerdeutsch, sondern auf hebräisch erzählt. Zudem blieb mir ja nur eine eigene Version: die Geschichte einer Konjunkturgesellschaft, die ihr gutes Geld macht, indem sie sich für eine Katastrophe rüstet, an die sie nicht glaubt. Sollte das nicht erst recht schweizerisch sein, da wir mit Leidenschaft an den Ernstfall denken, ohne mit ihm zu rechnen? Aber was – wenn Noah von seiner Frau gefragt wird, wie er zu seiner Idee der Sintflut gekommen sei und dies nach dreißig Jahren glücklicher Ehe, und Noah antwortet: »Ich habe mir die Gesellschaft angeschaut, da fiel mir nur eines ein, regnen lassen.« Ich fürchte, daß ich mit diesen Worten Noah kaum zu einem schweizerischen Paß verholfen habe.
Ohne Zweifel, ein solches Angehen der Bücher vom schweizerischen Aspekt her kann Überraschungen bringen. Ich erinnere mich an ein Gespräch über meinen Roman Der Immune. Mein Gegenüber hielt fest, daß jemand, der so nach Immunität verlange, ein Schweizer sein müsse; er stellte erstaunliche Zusammenhänge zwischen Immunität und Neutralität auf. So einigten wir uns darauf: Wenn die Ritter von einst die Intellektuellen von heute sind, dann wäre mein Immuner nicht ein Ritter von der traurigen Gesellschaft, sondern ein Intellektueller von der traurigen Neutralität.
Aber so überraschend solche Bemerkungen auch immer sein mochten, am Ende blieb ich mit meinem Helden allein, mit einem Manne, der nicht an seinen Empfindungen draufgehen möchte und der in einer Welt der Absurdität nicht wahnsinnig werden will. Sein Problem des Überlebens hat nichts mit Extremsituationen zu tun; es beginnt jeden Morgen mit dem Alltag von neuem, und nur schon die Banalität durchgestanden zu haben ist wie ein Triumph für ihn.
Nicht ohne Verwunderung jedenfalls habe ich manchmal in meinem Land die Diskussion über die Rolle des Schriftstellers verfolgt, als ob sich literarische Fragen für jemand anders stellen, der nicht einfach Schriftsteller ist, sondern Schweizer Schriftsteller. Es fällt mir nun einmal schwer, auszumalen, daß sich ein schweizerischer Chirurg darüber Gedanken macht, ob es eine besondere schweizerische Methode gibt, um einen schweizerischen Blinddarm zu operieren.
Für mein literarisches Schaffen stehen mir am Ende und am Anfang nichts als Worte zur Verfügung, und ich hoffe, daß ich diese Worte so zusammenbringen kann, daß daraus Sprache entsteht. Diese Sprache ist nicht ein Mittel, das ich wie ein Werkzeug benutzen kann, sondern es ist ein Instrument, das im Augenblick, da es angewendet wird, stets von neuem erfunden werden muß.
Es gibt nicht Sprache, sondern nur die Möglichkeit von Sprache, und dies nicht einfach linguistisch verstanden. Obwohl das Linguistische eine besondere Rolle spielt für mich als Schweizer: mit der Mundart im Mund und dem Schriftdeutschen in der Schreibmaschine.
Da ist auf der einen Seite eine Sprache, die an Begriffe glaubt und an die Terminologie, ihre Schrittart geht von Argument zu Argument, und es ist die Analyse, die ihr Zusammenhang gibt.
Und da ist eine andere Sprache, die an Metaphern glaubt, die sich auf die Phantasie verläßt, die nicht aufdecken und zergliedern will, sondern erschaffen und darstellen.
Beide Sprachen hängen zutiefst zusammen und stehen im unvermeidlichen Widerspruch. Und innerhalb jeder der beiden können wiederum die verschiedensten Sprachen angetroffen werden, entsprechend der ganzen Skala, die zum Menschen und seinen Möglichkeiten gehört. In ihnen spiegeln sich die widersprüchlichsten Situationen, in denen wir leben und zu leben haben, und jede dieser Situationen verlangt nach ihrer Sprache.
Jetzt mag es klarer geworden sein, wie die Sprachen, die ich auf meinen Fahrten durch die Welt antraf, und die Sprachen, die ich in mir selber vorfinde, wie die zusammengehören. Derart, wie das Thema dieser Inaugural-Adresse mit dem unserer Seminarien verbunden ist: die Situation eines Schweizer Autors innerhalb und außerhalb seines Landes führt unvermeidlich zur Frage, wieviel Sprachen braucht der Mensch.
Der Mensch als vielsprachiges Wesen, diese Vorstellung kommt nicht einfach einer liberalen Konfession gleich, im Sinne von Leben und Leben-lassen oder Schreiben und Schreiben-lassen. Damit ist mehr gemeint als eine wohlwollende Toleranz. Darin drückt sich ein unausweichliches Bedürfnis nach dem andern und den andern aus. Die anderen, sie sind die unerläßliche Voraussetzung für einen selbst. Erst durch die andern und dank ihnen erlangen wir Bewußtsein von uns selbst. Indem wir all die andern Sprachen und deren Möglichkeiten kennen, finden wir zurück zur eigenen und zu deren Möglichkeiten – selbst auf das Risiko hin, daß am Ende meine Sprache nur aus ein paar wenigen Worten besteht, aber es wären die unabdingbar eigenen.
Vom Erzählen erzählen
Die fünf Poetik-Vorlesungen wurden zwischen dem 12. Januar und dem 3. Februar 1988 in der Großen Aula der Ludwig-Maximilian-Universität München gehalten. Für die Buchausgabe wurden die Vorlesungen stellenweise überarbeitet. Wolfgang Frühwald, Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Universität München, der für die Buchpublikation Vom Erzählen erzählen die Einführung in das literarische Werk Hugo Loetschers schrieb, ist auch der Verfasser des Beitrags über Hugo Loetscher im Neuen Handbuch der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1945.
Am Anfang aller Entdeckungen Von Wolfgang Frühwald
Reisen«, so meinte der Reise-Enthusiast Hugo Loetscher 1981, sei wie »lesen – beginnt man einmal damit, hört es nie mehr auf. Nur wer zu Hause bleibt, weiß, wie die Welt ausschaut. Liest man nur ein Buch, kennt man die Wahrheit; liest man mehr als ein Buch, hört es nicht mehr auf, und man stellt fest, daß die Wahrheit eine Bibliographie hat.« Ein Reiseschriftsteller aber ist Hugo Loetscher nicht in dem vordergründigen Sinne, daß er über Entdeckungen und Erfahrungen in, heute so nahe gerückten, fernen Ländern berichtet, sondern in dem Sinne, daß er von den Rändern und den Grenzen berichtet, an welche der Mensch geraten ist. Mit dem Ende des 20. Jahrhunderts nämlich, also mit den Jahrzehnten, in denen wir heute leben, so heißt es bei Hugo Loetscher 1983, ist eine wenigstens fünfhundertjährige Geschichte zu Ende. »Eine, die mit dem begonnen hatte, was man noch immer hartnäckig die Entdeckungen nennt, und sie hatte damit aufgehört, daß es auf der Erde keinen weißen Fleck mehr gibt. Begonnen mit solchen, die hinter sich die Schiffe verbrannten, bevor sie sich an die Eroberung machten, und aufgehört mit Astronauten, die auf dem Mond für jeden Schritt mit der Zentrale auf der Erde in Verbindung standen.« (Ein Rückblick auf unser Jahrhundert von einem pazifischen Ufer aus, 1983).
Wenn das Zeitalter der falschen Entdeckungen, das der Eroberungszüge auf allen Kontinenten und Meeren der Erde tatsächlich zu Ende gehen sollte, wenn mit ihm vielleicht sogar das Zeitalter der großen Völkervertreibungen, der Flüchtlingszüge zu Wasser, zu Lande und in der Luft, zu Ende gehen könnte, müßte dann nicht, hier und jetzt, in den wenigen Jahren noch des zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts, das Zeitalter der wahren Entdeckungen beginnen? Die Ära der unüberschaubaren Vielfalt menschlicher Varietäten, die der Fremdheit des Vertrauten, der Ferne des Heimatlichen und der Nähe des Fremden?
Wer oft von Reisen zurückkehrt, wird die Heimat immer wieder neu und anders erleben, und im Sinne eines solchen grundlegenden Perspektivismus ist Hugo Loetscher ein Dichter der Entdeckungen geworden. In seinem Werk kennt er nur eine Angst, die vor der Unverbindlichkeit; so ist er von den Rändern Europas aus, von den Rändern der westlichen Zivilisation aus der »Ethnologe des eigenen Stammes« geworden. Es ist kaum verwunderlich, wenn in einem engagierten und von Fremdheitserfahrung gesättigten Werk diese Erfahrungen der Distanz und des Wechsels der Perspektiven auch auf die Figur des Erzählers und schließlich auf die des Autors übergreifen. In Hugo Loetschers Roman Die Papiere des Immunen (1986) findet sich der Satz: »Suchanzeige. Ich vermisse mich. Für die Auffindung meiner Person wird eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt.« Einen Zettel mit dieser Aufschrift findet der Ich-Erzähler des Romans unter den Papieren des Immunen, jener autobiographisch legitimierten Gestalt, welche Hugo Loetscher in einem Gespräch einen »intellektuellen Simplicissimus« genannt hat. Und wer – als Leser – in das weitläufige Abenteuer