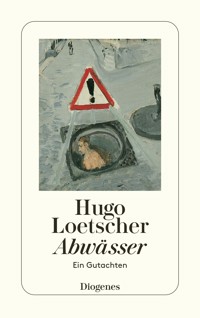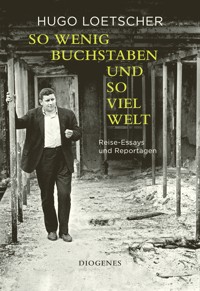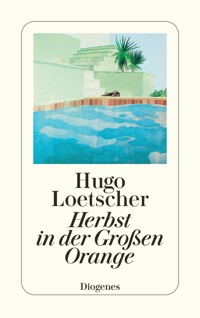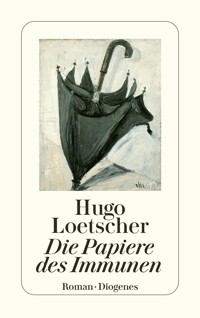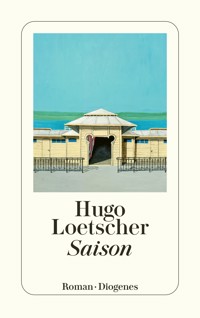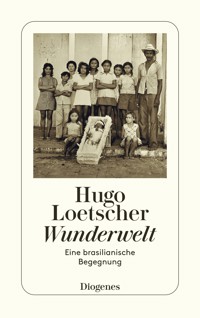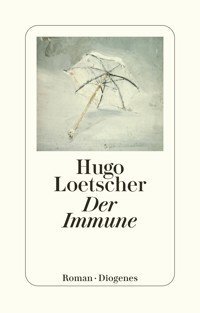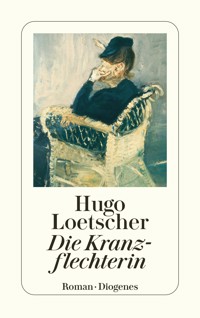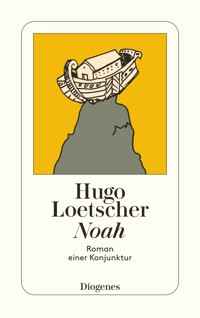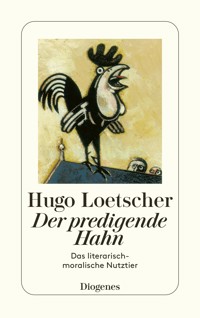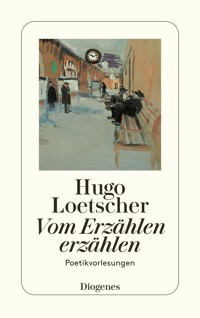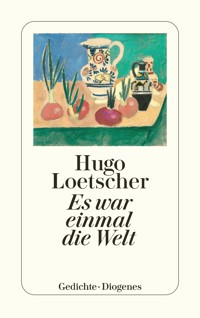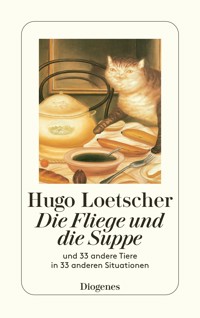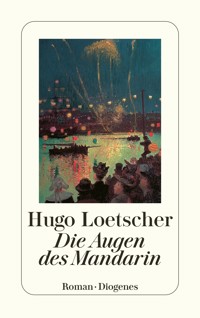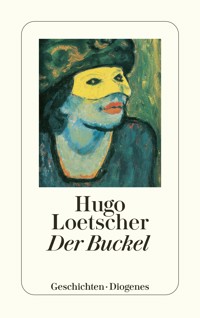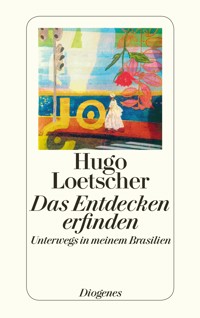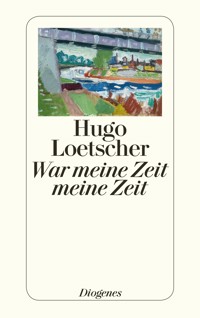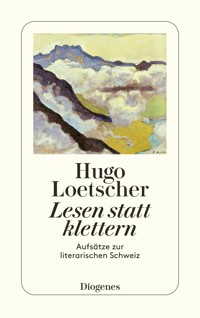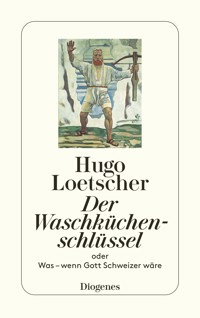
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Waschküchenschlüssel oder die täglichen Abfälle, die achte Todsünde oder ein Biotop mit einer Plastikfolie können Anlass für Geschichten über die Schweiz sein, wie sie in diesem Band gesammelt wurden. Ein Muss für jeden Alteingesessenen – und für alle Neuankömmlinge: das Schlüsselwerk zum Verständnis der helvetischen Seele und ihrer Eigenarten. Ein Buch über die kleine Schweiz von einem großen Schweizer Schriftsteller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hugo Loetscher
DerWaschküchen-schlüssel
oder
Was – wenn GottSchweizer wäre
Die Erstausgabe erschien 1983 unter dem Titel
›Der Waschküchenschlüssel und andere Helvetica‹
im Diogenes Verlag
Die Taschenbuchausgabe 1988
wurde um vier Beiträge erweitert
Die Neuausgabe 1998
wurde vom Autor nochmals um
zwei Beiträge erweitert
Umschlagillustration: Ferdinand Hodler,
›Wilhelm Tell‹ (1896/97)
Öl auf Leinwand, 256x196cm
Kunstmuseum Solothurn
Vermächtnis Frau Margrit Kottman-Müller
in Erinnerung an ihren Ehemann
Dr.Walther Kottmann, 1958
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 21633 2 (20.Auflage)
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]Inhalt
Der Waschküchenschlüssel [7]
»Niene geit’s so schön u luschtig« [13]
Helvetische Flurbereinigung [19]
Ethnologin auf Schweizer Forschungsreise [23]
Im Herz und in der Mitte [29]
Runde Welt und flächige Sprache [37]
Was ein schweizerischer Arbeiter zur Arbeit trägt [45]
Unser Sprachkuchen [53]
Arbeit und Freude [63]
Alphorn mit Bambus [67]
Objektiv und ausgewogen [77]
Die achte Todsünde [83]
Militärische Exkursion verschoben [89]
Zutritt für Räuber verboten [99]
Fast wie in Südamerika [103]
Ein Inserat und ein Image [109]
Der erste Tag [115]
Vor einem helvetischen Schalter [121]
Abfallarchäologie [127]
[6] Die Römer kommen [135]
Ein Schweizer Mädchen in Karthago [141]
Über das Muff-Sein [147]
Die kluge Else [153]
Maß und Wert oder Kilo und Meter [157]
Wenn der Liebe Gott Schweizer wäre [165]
Ein unhelvetisches Ende oder Besuch bei der Freiheit [171]
Post Scriptum [175]
[7] Der Waschküchenschlüssel
Der Waschküchenschlüssel ist in diesem Lande nicht einfach ein Gebrauchsgegenstand, welcher jenen Raum öffnet, den man Waschküche nennt und wo die Maschinen stehen, welche den Vorgang erleichtern, der »waschen« heißt.
O nein. Der Waschküchenschlüssel erschließt hierzulande einen ganz anderen Bereich; er bietet Zugang zu Tieferem.
Und dies nicht nur, weil der Waschtag einen hohen Stellenwert im Ritualleben der schweizerischen Hausfrau einnimmt – demnach kommen nicht Hemden und Blusen, Socken oder Unterhosen auf die Leine, sondern es werden Flaggen der Sauberkeit gehißt.
Nein – der Waschküchenschlüssel hat Bedeutung über seine bloße Funktion hinaus, eine Tür zu öffnen; er ist ein Schlüssel für demokratisches Verhalten und ordnungsgerechte Gesinnung.
Um das zu verstehen, muß ich mit einer Geschichte ausholen, die zwar Jahre zurückliegt. Aber die neuerliche Erzählung eines Bekannten, die in [8] gleicher Richtung zielte, bewies, daß es sich beim Waschküchenschlüssel um eine Grunderfahrung helvetischen Verhaltens handelt.
In meinem Fall spielte sich die Geschichte in einem jener Mietshäuser ab, in denen es nicht nur Wohnungen, Dachböden, Kellerräume, Vorräume und Abstellräume gibt, sondern auch eine Kollektiv-Waschküche und dazu einen gemeinsamen Schlüssel. Diesen Schlüssel reichte man nach einem Terminplan von Wohnung zu Wohnung und von Etage zu Etage weiter; wenn der Schlüssel ganz oben rechts angelangt war, fing er seinen Rundgang durchs Haus unten links wieder an.
Da ich Junggeselle war, brauchte ich diesen Schlüssel nicht, denn ich besorgte die Wäsche nicht selber. Aber ich mußte bald erfahren, daß es nicht nur ein Recht auf den Waschküchenschlüssel gibt, sondern auch eine Pflicht ihm gegenüber.
Gemäß der Hausordnung, die mir per eingeschriebenem Brief zugestellt worden war, klingelte eines Abends eine Frau und überreichte mir einen Schlüssel. Als ich sagte, ich brauche ihn nicht, sie solle ihn doch gleich der Mieterin über mir weitergeben, sah mich die Frau vor der Tür recht verdutzt an: wie sie dazu komme, mir den Weg ins obere Stockwerk abzunehmen.
Als ich das nächste Mal Waschtag hatte, klingelte [9] eine junge Frau, die Mutter von zwei Kleinkindern, die froh war, zwischendurch mal rasch die Waschküche benutzen zu können; ich überließ ihr den Schlüssel und bat sie, ihn gleich weiterzugeben, womit sie ohne weiteres einverstanden war.
Aber zwei Tage darauf klingelte die Frau von der oberen Etage, die Nachfolgerin in der Waschküchenschlüssel-Ordnung; sie reklamierte, es sei an mir persönlich, den Waschküchenschlüssel weiterzugeben, und obendrein sei die Waschküche nicht sauber gewesen. Ich entschuldigte mich und erklärte, daß ich gar nicht selber gewaschen hätte.
Doch die Frau machte mich darauf aufmerksam, daß ich verantwortlich sei für die Sauberkeit der Waschküche. Ihr Bruder arbeitete bei der Polizei, von dem wußte sie, daß man als Wagenbesitzer auch für den Zustand des Autos verantwortlich ist, selbst wenn man es einem dritten überläßt.
Als ich der jungen Frau, der ich den Schlüssel gegeben hatte, auf der Treppe begegnete, erzählte ich ihr lachend, was geschehen war. An einem der nächsten Morgen stand ihr Mann vor meiner Tür: er fände es unverschämt von mir, herumzuerzählen, seine Frau sei eine Schlampe, und er drohte, er würde alle notwendigen Schritte unternehmen.
Dennoch fragte mich die junge Mutter wieder, ob sie meinen Waschküchenschlüssel haben könne. [10] Kurz danach erkundigte sich auch die vom Parterre rechts, ob sie mal rasch in die Waschküche könne, ich brauchte sie ja nicht. Als ich sagte, ich hätte den Schlüssel bereits der Frau vom vierten Stock links gegeben, lächelte sie nur.
Ich wurde suspekt (ohne es vorerst zu merken); nun hieß es im Haus, was der – und das war ich – wohl mit der jungen Aeschlimann habe, daß er ihr immer den Waschküchenschlüssel zuhalte.
Da beschloß ich, den Schlüssel in Empfang zu nehmen und ihn in einer Schublade ruhen zu lassen, bis meine Waschtage um waren. Um nicht behelligt zu werden, schloß ich mich während dieser Tage ein, ging nicht an die Türe, wenn es klingelte, und legte im Hinblick auf die Waschtage Vorräte an.
Zudem entschloß ich mich, mit der Hausverwaltung Verbindung aufzunehmen, damit sie mich vom Weiterreichen des Waschküchenschlüssels befreie. Doch der Mann am Telefon sagte, das gehe aus grundsätzlichen Überlegungen nicht, man müsse nur an einen eventuellen Wohnungswechsel denken, was da passieren könnte… – nein, ich solle die Waschküche benutzen, er sei bereit, mir die Waschmaschine zu erklären, er kenne viele Junggesellen, die ihre Wäsche selber besorgten.
Also packte ich beim nächsten Waschtag meine schmutzige Wäsche in einen Korb und trug ihn [11] hinunter, als die Nachbarin mit einer andern auf der Treppe stand. Aber noch ehe ich die Bedienungsvorschrift der Waschmaschine gelesen hatte, war es mir verleidet. Ich ließ die Schmutzwäsche stehen und trug sie erst am Ende meiner Waschtage heimlich in die Wohnung, um sie dann im Koffer in eine Wäscherei zu bringen, die nicht in der Nähe des Mietshauses lag.
Aber dann stellte mich die Frau vom dritten Stock links: wann ich eigentlich wasche; sie würde auch gern zwischendurch einmal die Waschmaschine benutzen »wie die andern«, sie habe ein paar Mal am Abend bei mir geklingelt, aber ich sei ja gewöhnlich nicht zuhause und morgens früh traue sie sich nicht, weil ich doch regelmäßig erst nach Mitternacht heimkäme.
Es bot sich nur eine Möglichkeit, dem allem auszuweichen: Ich legte meine kurzen Reisen auf meine Waschtage, ich hielt als Journalist Ausschau nach Ereignissen, die dann stattfanden, wenn in der Hausordnung meine Waschtage vorgesehen waren.
Auf diese Weise war ich weg, und die andern blieben mit meinen Waschtagen zurück. Sie stritten, wer über den Schlüssel verfügen dürfe, ob die, welche vor mir dran war, oder die nach mir. So viele Parteien und Fraktionen sich auch [12] bildeten, in einem Punkt waren sich alle einig: »Da könnte jeder kommen und einfach verreisen.«
Ich hatte völlig falsche Vorstellungen gehabt vom Waschküchenschlüssel. Ich hatte gemeint, das sei ein Schlüssel für eine Waschküche, aber der Waschküchenschlüssel war etwas ganz anderes: Er war der integrierende Bestandteil einer Hausordnung, angesichts der die Waschküche selber an Bedeutung verlor. Wir benutzen die Waschküche wie unsere Demokratie – nicht so sehr als Boden für Freiheiten, dafür um so lieber als Fundament für eine Hausordnung.
Was für ein weites Feld ist da schon der Alltag. Und wenn darob auch Unglück entsteht, entscheidend ist nur, ob die Mehrheit an der Aufrechterhaltung der Waschordnung beteiligt ist oder nicht – zumal keiner der Unglücklichen behaupten kann, er sei nicht zu seinem Waschküchenschlüssel gekommen.
[13] »Niene geit’s so schön u luschtig«
»Niene geit’s so schön u luschtig, wie deheim im Ämmital« – so singt das Volkslied: Nirgendwo geht es so schön und lustig zu wie daheim im Emmental. Schon immer wollte ich einen Ort kennenlernen, wo es schön und lustig ist wie sonst nirgendswo. Also, auf ins Emmental. Nur – ist es im Emmental überall gleich lustig und gleich schön? Fährt man mit Vorteil nach Langnau oder auf die Moosegg? Ist es das ganze Jahr lustig? Auch während dem Heuet? Oder erst mit der Metzgete?
Während ich daran war, solches herauszukriegen, hörte ich am gleichen Radio, in dem eben noch das Emmental besungen worden war, ein Lied über Innsbruck: »Was ist wie du an Schönheiten voll, du Perle vom Tirol.«
Wenn aber Innsbruck so einzig voll von Schönheiten ist, wie kann es dann im Emmental schön sein wie nirgendswo? Aber vielleicht verhält es sich so: In Innsbruck ist es nur schön, im Emmental hingegen schön und lustig zugleich.
Warum soll ich nicht zuerst ins Emmental und [14] hinterher nach Innsbruck fahren? Es gibt vom Emmental über Bern nach Innsbruck schließlich eine Zugverbindung. Zudem könnte ich erst noch in St.Gallen die Fahrt unterbrechen und einen Abstecher ins Appenzell machen. Denn das hatte ich inzwischen auch herausgefunden: »E Ländli händs, Gott Lob und Dank, ke söttigs wit und brät.«
Von diesem Ländchen, wie es ein solches weit und breit nicht gibt, von diesem »schönste Fleckli Wölt«, fahre ich dann zur »Perle vom Tirol, die an Schönheiten ist voll«. Und wenn schon in Österreich, kann ich gleich nach Wien gehen; denn »Wien, Wien nur du allein, sollst stets die Stadt meiner Träume sein«. Die Gefahr, daß sich inzwischen etwas geändert hat, droht kaum, denn »Wien bleibt Wien«.
Allerdings würde ich dort nicht bleiben; auf der Rückfahrt würde ich über Kufstein reisen. Sollte mich jemand in Zukunft fragen: »Kennst du die Perle, die Perle Tirols?«, kann ich sagen, ich kenne zwei Perlen, Innsbruck und Kufstein am grünen Inn, und ich könnte erst noch angeben, ob es Natur- oder Zuchtperlen sind.
Als ich meinen Bekannten erzählte, ich würde ein Rundreise-Ticket zusammenstellen für Orte, die schön sind wie keine andern, fragte mich der eine, ob ich nach Kopenhagen gehe? Ehe ich eine [15] Antwort geben konnte, meinte ein zweiter: »Wieso Kopenhagen? Er fährt nach Palermo.«
Der eine summte mit Freddy »Wonderful Kopenhagen, keine Stadt ist wie du«. Dem andern aber hatte Peter Alexander anvertraut: »Palermo, wer deinen Zauber kennt, versteht meine Sehnsucht.« Ein dritter zitierte melodisch Maurice Chevalier: »Paris, la plus belle ville du monde.«
Gut, es gibt einen europäischen Reisepaß. Also fahre ich vom Emmental über Paris nach Kopenhagen, von dort ins Appenzell und über Innsbruck und Wien nach Kufstein und von da nach Palermo. Aber in Neapel steige ich nicht aus: Denn »Neapel sehen und sterben« würde bedeuten, daß ich nie nach Palermo käme, wo »es klingt und schwingt in den Palmen«.
Die Faldum-Alp lasse ich auch aus. Obwohl: Der Mann, der sang »am liebsten bin ich auf der Faldum-Alp«, tat es recht überzeugend. Diese Alp muß im Wallis liegen. So sehr ich dem Mann glaubte, daß er gerne auf dieser Alp ist, er ist sicher nur im Sommer dort; den harten Winter muß er unten im Tal bei Frau und Kind verbringen.
Aber es ist immer das gleiche: Hat man etwas im Kopf, hat man es auch schon im Ohr. Je entschiedener ich mir vornahm, dorthin zu gehen, wo es schön und lustig ist, um so verwirrender wurde das [16] Angebot. Sang doch eines Nachts spät Jonny Hill: »So schön wie Kanada ist kein anderes Land.« Jetzt fing es auch noch mit Übersee an. Und ich, der ich bereit gewesen wäre, mein Herz in Heidelberg zu verlieren, hätte es dort auf dem Fundbüro wieder abholen müssen, sonst hätte ich keines gehabt, um es in San Francisco zu lassen.
Die Sache wurde allmählich teuer und unerschwinglich. Denn auf die Frage von Tony Christie, ob ich je in Georgia gewesen sei, hätte ich beschämt gestehen müssen: »Nein«. Und dies, obwohl es dort »im Frühling wie Manna vom Himmel regnet«, worauf dann Sonnenschein folgt.
Ich begann mich überhaupt zu fragen, ob es sich vielleicht nicht gar so verhält, daß es überall lustig und schön ist wie nirgendswo. In mir stieg der Verdacht hoch: Vielleicht gibt es ein Lied über Zürich, die Perle an der Limmat, eine Stadt wie keine andere, wo es genauso lustig und schön ist wie nirgendswo auf der Welt.
Wenn dem so wäre, müßte ich nicht wegfahren. Dann hätte ich ja alles hier, auch wenn ich mir lustig und schöner vielleicht anders vorstelle, als ich es für gewöhnlich zu Hause antreffe.
Aber haben wir nicht schon als Jugendliche das Lied gesungen von »kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsre weit und breit«? Wir taten es [17] als Pfadfinder am Lagerfeuer. Später erfuhr ich, daß es auch ein Lied war, das die Hitler-Jugend sang. Es war eben ein allgemein gültiges Lied, das man überall und zu jeder Zeit singen kann: Denn es gibt nun mal »kein schöneres Land in dieser Zeit als das unsrige«, und zwar »weit und breit«.
[19] Helvetische Flurbereinigung
Es gibt Leute, die sind überzeugt, daß in unserem Land nur gedeihen soll, was schon immer zu ihm gehört hat. Vor allem wir selber, kraft unserer Vorfahren. Denn alles Fremde ist Bedrohung.
Wenn eine solche Gesinnung allgemeine Verbindlichkeit erlangen sollte, müßten wir aber konsequent sein. Wir hätten schon bei unserer einheimischen Natur zu beginnen. Natürlich sind die meisten davon überzeugt, das, was vor unseren Fenstern blüht und gedeiht, habe dort schon immer gegrünt und habe dort schon ewig gesprossen.
Aber dem ist leider nicht so. Denn vieles und nicht Unwichtiges, was wir säen und pflanzen, was wir düngen, ob chemisch oder biomäßig, wurde einmal importiert:
Ja, unsere Natur ist voll von »fremden Fötzeln«, voll von Eindringlingen und Zugewanderten.
So erschreckend die Einsicht sein mag, sie soll uns nicht daran hindern, unsere einheimische Natur einer gründlichen Prüfung zu unterziehen:
[20] Zu fordern ist eine helvetische Flurbereinigung.
Zum Beispiel müßten die Kirschbäume weg. So sehr dies ein Verlust fürs Auge und für die Flasche wäre, die Kirschbäume wurden von den Römern importiert; was aus Italien kommt, gefährdet unsere Wesensart ganz besonders. Daß die Römer die Kirschen aus Kleinasien übernahmen, ist dann deren Sache. Da wir aber schon daran sind, den Römern die Kirschbäume zurückzuschicken, könnten wir auch gleich die Kastanienbäume mitverladen.
Ohne Zweifel würde das für die Baselbieter und Zuger ein großes Opfer bedeuten. Aber sie wären nicht die einzigen, die ein Opfer zu bringen hätten. Wir haben genügend demokratische Erfahrung, um, wenn auch nicht den Gewinn, so doch die Opfer gerecht zu verteilen.
Auch die Berner müßten umdenken und vielleicht sogar »um-essen«. Die Kartoffel ist eben auch kein einheimisches Gewächs. Sie stammt aus Südamerika. Daß dort in den Anden andere Sennen wohnen als bei uns, kann man schon daraus ersehen, daß sie die Panflöte blasen und nicht Alphorn spielen wie wir.
Sollten sich die Walliser ins Fäustchen lachen, weil die Berner nun ohne Röschti dastehen, hätten sie das zu früh getan. Sie hätten in Zukunft zwar keine [21] Preissorgen mehr wegen der Überproduktion von Tomaten, und sie bräuchten sie nie mehr aus Protest in die Rhone zu werfen, aber sie würden auch nie mehr welche züchten. Denn dieses Nachtschattengewächs kommt ebenfalls aus Amerika.
Im Falle des Wallis hätte man allerdings stufenweise vorzugehen, damit diese Miteidgenossen nicht gleichzeitig auf ihre Tomaten und ihre Aprikosen verzichten müssen; diese letzteren würden allerdings nicht nach Südamerika, sondern nach Asien zurückwandern.
Da auch bei einer helvetischen Flurbereinigung die Berücksichtigung der verschiedenen Sprachregionen unerläßlich wäre, dürfte es den Tessinern einleuchten, daß der Mais von Natur aus nicht für die Tessiner Täler vorgesehen war; wobei man sich im Falle des Tessins den Abschied vom Mais mit einem großen Polenta-Essen auf einer Piazza vorstellen könnte.
Schwieriger wäre es schon mit unseren welschen »confrères«, die sicherlich an jenen Reben festhalten wollen, aus denen sie ihren Wein pressen, ob nun der rote oder weiße. Aber Reben sind nicht eine urschweizerische Pflanze. Zudem: Wenn man die Rebstöcke ausgerissen hätte, könnte man auch die Abhänge am Genfersee wieder so herstellen, wie sie der liebe Gott vorgesehen hatte: steil, abschüssig [22] und nicht mit Terrassen. Womit die Flurbereinigung noch lange nicht abgeschlossen wäre. Zum Beispiel die Pfirsiche, die hätten wir mit aller Wahrscheinlichkeit an die Chinesen zurückzugeben, nicht an Taiwan, sondern an die Volksrepublik China natürlich, da wir mit ihr diplomatische Beziehungen pflegen. Und ferner…
Da täte sich wahrlich ein weites Feld auf. Wie immer, wenn es uns ernst ist, würden wir eine Kommission bestellen. In ihr sollten schon wegen der zukünftigen Themenwahl auch Dichter vertreten sein, die ausschließlich Einheimisches besingen.
Allerdings könnte sich die Frage stellen, ob wir nicht noch weitergehen müßten. Denn die Vorfahren unserer Vorfahren sind einst eingewandert – Pfahlbauten hin oder her. Wenn dem aber so ist, drängt sich die Überlegung auf, ob wir, aus Respekt vor dem Land, wie es einmal war, nicht besser selber auswandern würden. Ohne Zweifel wäre das Schweizerland dann öd und menschenleer, aber dafür ursprünglich wie noch nie.
[23] Ethnologin auf Schweizer Forschungsreise
Ganz Genaues ist über den Fall nicht herauszukriegen. Aber er scheint uns wichtig genug, um darüber nicht einfach zu schweigen.