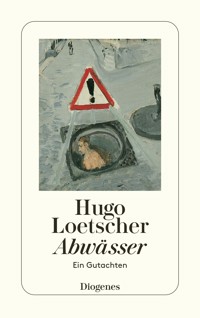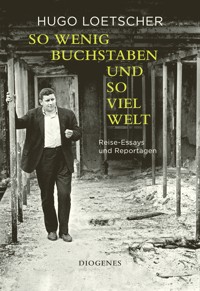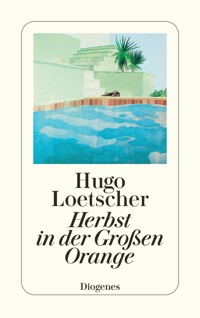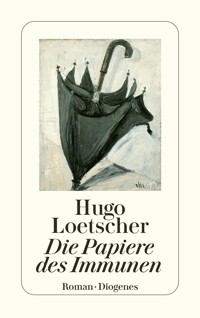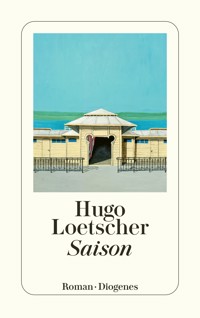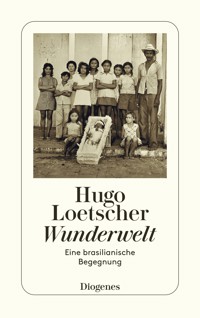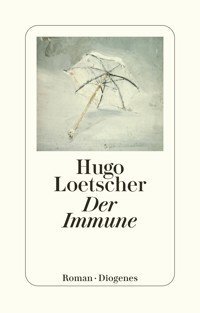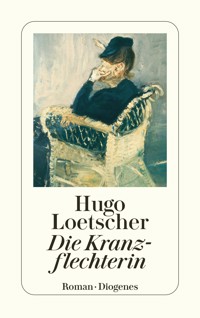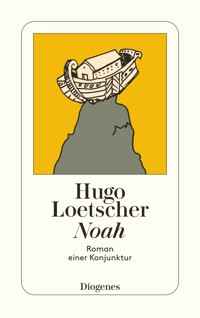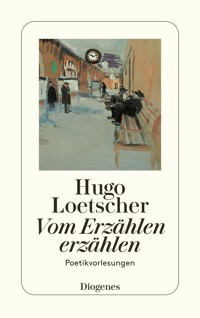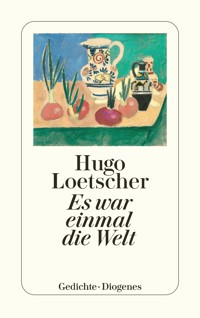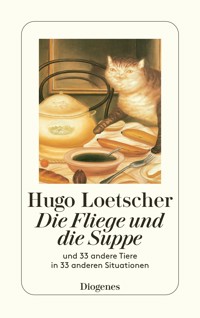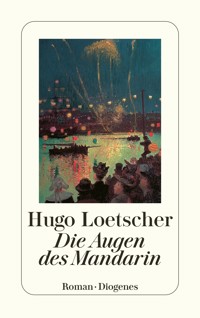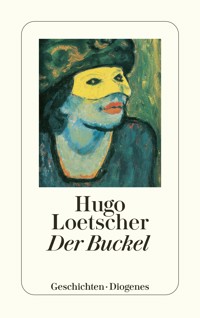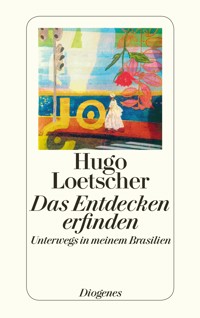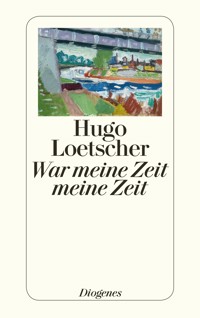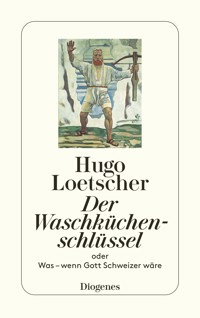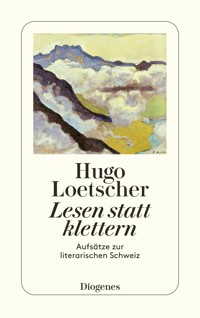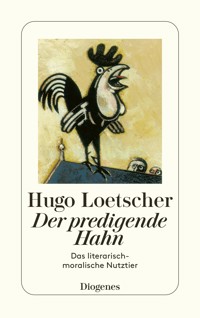
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicht nur für seine körperlichen Bedürfnisse nutzt der Mensch die Tiere: ohne die Tiere gäbe es Literatur und Malerei so, wie wir sie kennen, nicht. Man denke nur an Kafka und den Käfer… Mit bewundernswerter Leichtigkeit erzählt Hugo Loetscher aus der wundersamen Welt der vermenschlichten Tiere und ihrer vertierten Schöpfer. Illustriert mit berühmten Tierdarstellungen aus der Kunstgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hugo Loetscher
Der predigende Hahn
Das literarisch-moralische Nutztier
Diogenes
Grandville, aus: ›Vie privée et publique des animaux‹, Paris, 1867
Als ob Tiersein nicht schwer genug ist, der Mensch vermenschlichte die Tiere. Eine Folge davon: sie begannen zu reden.
Sie redeten mit allem, was ansprechbar war. Selbst mit toten Dingen. Wie die Viper, die eine Feile um etwas bat, obwohl die gewohnt ist, wegzunehmen und nicht hinzuzufügen.
Dank der Sprache verglichen ein Jagdhund und ein Haushund ihr Schicksal, wie antike Fabeldichter erzählen. Ein Fuchs stritt mit einem Adler darüber, wer von edlerer Abstammung sei. Oder ein Wildesel ließ sich unvorsichtigerweise beim Aufteilen der Beute mit einem Löwen auf einen Deal ein.
Die Tiere redeten notgedrungen auch mit dem Menschen: Der Fuchs mit dem Holzfäller, der das Tier, das sich bei ihm versteckte, nicht durch Worte, aber Gesten an den Jäger verraten wollte. Mit dem Ackersmann redete der Wolf, der, unfreiwillig in die Schlingen eines Pfluges verstrickt, Bereitschaft für Knechtdienst heuchelte.
Die Gespräche fielen entsprechend der Geographie und des Kulturraums aus. In Indien beschwerte sich ein Asket bei den sieben Läusen, denen er Gastrecht gewährte; sie hielten sich nicht an die Abmachung und bissen ihn während der Meditation. Und in Angola suchten Ziegen, Hühner und Schweine den Menschen auf, damit er ihnen gegen den gemeinsamen Feind, die Hyäne, Ställe und Pferche baue.
Unter welchen Himmelsstrichen Mensch und Tier sich begegneten, sie redeten miteinander und taten dies in der Sprache der Menschen.
Daß die Tiere bei der Begegnung mit dem zweibeinigen Aufrechtgeher dessen Sprache wählten, liegt auf der Hand. Schon deswegen, weil die Benachteiligten im Umgang mit den Mächtigen und Besitzenden gezwungen sind, deren Sprache oder mindestens Sprachbrocken zu lernen.
Die Tiere benutzten die Sprache der Menschen auch, wenn sie sich an die Götter wandten. Zum Beispiel der Esel, der sich über sein ausgebeutetes Dasein bei Zeus beklagte. Ihm tat der Göttervater in menschlicher Sprache himmlische Weisheit kund: er gerbte dem Esel die Haut, damit sie die Schläge besser aushält.
Die Tiere redeten die Sprache der Menschen, selbst wenn das Wort von Schnauze zu Schnabel und von Schnabel zu Rüssel ging.
Man kann sich vorstellen, daß einer, der kläfft, sich einem andern, der kläfft, verständlich macht, beim Beschnuppern wie beim Bebeißen. Doch wie soll der Fuchs, der keckert, mit der Amsel ins Gespräch kommen, die schackert, das Wesen, welches gackt, mit dem, das mauzt?
Oder sollte es eine Lingua franca geben? Als die NASA1977 den beiden Raumsonden Voyager I und Voyager II Botschaften für außerirdische Wesen mitverpackte, wurden Grußworte aus fünfundfünfzig Sprachen in Platinteller gepreßt sowie andere Laute und Geräusche der weltlichen Zivilisation, aber auch Gesänge von Buckelwalen, den einzigen Tieren, die außer dem Menschen längere Tonfolgen hervorbringen, sie exakt wiederholen und variieren. Die Buckelwal-Gesänge hätte man extraterrestrischen Tieren vorgespielt – die Frage blieb offen, mit welchen Lauten ein außerirdisches Schaf oder ein galaktisches Kamel geantwortet hätte.
Soweit die Tiere sich hienieden sprachlich äußern wollten, waren sie auf ein Esperanto angewiesen. Ihnen wurde als Verkehrssprache die der Menschen zugewiesen, obwohl diese keine verbindende Sprache besitzen, dafür kinderreiche Sprachfamilien.
Demnach begannen die Tiere in unserem Europa mit klassischem Griechisch und klassischem Latein. Redeten bei Aesop Prosa und bei Phaedrus per Gedicht. Sie skandierten elegant auf französisch oder russisch. Die Tiere redeten auch in Minoritätensprachen und im Dialekt. Zum Beispiel Alemannisch bei Johann Peter Hebel. Dann etwa, wenn der Käfer vor Lust auf süßen Saft bei einer Lilie sein Begehr stellte: »Ne Schöppli Alte hätti gärn.«
Die Sprachbegabung der Tiere ist enorm. Da kräht der Hahn auf dem ganzen Erdball »Kikeriki«. In Paraguay aber lernt er mehr als zwei Futurformen, in Afrika übt er für eine Bantu-Sprache Schnalzlaute, und in Laos aggluttiniert er.
Nun reden die Tiere nicht nur verschiedene Sprachen, sondern sie drücken sich gewählt aus wie ihre Lehrmeister. Man hört den Tieren an, ob sie französische Enzyklopädisten studierten oder sich in spanische Mystiker vertieften.
Nachdem die Tiere reden gelernt hatten, blieben sie dabei, sofern man sie zu Wort kommen ließ. Sie redeten sich bis heute durch Jahrhunderte und Kulturen hindurch und hinweg. Reden oder Nicht-Reden: ein tierliches Existenzproblem.
In Westafrika betrachten die Menschen die Affen als ebenbürtig und sind überzeugt, die Tiere verweigern sich dem Reden, um nicht in den Arbeitsprozeß eingeschaltet zu werden. Den thailändischen Affen hat das Nicht-Reden wenig genutzt; sie wurden abgerichtet, um an Stelle der Menschen auf Palmen zu klettern und reife Kokosnüsse denen zuzuwerfen, die am Fuß der Bäume kauern und am Strick ziehen. Ganz abgesehen davon – man hat es in der Sozialgeschichte stets begrüßt, daß die, welche arbeiten, nicht das Maul aufmachen. Anderseits wurden die Tiere in Zentralamerika gerade dafür bestraft, daß sie nicht reden. Im ›Popol Vuh‹, dem Schöpfungsbericht der Maya, liest man: »Nachdem die Zwillingsschöpfer Vierfüßler und Vögel geschaffen hatten, sprachen sie zum Reh, zu den Vögeln, zu Puma, Jaguar und Schlange: ›Lobt uns. Redet zu uns‹. Aber die Tiere konnten nicht reden wie Menschen. Sie zischten, schrien und gackerten. Sie konnten kein Wort formen, und ein jegliches schrie nach seiner Art. Da beschlossen die Former und Schöpfer: ›Wir werden euch ersetzen, da ihr nicht sprechen könnt. Ihr ward nicht fähig uns anzurufen. Daher werden wir andere erschaffen, die uns willig sind. Das ist fortan euer Schicksal: Euer Fleisch wird gefressen werden.‹«
Reden, um nicht gefressen zu werden, erwies sich bereits für den Menschen als Methode, der nur bedingt Erfolg beschieden war. Aus vielem, was einer aus Verzweiflung vorbrachte, hörte manch anderer »Mahlzeit« heraus.
Nur ist nicht immer klar, was ein Tier meint, wenn es etwas sagt; schon beim Menschen ist nicht eindeutig, was er mit seinem Reden meint. Insofern bieten auch Tiere Interpreten ein akademisches Auskommen. Der Rabe von Edgar Allan Poe blieb geheimnisvoll mit seinem »never more«, indem er nur dies und dies dafür in einem einzigen Gedicht gleich achtmal sagte »Nimmer mehr«.
Sie, die sich mit der Sprache einließen, erfuhren, wie doppeldeutig und nichtsbedeutend Worte sein können. Auch Tiere befiel Sprachskepsis. Das begann damit, daß sie mit den Worten, die sie benutzten, spielten. Dies durfte die kleine Alice mit Spaß und Erstaunen zur Kenntnis nehmen, nachdem sie einem weißen Kaninchen durch einen Kaninchenbau nachgekrochen war. In ihrem Wunderland betrieb der Schnapphase eine eigne Logik. Die Haselmaus mahnte, daß es bei einer Karamelmühle drauf ankommt, ob einer »radlos« oder »ratlos« ist. Wie umfassend eine schulische Ausbildung in Sprache sein kann, davon wußte die falsche Suppenschildkröte zu erzählen, die »Deutsch und alle Unterarten« lernte: »Schönschweifen, Rechtspeibung, Sprachelbeere, und Hausversatz«, nicht zu reden von der »Erdbeerkunde mit und ohne Schlagrahm und der Seeographie«.
L. Simonneau der Jüngere, ›Physiognomie des Ziegenbocks nach Le Brun‹, vor 1727
Dank der Vermenschlichung benahmen sich die Tiere wie vernunftbegabte Wesen, und sei es nur, daß sie zu lügen begannen.
Ein anonymer chinesischer Autor aus dem vierten Jahrhundert kennt in seiner Heimat eine wundersame Region, die Südwestwildnis. Dort wächst das Zuckerrohr bis dreihundert Meter, und dort lebt das »liegende Tier«, einem Riesen-Kaninchen nicht unähnlich. Wenn dieses »West« sagt, meint es »Ost«, sagt es »schlecht«, meint es »gut«. Sein Fleisch ist köstlich, wer davon genießt, kann nur noch lügen. Es sollen nicht zuletzt Politiker sein, die auf solche Delikatessen versessen sind.
Nachdem die Tiere einmal draufgekommen waren, daß ein Vokabular als Mimikri schützt und die Grammatik den Hakenschlag erlaubt, probierten sie das Lügen aus. Angefangen beim Aufschneiden und Flunkern.
Da hängt sich ein Esel ein Löwenfell um und versucht die Tierwelt mit seinem Gebrüll zu erschrecken, er verrät sich mit »IA-IA«. Und ein Affe trumpft vor einem Delphin auf, indem er sich der Bekanntschaft mit Piräus rühmt, weil er annimmt, was in Wirklichkeit ein Hafen ist, sei ein Mensch.
Einzelne übten sich darin, aus purer Boshaftigkeit mit Lust an Schadenfreude die Unwahrheit zu sagen. Wie die Ziege, von der die Brüder Grimm berichten. Auf der Wiese stöhnt sie: »Ich bin satt/ich mag kein Blatt«; zuhause jedoch meckert sie, sie habe nichts zu fressen gekriegt, so daß der Vater, ein braver Schneider, einen Sohn nach dem andern verjagt, bis die Ziege dem Vater den gleichen Streich besorgt.
Vor lauter Erfinden wurde das Tier zum erzählenden Poeten, die Literatur als Notlüge benutzend. Das jedenfalls tat in Seldwyla das Kätzchen, das Gottfried Keller »Spiegel« nannte. Diese Katze hängte ihrer verstorbenen Herrin eine Affäre an: die habe ihre Liebe gerade dadurch verloren, indem sie den Geliebten auf die Probe stellte, geblieben sei ein Geldschatz. Dessen Versteck verrät Spiegel an den Hexenmeister, dem er ansonsten laut Vertrag seinen Schmer, d.h. sein Fett, überlassen müßte. Das Kätzchen lügt mit solcher Anschaulichkeit miau, daß ihm das Fell nicht abgezogen wird.
Als vernunftbegabte Wesen logen die Tiere nicht nur, sie bekundeten auch Absicht und Wille, ihr Zusammenleben zu regeln.
Nun organisieren einige Arten schon von Natur aus ihr Kollektiv, daß man angesichts der Arbeitsteilung und der Hierarchien von einem Staat zu sprechen geneigt ist. Wie bei den Bienen. Die stellten sich ohne Zögern ein, als John Day 1608 zum ›Parliament of Bees‹ aufbot. »With their proper characters« erscheinen sie: der verachtete Soldat und der verachtete Dichter, der Zechbruder wie die sparsame und die leidenschaftliche Biene, der Wucherer wie der Quacksalber. Unter dem Vorsitz des Prorex Meister Biene diskutieren sie in Versdialogen ihre Taten und ihre Herkunft, ihre Kriege und ihre Sympathien, und am Ende werden die Bösewichte bestraft, die Wespen, die Hummeln und die Drohnen.
Wie der Bienenstock anfällig ist für Korruption, so der Ameisenhaufen. Doch schon tritt der Einzelkämpfer auf. Von einer solchen ›Ant in the Office‹ weiß John Gay 1727 zu berichten, zu der Zeit, als er an der ›Beggar’s Opera‹ arbeitete: eine Ameise versucht in der Ameisenverwaltung Ordnung zu schaffen. Der Autor hält in seinen Fabeln, die er an Prinz William addressiert, gleich anfangs fest: »But then you think my fable bears/allusion too to State affairs./I grant it does.«
Gemeinsame vitale Interessen ergeben sich nicht nur für Ameisen und Bienen, die in einem durchorganisierten Staat ihre Existenz verbringen. Die Vögel, ob einzeln lebend oder im Schwarm, bewiesen einen auffallenden »Bürgersinn« und stellten sich mit Debattierfreude den Forderungen der Zeit, deren Tagesordnung recht unterschiedlich ausfiel.
Im ›Parliament of Fowls‹, über das Geoffrey Chaucer um 1380 ein Traum-Protokoll führte, bevor er sich an die ›Canterbury Tales‹ machte, geht’s den Vögel um nichts Geringeres als um Minne und Sex. Die Vögel versammeln sich an St. Valentin, an dem Tag, an dem jeder gewöhnlich auf Partnersuche geht. Statt loszufliegen, treffen sie sich zu einer Grundsatzdebatte. In der Vollversammlung stehen sich mit den höheren und niedrigeren Vögeln zwei Konzeptionen von Liebesbeziehungen gegenüber. Das Adlerweibchen vertritt in Übereinstimmung mit der christlichen Unterweisung eine unsinnliche Liebe, jedenfalls eine, die vergeistigt ist. Doch meldet sich die Gans zu Wort, eine Vorläuferin des britischen »common sense«: in Fragen der Paarung überlasse man sich am besten ohne große Worte dem Naturtrieb.
Nicht alle Vögel stützen sich aufs Neue Testament, wenn Prinzipielles zur Debatte steht. Die Vögel zum Beispiel nicht, die Attar (wohl um 1177) zu einer Versammlung einlud, deren Konferenzsprache persisch war. Farid ud-Din Attar, einer Familie von Parfumherstellern entstammend, soll einen Großteil seiner Verse in seinem Drugstore verfaßt haben. Als Sufi, als Mystiker, der seinen eigenen Weg zu Gott sucht, kam er unvermeidlich in Konflikt mit der Orthodoxie, in seinem Falle der islamischen.
Aus aller Welt folgten die Vögel seinem Aufruf. Es war nicht das erste Mal, daß diese sich einen König wünschten. Als es in der griechischen Antike schon einmal so weit war, putzten sich alle Vögel heraus für ein kandidatenwürdiges Erscheinungsbild. Die Krähe hingegen stahl den andern Federn und präsentierte sich bunter als alle Konkurrentinnen und Konkurrenten zusammen, die Wahlplakate am eignen Leib tragend. Beinahe hätte die Krähe die Zustimmung der obersten Instanz, des Olymps, erlangt. Doch die Vögel pickten der Krähe die fremden Federn weg, mit denen die sich geschmückt hatte; in alter Häßlichkeit hatte sie abzudanken, ehe sie gewählt worden war. Bei diesem Skandal handelte es sich nicht im strengen Sinne um eine Wahl, sondern um ein Vorschlagsrecht. An Zeus hatten sich auch die Frösche gewandt, als sie sich einen König wünschten. Der Göttervater warf ihnen ein Stück Holz in den Teich, das sie erschreckte, aber das sie nicht als Herrscher akzeptierten, daher forderten sie einen andern König, worauf Zeus ihnen den Storch schickte. Doch kam es daneben zu durchaus veritablen Wahlen mit Propagandareden und Stimmenzählen, wie zu jener Wahlversammlung, an welcher der Affe zum König gewählt wurde. Der Primat siegte, weil er am »schönsten tanzte«; man muß das griechische »sehr gut« tanzen zeitgemäß übersetzen mit »telegen«.
Den Vögeln, die im zwölften Jahrhundert dem Aufruf des Persers folgten, wird Überraschendes kundgetan. Der Wiedehopf, durch den der Autor spricht, verkündet, daß nur ein Kandidat in Frage kommt: Simurgh hinter den sieben Tälern. Die Reise dorthin ist beschwerlich. Attar selber hatte als junger Mann seine Heimatstadt Nishapur verlassen und war auf religiöse Wanderschaft gegangen. In seinem ›Buch der Leiden‹ macht sich die Seele auf zum »Meer der Seelen«. Als Attar Heiligen-Biographien zusammenstellte, berief er sich neben dem Koran und anderen überlieferten Schriften auch auf die mündlichen Weisheiten von Wanderpredigern – der Ratsuchende, der Rat auf Wanderschaft sucht.
In Aussicht eines mühsamen Fluges erfinden die Vögel Ausreden, »jeder nach seiner Art«: Warum sollte der Lämmergeier einen König begehren, da er als Beherrscher sich selber genügt, und weshalb sollte der Falke seinen irdischen König aufgeben, dem er dient und der für ihn sorgt. Das Rebhuhn verzichtet nicht auf den Berg, in dem Edelsteine verborgen, und der Uhu nicht auf die Ruinen, in denen Schätze vergraben sind. Die Ente gibt ihr Element, das Wasser, nicht auf, und der Reiher nicht die Lagune, wo er zuhause ist. Der Pfau tauscht sein irdisches Paradies nicht gegen ein himmlisches, und der Papagei sehnt sich nach Unsterblichkeit und nicht nach Gott. Die Nachtigall trennt sich nicht von der Rose, die sie liebt, und der Sperling meint mit Kleinmut, eine solche Reise übersteige seine Kräfte.
Nach einem Hin und Her von Vorbehalten brechen die Vögel auf. Da sie eine allegorische Reise antreten, tragen die Täler symbolische Namen: Vom »Tal der Suche« geht es zu dem der »Liebe« und dem der »Erkenntnis«, dahinter liegen die Täler der »Einheit« und der »Verwirrung«, bis sie ins »Tal der Selbstaufgabe und Entsagung« gelangen. Bei jedem dieser Täler melden Vögel Bedenken an. Und jedesmal antwortet ihnen der Wiedehopf mit Geschichten und Anekdoten. Für einmal werden nicht dem Menschen Tiergeschichten zur Belehrung geboten, sondern den Tieren Menschengeschichten als besinnliche Beispiele vorgeführt. Dabei kommt Attar nicht ohne das Paradox aus, das sich einstellt, wenn Unsagbares gesagt werden soll: »Blind sahen sie sich, und sie hörten sich mit tauben Ohren.«
»Am Ende kam nur ein kleiner Teil dieser großen Gesellschaft am erhabenen Ort an. Von diesen Tausenden von Vögeln waren fast alle verschwunden. Viele waren im Ozean verloren gegangen, andere waren vom Durst gequält auf den Gipfeln der hohen Berge umgekommen; wieder andern hatte das Feuer der Sonne die Flügel verbrannt und das Herz ausgetrocknet; andere wurden von Tigern und Panthern verschlungen. Manche starben vor Erschöpfung in der Wüste und der Wildnis, ihre Lippen ausgedörrt und ihre Körper von der Hitze besiegt. Manche wurden verrückt und töteten einander wegen eines Gerstenkorns. Andere, durch die Leiden und Anstrengungen der Reise geschwächt, fielen auf der Straße nieder, unfähig weiterzugehen; einige, verwirrt von den Dingen, die sie unterwegs sahen, blieben bestürzt stehen, wo sie waren, und viele, die aus Neugierde oder zum Vergnügen sich auf diese Reise begeben hatten, kamen um, ohne jede Vorstellung davon, worin das Ziel ihrer Suche bestand.«
Nur dreißig erreichen ihr Ziel. Wie aber soll sich ihr Kandidat zum König wählen lassen, da er dies bereits ist, wie es Gott oder die Wahrheit gibt, unabhängig davon, ob sich die Vögel oder die Menschen dafür entscheiden. Simurgh heißt soviel wie »Dreißig Vögel«, und wenn sich »Simurgh Dreißig Vögel« am Ende den dreißig Vögeln offenbart, erkennen diese, daß Selbstaufgabe und Selbstfindung ein und dasselbe sind: es war eine Reise nach Innen.
Irdischer ging es in der Vogelversammlung zu, von der Cyrano de Bergerac erzählt, obgleich sie nicht auf der Erde, sondern auf der Sonne stattfand. Dieses Gestirn suchte der Franzose auf, nachdem er bereits seine erste Reise und damit seine erste »histoire comique« hinter sich hatte, die Fahrt auf den Mond, und dies dank einer Rakete, bei deren Konstruktion ihm wahrscheinlich ein antiker Kollege wie Lukian geholfen hat. Von diesen Reisen erfuhr man erst postum (1657/1662). Solche Abenteuer überraschen kaum bei einem Haudegen und Raufbold wie Cyrano so wenig wie die Tatsache, daß dieser Kämpfer gegen Autoritäten sich im Weltall nach Freiheiten umsah. Seine Nase war so lang, daß er sie überall hineinsteckte. Auf der Sonne jedenfalls stieß sie auf einen Idealstaat der Vögel. Dort regiert nicht der Stärkste, sondern der Schwächste, und nur auf befristete Zeit, damals gerade eine Taube: »Deren Gemüt war so friedfertig, daß man kürzlich, als zwei Spatzen ausgesöhnt werden sollten, alle Mühe hatte, der Taube begreiflich zu machen, was Feindschaft ist.« Doch diese Vögel dulden keinen Eindringling und schon gar nicht Menschen. Zwar ist nicht offensichtlich, ob Cyrano ein Mensch ist, zumal er sich in Notwehr als Affe ausgibt. Doch die Verdachtsmomente lasten schwer, wenn der Staatsanwalt, das Rebhuhn, Klage erhebt: »Dieses Wesen lacht wie ein Irrer, weint wie ein Dummkopf, ist ein unverfrorener Lügner, putzt seine Nase auf niedrige Art, ist gefedert wie ein Räudiger, zudem hängt ihm der Schwanz nicht hinten herunter, sondern vorn, und er betreibt schwarze Magie, jeden Morgen hebt er Nase, Augen und Schnabel empor, drückt Handfläche gegen Handfläche, die Fingerspitzen himmelwärts gerichtet, er bricht sich die Knie und läßt sich auf die Schenkel nieder, murmelt irgendwelche Zauberworte, fügt hinterher die Beine wieder zu einem Ganzen, erhebt sich und ist fröhlich wie zuvor.« In diesem Strafprozeß mit Elstern, Hühnern und Staren als Richtern, Anwälten und Räten wird Cyrano, des Menschseins überführt, zum Tod verurteilt: Fliegen sollen ihn auffressen. Doch in letzter Minute rettet ihn ein Papagei, dem er einst auf Erden das Käfigtürchen aufgetan. Cyrano entgeht damit einem noch schlimmeren Tod. So ideal der Vogelstaat sich mit seiner Gleichberechtigung ausnimmt, man muß auch hier mit Übeltätern rechnen. Die grausamste Strafe ist der »traurige Tod«: Der Verurteilte wird auf einer Zypresse ausgesetzt, und um ihn scharen sich lauter Vögel, die tragische Lieder singen, und dies non-stop, tieftraurige Lieder, die in Brust und Bauch gehen, derart, »daß die Bitterkeit des Kummers dem Verurteilten die Ökonomie seiner Eingeweide durcheinanderbringt und ihm aufs Herz drückt, bis er sich zusehends selber verzehrt, um am Ende an seiner Traurigkeit zu ersticken.«
Daß Vögel mit ihrem Bürgersinn hellhörig sind für politische Missionen, dessen war sich bereits Aristophanes bewußt. Er hatte in der Manier der alt-attischen Komödie den tierischen Mummenschanz geliebt. Er stattete den einen Chor mit Stacheln aus, welche die Sänger als Wespen charakterisierten. Oder er ließ einen andern Chor als Frösche auftreten, so daß die Choreuten in ihren Standliedern nüanciertes Quaken vortrugen: »Brekekekex. Koax. Koax. Brekekekex. Koax. Koax. Brüder im Sumpf und Bach, laßt uns im Flüsterton feierlich unser Lied anstimmen. Süß, melodisch. Koax. Koax.«
Mit der politischen Disponibilität der Vögel spielend, inszenierte Aristophanes seine Aussteiger-Geschichte. Zwei Athener, der Prozeßwut und der Streitlust ihrer Vaterstadt überdrüssig, sehen sich nach einer geruhsameren Niederlassung um. Mit Hilfe eines Wiedehopfs als Vermittler überreden sie die Vögel, einen Idealstaat zu gründen, die Wolkenkuckucksburg. Zur ideologischen Legitimierung berufen sich diese auf die einstige Weltherrschaft, deren sie verlustig gingen. Die Vögel machen sich auch gleich daran, ihre Stadt zu befestigen: »wie Babylon, rund mit Mauern umziehn, kolossal aus gebackenen Quadern«. Der Mauerbau dürfte das erste historische Beispiel sein für die Sperrung von Luftraum, was erwartungsgemäß eine himmlische Krise auslöst. Die Götter, alarmiert, schicken einen diplomatischen Vertreter, da durch die usurpatorische Luftsperre die Zufuhr von Opferfleisch nach dem Olymp gestoppt wurde.
Es stellen sich aber auch schon die ersten Erdbewohner ein, ein Priester, willens, die Vögel als Olympier zu verehren, und ein »honigsüßengesangausströmender« langhaariger Dichter, der bereits engagierte Oden auf den Vogelstaat verfaßt; die beiden werden weggeprügelt wie der Wahrsager, der Luftvermesser und der Rechtsverdreher. Doch der Ruhm der »weltberühmten Luftstadt« ist nicht aufzuhalten; überall wird »alles umgevogelt und vogeltümlich«. Als Erfolg dieses Trends annonciert ein Herold: »Es kommen mehr als zehntausend gleich dort unten ’rauf, die wollen modische Klau’n und Flügel. Schafft drum Federn an für all die Kolonisten.« Der Slogan ist zum Credo geworden: »Nichts ist schöner, nichts bequemer, als geflügelt zu sein.«
Es heißt, keine Krähe hacke einer andern ein Auge aus. Daraus darf man nicht schließen, daß Geflügeltes Geflügeltes schont. Insektenflügel, durchsichtig und zart, sind nicht tabu, und für Raubvögel geben kleine Singvögel eine leckere Nahrung ab. Die Greifvögel haben dementsprechend ihren Kropf eingerichtet: sie ballen in ihm die unverdaubaren Federn und Haare zu einem Klumpen und erbrechen ihn als »Gewöll«. »Alle Kinder Gottes haben Flügel« titelte Eugene O’Neill 1924 eines seiner Theaterstücke: er führte vor, wie die Liebe eines Negers zu einer Weißen an rassistischen Vorurteilen scheitert, obgleich beide Gottes Kinder sind. So wenig die Gemeinsamkeit von Flügeln Sicherheit garantiert, so wenig das gemeinsame Merkmal Flossen. Wie in der Luft und auf dem Boden gilt auch im Wasser, daß die Großen die Kleinen fressen. Insofern brachten die Tiere beste Voraussetzungen mit für ihre Vermenschlichung.
Wenn sich innerhalb der eigenen Gattung Existenz- und Überlebensprobleme ergeben, wie erst recht angesichts der Gesamt-Fauna.
Daß zuerst das Fressen kommt und dann die Moral, mit diesem menschlichen Glaubenssatz konnten sich die Tiere durchaus anfreunden. Sie fraßen allerdings nicht drauflos, sondern übten bei der Wahl ihrer Nahrung ein Selbstbestimmungsrecht aus. Mindestens die nordamerikanischen Tiere, die im Stammesbereich der Menomini-Indianer lebten:
»Also begannen der Hase und die Schleiereule. Der erste wiederholte nur ›Wabon‹, ›Wabon‹ (Licht, Licht), und die Schleiereule leierte nichts als ›Unitipaqkot‹, ›Unitipaqkot‹ (Nacht, Nacht) herunter. Falls einer das Wort des andern benutzte, hatte er verloren. Es war die Eule, die aufgeben mußte, denn sie hatte ›Wabon‹, ›Wabon‹ gesagt. Es war am Hasen, die erste Entscheidung zu treffen; er sprach sich zugunsten des Lichts, d.h. des Tages aus, doch ließ er gegenüber dem Besiegten Gnade walten und auch ein wenig Unitipaqkot gelten, nämlich Nacht. Auf diese Weise waren beide zufrieden und einigten sich darauf, daß die Tiere selber ihre Nahrungsmöglichkeiten auswählten. Der Hase fragte Owasse, den Bären, wie es sich bei ihm damit verhält. Der Bär entschied sich für Eicheln und Früchte. Danach traf der Hase den ›Falkenfisch‹, der war willens, zu fressen, was auf dem Grund des Wassers lebt. Da intervenierte der Schildfisch: ›Du wirst mich nur fressen, sofern du der Stärkere bist, doch das werden wir noch sehen.‹ Der Schildfisch verkroch sich in der Tiefe des Wassers, wo ihn sein Gegner nicht ausfindig machte. Da erhob sich ein Vogel in die Luft, genau über der Stelle, wo sich der Fisch versteckt hatte. Dieser erschrak wegen des Schattens, meinte, das habe mit Zauberei zu tun, und schwamm vorsichtig an die Oberfläche. Das war exakt, was der Vogel beabsichtigt hatte; er stürzte sich auf den Schildfisch, packte ihn mit den Krallen, trug ihn fort und verspeiste ihn. Der Wolf entschied sich dafür, den Hirsch zu fressen. Doch der Hirsch replizierte: ›Du wirst mich nicht fressen, ich laufe rascher.‹ Als es drauf ankam, holte der Wolf den Hirsch ein. Da entschied sich ein anderer Hirsch dafür, Indianer zu essen. Als ein Indianer auf die Jagd ging, pirschte sich der Hirsch an seine Nahrung heran, doch der Indianer war mit Bogen und Pfeil schneller. Der Schatten des erlegten Hirsches floh zu den andern Tieren zurück, um zu berichten, was vorgefallen war. Der Hase wiederholte seine frühere Mahnung, daß der Indianer zu stark sei, als daß ihn ein Hirsch fressen könnte, und er riet dem Hirsch, sich mehr an Blätter und Gräser zu halten. Wonach die Aufteilung der Nahrung unter den Tieren weiterging.«
Angesichts solcher Freßlust erinnerten sich die Bibelkundigen unter den Tieren nicht ungern des Paradieses. Im Ersten Buch Moses, in dem der Schöpfungsakt bekundet wird, ist aber nirgends von friedlichem Zusammenleben die Rede. Dort wird lediglich rapportiert, wie Gott die Tiere zu Wasser, zu Land und in der Luft erschuf und wie er sie Adam, dem Menschen, anvertraute. Mit der Nutzungserlaubnis wurde die erste Fleischerlizenz und der erste Jagdschein ausgestellt. Ein Zur-Verfügung-stellen, das zur Zeit der Hochindustrialisierung Tierfabrikanten als Freipaß nehmen.
Erst der Prophet Jesaias entwarf ein detailliertes Bild: »Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben … und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhle der Natter.« Der idyllische Anfang der Menschheitsgeschichte ist die Erfindung einer späteren Zeit. Jesaias verkündet ein kommendes Reich, das mit der Herankunft des Messias verwirklicht wird. Geradezu ketzerisch bringt der Prophet mit seinem Endreichentwurf an der ursprünglichen Konzeption Korrekturen an. Daß die wilden Tiere die zahmen fressen, geht nicht auf das Schuldkonto des Menschen, sondern auf das des Schöpfers. Ohne sich viel über die täglich notwendige Eiweißzufuhr auszulassen, zwingt der Prophet im Sinne einer umfassenden Toleranz die fleischfressenden Tiere, auf vegetarische Nahrung umzustellen: »Und Löwen werden Stroh fressen wie Rinder.«
Sehnsucht nach Weltfrieden ruft unweigerlich falsche Propheten auf den Plan. Dem Hühnervogel, der auf dem Baum sitzt, überbringt der Fuchs die sensationelle Neuigkeit, von Stund ab herrsche zwischen den Tieren ewige Freundschaft, er könne unbesorgt vom Baum herunterkommen zum Bruderkuß. Doch wie der Hühnervogel den Fuchs darauf aufmerksam macht, daß sich Hunde im Lauf nähern, rennt der Fuchs davon: was, wenn die Jagdhunde noch nicht darüber informiert sind, daß der ewige Friede ausgebrochen ist?
Bevor das Endreich kommt, gilt auch für die Tiere, sich in der real existierenden Welt einzurichten. Hier wird nicht »Hosiannah« gesungen, sondern »Fuchs, du hast die Gans gestohlen« und »Jäger, geh das Füchslein holen«.
Die Tiere mußten zur Kenntnis nehmen, daß neben Propheten gewöhnliche Sterbliche paradiesische Vorstellungen haben. Nach der Vertreibung aus dem Garten Eden wurden die Menschen dazu verurteilt, im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot zu verdienen. Seither wurde viel geschwitzt beim Ausdenken darüber, wie man solchen Schweiß vermeiden könnte, wobei die verführerische Möglichkeit lockte, andere für einen schwitzen zu lassen. Einige erträumten sich Lustländer, wo der, welcher nichts tut, belohnt, und der, welcher arbeitet, bestraft wird: Arbeitslosigkeit als Staatsmaxime. Nicht alle, die zu einem solchen Schlaraffenland aufbrachen, sind dort angekommen. Die jedenfalls nicht, welche 1494 Sebastian Brants ›Narrenschiff‹ bestiegen: »Gesellen folgt uns unverwandt./Wir fahren ins Schlaraffenland./Und stecken doch in Schlamm und Sand.«
Verständlich, daß Hungrige von einem Land träumten, wo es genug zu essen gibt, so viel, daß die Todsünde Völlerei zum obersten Gebot wird. Wie immer dieses Land heißen mochte, ob Schlaraffenland oder Lubberland, ob Cocagne oder Cucania, die Traumländer entsprachen nationalen Gelüsten: wo Deutsche vom vollen Bauch schwärmten, waren die Zäune aus Würsten gefertigt, und die Semmel dazu wuchsen an Bäumen; die Franzosen kriegten zum Gansbraten eine weiße Knoblauchsauce serviert; und wo Italiener schlemmten, spuckte ein Küchenvulkan Nudeln aus, die sich beim Herabrollen an den Hängen mit Käse überzogen.
Daß in einem solchen Land Milch und Honig fließt, daß aus Brunnen süßer Wein sprudelt, mochte den Tieren ebenso recht und billig sein, wie wenn ein König beim Furzen Marzipan von sich gibt. Schön, daß der Himmel voll Geigen hängt. Was aber sollen Tauben von einem Himmel halten, von dem gebratene Tauben fallen? Und was die Kapaunen, welche anstelle der Tauben tischgerecht herumflattern, und was die Lerchen, welche zur Abwechslung des Speisezettels Tauben und Kapaune ersetzen? In den Flüssen Fische, gebraten oder gesotten. Auf dem Markt Hühner, die sich von selber am Spieß drehen. Und in allen Straßen und Gassen gegrillte Schweine, denen griffbereit die Gabel im Rücken steckt.
Des einen Schlaraffenland ist nicht des andern Paradies.
Was Idealstaaten betraf, konnten sich die Tiere menschenfreundlicher erweisen, wenn man an die internationale Konferenz denkt, welche sie nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 im Hochhaus der Tiere abhielten. Nach dem Zeugnis von Erich Kästner taten sie dies im Interesse und zum Wohlwollen der Kinder: Nie mehr Krieg, und an den Grenzen sollten die Barrieren niedergerissen werden. Da jedoch die Politiker sich um Kinderwünsche nicht kümmerten, entführten die Tiere die Kinder auf eine Insel. Idealisten wurden zu Kidnappern, die ihren Bekennerbrief an die Weltöffentlichkeit richteten. Wenn sie nicht zu Terroristen wurden, dann nur, weil die Politiker Eltern waren und die Eltern utopisch erpreßbar: »Es brach ein solcher Jubel auf der Erde aus, daß sich die Erdachse um einen halben Zentimeter verbog.«
Es sollte sich allerdings recht bald herausstellen, daß die Tiere besser in ihrem eigenen Interesse internationale Konferenzen abhalten, auch wenn es für einige zu spät ist, da die Tagesordnung jeden Tag um die Tiere länger wird, welche verschwinden oder vernichtet werden.
Soweit die Tiere zoa politika geworden waren und sich für eine weltweite Friedensordnung der Fauna einsetzten, bildeten sie nicht mehr bloß Gattung, Art und Familie, sondern Parteien, Fraktionen und Interessenklüngel.
Den Hasen, welche in der Antike Volksreden schwangen und für die Gleichheit aller eintraten, hielten die Löwen entgegen: Euren Argumenten fehlen die Klauen und Zähne, wie sie unsere Argumente haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg prägten auf der Tierfarm von George Orwell die Schweine einen Glaubenssatz, den kein Chef-Ideologe zwingender formulierte: Alle Tiere sind gleich, aber einige sind gleicher.
Nachdem die Tiere sich wie vernunftbegabte Wesen benahmen, gingen sie nicht mehr bloß wegen Nahrungssuche auf die Jagd, sondern organisierten sie Kriege:
Da drangen zum Beispiel auf dem tibetanischen Hochland die Affen ins Grasbergland ein und fraßen den Vögeln Blumen und Goldpilze weg, so daß das weiße Waldhuhn die Invasoren zur Rede stellte. Bei den Okkupationsverhandlungen meinte einer der Affen zum Thema Bodenbesitz: »Allgemeine Felder durch einzelne beanspruchen zu lassen, führt zu Streitigkeiten.« In der Krisensitzung entspann sich unweigerlich ein Generationenkonflikt, als ein oppositioneller Jungaffe aufbegehrt: »Ihr alten Affen habt das konfuse Alter erreicht, und aus dem Mund eines Konfusen kommen nur konfuse Reden. Die Maßvollen und Mutlosen irren sich.«
Mit der Politisierung des Tierbewußtseins wurden Hoffnungen geweckt, auch die, daß die Schwächeren sich gegen die Stärkeren zu behaupten vermögen.
Katze und Maus machen einen Boxkampf, Adler spielt Schiedsrichter. Altägyptisches Relief
Es waren immer wieder Mäuse, die ihren mausgrauen Davidtraum träumten. Jedenfalls zogen sie in den Katzen- und-Mäuse-Krieg, den Theodoros Prodomos in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts auslöste. Sie hätten den Krieg des byzantinischen Autors verloren, hätte sich nicht im letzten Moment ein Balken von der Decke gelöst, der die Katze erschlug. »Deus ex machina« hieß in Ost-Rom, was Hollywood später ein »happy end« nannte.
Kurz vor dem byzantinischen Katzen-Mäuse-Krieg war einer in Persien ausgebrochen, wie Obeid Zakani erzählt, und wenige Jahrzehnte danach sammelten sich deutsche Mäuse, um gegen deutsche Katzen ins Feld zu ziehen. Lange vor diesen Kriegen, in der neunzehnten Dynastie, 1400 Jahre v. Chr., hatten Mäuse in Ägypten bereits eine Katzenburg berannt.
Der Kampf findet bis in die Fernsehtage unseres Jahrhunderts statt, auch dort, wo er individuell ausgetragen wird. Tom, der Kater, will nichts anderes, als die Maus Jerry fressen. Und Jerry will nichts anderes, als nicht gefressen werden, schon gar nicht als Sandwich mit Ketchup. Daher bleibt der Maus nur übrig, aus Schwäche List zu machen und dem Kater jene Schnippchen zu schlagen, die ihr die Existenz bis zur nächsten Folge der Serie garantieren – nicht nur der Machart nach ein Trickfilm.
Den Tieren ergeht es wie den Menschen. Sprache hin oder her, sie kommen auf dem Bildschirm leichter davon.
Mensch und Tier teilen das gleiche Geschick« hatte Salomon gesungen; er hatte dies gut gemeint.
Der israelitische König war der erste Naturlyriker und Fabelerzähler des Alten Testamentes: »Er dichtete von den Tieren des Landes, von Vögeln, vom Gewürm und von Fischen.« In seinen ›Sprüchen‹ empfiehlt er die Ameise als emsiges Vorbild fürs Wirtschaften. Nach der Legende, die ihn auch zu Sulayman Ibn Daud werden ließ, holte er bei der Eule statistische Information. Auf seine Frage, ob es mehr Männer oder Frauen gebe, antwortete diese, ohne Fragebogen zu konsultieren: »Mehr Frauen.« Die Eule zählte zur Anzahl der Frauen auch die der Männer hinzu, die Frauen hörig sind.
Im biblischen Kontext konnte »gleiches Geschick« heißen: Beschließt Gott die Menschen zu vernichten, ertränkt er die Tiere mit, selbst wenn er sie am Ende paarweise vor der Flut rettet. Aber im Feuerregen von Sodom und Gomorrah verbrannten die Tiere. Gleiches Geschick führte zu Kollektivschuld und Holocaust, obwohl weder Rüde noch Kater die männlichen Boten des Herrn begehrt hatten.
Gegen solch göttliche Willkür im Umgang mit Gerechtigkeit rebellierte ein Rabe. Er kam von »Hinter den Bergen«, aus »Trás-os Montes«, woher auch sein Text-Autor stammt, Miguel Torga. Nach vierzig Tagen hatte der Rabe Vicente von der Arche genug und flüchtete; er suchte festen Boden und fand als letzten Zufluchtsort die Spitze des Berges Ararat. Von dort aus erhob er seine krächzende Stimme gegen Gott und seinen von Wolken verhangenen Himmel:
»Noah und die übrigen Tiere wohnten wortlos dem Zweikampf zwischen Vicente und Gott bei. Und im klaren oder vernebelten Geist eines jeden wurde nur diese Zwangswahl laut: Entweder wurde der Sockel, der Vicente trug, gerettet, und der Herr bewahrte die Größe des Schöpfungsaugenblicks – die vollständige Selbständigkeit des Geschöpfs seinem Schöpfer gegenüber –, oder, sofern die Kuppe des Stützpunkts versank, starb Vicente, und sein Untergang machte diese erhabenste Stunde wertlos. Das sinnvolle Leben war unlösbar mit dem Akt der Auflehnung verknüpft. Denn kein Bewohner der Arche empfand sich mehr am Leben. Nun waren Blut, Atmung, Lebenssaft jener schwarze Rabe, naß von Kopf bis Fuß, der, ruhig und hartnäckig auf der allerletzten Warte natürlichen Überlebens kauernd, die Allmacht herausforderte.
Dreimal beleckte eine aufschäumende Woge im letzten Ansturm die Krallen des Raben, doch dreimal wich sie zurück. Bei jeder Welle erbebte schreckhaft das von Vicentes entschlossenem Herzschlag abhängige schwache Herz der Arche. Der Tod fürchtete den Tod.
Doch kurz darauf wurde offenbar, daß der Herr nachgeben werde. Daß Er nichts vermochte gegen jenen unerschütterlichen Willen, frei zu sein.
Daß Er, um das eigene Werk zu retten, schwermütig die Schleusen des Himmels schließen mußte.«
Auch die Tiere hatten mit Gott und Göttern zu rechnen. Einige überholten dabei die Menschen, da sie nicht nur vermenschlicht, sondern vergöttlicht wurden; das erweiterte notgedrungen ihr Vokabular.
Ein vorsokratischer Aufklärer spottete: wären die Menschen Affen, hätten sie Affen als Götter. Die Inder verehrten einen Affengott, obwohl sie keine Affen sind, sondern Arier wie die Deutschen. Zwar ist Hanuman eine eher mindere, doch äußerst populäre Gottheit. Sein Auftritt ist bis heute gesichert: in indischen Comics, im javanischen Schattenspiel und im thailändischen Tanztheater. In der ›Ramayana‹ (oder in der thailändischen Variante ›Ramaykien‹) kann man es nachlesen: Prinz Rama hätte nie seine entführte Frau zurückbekommen und hätte nie den Kampf der Menschen (der Guten) gegen die Dämonen (die Bösen) gewonnen ohne das strategische Geschick des Affengottes Hanuman. Der, »ein Stier unter den Affen«, ein »mächtiger Elefant unter den Affen«, befehligte als Kriegsminister ein Heer, und der »fünfköpfige Sohn des Windes« machte einen Sprung, bei dem er sich in homerischer Manier wie »ein geflügelter Berg« ausnahm. In einem einzigen Satz sprang Hanuman von Indien nach Sri Lanka, eine Strecke, die seine Affensoldaten erst überwanden, nachdem sie ihre Furcht vor dem Meer ablegten und eine Brücke gebaut hatten.
Und Herodot, ein anderer Nicht-Barbar, entsetzte sich, als er in Ägypten Gottheiten mit Tierköpfen vorfand. Über solche Mischwesen hätte sich der Grieche nicht zu wundern brauchen, hätte er an die einheimischen Wälder gedacht, wo Pan seine Stunde hat und wo seine Gefolgskumpanen Bocksprünge machen, wenn sie sich mit den Nymphen verlustieren. Mit Bocksbeinen und Hörnern nahmen sich die Satyrn und Silene nicht anders aus als ägyptische Gottheiten: die Göttin der Liebe, Hathorn, trug die Hörner einer Kuh und Serapis die eines Widders. Allerdings gab es daneben Götter, die nicht bloß mit animalischen Versatzstücken an Tiere erinnerten, sondern veritable Tierköpfe hatten, den eines Krokodils oder wie der Gott des Todes den eines Schakals.
Nun kannten die ägyptischen Tiergottheiten durchaus menschliche Regungen. Da entzweit sich die Sonnenkatze Tefnut mit ihrem Vater und zieht sich erzürnt in den Süden nach Nubien zurück. Ein Mythos, den die Meteorologen mit dem Wechsel der Jahreszeiten enträtselten, da sich nun einmal die Sonne im Winter verbirgt.
Im Papyrus ›Mythos vom Sonnenauge‹ wird Thot, der Hundskopfaffengott ausgeschickt, um die grollende Sonnenkatze zur Rückkehr zu bewegen. Dies tut der Götterbote, indem er ihr Geschichten erzählt, die Literatur als Beruhigungsmittel einsetzend. Wie die Sonnenkatze die allzu pädagogischen Absichten heraushört und das penetrant Tendenziöse des Erzählers merkt, verwandelt sie sich in eine wütende Löwin, die den Erzähler zerreißen will. Wenn heutige Leserinnen und Leser mit gleichem künstlerischem Feingefühl reagierten und Autorinnen und Autoren solcher Belehrungsliteratur zerfleischen würden, wäre es um einiges besser bestellt mit der zeitgenössischen Literatur, und dies nicht nur in der Schweiz.
Doch am Ende gelingt dem Hundskopfaffengott, die aufgebrachte Sonnenkatze zu besänftigen, natürlich mit Geschichten und einer wie der, die seither überall nacherzählt wurde: eine Maus erbettelt sich vom Löwen Schonung und verspricht, als Schwache dem Starken sich erkenntlich zu zeigen. Eines Tages durchnagt die Maus die Fesseln, mit denen der Löwe gefangengehalten wird; in seiner Mähne versteckt kehrt sie in die Freiheit der Wüste zurück.
Die Tiere kamen aber auch zu himmlischen Rollen, ungeachtet, ob das Aussehen der Götter an Tiere erinnerte oder nicht. Kein vedischer oder hinduistischer Gott, der nicht über ein Tragtier verfügt hätte wie Büffel, Schildkröte, Schlange, Pfau oder Garuda. Genesa, der untersetzte Elefantengott, der sich der Weisheit annahm, wofür es einen Dickhäuter braucht, reitet auf einer Ratte, die wie das Rüsseltier kein Hindernis scheut und geradewegs aufs Ziel losgeht. Nur den Gott des Unglücks, den unheilbringenden Nirriti, hält kein Tier aus, den buckelt der Mensch, was man als seltene Tierliebe deuten mag.
Keines der Tragtiere war so gesprächig wie das von Kama, dem Liebesgott. Es ist ein Papagei. Ihm verdanken wir an die siebzig Geschichten, die im ›Sukasaptati‹ gesammelt wurden, im »Papageienbuch«. Als Tragtier des Liebesgottes kannte sich der Papagei in erotischen Belangen aus. Nun war die Situation auch danach. Ein Ehemann geht auf Geschäftsreise, und die Gattin, allein zurückgelassen, möchte ihre Zeit der Abstinenz mit Liebhabern ausfüllen. Daran hindert sie der Papagei, indem er Geschichten erzählt, lauter Liebesabenteuer: ›Wie sich Madanvati trotz starker Bewachung einen Liebhaber beschafft und seine Zurückhaltung überwindet‹ oder ›Wie Vaijika die Nacht mit ihrem Liebhaber verbringt und ihr Fernbleiben dem Ehemann verständlich macht‹. Der Papagei erweist sich als indischer Clausewitz in Sachen erotischer Strategie und Taktik; er macht der Frau klar, man solle sich erst in eine Affäre einlassen, wenn man über den entsprechenden Witz verfügt, aus ihr herauszufinden. Die Lehrexempel bietet er nach dem Prinzip »Fortsetzung folgt«, indem er die Handlung dort abbricht, wo man erfahren würde, wie sich jemand aus der Affäre zog. Die Lösung offeriert er erst am andern Morgen. So verbringt die Ehefrau die Nacht nicht mit einem Liebhaber, sondern mit einem Rätsel, was vielleicht aufs gleiche hinausläuft. Der Papagei ist auch insofern ein Kenner erotischer Literatur, als er die Aufrechterhaltung ehelicher Ordnung als Anlaß benutzt, um lüstern auszuschweifen: ›Wie der Diener Halapala die Tochter seines Herrn genießt und diesen von seiner Unschuld überzeugt‹ oder ›Wie Rukmini ihren Liebhaber vor den Augen ihres Gemahls und doch unbemerkt genießt‹. Donatien Alphonse François de Sade hätte bei dem Papagei Gunasagara in die Schule gehen können; in ›Justine und Juliette‹ schildert ›le divin Marquis‹ sexuelle Exzesse um vorzuführen, wie übel es der Tugend in einer Welt wie der unseren ergeht.
Der Papagei Gunasagara fand wie alle guten Fabulierer Nacherzähler, was unter Papageien kaum überrascht. Was auf Sanskrit wirkte, ließ sich auch in andern Sprachen vortragen. Der Papagei, der auf persisch nachredete, erzählte statt siebzig Geschichten noch deren zweiundvierzig, und dafür, daß er vor einem persischen Publikum nicht das Flair von ›Tausend und einer Nacht‹ vergaß, sorgte sein Tierhalter, der Dichter Nashabi. Dieser gab der Sammlung den Titel ›Tuti Nameh‹, der auch auf türkisch beibehalten wurde. Mit der Übertragung und Verpflanzung aus dem einen Kulturraum in einen andern änderte sich einiges. Der Dichter Qadir, der seinem Papagei türkisch beibrachte, läßt den Vogel nicht mehr nach dem Prinzip »Fortsetzung folgt« erzählen; der Papagei berichtet die ganze Geschichte, zieht diese aber in die Länge, so daß es für die Ehefrau, bereits herausgeputzt, jedesmal zu spät wird, zu ihrem potentiellen Galan zu huschen. Während der altindische Papagei ein verzauberter Mensch ist, der zum Schluß wieder Menschengestalt erlangt, ist der türkische Papagei ein veritabler Vogel, der für seinen Liebesdienst an seinem Herrn und für den Unliebesdienst an seiner Herrin die Freiheit fordert, was ihm schon aus literarischer Anerkennung zugestanden werden muß.
Verglichen mit dem fabulierenden Tragtier aus Indien waren die Begleittiere der griechischen und römischen Götter literarisch nicht ergiebig. Die Taube der Liebesgöttin Aphrodite und Venus berichtete nichts Erotisch-Gurrendes. Oder war sie einfach diskret? Und die Eule der Athene, der Vogel der Weisheit, eignete sich mehr fürs Signet als fürs Erzählen. Oder war die Eule der Philosophie schon in Athen und nicht erst in Wien überzeugt, worüber man nicht reden könne, darüber müsse man schweigen?
Auch der Adler nahm die Chance nicht wahr, obgleich er mit einem Bestseller hätte aufwarten können: »Ich war Zeus’ Adler.« Warum nicht ausbringen, wie das mit der Kopulation abläuft, wenn ein Mann sich einer Frau als Stier nähert, oder welchen Tisch- und Bettsitten Ganymed als Minderjähriger ausgeliefert war. Der Adler hätte ein Stück Enthüllungsliteratur geboten. Unbestritten hatte er täglich an der Leber von Prometheus gerissen, der an einen Felsen geschmiedet wurde, weil er dem Menschen einen Zivilisationsdienst erwiesen hatte wie den, ihm das Feuer zu schenken. Als Mitquäler und Mitmacher hätte der Adler Rechtfertigungsliteratur vorgelegt, wie sie jede Wende hervorbringt, ob politisch oder religiös.
Denn dem Adler und andern abendländischen Tieren war es eines Tages ergangen wie dem Menschen, sie wurden getauft, ohne gefragt worden zu sein. Der Adler diente von nun ab einem neuen Herrn, Johannes. Das Lamm wurde christlich-fromm. Der Fisch, soweit griechisch, diente als Kryptogramm für Christus. Der Löwe war nicht mehr länger einem Androklus dankbar, der ihm einen Dorn aus der Pfote gezogen hatte; nun war es ein Kirchenvater, der diesen Samariterdienst erwies. So liegt der Löwe bei Hieronymus in der Studierstube, die Albrecht Dürer entworfen hat, und der Löwe stört den Heiligen nicht, der damit beschäftigt ist, die Bibel aus dem Griechischen ins Lateinische zu übersetzen. Der Stier stand jetzt im Dienste des Evangelisten Lukas. Das war nicht mehr der Stier, der wegen seiner Potenz in Mesopotamien verehrt worden war. Nicht mehr ein Kalb, von denen vergoldet, die es umtanzten. Nicht mehr der Apis-Stier, dessen ägyptische Mutter ein Himmelsstrahl schwängerte und der mumifiziert wurde. Kein persischer Stier mehr, dem Mithras den Dolch in den Nacken stößt, den ein Skorpion in die Genitalien zwickt, gegen den ein Hund hochspringt, an dem eine Schlange ihren Durst stillt und aus dessen Schwanz Getreide wächst und aus dessen Blut Wein entspringt.
Manche Tiere wurden im Verlauf der Religionsgeschichte römischkatholisch. Die Gans verriet den Heiligen Martin, der sich aus Demut versteckte, weil er nicht zum Bischof gewählt werden mochte. Seither begleitet sie den Heiligen und wird an seinem Namenstag, am 11. November, aufgetischt. Die Mutter des Heiligen Bernhard von Clairvaux hatte vor ihrer Niederkunft im Traum ein weißes Hündchen gesehen, was die Geburt eines großen Predigers verhieß. Doch nicht das kläffende Hündchen wurde zum Symboltier des Propagandisten der Kreuzzüge, sondern der Bienenkorb; man muß dazu wissen, daß die Biene als Botin des Geistigen galt, ansonsten man zur fatalen Fehlinterpretation verleitet würde, wonach die Biene den Stachel der Bekehrung ins Fleisch des Ungläubigen setzt, so daß ihm der Glaube als Beule wächst.
Die Hunde kamen trotzdem zu ihrem religiösen Wächterdienst. Die Dominikaner, denen die Inquisition anvertraut wurde, richteten als »Spürhunde Gottes« die Hunde im Zwinger der Orthodoxie ab. Wie die Prediger Hunde gegen Wölfe, die Ketzer, hetzen, kann man in Florenz auf einem Fresko in der Kirche S.M. Novella sehen. Man begreift, daß damals, als der Scheiterhaufen für Häretiker etabliert wurde, ein Wolf ins Kloster ging und die Kutte nahm, wie ein Troubadour als Zeitgenosse zu singen weiß.
Nicht alle Tiere waren hartnäckig wie die Viper, die nichts von den Sprüchen und Psalmen des Alten Testamentes wissen wollte; wie hätte sie für die Gleichnisse des Neuen empfänglich sein sollen. Ihre Borstigkeit war wohl Solidarität mit jener ersten Schlange, der verheißen wurde, daß ihr eines Tages eine Jungfrau den Kopf zerschmettert. Nun besitzen Schlangen gar keine Ohren. Sollten sie deswegen kein Ohr für Frohbotschaften haben, oder haben sie sich keine Ohren zugelegt, um Evangelien erst gar nicht vernehmen zu müssen?
Schafe scheinen über ein willigeres Gemüt zu verfügen, jedenfalls jene, die in der Nähe weideten, als Balscheem sich genötigt sah, auf freiem Feld den Sabbat einzuweihen. Als er den Segen sprach, der die nahende Braut Sabbat begrüßt, erhoben sich die Schafe auf ihre Hinterfüße und blieben so, dem Meister zugewandt, bis er das Gebet vollendet hatte. »Denn solange es die Andacht des Balscheem vernahm, war jedes Geschöpf in seiner Urhaltung, wie es am Throne Gottes steht.« Aus dieser Chassidim-Geschichte läßt sich mindestens ableiten, daß die Frömmigkeit aus Vierbeinern Zweibeinern macht; die Gegenwart Gottes zwingt nicht in die Knie, sie richtet auf.
Auch die Fische hörten ohne Widerrede dem Gottesmann zu, zum Beispiel dem Heiligen Antonius, der selbst den Haien Nächstenliebe predigte, so daß diese für einmal den Rachen vor Staunen aufsperrten. Antonio Vieira, der portugiesische Stilist des siebzehnten Jahrhunderts, schlüpfte als Jesuit in die Kutte des Kapuziners Antonius, als er sich 1648 an die Fische richtete (»eine dankbare Zuhörerschaft, da stumm«). Er zielte mit seiner Rollenpredigt auf die portugiesischen Kolonialisten in Brasilien, was diese ihm heimzahlten; sie schoben ihn nach Portugal ab, sie mochten sich nicht Vorhaltungen machen lassen wie die: »Ein Skandal, daß Ihr Fische einander freßt, um so größer der Skandal, weil die großen die kleinen fressen. Umgekehrt wäre weniger schlimm. Da würde ein großer für sehr viel kleine herhalten.«
Viele waren ausersehen, aber wenige auserwählt. Die Vögel fielen unisono in den Lobgesang des Herrn ein, den Franziskus anstimmte, auch wenn zunächst einmal die Schwalbe wegen ihres Zwitschern zurechtgewiesen werden mußte. Man kennt jedoch keinen Cantus der Käfer oder Walrosse, wohl deswegen nicht, weil kein Heiliger sich je die Mühe nahm, abzuklären, welche Rolle diesen Lebewesen im Heilsplan zukommt.
Schöpfer wollen gepriesen werden. Die oberste Instanz scheint nicht ohne Legitimierung auszukommen, und die garantieren die Geschöpfe den Schöpfern. Vielleicht dient das Lob des Schöpfers dazu, ihm die Bedenken zu nehmen, die er angesichts seiner Kreation hegt, das tägliche Gebet unten gegen den täglichen Zweifel oben.
Nicht nur die Maya-Schöpfer, nicht nur der alt-testamentarische und der christliche Schöpfer wollen gepriesen werden, auch der islamische. Das kann man einer der Kaffeehausgeschichten aus ›Tausend und einer Nacht‹ entnehmen. Da lebt auf einer Insel eine Gans, die Schreckliches vom Menschen gehört hat und die schon beim Gedanken an ihn zittert. Als Menschen auf der Insel landen, wird die Gans gefangen und gebraten. Der Pfau, der sich auf einen Baum rettete, verrät dem Reh, das sich ebenfalls in Sicherheit brachte: die Gans habe solches Schicksal erlitten, weil sie das tägliche Lob des Herrn vernachlässigte. Worauf das Reh anfängt, den Schöpfer den lieben langen Tag zu loben.
Einige, die reden lernten, lernten beten. Womit die Frage nicht beantwortet ist, was passieren würde, begännen die Tiere in den Hühnerbatterien, den Rinderfabriken oder Schweinemästereien den Herrn zu loben.
Ein Tier rettet sich nicht nur, indem es den Herrn preist. Es kann davonkommen, indem es sich zum glorreichen Prediger erhebt. Das demonstrierte Mitte des 12. Jahrhunderts ein Hahn, der geschlachtet werden sollte. Der Gokkel flüchtet sich von Winkel zu Winkel und von Dach zu Dach, bis er weit oben ungreifbar thront, wo er sich auf Hiob (38,36) beruft: Gepriesen der Herr, der dem Hahn Intelligenz verlieh.
»Jetzt da ich nicht mehr der Jüngste und in eurem Dienst gealtert, jetzt nachdem meine Tage und meine Jahre schon längst gezählt sind, und da ich jetzt ein Greis bin, begleicht ihr mir Gutes mit Schlechtem und bezahlt meine Liebe mit Haß. Ihr wollt mich von meinen Söhnen trennen, mich vom Schoß meiner Frauen vertreiben, ich soll meine Töchter als Waisen und meine Frauen als Witwen zurücklassen. Stände ich noch im Saft, würde ich Eure Gelüste verstehen und nicht auf Rache sinnen. Doch mein Fleisch ist härter als Stein und würde sich kaum als Opfer für den Herrn eignen. Mein Augenlicht hat abgenommen und meine Manneskraft nachgelassen. Meine Stärke ist trocken wie ein Ziegel, meine Knochen sind im Verlauf der Zeit eisern geworden, und was ich einst an Geschmack zu bieten hatte, hat sich verflüchtigt. Wer sich von mir eine Tranche abschneidet, wird ein zähes Stück bekommen, und ich gebe im Teller nicht mehr ab als die Brühe von einem unsauberen Tier. Meine Drüsen hörten längst auf zu funktionieren, an meinen Flügeln ist wenig Fleisch dran, meine Augen verdunkelten sich und in meinen Nieren ist kaum Fett. Wie Wasser löse ich mich auf, und meine Knochen sind verrenkt. Ißt ein Kranker von mir, stirbt er noch gleichen Tags, beladen mit Sünden, ohne daß ihm noch vergeben werden könnte. Ißt ein Gesunder von mir, findet er keine Stärkung und behält seine Schlaffheit. Weshalb also zahlt ihr mir auf diese Weise heim, Euren Nachkommen ein solches Beispiel von schändlichem Tun bietend? Geben meine Söhne nicht besten Ersatz ab, eine köstliche Offerte? Denn sie sind jung, rein, lecker, saftig, jeder von ihnen lobenswert. Zart sind die Stücke, die man von ihnen abschneidet, und sie verbreiten ein Parfüm von Wohlgeschmack. Ihre Körper strotzen vor Fleisch, und sie haben Mark in den Knochen. Und erst meine Töchter. Wie bekömmlich sind sie, angenehm für jede Zunge und von jedem Herzen begehrt. Ißt ein Kranker von ihnen, wird er ohne ärztliche Hilfe gesund.«
Mit wortgewaltigem Krähen überzeugt der Hahn seine tief betroffenen Zuhörer, was er in Prosa vorbringt, trägt er auch im Gedicht vor. Dem Gockelbesitzer bleibt nichts anderes übrig, als den Hahn zu schonen. Dies berichtet der Hebro-Spanier Yehudah al-Harizi, dem es Heman al-Ezrahita erzählte.
Es soll ein Manuskript geben, allerdings verschollen, darin stellt sich der Hahn vor seine Töchter und Söhne, der Gockel macht das Nachkommen-Fleisch mies, preist die eignen saftlosen Knochen und empfiehlt seine zähen Schenkel als besonders bekömmlich und leckerbißlich.
Wenn Tiere sich schon in einen Himmel teilen müssen, den der Mensch ausgedacht, haben sie erst recht mit ihm als Erdbewohner zu rechnen.