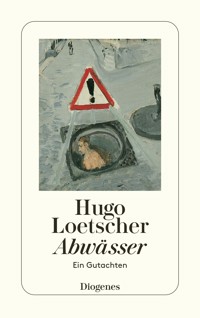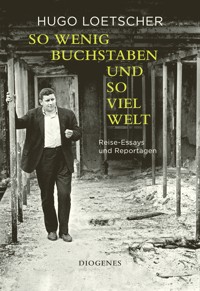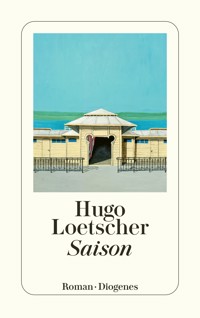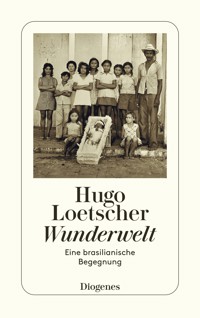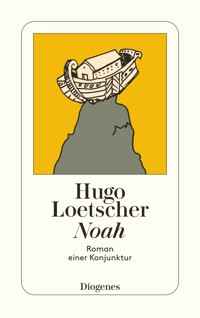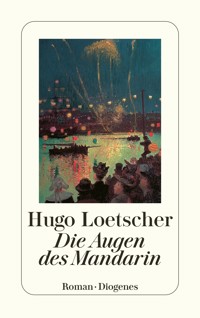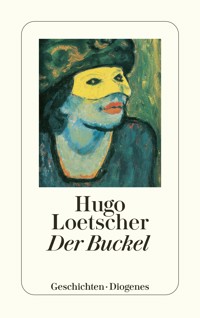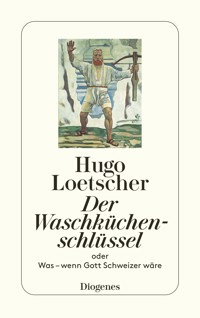11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wo andere Völker nach den Sternen greifen, fangen die Schweizer an zu klettern«, schreibt Hugo Loetscher. Doch wer liest, statt zu klettern, findet in diesem Band 17 brillante Essays zur Schweizer Literatur mit ihren bekannten und weniger bekannten Protagonisten. Hugo Loetschers nicht ganz unpersönliche Ansätze zu Max Frisch, Ludwig Hohl, Adolf Muschg, Friedrich Dürrenmatt, Niklaus Meienberg u.v.a.m. bilden ein Standardwerk zur Schweizer Literaturgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hugo Loetscher
Lesenstatt klettern
Aufsätze zurliterarischen Schweiz
Die Erstausgabe
erschien 2003 im Diogenes Verlag
Die vorliegende Ausgabe
wurde um drei Beiträge erweitert
Editorische Notiz am
Schluβ des Bandes
Umschlagillustration: Ferdinand Hodler,
›Die Dents-du-Midi von Caux aus‹,
1917 (Ausschnitt)
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23721 4 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60110 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]Inhalt
Vorwort von Jeroen Dewulf [7]
Die urbanen Platters – die andere helvetische Tradition [11]
Interview mit Albrecht von Haller [22]
Salomon Geßner und die leichte Flöte [52]
Johann Georg Zimmermann oder das Leiden an der Schweiz [73]
Jeremias Gotthelf: Käsehütte statt Schulhaus [94]
Mit Gottfried Keller im ungemütlichen Seldwyla [113]
Das Zu-Ende-Dichten – ein Zitaten-Führer durch die Verse von C. F. Meyer [137]
Zur Wiederentdeckung von C. A. Loosli [151]
Blaise Cendrars – Hommage à un »fumiste« [171]
Adrien Turel oder das formulierte »Heimweh nach der Zukunft« [175]
Friedrich Glauser – der arme Hund, der jeder von uns ist [195]
Der Lehrer der Sprache, der Anwalt der Bildung – Max Rychner [213]
[6] Konrad Farner – ungewöhnliche Stichwörter zu einem ungewöhnlichen Marxisten [222]
Ludwig Hohl und die voreiligen Herbergen [244]
Max Frisch – erschwerte Verehrung [268]
Maurice Chappaz und sein Judas-Evangelium [297]
Die Teufels-Musen von Jacques Chessex [307]
Friedrich Dürrenmatt – labyrinthische Erinnerungen [316]
Wenn Radikalitäten sich begegnen – Varlin und Dürrenmatt [410]
Im Helvetischen Chatroom [424]
Editorische Notiz [467]
[7] Vorwort
Wir werden nicht mit Wurzeln, sondern mit Füßen geboren. Sie verleihen die Freiheit, von dort wegzugehen, wo man zufälligerweise auf die Welt gekommen ist. Diese Freiheit nutzte Thomas Platter. Als Renaissance-Mensch nahm er sein eigenes Schicksal nicht nur in die eigenen Hände, sondern stellte es auch auf die eigenen Füße. Der Geißbub Platter verließ die Berge seines Heimatkantons Wallis und zog in die Stadt Basel. Mit einer Zukunft, die aus Käse, Heu und Kühen bestehen würde, konnte er sich nicht zufriedengeben; er suchte Bildung und fand sie im Humanismus.
Daß diese Entscheidung Platters einen Autor wie Hugo Loetscher einnimmt, wird nicht verwundern. Schließlich bekannte sich Loetscher im Immunen zum Credo: »Natura hominis arte facta est« – die Natur des Menschen ist aus Kunst gemacht. Damit stellt er sich gegen die Determiniertheit durch Natur und Milieu und plädiert für eine Gesellschaft, die dem Schwächeren einen gleichberechtigten Platz einräumt. Und eine solche Gesellschaft kommt ohne Bildung nicht aus.
Mit diesem Credo sucht er das wahre Leben nicht auf der Alp, entgegen einer Tradition, die den Einstieg in die Schweizer Literatur mit den Gedichten Albrecht von Hallers zu Unrecht monopolisiert hat. Einmal, weil die [8] Autobiographie Platters zweihundert Jahre vor den Versen Hallers geschrieben worden ist, andererseits auch, weil die Gegenbewegung, »vom Alpinen zum Urbanen«, ebenso Tradition hat wie die Idealisierung der Sennen. Schließlich fiel die Wahl zwischen Käsehütte oder Schulhaus, wie sie in Jeremias Gotthelfs Käserei in der Vehfreude beschrieben worden ist, in der Schweiz nicht immer zugunsten der Käsehütte aus.
Indem nun Loetscher seine Aufsätze zur Schweizer Literatur mit dem Wunsch Platters beginnt, in die Schule gehen zu dürfen, und er die idealisierenden Dichtungen Hallers erst an die zweite Stelle setzt, erscheint die schweizerische Literatur in einer anderen Perspektive, nämlich in einer, die zum Umdenken nicht nur einlädt, sondern geradezu zwingt.
Nicht ganz unpersönliche Aufsätze hat der Autor beabsichtigt. Da sind einmal solche über klassische Autoren wie Gotthelf oder Keller, daneben aber auch über andere, an deren Werk sich heute kaum noch jemand erinnert oder die bereits zu Lebzeiten ohne Erfolg geblieben sind. Doch ermöglicht gerade die Lektüre etwa eines Adrien Turel oder Konrad Farner unerwartete Einsichten, wenn es darum geht, der literarisch-intellektuellen Schweiz näherzukommen. Bezeichnend für Loetschers Bekenntnis zu Mehrsprachigkeit und Multikulturalität ist die Tatsache, daß zu seiner Schweiz selbstverständlich auch welsche Autoren gehören wie Maurice Chappaz oder Jacques Chessex; ihre Werke repräsentieren eine Religiosität, wie sie sich im deutschsprachigen Landesteil nicht im ähnlichen Maße findet und daher mehr ist als nur eine Ergänzung.
[9] Nun hat Loetscher selber eine Epoche der Schweizer Literatur mitbestimmt. Dabei entstanden persönliche Beziehungen, die seine Sicht auf Autoren seiner Generation und ihre Werke mitgeprägt haben. Die Auseinandersetzung mit einem Max Frisch, einem Friedrich Dürrenmatt oder einem Adolf Muschg mag dadurch logischerweise viel persönlicher geprägt sein; dennoch steht auch bei ihnen das Dilemma von Engagement und Ästhetik, von politischer Verantwortung versus Recht auf Kunst ebenso an zentraler Stelle wie bei Gottfried Keller und seinem Hin- und Hergerissensein zwischen dem Wahren und dem Schönen. Wie universell dieses Dilemma auch sein mag, im Falle der Schweiz äußert es sich mit Hartnäckigkeit, fast als ob das Bekenntnis zur Belletristik etwas Unziemliches hätte.
Erstaunlich ist diese Sammlung nicht zuletzt wegen der Stilvielfalt der Essays. Einmal nähert sich Loetscher den Autoren in Gestalt eines fingierten Interviews, ein andermal in Form der Erinnerung, dann wieder mittels einer Analyse des Gesamtwerkes oder einer überraschenden Begegnung in einem Helvetischen Chatroom; im Falle von Blaise Cendrars tritt er gar als dessen Gepäckträger auf.
Die Essays sind Zeugnis einer Beschäftigung mit Schweizer Literatur über Jahrzehnte; manche sind eigens für diesen Band konzipiert worden, andere erschienen bereits früher in diversen Zeitschriften oder Anthologien. Sie zeigen, daß sich der überzeugte Kosmopolit Loetscher, trotz seiner intensiven Beschäftigung mit Lateinamerika und Asien, immer wieder auch zur Literatur der Schweiz geäußert hat. Von einem Autor, der selber die Frage aufwarf, wer wohl die Schweiz entdeckt haben könnte, und sogar [10] befürchtete, seine Heimat sei vielleicht noch gar nicht richtig entdeckt worden, läßt sich auch nichts anderes erwarten. Sein Vorschlag, die Geschichte der Schweizer Literatur aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten, lädt zu einer Entdeckungsreise innerhalb der eigenen literarischen Heimat ein. Damit relativiert er vieles, was zum Mythos geworden ist.
Schon der junge Loetscher relativierte den Mythos Heimat. Er definierte sie nicht als etwas Gegebenes, sondern als etwas, das man sich fortwährend erwirbt, als etwas, das man stets für sich vergrößert und dessen Grenzen man immer wieder verschiebt. Das veranlaßte ihn auch dazu, anders über die heimatliche Literatur nachzudenken und zu dem Schluß zu kommen: Provinz ist keine Gegebenheit, sondern eine Entscheidung.
Jeroen Dewulf
[11] Die urbanen Platters – die andere helvetische Tradition
Gemeinhin lassen wir die deutschsprachige Literatur der Schweiz mit Albrecht von Hallers Gedichtband Die Alpen beginnen – aber es gäbe einen anderen Einstieg und eine andere Einsicht.
Zwar sind die Berge auch schon vor Haller bedichtet worden. Aber er war es, der ein Datum setzte. Erst 1732 erlangte die Alpendichtung dank des Berner Aristokraten literarischen Rang.
Nun waren die Alpen nicht irgendein Motiv; sie waren Bekenntnis. Modisch gesprochen: Sie waren identitätstiftend. Nicht umsonst hatte Haller, programmatisch wie entschuldigend, seine Verse »schweizerische« Gedichte genannt.
Die Bergwelt als das feierlich Ureigene – man konnte über sie ganz anderes lesen: Vom »hohen und grusamen Berg« schrieb Thomas Platter. Und das war zweihundert Jahre früher.
Thomas Platter (1499–1582), ein Walliser Geißbub, der die Bergwelt verließ, um in der Stadt seinen Wirkungsraum zu finden. Und Albrecht von Haller, der Städter, der in der Bergwelt göttliche und vaterländische Offenbarung erfuhr, der wanderte durch das Erhabene, ohne sich dort niederzulassen.
Auf der einen Seite Haller, der die Welt der Sennen [12] idyllisierte: »Wann Tugend Müh zur Lust und Armut glücklich macht… man ißt, man schläft, man liebt und danket dem Geschicke.« Auf der andern Seite Platter, der sich erinnert: »Im Sommer mußte ich im Heu liegen, im Winter auf einem Strohsack voller Wanzen und oft auch voller Läuse. So liegen gewöhnlich die armen Hirtlein, die bei den Bauern in den Einöden dienen.« Und manchmal war der Durst so groß, daß sich der Junge in die Hand pinkelte und das eigene Wasser trank. Trotz bitterarmer Jugend (»große armut von mutter lyb an«) erinnert er sich an glückliche Momente wie ans Kristall-Suchen. Aber die Alpen waren bedrohlich – »grausig der Berg«, »grausig der Fels«.
Als Jüngling hatte Platter seine Bergwelt verlassen. Er kehrte gelegentlich noch dorthin zurück. Doch es blieb beim Zwischenhalt; auch wenn er später einmal daran dachte, sich mit seiner Familie im Herkunftstal niederzulassen: Die Absicht blieb von kurzer Dauer, und dies, obwohl die Walliser Regierung ihm das Schulwesen anvertrauen wollte.
Als er seinen Heimatort Grächen zum letzten Mal aufsuchte, war er vierundsechzig, Leiter eines Internats, Rektor der Münsterschule in Basel, ein erfolgreicher Drucker und angesehener Wissenschafter. Die Wiederbegegnung bestätigte Trennung und Abschied, die schon lange vorher stattgefunden hatten. Er hatte als Knabe beim Rodeln einst geglaubt: »Ich könnte es ebenso gut wie meine Brüder.« Aber er machte, übers Rodeln hinaus, die Erfahrung: »Sie waren die Berge besser gewohnt als ich.«
Auf diesem letzten Besuch begleitete ihn sein Sohn Felix (1536–1614), seinerseits ein anerkannter Mediziner, der [13] Würde nach Basler Stadtarzt. Dieser, in der Stadt geboren, hatte Mühe mit der Familienwallfahrt ins Oberwallis. Von ihm als Studenten hatte es geheißen: »Zuerst die medizinische Ausbildung und dann eine reiche Heirat… unser ehrgeiziger Jüngling verliert diese klassischen Wege des sozialen Aufstiegs nicht aus den Augen.« Sein jüngerer Halbbruder wird für ihn die Grabinschrift entwerfen: »Aeskulap seiner Stadt und der ganzen Welt.« Felix Platter hatte andere Reiseerfahrungen gemacht als sein Vater; er hatte in Montpellier Medizin studiert und auf dem Hinritt und dem Rückritt ein Stück Frankreich kennengelernt.
Der Vater, Thomas Platter, hingegen war als junger Geißhirt ausgezogen, um lesen und schreiben zu lernen. Was ihm, der Halbwaise, zu Hause geboten wurde, hatte wenig mit schulischer Bildung zu tun. Der Pfarrer, der sich seiner zeitweilig annahm, war großzügiger mit Schlägen als mit Lektionen; von dieser pädagogischen Methode hatte Platter mitgekriegt, daß es zuweilen für einen Lehrer nützlich ist, den Unterrichtsstoff einzubleuen.
Platter suchte seine Ausbildung jenseits der Berner Alpen, in der Außerschweiz, wie die Walliser noch heute sagen, in Deutschland. Mit »Tütschland« war der deutschsprachige Raum gemeint und damit auch die Schweiz. Er brach in Städte auf wie München und Dresden, wie Naumburg und Breslau. Das war zu einer Zeit, als »Ausland« und »Elend« sprachlich noch die gleiche Bedeutung hatten.
Eine neue Welt tat sich auf, und sei es nur, daß der Walliser Bergbub zum ersten Mal Kachelöfen sah oder Ziegeldächer. Zum ersten Mal begegnete er auch seltsamen Tieren wie Gänsen. Die verlockten zu einer neuen [14] Möglichkeit, sich durchzuschlagen, zum Beispiel zum Gänsediebstahl.
Sechs Jahre zog Platter als fahrender Student durch die deutschen Lande, in Begleitung eines selbstherrlichen Vetters. Der Jüngere, als »Schütze«, mußte, wie es Usance war, in Gegenleistung für den Unterricht sich um den Unterhalt kümmern. Statt daß der Ältere, ein sogenannter »Bacchant«, sich groß um dessen Ausbildung sorgte, nutzte dieser den »Schützen« nach Strich und Faden aus.
Sechs Jahre Vagantentum. Der junge Platter stahl sich durch, wie Not heischte und sich Gelegenheit bot. »Singen gehen« hieß soviel wie betteln. Und Platter lernte singen. Auf unerwartete Weise erfuhr er Sympathie. Nach der Schlacht von Marignano (1515) empfand man europaweit ein Mitgefühl für die geschlagenen Schweizer; die hatten bis dahin als unbesiegbar gegolten. Dank einer helvetischen Niederlage kam Platter zu manchem Notgroschen. Und wenn er gar Walliser Dialekt redete, kriegte er für sein exotisches Deutsch oft einen Sonderbatzen.
Allerdings, als er nach seinen Vagantenfahrten ins Wallis zurückkehrte, wunderten sich nicht nur Familie und Verwandtschaft, wie »fremdländisch« er sprach. Jahrzehnte später wird er seinen Sohn Felix, als dieser von seinem Studium und seinen Reisen aus Frankreich zurückkehrt, mahnen, nicht so ausländisch zu sprechen, sondern sich dem heimisch-langsamen, betulichen Redegang anzupassen. Als sein Sohn Felix ihm Südfrüchte schickte, schrieb er zurück: »Ich bringe das seltsame Zeug nicht herunter; Pomeranzen machen mir lange Zähne, daß ich beim Brot nicht beißen mag; Granatäpfel sind langweilig zu speisen. Ich esse nach [15] meinem alten Brauch ein gut Stück Habermus wie die andern Bauern.« In solchen Momenten kam in dem Basler Humanisten der Bergler hoch, der auch nicht alle groben Scherze der Herkunft aufgegeben hatte.
»I wott id Schuel« – Platters Wunsch gibt einen Slogan ab für die Geschichte unseres Bildungswesens: »Ich will in die Schule.«
Was sich als älteste Demokratie rühmt, kennt erst dank eines Heinrich Pestalozzi seit gut zweihundert Jahren die demokratische Möglichkeit, daß alle in die Schule gehen können – was auch soviel heißen kann wie Schulzwang. Der Autodidakt (»Ich will in die Schule«) stellt in unserer Literaturgeschichte einen Typus dar: sei es Ulrich Bräker, der arme Mann aus dem Toggenburg, oder Kleinjogg, der philosophische Zürcher Bauer. Ich will in die Schule, und wenn ihr mich nicht laßt, bau ich mir selber eine. So schulfreundlich war das Land nicht immer und nicht überall. Im neunzehnten Jahrhundert wird Jeremias Gotthelf darüber einen Roman schreiben, wie die Einwohner der Vehfreude sich gegen den Bau eines Schulhauses aussprechen zugunsten einer Käserei.
Platter entschied sich nach seinem studentischen Vagantentum und einem kurzen Abstecher ins heimatliche Wallis für Zürich. Bei Myconius, dem Schulmeister am Fraumünsterstift, lernte er Latein. Griechisch erwarb er sich im Selbststudium; wo er keinen Lehrer hatte, machte er sich selber zu einem. Ein Bildungswille, der sich durch keine Umstände kleinkriegen ließ. Nachts stand er heimlich auf, um seinen Homer zu lesen. Seine Hebräisch-Kenntnisse erwarb er, indem er zur nächtlichen Stunde eine Grammatik [16] abschrieb, während deren Verfasser schlief. Seine Situation verbesserte sich, als der Autodidakt selber Lehrer wurde. Er wurde Hauslehrer bei Heinrich Werdmüller, einem Müller und Ratsherrn, das bedeutete Kost und Logis. Er übte mit den übrigen Tischgängern von Myconius Grammatik. Und zwischendurch fand er ein Auskommen, indem er sich in Zürichs Umgebung als Hebräisch-Lehrer anbot.
Als er mit einer ersten ordentlichen Ausbildung begann, war er längst über das übliche Studentenalter hinaus. Er hatte sich mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen, lebte zeitweilig in einem Halbbordell, besorgte Botengänge, darunter hochpolitische und höchst gefährliche. Als Hühnerhändler verkleidet, schmuggelte er Nachrichten nach Zürich, um Huldrych Zwingli über die Disputationen zu informieren, von denen der Reformator ausgeschlossen war, bei denen aber die Sache der Reformation verhandelt wurde.
Der Wechsel vom Wallis nach Zürich war kein bloßer Ortswechsel, Platter hatte nicht einfach die Berge gegen eine Stadt eingetauscht. Der Geißbub, für den zu Hause vielleicht die Ausbildung zum Priester möglich gewesen wäre, ließ den Katholizismus seiner Kindheit hinter sich; er bekannte sich zur Lehre von Zwingli. Als Protestaktion mag man die Szene deuten, die er nicht ungern weitergab: Als er als Kustos die Kirche heizen sollte, machte er mangels Brennmaterials mit einer Johannes-Statue Feuer; der Evangelist erwies sich als tauglicher Wärmespender.
Wenn sich Platter mit Hanf eindeckte und die Seilerei erlernte, dann nicht nur, um einen Brotberuf zu haben. Der Religionsmeister Zwingli hatte das Handwerk als Gegenmittel zum unverbindlichen Disputieren und Spekulieren [17] empfohlen. Angesichts mancher heutiger Symposien denkt man nostalgisch an die zwinglianische Empfehlung.
Das Seilerhandwerk war eine Zeitlang für sein Auskommen wichtig, auch noch, als Platter nach Basel zog. Doch trat neben das Handwerk und bald an dessen Stelle die Lehrtätigkeit. In Basel wurde er Professor, leitete ein Internat und gründete eine Druckerei. Der Geißbub, der einst verdingt worden war, wurde Hausbesitzer an einer guten Basler Adresse und Eigentümer eines Landgutes, ein sozialer Aufstieg, der bis ans Lebensende nicht frei war von Schuldenlast.
Über seinen Lebenslauf hat Platter einen Bericht geschrieben, Lebenserinnerungen verfaßt, um seinem Sohn Felix darzulegen, welche Mühsal ihm widerfahren war, aber auch, wie er all die Mühsal meisterte – »durch gottes gnadt«. Er war recht offen, wenn er gestand, wie er und seine Angetraute monatelang die Ehe nicht konsumierten, »da sich beide schämten«.
Seine Autobiographie ist ein frühes Zeugnis jener literarischen Gattung, die in der schweizerischen Literatur einen festen Platz einnehmen wird: bei Albrecht von Haller als Tagebuch seiner Beobachtungen über Schriftsteller und sich selbst und bei Johann Caspar Lavater als Tagebuch eines Beobachters seiner selbst, später als Sieben mal sieben Jahre aus meinem Leben bei Jakob Stutz bis zur Bilanz eines erfolglosen Lebens bei Adrien Turel.
Platters Lebenserinnerung ist geschrieben in einem Frühneuhochdeutsch, das sich nur mit etlicher Anstrengung im Originalton lesen läßt. Es gibt Übertragungen ins Deutsche unserer Zeit, die ein zusätzliches Lesevergnügen bieten, da [18] sprachliche Reminiszenzen beibehalten (und erklärt) werden: »Zank« heißt nicht »Streit«, sondern »Diskussion« und »Einöde« soviel wie »steinichte Alpenweide« oder »Einzelhof«, »küsse« bedeutet »Kissen«, und »große Welt« heißt »viel Leut«, und es wird einem bewußt, daß »Gewehr« von »wehren« kommt, so daß eine Stoß- und Hiebwaffe wie die Hellebarde auch ein »Gewehr« sein konnte; eine Redewendung wie »sich in die Nesseln setzen« wird anschaulich, weil sie aufs Hinkauern beim Bedürfnisverrichten anspielt, indem man »in die Nesseln brünzlet«.
Hundertfünfzig Jahre kursierten die Lebenserinnerungen nur in Abschriften, bis sie Ende des 18.Jahrhunderts gedruckt wurden. Seither bilden sie ein sicheres Kapitel der deutschschweizerischen Literatur. Unter verschiedensten Gesichtspunkten wurde das Werk publiziert – nicht nur, um »zu belustigen und zu ergetzen«. Anfänglich als Erbauungslektüre gedacht, als Beispiel für ein tapfer gottergebenes Leben, später als »Sittengemälde ihrer Zeit«, immer aber als einzigartiges Dokument der Reformation und der Renaissance verstanden, ein Zeugnis der Neuzeit, in der das Individuum beginnt, von sich Kenntnis zu nehmen.
Aber nicht nur die eigenen Erinnerungen geben Auskunft über sein Leben, sondern auch die seines Sohnes Felix. Allerdings deckt dieser mit dem, was er zu Buche brachte, nicht sein ganzes Leben ab. Was er als Siebzigjähriger niederschrieb, sind die Erinnerungen an seine Studentenzeit in Montpellier und an seine Reise durch Frankreich. Auch der Sohn aus zweiter Ehe, Thomas der Jüngere (1574–1628), Tomilin genannt, verfaßte ein Buch über seine Reisen, diese führten ihn nach Spanien, England und in die Niederlande.
[19] Nimmt man die drei Memoirenwerke als Ganzes, erhält man Einblick in ein Jahrhundert. Das Dokumentarische wird um so bedeutungsvoller, wenn man die Briefe von Thomas Platter an seinen Sohn mit berücksichtigt. Und wenn man bei Felix Platter neben seinen wissenschaftlichen Werken wie den Observationes die Beschreibung der Stadt Basel und den Pestbericht aus den Jahren 1610/11 mit in Betracht zieht. Eine solch dokumentarische Zeugenschaft zweier Generationen hat den französischen Historiker Le Roy Ladurie zu seinem breit angelegten Werk Le siècle des Platters inspiriert; auf deutsch wurde »Das Jahrhundert der Platters« zu Eine Welt im Umbruch; die Platters wurden ins Souterrain des Untertitels verwiesen: »Der Aufstieg der Familie Platter im Zeitalter der Renaissance und der Reformation.«
Wie stark dabei das Alpine die Denkart bestimmen kann, mag man auch daran erkennen, daß Le Roy Ladurie für den beruflichen Aufstieg des Humanisten metaphorisch dem Berglerischen verfällt: »Als geborener Alpinist wird Thomas der Bergler jeden Schritt seiner beruflichen Karriere sichern. Erst wenn er mit den Füßen Halt gefunden hat, sucht er mit der Hand auf der glatten Felswand den nächsten Griff zu ertasten, den winzigen Steinvorsprung, an dem der Kletterer sich festklammern kann, um in einem Schwung seinen ganzen Körper weiter nach oben zu befördern: vom Halt, den das Betteln gewährte, zum Griff der Alphabetisierung…«
Sosehr die Autobiographie von Thomas Platter kulturgeschichtliche Einblicke bietet, die Stärke des Lebensberichtes liegt nicht primär in der Kenntnisnahme der [20] politisch-gesellschaftlichen Situation seiner Zeit. Die Ausrichtung auf das persönlich Erlebte bedeutet unweigerlich Einschränkung, sie verschafft aber dem Werk zugleich eine eigene Qualität. Die Lebenserinnerungen Platters sind die erste Autobiographie der Deutschschweizer Literatur.
Man könnte neben Platter für den schweizerischen Kulturbereich weitere zeitgenössische Autoren nennen, die ihre Autobiographien veröffentlichten. Josua Maler (1529–1599), der das Wörterbuch Die Teutsch spraach bearbeitet hatte, hielt seine Lebenserfahrungen in einer Hauschronik für Kinder und Kindeskinder fest. Andreas Ryff (1550–1603), ein Basler Rats- und Tuchherr, orientierte mit seinen biographischen Aufzeichnungen über die damaligen Geschäftsusancen. Es ist die Zeit der Emanzipation des Individuums, in der Selbstzeugnisse verfaßt werden, die man später als »Ego-Dokumente« bezeichnete.
Platter aber zeichnet aus, daß sein Lebensbericht übers Individuelle hinausweist. Er ist repräsentativ für den Ausbruch aus dem Alpinen in die Urbanität.
Platter erinnert sich, wie er einst mit einem andern »hiertlin« davon träumte, fliegen zu können, um über die Berge hinweg in die Welt hinauszugelangen. Aber er mußte mit dem andern Hirtlein feststellen, daß Gott den Menschen nicht geschaffen hatte, »zfliegen, sundern zghan«. Und er ist nicht »geflogen«, sondern »gegangen«. Es waren nicht Flügel, die sein Weggehen ermöglichten, sondern Füße, und an die Stelle der Träume waren Bücher getreten.
Ein Geißbub, der aus den Bergen ausbricht und in der Stadt zur Kultur findet, in seinem Fall im Basel des Humanismus, wobei man daran erinnern darf, daß »urban« einst [21] soviel wie »kultiviert« bedeutete. Damit begründete Platter einen Topos: lesen statt klettern.
Das ist ein anderer Einstieg in die schweizerische Literatur als das, was später Tradition werden sollte, eine Tradition, die das wahre Leben in den Bergen sucht, nicht biographisch, sondern symbolisch-ideologisch, sich auf Herkunft berufend, selbst wenn das, was inzwischen historisch entstanden ist, mit dieser Herkunft wenig zu tun hat: die Alpen als Markenzeichen, ein Image, das ebenso eingängig wie beliebt ist, aber hartnäckig das schweizerische Selbstverständnis verstellt.
Als die Schweiz 1998 an der Frankfurter Buchmesse den Schwerpunkt abgab, wählten die Organisatoren für das hochindustrialisierte Land den alpinen Slogan »Hoher Himmel, enges Tal«. Nur eben: Keine einzige große oder größere Stadt liegt im engen Tal, und der Himmel ist so hoch wie überall: zehntausend Meter, darüber ist er Freiraum für Satelliten und Engel.
[22] Interview mit Albrecht von Haller
Fühlen Sie sich als Gespenst?
Warum sollte ich?
Als einer, der zurückkehrte, als »revenant«?
Wie kommen Sie darauf?
Ein anderer Rückkehrer in die Schweiz hat sich als »revenant« bezeichnet und dabei an die deutsche Bedeutung »Gespenst« gedacht. Adrien Turel.
Kenne ich nicht.
Er lebte von 1900 bis 1934 in Berlin. Er hat in Deutschland seine ersten Werke veröffentlicht. Gedichte und philosophische Essays.
Fand er als Gespenst sein Auskommen?
Er schrieb die Bilanz eines erfolglosen Lebens. Ein Aussteiger, bevor es das Wort gab. Ein Verweigerer. Erfolglosigkeit im Selbstverlag – nicht immer aus freien Stücken. Einer, der zurückkehrte und sich absetzte. Lesenswert, was er an Autobiographischem verfaßte.
Autobiographisches? Das hat mich immer interessiert.
Er hat von uns Schweizern behauptet: »Für gewisse Laster sind wir nicht zahlreich genug.« Er kehrte wegen der Nationalsozialisten zurück.
Ich bin freiwillig zurückgekehrt.
Sind Sie auch freiwillig gegangen?
[23] Ich bin zweimal gegangen. Das erste Mal –
Und das zweite Mal?
Das erste Mal ging ich als Student nach Tübingen. Wegen der Naturwissenschaften. Ich war damals, 1723, gerade fünfzehn Jahre alt. Mein Medizinstudium aber schloß ich in Leyden ab. Mit einer Dissertation über den Speichelgang. Es war üblich, daß einer nach dem Examen auf Reisen ging. Nicht eine Kavalierstour, sondern eine Fachreise: Hospitäler, Botanische Gärten, Raritätenkabinette.
Wie in London. Dort notierten Sie anläßlich eines Besuches bei einem Ihrer Kompatrioten aus Zürich: »Sah einen teil seiner Curiositäten, der insonderheit in Statuen besteht. Er nehrt einige curiose Thiere, als einen Zobel aus Norwegen, der meist einem Wiesel gleich sieht und Fleisch frißt. Einen ostindischen Kranich, der entsetzliche Beine und einen extralangen Hals hat.« Stimmt es, daß Sie Ihren Pariser Aufenthalt frühzeitig abbrachen? Wegen einer Polizeiaffäre? Weil Sie sich für Ihre anatomischen Studien vom Totengräber Leichen beschafften?
Die Reise führte weiter von Paris nach Straßburg und Basel. Man kann dies nachlesen. Mein Gott – es waren Krankheitsrapporte und Therapien.
Nicht nur. Damals lobten Sie Landstriche, die mit dem Lineal und der Schnur gezogen worden waren. Sie führten ein Reisejournal.
Das war niemals zur Veröffentlichung gedacht. Schon wegen der Sprache nicht. Wir redeten in Bern französisch.
Sie meinen, unter den gebildeten Bürgern, unter den Aristokraten?
Natürlich redeten wir auch Dialekt. Der Herausgeber [24] meiner Studienreise hat mir angekreidet, wie sich Französisch und Dialekt in mein Deutsch einschleichen: »Je suis tombé malade« ergab bei mir »ich fiel(e) krank«. Wir sagen von einer Landschaft, daß sie »abhaltet«, und nicht, daß sie »abfällt«.
Ein Jahr danach schrieben Sie Die Alpen. Ein Gedicht, dessen Sprache allgemein bewundert wurde.
Ich habe die deutsche Sprache geliebt und geschätzt. In meinem Gedicht über »Vernunft, Aberglauben und Unglauben« habe ich meiner Überzeugung Ausdruck verliehen: nämlich, daß sich die deutsche Sprache so gut wie das Englische für philosophische Dichtung eignet.
Weshalb der Blick nach England?
Es war die Sprache von Alexander Pope und des großen John Milton.
Ihre erste Publikation nannten Sie Schweizerische Gedichte. Genauer: Versuch schweizerischer Gedichten. Mit einem falschen Genitiv?
Der ließ sich korrigieren.
Schweizerisch wegen der Thematik?
Nein. Mehr als Bitte um Nachsicht.
Schweizerisch als Entschuldigung, als mildernder Umstand?
Das Wort »schweizerisch« hatte im deutschen Kulturraum keinen guten Klang – wenn überhaupt einen. Die Entschuldigung war angebracht, wenn Sie an die Leipziger Puristen denken, an Johann Christoph Gottsched und die Gottschedianische Sekte.
Noch immer durchkämmen deutsche Lektoren und Kritiker schweizerische Texte nach Helvetismen und zeigen mit [25] Trophäenstolz, was für linguistische Böcke geschossen wurden. Friedrich Dürrenmatt, auch ein Berner, hat in die deutsche Sprache das Wort »Morgenessen« eingeführt: Zwar macht der Zeremonienmeister den Bühnenhelden Romulus darauf aufmerksam, daß es korrekterweise »Frühstück« heißt, aber Romulus begehrt auf: Was klassisches Latein in diesem Haus, bestimme ich.
Kennen Sie Johannes Grob? Er stammte aus dem Toggenburg. Er war ein schätzenswerter Epigrammatiker. Spazierwäldlein heißt eine seiner Sammlungen. Er starb wenige Jahre vor 1700. Einem deutschen Richter in Sachen Poesie, einem »Dichtgesetzgeber«, rief er zu: »Du lehrest, wie man soll kunstreiche Reime schreiben./Und wilt den Dichtergeist in enge Schranken treiben:/Allein ich gebe nicht sobald die Freiheit hin./Weil ich von Mut und Blut ein freier Schweizer bin.« So unbegründet waren meine Bedenken nicht. Ich bin Schweizer, und Deutsch ist für mich eine Fremdsprache.
Dem würde heute, ein Vierteljahrtausend später, ein Peter Bichsel Wort für Wort zustimmen. Er ist überzeugt, gerade weil Deutsch eine Fremdsprache ist, würden wir Schweizer mit ihr besonders sorgfältig umgehen.
Und immer daran feilen.
Auch an der Gesinnung?
Nehmen Sie Drollinger, der fast gleichzeitig wie ich mit Dichten angefangen hat. Ich lernte ihn bei einem meiner Aufenthalte in Basel kennen. Karl Friedrich Drollinger. Ein Schwabe, der als glühender Schweizer fühlte. Ist es nicht bezeichnend, wie skeptisch er apropos der Sprache blieb: »Ein geborener Schwabe zu sein und seine meiste [26] Lebenszeit in der Schweiz zugebracht zu haben sind wohl nicht die Umstände, die zu einer reinen deutschen Poesie zutragen können.« Und sah sich mein Zürcher Bekannter Breitinger nicht veranlaßt, eine Verteidigung »der schweizerischen Muse von Haller« zu verfassen? Und sein Mitkämpfer, der andere Zürcher, Bodmer? Schickte er seine Manuskripte vor der Drucklegung nicht nach Deutschland, um sie auf gut Deutsch redigieren zu lassen? Bot er nicht mit seiner Homer-Übersetzung eine aufschlußreiche Hierarchie? Die erste Fassung, die unvollkommene, nannte er die »schweizerische«, die verbesserte die »deutsche« und die dritte dann die »poetische«.
Immerhin steht über der »deutschen« noch die »poetische«. Trotz allem sind Sie der erste Schweizer, der mit seiner Dichtung über sein Land hinausgewirkt hat. Ein Lessing wunderte sich Ihretwegen, daß Alpensöhne elegant schreiben: »Es war eine Zeit, da ein schweizerischer Dichter ein Widerspruch zu sein schien. Der einzige Haller hob ihn.«
In seinem Laokoon hat er ganz andere Argumente gegen mich vorgebracht. Ich sah mich genötigt, dagegen zu opponieren.
Verse von Ihnen wurden ein Lieblingszitat des jungen Schiller. Die Gott verherrlichenden Verse aus dem Gedicht »Morgengedanken«: »Den Fisch, der Ströme bläst und mit dem Schwanze stürmet,/Hast du mit Adern ausgehöhlt./ Du hast den Elefant aus Erden aufgetürmet/Und seinen Knochenberg beseelt.«
In seinen Ausführungen Über naive und sentimentalische Dichtung hielt mir Schiller vor, ich hätte nicht [27] Empfindungen ausgedrückt, sondern Gedanken über Empfindungen. Wenn schon eine Referenz, dann Goethe, obgleich ich kein Freund der Genies und ihres Geniekultes war.
Er fand Ihre Gedichte in der Bibliothek seines Vaters.
Er soll seiner ersten Fassung des Egmont als Motto einen Satz aus meinem Usong vorangestellt haben. Und im Wilhelm Meister, das steht fest, hat er die Alpen »ein großes und ernstes Gedicht« genannt und vom »Anfang einer nationalen Dichtung« gesprochen.
Schweizerisch hieß also nicht mehr bloße Entschuldigung, sondern erwachendes Selbstbewußtsein?
Darf ich mich selber zitieren: »Dann hier, wo Gotthards Haupt die Wolken übersteiget/Und der erhabnern Welt die Sonne näher scheint,/Hat, was die Erde sonst an Seltenheit gezeuget,/Die spielende Natur in wenig Lands vereint./ Wahr ist’s, daß Libyen uns noch mehr Neues giebet,/Und jeden Tag sein Sand ein frisches Untier sieht;/Allein der Himmel hat dies Land noch mehr geliebet/Wo nichts, was nötig, fehlt und nur, was nutzet, blüht.«
Ein Land, das der Himmel mehr als andere liebt – mit der Formulierung können wir uns auch heute noch bestens abfinden, obgleich vieles blüht, nicht weil es nutzet, sondern weil es subventioniert ist, und vieles blüht, das als Pflanze importiert wurde. Der Anfang einer nationalen Poesie – sollte er zugleich Beginn eines nationalen Stolzes sein?
Nationalstolz? Das Wort läßt mich an Johann Georg Zimmermann denken.
Ihr erster Biograph. Zimmermann.
Ich war gegen die Veröffentlichung der Lebensbeschreibung.
[28] Er hat im nachhinein behauptet, Sie hätten ihn nicht besonders gemocht.
Er hat als junger Mann bei mir in Göttingen studiert. Medizin, mit auffallendem Interesse für Staatswissenschaften. Gern habe ich mich in seine Schrift Über die Einsamkeit vertieft. Wir haben oft davon gesprochen. Ich war als Kind viel allein. Der frühe Tod meiner Mutter. Der frühe Tod meines Vaters.
Mit neun legten Sie ein hebräisches und griechisches Lexikon an und befaßten sich mit einer chaldäischen Grammatik.
Latein war die Sprache, in der ich meine wissenschaftlichen Arbeiten publizierte.
Zimmermann ist – wie Sie – gegangen.
Man hat ihm den Posten eines königlichen Leibarztes angeboten. In Hannover.
Er ging aus Enttäuschung. Er hatte versucht, sich in seiner Heimatstadt einzurichten.
Ich war es, der ihn als Stadtphysikus nach Brugg empfohlen hatte.
Er gehörte zu denen, die auf Verbesserungen versessen waren. Er war ein Sympathisant der »Helvetischen Gesellschaft«. Sie selber hielten zu dieser Vereinigung eher Distanz.
Helvetisch, schweizerisch, kein Intelligenzblatt kam ohne diese Wörter aus.
Wenn ein Lavater »Schweizerlieder« dichtete, war er »schweizerisch« stolz: »Wer, Schweizer, wer hat Heldenblut…«
Sie hingen alle gefährlichen Umstürzlerideen nach. Auch [29] ein Mitbegründer der »Helvetischen Gesellschaft« wie der Basler Isaak Iselin. Helvetischer Patriot hieß sein Periodikum: Er verfaßte die »philosophischen und patriotischen Träume eines Menschenfreundes«.
»Menschenfreund«, »l’ami du peuple« – das war später eine Kampfparole von Jean-Paul Marat, der seine neuenburgische Heimat verlassen hatte, ein Hauptakteur der Französischen Revolution.
Revolution – das war für das korrupte Frankreich vorauszusehen.
Sie meinen: Revolution fürs Ausland und zu Hause Ordnung und Tradition? Was aber, wenn einer mit seinen Reformvorschlägen scheitert? Wie der erwähnte Iselin? Er wollte das Schulsystem verbessern, das Einbürgerungsgesetz larger handhaben. Sein Amt als Ratsschreiber in seiner Heimatstadt Basel empfand er als Sklavendienst. Auch er trug sich mit dem Gedanken, ins Ausland zu gehen. Er hatte Zimmermann gebeten, sich nach einem konvenablen Posten umzusehen. Aber er ist geblieben. Gegangen ist Zimmermann. Gegangen sind Sie, Herr Haller.
Man hatte mir an der eben gegründeten Universität von Göttingen eine Professur für Botanik, Anatomie und Chirurgie angeboten.
War dies der einzige Grund zu gehen?
Die Kultur wurde in Bern nie hochgeschätzt, so dünkte mich jedenfalls damals.
Ein Holzboden, wie Gottfried Keller später sagen wird? Nicht nur Bern, sondern die Schweiz. Darf man in dem Zusammenhang Voltaire zitieren?
Einen Freygeist!
[30] Hatten Sie nicht einmal gedichtet: »Wer frei darf denken, denket wohl.«?
In meinen Briefen über einige »Einwürfe noch lebender Freygeister wider die Offenbarung« habe ich dargelegt, was ich von Voltaire und seinem Verhältnis zur Religion halte. Ich fühlte mich dazu verpflichtet als »tätig ernstlicher Christ«.
In Lausanne hatte ein bernischer Landvogt zu Voltaire einmal gesagt: »Warum machen Sie immer so viele Verse? All das Zeug führt zu nichts. Mit Ihrem Talent könnten Sie es zu etwas bringen. Sehen Sie mich an. Ich habe es zum Landvogt gebracht.« Wie hieß doch dieser Landvogt?
Ich erinnere mich nicht.
Nach der Veröffentlichung Ihrer Gedichte waren Sie ein berühmter und gerühmter Mann.
Ja, schon.
»Zu meinen Füßen lag ein ausgedehntes Land,/Durch seine eigne Größ’ umgrenzet,/Worauf das Aug’ kein Ende fand,/ Als wo Jurassus es mit blauen Schatten kränzet./Die Hügel decken grüne Wälder./Wodurch der falbe Schein der Felder/Mit angenehmem Glanze bricht;/Dort schlängelt sich durchs Land, in unterbrochnen Stellen,/Der reine Aare wallend Licht.« Solche Naturnähe war neu.
Das war der Blick vom Gurten, dem Hausberg Berns, auf die Flußlandschaft der Aare.
Oder in den Alpen die Schilderung des Lauterbrunnen-Wasserfalls.
Das ist ein Irrtum. Die Vorlage dazu bot der Staubbach Pisse-Vache im Wallis.
Sie haben die Alpen entdeckt.
[31] Vor mir haben es schon andere mit den Bergen versucht. Vor über hundert Jahren Hans Rudolf Rebmann.
Schon, aber…
Dieser Berner Pfarrer lud zum Gespräch der Berge Niesen und Stockhorn ein – das Stockhorn übrigens, die Besteigung des Stockhorns, die lateinischen Hexameter der »Stockhornias«, datieren von noch früher. Vergessen Sie Conrad Gesner nicht, unseren europäischen Plinius aus Zürich, seine Besteigung des Pilatus, seine Wanderungen in den Glarner Alpen.
Wenn schon, dann auch Johann Jakob Scheuchzer mit seiner Barometrik und Höhenmessung. Er war der erste, der den Föhn ernst nahm, der seinetwegen nicht einfach Kopfweh kriegte, sondern ihn untersuchte. Als seine Naturgeschichte der Schweiz herauskam, lernten Sie gerade lesen und schreiben. Dieser Rebmann hingegen, der zu einem »Gastmahl und Gespräch zweier Berge, des Niesen und des Stockhorn« einlud…
Ein Lehrgedicht.
Eine zurechtgestutzte Kosmographie, eine verrückt gewordene Enzyklopädie. Sie hingegen haben aus eigener unmittelbarer Anschauung geschrieben.
Unsere Wanderung begann im Jura, um genau zu sein. Wir kehrten über Savoyen in die Schweiz zurück: in die Walliser Alpen und dann in die Berner und von dort in die Innerschweiz. Wir waren zu zweit. Ich wanderte zusammen mit Johannes Geßner, dem nachmaligen Canonicus, Mathematikprofessor und Botaniker in Zürich. Eine Reihe von alpinen Pflanzen hat er als erster beschrieben. Auch dies ist ein Ergebnis unserer Wanderung.
[32] Also steht am Anfang unserer nationalen Poesie das Klettern. Ob von da unsere Vorliebe für die kleinen Schritte kommt?
Ich war Paßwanderer. Das Hochgebirge wurde später erklommen.
Saussure und seine Wanderung in den Alpen. Er war auf den Montblanc geklettert. Nach den Wissenschaftlern kamen die Touristen. Vorab die von Ihnen so geschätzten Engländer.
Manchmal würde ich gern noch einmal durch die Alpen wandern.
Es stünden Ihnen Drahtseilbahnen, Schwebebahnen, Sessellifte zur Verfügung. Es werden Pauschalarrangements angeboten. Jodel und Wurst inbegriffen, vom Panorama nicht zu reden und vom Drehrestaurant: in alle vier Himmelsrichtungen schauen, ohne sich vom Platz erheben zu müssen.
Sie meinen, das sei alles nicht mehr bedichtungswürdig?
Die Frage ist eher, ob Sie noch einen Gipfel oder ein Seitental finden, das noch nicht bedichtet wurde. Sie stehen nicht nur am Anfang einer nationalen Poesie, sondern auch einer nationalen Epik.
Ob sich der Roman für ein so hohes Motiv wie die Alpen eignet?
Als Liebhaber von Bibliographien könnten Sie einen umfangreichen Katalog der Bergliteratur anlegen: mit Lawinen und Felssturz, mit Morgenrot und Matten, mit Verbauungen und Staudämmen. Die Dichter klettern noch immer. In unseren Tagen schrieb Ludwig Hohl eine Erzählung, Bergfahrt, nicht eigentlich eine Fahrt, sondern eine [33] Begehung. Wenn er vom »unermeßlichen, unüberblickbaren Gestürme der Bergflanken« schreibt, meint man, er habe vorher bei Ihnen nachgeschlagen. Das Hochgebirge mit seiner dünnen Luft verführte zur höheren Prosa.
Zu meiner Zeit konnte man in medizinischen Werken lesen, die Alpenluft verdumme.
Sie ist manchmal dem Lungenkranken besser bekommen als dem Dichter. Bergsteigen als Symbol war immer beliebt, wo man das Leben als keuchenden Aufstieg verstand. Hohl hat zwischen dem Künstler und dem Alpinisten Verwandtschaft entdeckt – der Alpinist erklimmt den Gipfel, der Künstler zieht sich in einen Teil des Bergraumes zurück, möglicherweise in einen Stein, »in dessen Glitzern und Funkeln sind viele und zukünftige Besteigungen enthalten«. Allerdings konnte der gleiche Autor von den Alpen sagen, sie seien »schauerlich, unmenschlich und ungeistig«.
Das kommt mir bekannt vor. Johann Joachim Winckelmann, der das Mediterrane schätzte, der Bewunderer der edlen Einfalt und stillen Größe, er zog bei der Alpenüberquerung in der Postkutsche die Vorhänge zu, um die schauerliche Landschaft nicht sehen zu müssen. Wie war schon der Name des Alpinisten-Dichters?
Ludwig Hohl. Er lebte in Genf.
Ein Welschschweizer?
Er kannte auch Holland. Er ging dorthin in eine Art freiwilliges Exil. Er fand Holland gräßlich wie die Schweiz. Er bekundete seine Anhänglichkeit an die Schweiz, indem er ein Exil wählte, das in seiner Mentalität ihr ähnlich war. Zurückgekehrt, ließ er sich in der französischen Schweiz nieder – allein, um nicht den Dialekt zu hören, diese [34] »kuhmistartige Sprache«, wie er meinte. Sie sehen, man kann auch innerhalb des eigenen Landes exilieren.
Das läßt mich an Beat Ludwig Muralt denken. Seine Lettres sur les Anglais et les Français waren für unsere Generation bedeutungsvoll. Auch für mich. Er sah in den Engländern ein freieres Volk als in den Franzosen, die wir in allem nachäfften. Er liebte das einfache Leben auf dem Land, das weniger verdorben war als das der Städte. Er wurde aus Bern verbannt. Wegen seiner pietistischen Ansichten, seiner ketzerischen Moral. Er brach offen mit der Landeskirche. Vor unserer Alpenwanderung wollte ich ihn in Colombier besuchen. Er lebte zurückgezogen im Neuenburgischen. Bis er amnestiert wurde.
In der guten alten Zeit gab es noch Landesverweis. So was schlägt sich in der Volksseele nieder. Heute ist Landesverweis juristisch nicht mehr möglich. Doch bei Zeit und Gelegenheit kommt aus der Tiefe solches hoch: Wenn man einen linken Kritiker weghaben wollte, hieß es zu einer gewissen Zeit »Moskau einfach«.
Schön, daß die Dichter immer noch klettern.
Es gibt sehr moderne Kombinationen. Da veröffentlicht Emil Zopfi Texte vom Klettern: Die Stunden im Fels. Der Autor, Alpinist und Sportkletterer ist auch Erwachsenenbildner für Informatik und Sprache. Die Schiefertafel, wie Sie sie kennen, ist elektronisch geworden. Allerdings, als in den achtziger Jahren unsere Jungen rebellierten, wollten sie die Alpen abtragen, um einen freien Blick aufs Mittelmeer zu gewinnen.
Die Alpen abtragen! Dieser großartige Ausweis für die sinnvolle Schöpfung: »Genug, es ist ein Gott, ruft es die [35] Natur.« Diese Schöpfung versuchte ich poetisch zu malen. Nach dem Leben.
Gemälde in einer barocken Sprache.
Barock? Das Wort mag ich nicht. Ich bin Protestant. Militanter Protestant. Haben Sie meine Zeilen gegen die Jesuiten nicht gelesen, gegen den Papst? Wenn ich mich für Missionierungen interessierte, dann nur, weil ein einziger zum Protestantismus Bekehrter mehr wert ist als tausend Katholiken. Dank Spenden konnte ich in Göttingen eine protestantische Kirche bauen.
Wenn Sie schreiben: »und ist der süße Schaum der Euter ausgedrückt«, meinen Sie, daß einer mit dem Melken fertig ist?
Was sonst?
Und wenn Sie schreiben: »Dort eilt ein künstlich Blei nach schwergehörnten Böcken«, dann wurde wohl ein Schuß abgegeben.
Nach Gemsböcken. Das dürfte klar sein. Ich dichtete auch über den Käse.
»Das Mehl der Alpen.«
Ich erwähne die Stelle mit dem Käse nur, weil ich weiß, zu was für spöttischen Bemerkungen sie Anlaß gegeben hat.
Dennoch: Ihre Sennerinnen und Sennen haben mehr mit der Alp zu tun als die Schäferinnen und Schäfer eines Salomon Geßner mit der Viehzucht.
Jener Geßner schrieb seine Idyllen in völlig anderer Absicht. Bei unserer Alpenwanderung galt die ursprüngliche Intention dem Botanischen. Doch dann erlebten wir die Welt der Alpenbewohner: »Seht ein verachtet Volk zur Müh’ und Arbeit lachen./Die mäßige Natur allein kann glücklich machen.«
[36] Hundertfünfzig Jahre vor Ihnen hat ein Genfer Pastor in Brasilien –
Wo? Ich präsidierte in Deutschland eine wissenschaftliche Gesellschaft, welche die Natur der überseeischen Länder erforschen wollte.
Jean de Léry, ein Calvinist, begleitete ein französisches Expeditionscorps nach Südamerika, nach Brasilien. In seinem Tagebuch informiert er über die Sitten der Indios, der Ureinwohner. Ihm fiel auf, daß Kannibalen menschlicher sein konnten als die, welche sich Christenmenschen nannten. Er entdeckte, was man später den »guten Wilden« nannte. Sie, Herr Haller, entdeckten den guten Wilden mitten unter uns. Auf der Alp.
Sicher habe ich idealisiert. Ich habe später auch Korrekturen angebracht, als ich feststellen mußte, wie Luxus und Verderbtheit vor der Alpenwelt nicht haltmachten.
Man hat in Ihnen einen Vorläufer von Rousseau gesehen.
Jetzt kommen auch Sie damit. Natürlich schätzte ich an Rousseau seine Hinwendung zur Natur. Ein Buch wie La Nouvelle Héloïse. Doch was für Schlüsse hat er aus seinem »Contrat social« gezogen! Das führt unweigerlich zur Pöpelrepublik.
Darf man Die Alpen als ein kulturfeindliches Poem lesen: »Ihr Schüler der Natur, ihr kennt noch güldne Zeiten.« Entwicklungsfeindlich wie jedes Lob des Ursprungs? »Du Volk, du aber hüte dich, was größres zu begehren,/Solang die Einfalt dauert, wird auch der Wohlstand währen.« Und antiintellektuell? »Hier hat die Natur die Lehre, recht zu leben,/Dem Menschen in das Herz und nicht ins Hirn gegeben.«
[37] In dem Gedicht »Die Falschheit menschlicher Tugenden« habe ich klar zwischen echter und falscher Kultur unterschieden. Sie sollten die erste Fassung lesen. Nicht die von der Zensur verstümmelte. Ich benutzte die Einwohner der Alpenwelt als –
Als Gegenwelt? So würden wir heute sagen.
Gegenwelt? Anti? Vielleicht. Ich wollte unserer Gesellschaft, meiner Berner Gesellschaft, einen Spiegel vorhalten.
Wie in dem Gedicht »Der Mann nach der Welt«, was wohl soviel heißt wie ein Typ nach dem Geschmack seiner Zeit: ein Nichtsnutz und ein Tunichtgut, einer, wie ihn die verrottete Gesellschaft liebt: »O Zeit, o üble Zeit, wo Laster – pardon – Läster – rühmlich werden.«
Sie erinnern mich an meine jugendliche Empörung: »Das Herz der Bürgerschaft, das einen Staat beseelt,/Das Mark des Vaterlandes ist mürb und ausgehöhlt./Und einmal wird die Welt in den Geschichten lesen,/Wie nah dem Sittenfall der Fall des Staats gewesen.«
Damals waren Sie noch kein Rückkehrer.
Es gab andere, die anders dichteten. Dieser Hardmeyer, Johann Melchior. Einer, der zum Katholizismus konvertierte. Er mit seinen weltlichen und geistlichen Sprüchen. Da tönte es anders: »Schöner Baum der Eidgnosschaft./In dir ist noch Mark und Saft.«
Was mehr Patriotismus als Sinn für Rhythmus verrät.
Die Politiker waren käuflich und die Sitten korrupt. Ich war nicht der einzige, der solches vorbrachte.
Ein Historiker wie Schlözer hat die Berner Regierung als »Kakistokratie« apostrophiert.
Die Kritik hat Tradition. Lange vor mir hat Grob, den [38] ich bereits erwähnte, den Treugemeinten eidgenössischen Aufwecker veröffentlicht, in welchem er die Mißstände geißelte. Eine Flugschrift, die unter dem Pseudonym »Warnmund« erschien. Oder denken Sie an Heutelia, Sie erkennen sogleich das Anagramm für Helvetia. Eine Reisebeschreibung, eine fiktive natürlich. Was man darin alles an Kritik und Vorwürfen findet: eine feile Justiz, Vögte, die bestechlich sind, die Armut der sogenannten Untertanenkantone; der Autor kämpfte gegen den Aberglauben, er forderte die Abschaffung der Vorrechte der Städte, die Vereinheitlichung der Münzen…
Wie hieß dieser Autor?
Das Werk ist anonym erschienen.
Pseudonym, anonym. Was für ein Fressen für die Politische Polizei. Was die alles in die Fichen eintragen konnte.
Fichen?
Ja… Karteikarten einer Subversiven-Registratur, angelegt während des Zweiten Weltkriegs und bis in die neunziger Jahre weitergeführt, einer der Skandale der Nachkriegszeit.
Wir mußten stets mit der Zensur rechnen, der obrigkeitlichen und der geistlichen. Die erste Ausgabe der Alpen ist anonym erschienen. Die zweite trug meinen Namen.
Und die letzte den Namen mit allen Titeln.
Ja, Albrecht von Haller, Herrn zu Goumoens Le Jux und Eclagens. Präsident der königlichen Gesellschaft zu Bern; der Kaiserlichen und königlichen Französischen, Englischen, Preußischen, Holländischen, Edimburgischen, Bononischen, Schwedischen, Arcadischen, Bayrischen, Carinischen, Uppsalischen Academien und Gesellschaften der Wissenschaften Mitglied. Versuch Schweizerischer Gedichte.[39] Elfte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit des hohen Standes Bern gnädigsten Freyheiten.
Mir fällt auf: Wir haben bis heute keine Geschichte des schweizerischen Zensurwesens. Unsere Kulturgeschichte ist aber erst komplett, wenn wir nachlesen können, was einst nicht gelesen werden sollte und was nicht gelesen werden konnte. Eine Geschichte unserer Verbote und Repressionen. Unter Berücksichtigung unserer Vorväter. Ganz im Sinne der Tradition.
»Sag an Helvetien, du Heldenvaterland./Wie ist dein altes Volk dem jetzigen verwandt?« – Was mußte ich mir diese meine eigenen Verse vorhalten lassen.
Sie eignen sich nun einmal für patriotische Feiern. Auch dann, wenn die Schweiz ihren siebenhundertsten Geburtstag begeht. Die Verse eignen sich schon deswegen, weil sie eine Klage sind. Ohne Klage geht es nicht. Ohne Klage, daß es nicht mehr ist wie früher. Was aber, wenn es schon vor zweihundertfünfzig Jahren nicht war wie früher? Die Klage scheint so alt zu sein wie die Vorväter. Aktuell bleibt die Klage, auch dann, wenn Sie schreiben: »Bei solchen Herrschern wird ein Volk nicht glücklich sein./Zu Häuptern eines Stands gehöret Hirn darein.« Ganz ohne Kopf scheint’s doch nicht zu gehen.
Gut – ich wurde Stadtarzt. Man bot mir die Stelle eines Bibliothekars an. Bei der Besetzung wichtiger Ämter aber wurde ich übergangen. Als im Inselspital die Stelle eines dirigierenden Arztes frei wurde, hieß es: Das ist nichts für einen Poeten. Als ich für eine Professur kandidierte, Geschichte und Eloquenz, mußte ich hören: Das ist nichts für einen Arzt.
[40] Und dann sind Sie gegangen. Ein zweites Mal.
Vorher habe ich noch einmal eine Alpenwanderung gemacht. Ich habe noch einmal einen Lieblingsort aufgesucht. Den Bremgartenwald. Dort habe ich…
Sie zögern?
Dort habe ich ein Gedicht begonnen. Vielleicht mein bestes, auch wenn es nicht so berühmt wurde. Immerhin hat Kant, Immanuel Kant, der Philosoph –
Wir lesen ihn noch immer.
Er schätzte meine Verse als erhaben ein. Ein unvollkommenes Gedicht, das heißt, es wurde nie vollendet. Darin der Versuch, die Ewigkeit sprachlich zu erfassen: »Ich häufe ungeheure Zahlen./Gebürge Millionen auf./Ich wälze Zeit auf Zeit und Welt auf Welten./Und wenn ich auf der March des Endlichen nun bin/Und von der fürchterlichen Höh’/Mit Schwindel wieder nach dir sehe/Ist alle Macht der Zahl vermehrt mit tausend Malen/Noch nicht ein Teil von dir/Ich tilge sie und du liegst ganz vor mir.«
In Göttingen hörten Sie auf zu dichten.
So radikal läßt sich das nicht sagen.
Abgesehen von Gelegenheitsgedichten: das Einweihungsfest der Göttingschen Hohen Schule oder die Kantate, die in der allerhöchsten Gegenwart seiner Königlichen Majestät Georg des Andern aufgeführt wurde.
Die Vorsehung hat mich bei unerwarteter Gelegenheit zum Dichter gemacht.
Beim Tod Ihrer Frau.
Einige Tage zuvor hatte ich noch über »Marianens anscheinende Besserung« gedichtet, aber dann lautete der Titel der Trauer definitiv »Beim Absterben meiner geliebten [41] Mariane: »Ich seh’ dich noch, wie sie erblaßt ist./Wie ich verzweifelnd zu ihr trat,/Wie du die letzten Kräften faßtest/Um noch ein Wort, das ich erbat.« Kaum waren wir in Göttingen, starb sie.
Drei Jahre später, bei einem Besuch in der Schweiz, heirateten Sie wieder, die Tochter eines Berner Ratsherrn.
Und das gleiche Geschick. Zwölf Monate später starb sie im Kindbett. Diesmal hatte ich über den Tod meiner zweiten Frau Elisabeth Buchner zu schreiben.
»O nennet mir ein Elend wie das meine,/Und sprecht mir dann das Recht der Tränen ab.«
Manchmal ist mir, als hätten diese Verse über ihren Anlaß hinaus Gültigkeit. Der Trübsinn in mir wirkte stärker als die Heiterkeit und nahm mit dem Alter zu.
Fühlten Sie sich fremd in Göttingen? Aus Ihrer holländischen Studentenzeit stammt ein Gedicht, »Sehnsucht nach dem Vaterland«.
»Hemvé«, wie die Franzosen, von unserer deutschen Sprache inspiriert, das Heimweh nennen, die »maladie suisse«.
Unser guter Zimmermann hat diese Krankheit untersucht. Er hat nachgewiesen, daß sie nicht eine spezifisch schweizerische ist, daß aber die Schweizer diese Art Melancholie für sich reklamieren – überzeugt von den »Vorteilen ihres Vaterlandes«, glauben sie, daß keine andere Nation so viel Anspruch auf Heimweh hat, obgleich andere Völker dazu genauso viel Anlaß hätten.
Vielleicht ist es nicht ein Vorrecht von uns, sondern eine Begabung.
Man könnte auf Zschokke hinweisen. Heinrich Zschokke, naturalisierter Deutscher, hat gut hundert Jahre nach [42] Ihnen Wanderungen unternommen – nicht durch die Alpen, sondern durch die Schweiz. Er konnte das unbehelligt tun: »Kaum ein europäisches Land besitzt eine bessere Sicherheitspolizei mit geringeren Kosten als eben die Schweizer Polizei.« Das dürfte heute, was die Kosten betrifft, anders sein.
Wer an die Ordnung glaubt, muß den Ordnungskräften vertrauen.
Darum geht es in diesem Zusammenhang nicht. An der gleichen Stelle fährt Zschokke fort: »Überall ländliche Wohnungen, vereinzelt, inmitten ihrer herumgelegenen Grundstücke; Dörfer, Weiler, einzelne Höfe fast überall nur eine halbe oder viertel Stunde von einander entfernt; im täglichen Verkehr verwandte Nachbarschaften, wo Jedermann, klein und groß, sich kennt und nennt; – wie würde da verdächtiges Gesindel Gelegenheit finden, sich anzunisten? Oder wie könnte da ein Unbekannter nur vorübergehen, dessen Signalment die männliche und weibliche Neugier nicht sogleich aufnähme? Schon, wer nicht in der gleichen Ortschaft oder Nachbarschaft wohnt, und wäre er auch ein Bürger des gleichen Landes, heißt ein Fremder.« Wir könnten innerhalb des eigenen Landes in die Fremde gehen. Sie gingen in die Fremde jenseits der Grenzen.
Ich hatte meine Arbeit. Die Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, mein Kompendium der schweizerischen Pflanzenwelt, war eine stete Verbindung mit der Heimat. Man kann auch in einem Herbarium oder in einem Botanischen Garten zu Hause sein – ad interim.
Man hat von Ihnen gesagt, ich glaube, es war Herder, Sie trügen eine »Alpenlast von Gelehrsamkeit«, Sie seien der [43] geistvollste Kompilator. Imposant, wenn man an Ihre kritischen Bibliographien denkt – an die Bibliotheca botanica.
Oder die Bibliotheca anatomica. Die Bibliotheca chirurgica. Die Bibliotheca medicinae practicae.
52000Buchtitel hat ein Wissenschaftler gezählt.
Wenn wir schon beim Zählen sind: Da wäre das Handbuch der Physiologie zu erwähnen, acht Bände. Bei meiner Herausgebertätigkeit habe ich gern mit Künstlern zusammengearbeitet, wegen der Illustrationen.
Sie hatten einen Ruf nach Utrecht und einen nach Oxford.
Friedrich der Große wollte mich nach Berlin holen.
Sie aber sind nach Bern zurückgekehrt.
Ich war der Querelen müde. All der Anfeindungen und Anfechtungen. Von den Verleumdungen nicht zu reden. Und dann meine Gesundheit.
Hätte man die nicht auch in Göttingen kurieren können? Bei so vielen Berufungen und Ehrungen – die Wahl in den Großen Rat von Bern soll für Sie einer der glücklichsten Tage gewesen sein.
Ich bin danach noch acht Jahre in Göttingen geblieben.
Dann aber sind Sie zurückgekehrt.
Nicht als Gespenst, sondern als Rathausammann.
In dieser Funktion mußten Sie den Regierungsmitgliedern die Tür aufmachen und als Stimmenzähler wirken. Man spottete über den »großen Haller«. Als Rathausammann durften Sie über die gebrauchten Stoffe verfügen, grünes Tuch. Es heißt, die Kleider Ihrer Kinder seien daraus verfertigt worden, so daß diese alle als grüne Heinriche herumliefen.
Ich war Mitglied des Schulrats. Mir wurde die Revision der Akademie zu Lausanne anvertraut. Ich stand dem [44] Waisenhaus vor. Ich wurde mit archäologischen Aufgaben betraut. Das alles erlaubte mir trotzdem, eine private Arztpraxis zu führen. Und dann wurde ich Direktor der Bernischen Salzwerke in Roche.
Eine glückliche Zeit?
Jeder arbeitet auf seine Weise am Glück der Welt. Trotz aller administrativen Last, die ich nie verabscheute, fand ich Zeit für wissenschaftliche Tätigkeit wie für meine Icones anatomicae, ein Großwerk anatomischer Abbildungen.
Als Ihre Amtszeit zu Ende war, fürchteten Sie, sich wieder mit subalternen Posten zufriedengeben zu müssen. Sie dachten erneut daran, wegzugehen.
König Georg III. bot mir die Stelle eines Kanzlers an. Eine hochdotierte Position. Wieder in Göttingen.
Warum haben Sie nicht akzeptiert?
Meine Familie.
Sie hatten bald nach dem Tod Ihrer zweiten Frau wieder geheiratet.
Meine Frau und meine Kinder, die fühlten sich in Bern daheim.
Aber Ihre Treue wurde nicht belohnt. Sie hatten gehofft, in die eigentliche Regierung gewählt zu werden, in den »täglichen Rat«. Dies war nicht der Fall, obwohl Sie die Hand zur Versöhnung gereicht hatten.
Wie meinen Sie das?
Mit der Bearbeitung Ihrer Gedichte.
Variantes lectiones. Lesarten. Ich habe an meinen Gedichten gearbeitet.
Ich rede nicht von den stilistischen Änderungen, den sprachlichen oder metrischen Verbesserungen.
[45] Ich ließ lieber einen Sprachfehler stehen als einen matten Gedanken.
Ich meine nicht einmal die Kommentare, die Sie zu jedem Gedicht verfaßten. Obwohl die sich wie Herabsetzungen der eigenen Arbeit lesen. Oder sollte zum Beginn der nationalen Poesie auch die Entschuldigung gehören – nicht dafür, daß Sie schweizerische Gedichte schrieben, sondern daß Sie überhaupt Poesie verfaßten?
Meine Gedichte waren immer mühsame Kleinigkeiten. Ich habe in Nebenstunden gedichtet. Im Zustand des Krankseins zum Beispiel oder in einer schwermütigen Stunde. Es gab die Augenblicke, da mich die »poetische Krankheit« befiel.
Ich denke an die Kommentare, in denen Sie das, was Sie einst in Ihren Gedichten geschrieben haben, widerriefen oder es mindestens in Frage stellten – wobei es mich überrascht, daß Sie bei solcher Distanzierung die Gedichte überhaupt auflegten.
Junge Leute, die in Büchern die Welt kennengelernt haben, wo die Laster immer gescholten und die Tugenden immer geehrt und die vollkommensten Muster ihnen vorgemalt werden, fallen leicht in den Fehler, daß ihnen alles, was sie sehen, unvollkommen und tadelhaft vorkommt. Auch ich war einmal jung.
Ihre Sozialkritik wäre am Ende nichts als verfehlter Übermut? Soll man dies so verstehen, wenn Sie dem Gedicht »Die verdorbenen Sitten«, mit dem Sie einst schockierten, Sätze wie die voranstellten: »Der unzweifelhaft blühende Zustand meines glückseligen Vaterlandes bezeugt unwidersprechlich, daß die herrschenden Grundregeln ihrer [46] Vorgesetzten gut und gemeinnützig sind.« Der »unzweifelhaft blühende Zustand« und die »guten und gemeinnützigen Grundregeln«, darüber hatte ein Samuel Henzi eine andere Meinung.
Er war ein Rädelsführer.
Er hatte, mit anderen zusammen, lediglich in einer Bittschrift gefordert, die angestammten Rechte wiederherzustellen und zu respektieren. Die Antwort war Landesverweis. Und als er zurückkehrte, wurde er verhaftet und zum Tode verurteilt.
Er wollte die Regierung mit Gewalt stürzen.
Die Affäre war ein internationaler Skandal.
Die Affäre wurde aufgebauscht.
Lessing hat den Skandal zum Thema eines Theaterstücks gemacht; es ist allerdings Fragment geblieben.
Ich versuchte, Lessing davon abzuhalten.
Wissen Sie, daß ein zeitgenössischer Autor wiederum daran dachte, Henzi auf die Bühne zu bringen? Friedrich Dürrenmatt?
Der mit dem »Morgenessen«?
Während Sie das Aggressive Ihrer Satiren zurücknahmen, verfaßte Henzi mit einem einzigen Satz die schärfste Satire. Als der Scharfrichter beim ersten Mal nicht traf, reckte der Verurteilte noch einmal den Hals: »In dieser Republik sind selbst die Henker schlecht.«
Ein Zeitgeist des Aufruhrs.
Ein demokratischer Aufbruch.
Gegen eine aristokratische Ordnung.
Ein Gespensterkampf? Selbst Ihre Leidenschaften verleugneten Sie. »Doris«, ein Liebesgedicht, das Sie schrieben, als [47] Sie Ihre erste Frau, Mariane, kennenlernten, als Sie davon dichteten, wofür die Weste, die Westwinde, Zeugen sind, Verse, berühmt und oft zitiert, deren Sie sich später schämten: »Komm, Doris, komm zu jenen Buchen,/Laß uns den stillen Grund besuchen,/Wo nichts sich regt als ich und du./ Nur noch der Hauch verliebter Weste/Belebt das schwache Laub der Äste,/Und winket dir liebkosend zu.«
Was uns, wenn wir zwanzig sind, lebhaft und erlaubt vorkommt, scheint mit siebzig töricht und unanständig. Wie ich mir ein Leben im Dienste der Religion vorstelle, habe ich in meinen Briefen über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung dargelegt. Von meinem Spätwerk reden Sie nicht.
Entschuldigen Sie. Ich möchte nicht unterschlagen, daß Sie für die Göttingschen Zeitungen von Gelehrten Sachen –
Später: Göttingsche Anzeigen von Gelehrten Sachen.
An die neuntausend Rezensionen sollen Sie dafür verfaßt haben, vorab wissenschaftliche Werke annoncierend, aber auch literarische.
Mindestens sagen Sie nicht, ich hätte bei diesem Gespensterkampf keine Kenntnis genommen von dem, was zu meiner Zeit publiziert wurde.
Anläßlich Ihrer Briefe über die Offenbarungswahrheiten meinen Sie, daß »die Angelegenheiten der Ewigkeit« zu ernst seien, als daß man sie »mit einer Geschichte vermischen sollte, worin von Liebe und Krieg und von anderen Geschäften des gemeinen Lebens« die Rede ist. Die Geschichte (oder die Literatur?) als Störenfried der Belehrung?
Ich habe auch an einem Dichter wie Homer das Didaktische vermißt.
[48] Und ihn dafür getadelt. Sollte zu Ihnen als dem Anfang der nationalen Poesie auch das Bekenntnis zum Didaktischen gehören? Der Autor nicht auf der Suche nach einem Publikum, sondern auf der Suche nach einem Klassenzimmer? Warum aber schrieben Sie trotzdem Romane?
Ich weiß, daß diese Bücher kaum Anklang fanden. Vom Verstandenwerden schon gar nicht zu reden. Sie waren unzeitgemäß.
Daran allein kann es nicht liegen.
In Usong stellte ich die ideale Staatsführung einer absoluten Monarchie dar, ohne einem blinden Lob der Monarchie zu verfallen. In Alfred behandelte ich die gemäßigte Monarchie, die englische Staatsverfassung. In Fabius und Cato versuchte ich zu zeigen, daß eine Republik mit ihren republikanischen Rechten nicht zu weit gehen sollte.
Usong spielt im Orient, in Persien, Alfredin einem historischen England. In Fabius und Cato verteidigt der Altrömer Cato den republikanischen Staat gegen die demokratischen Ideen des Sophisten Karneades. Ferne Schauplätze und historische Situationen: Sollte ein Weggehen denkbar sein, das einem erlaubt zu bleiben, indem man thematisch auswandert?
Gemeint war immer Bern.
Weshalb haben Sie es nicht genannt? Einem Helden in Usong leihen Sie viel von Ihrem Leben, viel von den bitteren Erfahrungen, die Sie in Bern machen.
Meine Helden sind exemplarisch.
Exemplarisch bis zu jener Allgemeingültigkeit, die keiner konkreten Situation mehr weh tut? Weshalb überhaupt die Romanform?
[49] Um Leute anzulocken, die ein bloß ernsthaftes Buch nicht in die Hände nehmen würden.
Literatur als Lockmittel? Als Falle? Als Verpackung?
Ich habe in meinen Romanen eindeutig Stellung bezogen – oder beziehen lassen.
Eindeutig zum Beispiel Ihre Abrechnung: »Die Herrschaft des Volkes ist wesentlich der Sitz der Aufruhren.«
Man kann in der Tat in die Fremde gehen, auch wenn man bleibt, dann, wenn die eigene Zeit immer fremder wird.
Sie sind zu einem Buch gekommen, das Sie selber nicht veröffentlichten, das erst nach Ihrem Tod herauskam.
Mein Journal?
Welches Ihr Herausgeber betitelte Tagebuch seiner Beobachtungen über Schriftsteller und sich selbst.
Notizen über Autoren, Werke und Themen, die mich bewegten – aber wozu diese »Aufzeichnungen« um Stellen aus meinem privaten Tagebuch ergänzen?
Man könnte sich diese Mischung noch konsequenter denken: die Auseinandersetzung mit seiner intellektuellen Zeit und parallel dazu zeigen, wie der Autor mit sich selber umgeht.
Das lag nicht im Trend.
Sie nehmen mit Ihrem Tagebuch mehr an unserer nationalen Literatur teil, als Sie vielleicht vermuten. An jener Literatur der Introspektion, die Tradition haben wird – als Selbstschau und mit dem Tagebuch als literarische Form. Und selbst mit Ihrem schlechten Gewissen partizipieren Sie an dieser Literatur, wenn ich an unsere Jahrzehnte denke – da wird das schlechte Gewissen selbst von solchen [50] kultiviert, die gar nicht sündigten – aus purer moralischer Bereitschaft.
Ein Lavater hat selber sein Tagebuch eines Beobachters seiner selbst herausgegeben.
Man könnte auch die pietistische Erweckungsliteratur Ihrer Zeit anführen.
Ich habe schon anfangs gesagt, daß mich Autobiographisches interessiert. Denke ich an das Jahrhundert vor mir, fällt mir kaum Erzählendes ein. Dafür die Autobiographien der beiden Walliser Platter, des älteren Thomas und des jüngeren Felix, des Geißbuben, der zum Gelehrten wurde, und des berühmten Mediziners.
Aber Ihre Art, sich mit sich selber zu beschäftigen, zählt zu einer Literatur, die bei uns Tradition hat. Amiel ist nicht bloß ein Sonderfall des neunzehnten Jahrhunderts: der Mann, der mit »Roulez tambours« ein vaterländisches Lied dichtete und sich über Tausende von Seiten hinweg der Selbsterziehung ausliefert. An seinem »Journal intime«, oder genauer, an solcher Literatur der Introspektion, haben sich eine Reihe welscher Autoren inspiriert. Man wird Sie jedenfalls auch dort nennen müssen, wo sich Schreiben als Sichverkriechen und In-sich-selbst-Verkriechen betätigt.
Das Tagebuch war ein Ort meiner Zuflucht.
Ein Ort der Peinigung und Zerknirschung, der Infragestellung und Selbstquälerei.
Ich war Beobachter meiner selbst. Vielleicht schon, weil ich Arzt war. Als ich einem Freund die Geburt meines ersten Sohnes mitteilte, geriet mir die Freudennachricht zu einer veritablen Beschreibung einer Entbindung.
Waren Sie süchtig?
[51] Meine Alterskrankheiten zogen sich hin. Gicht. Und dann mein Nieren- und Blasenleiden. Ein Schmerz, den ich mit Opium linderte.
Und die Dosierung?
Meinen Sie die Dosierung des Schmerzes oder die Dosierung des Opiums?
Sie haben über den Verlauf der Krankheit einen Bericht verfaßt und der Göttingschen Akademie zur Verfügung gestellt.
Das eigene Leiden als Anlaß fürs Schreiben, nicht weil es ein eigenes ist, sondern weil es Kompetenz verleiht darzustellen, was, woran und wie ein Mensch leidet.
Wenn solche Absicht literarisches Programm geworden wäre. Noch kurz vor Ihrem Tod, so ist in Ihrem Tagebuch zu lesen, quälten Sie sich mit Vorwürfen wegen Ihres ungenügend christlichen Verhaltens. Als es ans Sterben ging, erlebten Sie einen Moment hoher Luzidität: Sie fühlten sich selber den Puls.
Il bat, il bat, il bat – plus.
Er schlägt, er schlägt, er schlägt – nicht mehr.
[52] Salomon Geßner und die leichte Flöte
»Diese Dichtungsart bekommt besonderen Vorteil, wenn man die Szenen in ein entferntes Weltalter setzt; sie erhalten dadurch einen höheren Grad der Wahrscheinlichkeit, weil sie für unsere Zeit nicht passen, wo der Landsmann mit saurer Arbeit untertänig seinem Fürsten und den Städten den Überfluß liefern muß und Unterdrückung und Armut ihn ungesittet und schlau und niederträchtig gemacht haben.«
Erstaunlich, daß man diesen Sätzen praktisch kaum im Wortlaut begegnet, liest man über den Autor und sein Werk.
Als Salomon Geßner (1730–1788) diese besondere Dichtungsart in der Einleitung zu seinem Idyllen-Band darlegte, war er sechsundzwanzig Jahre alt. Er hatte bereits einige Dichtungen veröffentlicht, Über die Nacht und Daphne. Ein junger Literat, der erste europäische Anerkennung erlangt hatte und der zu seinen Bekannten literarische Persönlichkeiten wie Ewald von Kleist oder J. W. L. Gleim zählen durfte. Den großen internationalen Erfolg brachten die Idyllen, die 1756 herauskamen und die in zweiundzwanzig Sprachen übersetzt wurden.
Der Autor, der so hart über den damaligen Bauernstand urteilte, war ein Städter. Er entstammte dem Zürcher [53] Patriziat. Allerdings hatte er sich als sperriger Jüngling erwiesen, so daß man ihn zur Nacherziehung nach Berlin in eine Buchhändlerlehre schickte. Nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt erwies er sich zunehmend als nützliches Glied der Gesellschaft. Er, der sich einen Namen als Dichter gemacht hatte, trat in die väterliche Firma ein. Er wurde ein anerkannter Drucker, Verleger, Buchmacher, Graveur. Dank seiner Heirat mit Judith Heidegger festigte er Firma und Haushalt; sie war die Tochter eines Buchdruckers, des Konkurrenten seines Vaters. Die Heirat war eine gewerblich-handwerkliche Bett-Fusion.
Nun hatte Geßner in der Einleitung zu seinen