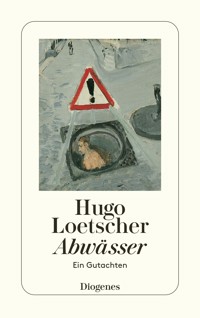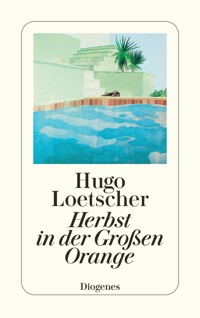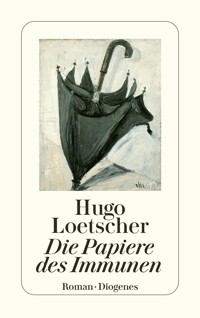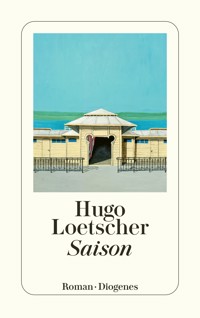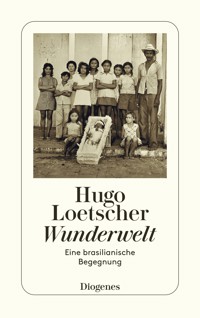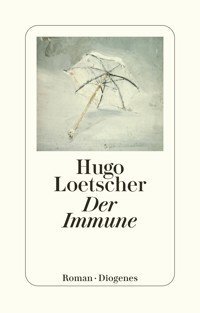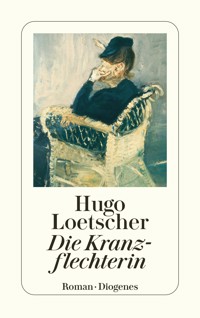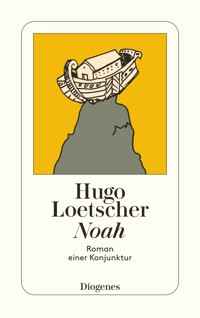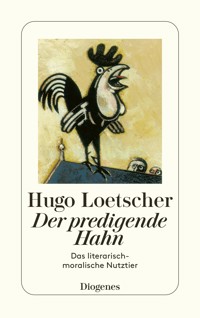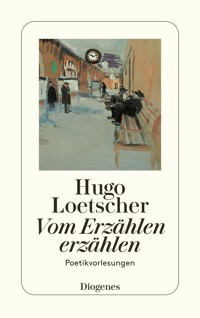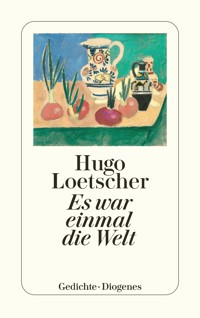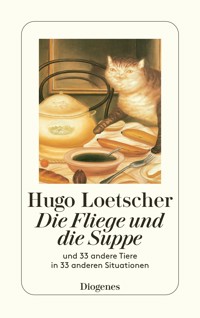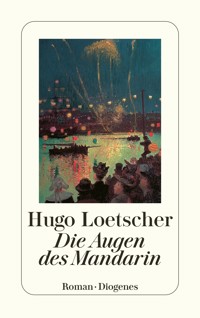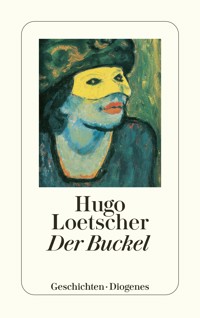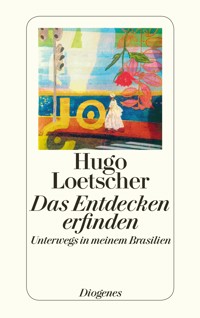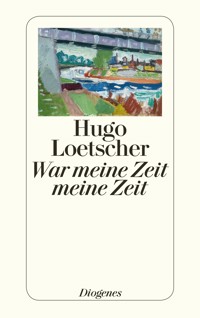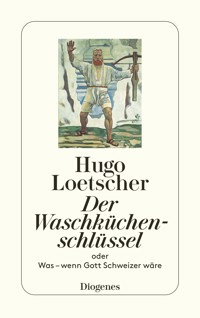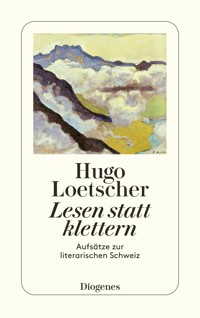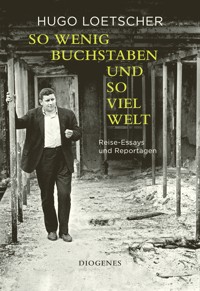
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hugo Loetscher war ein Schriftsteller, der »erfahren wollte, was mir als Welt zugefallen war«. Von der Schweiz aus brach er in alle Himmelsrichtungen auf, oft im Auftrag von Zeitungen und Magazinen, für die er kenntnis- und geistreiche, literarisch funkelnde Essays und Reportagen schrieb. Loetschers Blick für die Gleichzeitigkeiten und Mischformen einer globalisierten Welt ist ungemein modern, sein Stil immer originell und überraschend. Dieser Band ist ein wunderbarer Ausgangspunkt, um einen der großen Schweizer Autoren und Publizisten neu- oder wiederzuentdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Hugo Loetscher
So wenig Buchstaben und so viel Welt
Reise-Essays und Reportagen
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Jeroen Dewulf und Peter ErismannMit einem Bildteil
Diogenes
Literatur und Journalismus
Ein (helvetischer) Überblick – mit (nicht-helvetischem) Seitenblick
1999
Wie Geschwister, ob Hand in Hand oder feindlich, sie kommen voneinander nicht los –
wie oft wurde ich gefragt, ob und wie sich Journalismus und Literatur beruflich vertragen. Als ob der Lehrer in unseren Autoren der Literatur so zuträglich ist. Aber die Alpen-Muse scheint sich wohler zu fühlen in der Schulstube und auf der Kanzel als in einem Redaktionsbüro.
Erstaunliche Bedenken, wenn man die journalistischen Auftritte von Schriftstellern vor Augen hat – und nicht nur, weil viele Schriftsteller in ihren Anfängen journalistisch arbeiten oder zwischendurch für die Zeitung schreiben, selbst die renommiertesten: Der junge Max Frisch hat in den Dreißigerjahren Artikel in der NZZ veröffentlicht, und Friedrich Dürrenmatt war kurze Zeit für die Weltwoche als Theaterkritiker tätig.
Ohne große Mühe lässt sich zwischen Literatur und Journalismus eine Personalunion ausmachen, auch wenn es sich gewöhnlich um Redaktoren des Ressorts Kultur handelt. Zu den Schriftstellern, die als verantwortliche Feuilletonredaktoren zeichneten, gehörten dem Temperament und der Diktion nach so unterschiedliche Autoren wie Hermann Burger, Dieter Fringeli oder Walter Matthias Diggelmann.
Aber Feuilletonredaktor oder Feuilletonredaktorin zu sein (Redakteur, wie der bundesdeutsche Lektor korrigieren würde), diese Tätigkeit kann sich nachteilig auswirken, nicht unbedingt auf die schriftstellerische Arbeit selber, aber auf die Akzeptanz als Schriftsteller. Der Redaktor steht dem Schriftsteller im Weg bei der Rezeption durch die Kritik. Diese zurücksetzende Erfahrung dürfen sich Hanno Helbling (langjähriger Feuilletonchef der NZZ) oder Peter K. Wehrli (Redaktor beim Deutschschweizer Fernsehen) teilen, wenn sie mit belletristischen Büchern an die Öffentlichkeit treten.
Jeder von uns hat im Bauch ein ungeschriebenes Buch, erst recht jemand, der beruflich mit Schreiben zu tun hat. So kommt es zur Abstecher-Literatur, ein unberücksichtigtes Kapitel, das nicht über Literatur Auskunft gäbe, dafür über den gängigen Literaturbetrieb. Die Buch-Sehnsucht kennt ein Schema: Der Feuilletonredaktor veröffentlicht einen Roman, dem er später ein zweites Buch nachschickt, diesmal gesammelte Artikel. Und dass ein Redaktor nach seinem Abgang als Ehrenredaktor im Impressum figuriert, ist ein Novum in der Geschichte der Presse und der Ambitionen.
Durch das Zusammenleben von Literatur und Journalismus spukt der Wunsch vom Aussteigen: nicht mehr nur für den Tag schreiben. Als ob es schöpferischer Freiheit gleichkommt, kein fixes Gehalt zu haben, als ob es erhebend ist, statt eines Leserbriefs einen Verriss zur Kenntnis zu nehmen, als ob zur literarischen Produktion nicht auch Ramsch gehört, der »Restseller«. Dass die Beendigung einer Journalisten- und Redaktortätigkeit eine Trennlinie zieht, hinter der ein neuer, ein literarischer Lebensabschnittt beginnt, dafür bietet Laure Wyss mit ihrer Prosa und Lyrik ein seltenes Beispiel.
Publiziertes aus der Vergänglichkeit der Tagespublikation herüberzuholen (herüberzuretten), kann [sich lohnen. Das] macht eine Standortbestimmung der schweizerischen Gegenwartsliteratur klar, wie wir sie dank des Sammelbandes Lesarten von Beatrice von Matt vor uns haben. Nicht weniger bemerkenswert die Bilanz Meindreiviertel Jahrhundert, wie sie nur der homme de lettres François Bondy mit Artikeln und Essays ziehen kann.
In irgendeiner Ecke träumt der Journalismus von der kleinen Ewigkeit zwischen zwei Buchdeckeln –
hinter der Frage, wie vertragen sich Journalismus und Literatur, steht die Auffassung, wonach Literatur der Ewigkeit und dem Allgemeingültigen verpflichtet ist: Wie soll, was für Höheres vorgesehen, in die Niederungen gehen. Eine Entsprechung fand diese Haltung lange genug in der grundsätzlichen Distanz, welche der akademische Bereich gegenüber dem journalistischen einnahm. Wie das Literaturgespräch profitiert, wenn der Graben überbrückt wird, beweist Peter von Matt, brillant als Germanist wie als Literaturkritiker. Es gab stets Ausnahmen, man nehme von dem Basler Germanisten Walter Muschg bloß die Sammlung Pamphlet und Bekenntnis zur Hand. Leider blieb der ad personam Werner Weber geschaffene Lehrstuhl für Literaturkritik an der Universität Zürich eine einmalige Einrichtung.
Das elitäre Sich-Absetzen hat Tradition, vor allem deutsche. Das verhält sich in anderen Sprachkulturen anders –
man darf für ein erstes Kontrastprogramm Angelsachsen anführen, Engländer wie Amerikaner. Literaturgeschichte ist ein gutes Stück Geschichte der Publizistik. Die Namensliste ist kaum zu erschöpfen. Jonathan Swift war Redaktor und Herausgeber wie Daniel Defoe oder Mark Twain, der Romancier Theodore Dreiser so gut wie der Lyriker Samuel Taylor Coleridge. Frank Norris war Kriegsberichterstatter im spanisch-amerikanischen Krieg, Stephen Crane im griechisch-türkischen und George Orwell im Spanischen Bürgerkrieg. Eine journalistische Tradition, die von den Pamphletisten des 18. Jahrhunderts bis heute reicht, zu Ernest Hemingway und seinen Berichten über den Stierkampf oder Afrika, zu John Dos Passos oder Graham Greene – was wäre The New York Review of Books ohne Thomas Wolfe oder Gore Vidal.
Ein zweites Kontrastbeispiel mag die spanisch-hispanoamerikanische Publizistik bieten. Gabriel García Márquez hat seine Zeitungsartikel in mehreren Bänden gesammelt; er träumte nicht nur von einer eigenen Zeitung; zu seinen Plänen gehörte schon immer die Gründung einer Journalistenschule. Neben dem Kolumbianer Márquez der Peruaner Mario Vargas Llosa, der Mexikaner Carlos Fuentes oder der Kubaner Guillermo Cabrera Infante, Namen, die um viele andere und gleichrangige ergänzt werden könnten, durch einen Spanier wie Juan Goytisolo oder Manuel Vázquez Montalbán. Wenn El País eines der führenden Blätter Europas ist, dann nicht zuletzt, weil die Zeitung für spanische und hispanoamerikanische Schriftsteller ein Forum darstellt, und dies nicht nur im Gehege der Feuilletonseiten.
Solches ist nicht unbedingt deutsch, obwohl –
die deutsche Klassik beginnt mit dem Zeitungsschreiber Gotthold Ephraim Lessing, der als einer der Ersten versuchte, vom Schreiben zu leben; er betreute in der Vossischen Zeitung die Monatsbeilage »Das Neueste aus dem Reich des Witzes« und verfasste seine Hamburgische Dramaturgie, die eine Grundlage literarischer Kritik werden sollte, als Artikel für die Kaiserlich-privilegierte Hamburgische Neue Zeitung. Hört es sich nicht nach modernstem Boulevard-Konzept an, wenn Johann Peter Hebel 1806 den Kurfürstlich badischen gnädigst privilegierten Landkalender für die badische Markgrafschaft lutherischen Anteils in den Jährlichen Hausfreund umtauft und als Redaktionsprogramm vorschlägt: »politische Begebenheiten des vorigen Jahres, Mord- und Diebesgeschichten, verunglückter Schatzgräber- und Gespensterspuk, Feuersbrünste, Naturereignisse, edle Handlungen und witzige Einfälle«.
Es gibt seit dem 18. Jahrhundert eine journalistische Tradition in der deutschen Literatur – zu Avantgardisten des literarischen Journalismus zählt der Volkssänger Christian Friedrich Daniel Schubart mit seiner Teutschen Chronik (1774–1777), die jeden Montag und Donnerstag erschien, wie Georg Forster, der Weltreisende, mit seinen Berichten über die Französische Revolution oder der Autor der Reisen eines Deutschen in Italien, Karl Philipp Moritz. Was damals an Reiseschilderungen veröffentlicht wurde, waren Vorläufer der (Reise-)Berichterstattung, wie sie mit Heinrich Heine und Ludwig Börne literarischen Rang erzielte, ein Anspruch, der weiterwirkte, bis zu Theodor Fontane, der in der Mark Brandenburg wanderte, oder bis zu Egon Erwin Kisch, der als rasender Reporter über alle Welt berichtete.
»Briefe aus …« waren Vorläufer der Reportage. Es konnten »unterhaltsame Aufsätze« sein, wenn man an die Briefe von Georg Christoph Lichtenberg aus England denkt. Und Information aus erster Hand, ob es von Nikolai Karamsin die Briefe eines russischen Reisenden sind oder solche, die Gustave Flaubert aus Ägypten nach Paris schickte. Als journalistische Gattung hat der Brief bis heute Bedeutung behalten. The New Yorker liefert dafür besten Lektüren-Beweis: Letters from Paris von Janet Flanner und ihrer Nachfolgerin Jane Kramer.
Wie sich aber auf Deutsch die Vorstellung von hoher Literatur und niedrigem Journalismus mit nebulöser Hartnäckigkeit behauptet, hat in jüngster Zeit der Dramatiker und Erzähler Botho Strauß deklamiert. In seinem Aufstand gegen die sekundäre Welt propagiert er anstelle von Aktualität »Anwesenheit von mythischen Zeiten«.
Unabhängig solch hartnäckiger Neo-Mythomanie hat sich das Verhältnis von Literatur und Journalismus in den letzten Jahrzehnten geändert –
einmal, weil sich das Literaturverständnis selber geändert hat, und sei es nur, dass der Essay nicht länger ein Gastarbeiterdasein führt, und dass Tagebuch wie Notizen literarische Anerkennung finden. Man darf von »literarischen Reportagen« reden, wenn man an die Sammelbände von Jürg Federspiel denkt Die beste Stadt für Blinde oder Wahn und Müll. Eine Reihe von Autoren führen in ihrer Bibliografie Reportagen auf, so Gerold Späth mit den Reisebildern Von Rom bis Kotzebue oder Manfred Züfle mit seinen »Geschichten aus Europa« (Der Löwe im Kloster).
Wie sich der Begriff des Literarischen erweitert und aufgefächert hat, mögen ein paar Titel illustrieren. Zum Beispiel: Bern 1972. Ein politisches Tagebuch und Ruhe und Ordnung. Aufzeichnungen. Abschweifungen 1980–1983 nehmen im Œuvre von Kurt Marti neben Gedichten und Erzählungen einen festen Platz ein. Hans Rudolf Hilty hat »erzählerische Recherchen« unter dem Titel Risse herausgegeben und so auch sein Buch über Bruder Klaus oder zwei Männer im Wald charakterisiert. Rolf Geissbühler verfasste eine »Aufsatz-Trilogie«. Iso Camartin hat neben essayistischen Prosatexten seine Einleitungen zu TV-Kulturfilmen als »52 Flash-Geschichten« (Der Teufel auf der Säule) veröffentlicht.
International erfolgreiche Beispiele für »non fictional novel« boten Amerikaner: Norman Mailer (Heere aus der Nacht oder Auf dem Mond ein Feuer) und Truman Capote mit Kaltblütig, ein »wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen«, wie der bezeichnende Untertitel lautete. Die Trennung von Literatur und Journalismus wurde porös. Was auf der einen Seite Gewinn war, verführte zu Kriterienlosigkeit. Schrieb ein Autor einen engagierten Roman und führte er darin Dinge an, die faktisch nicht richtig waren, berief er sich auf dichterische Freiheit; stellte man die künstlerische Qualität infrage, wurde einem bedeutet, dass es sich primär nicht um Kunst handelt.
Ein neues Beispiel für subtiles Manövrieren bot Peter Handke. In Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina attackiert er journalistische Praktiken; er versucht »Gerechtigkeit für Serbien« herzustellen, indem er über allem schwebend von Nichtgenehmem absieht. In seinem »sommerlichen Nachtrag« deklariert er den winterlichen Reisebericht als Erzählung; damit entzog er sich und sein Werk dem Argumentieren, das sich auf Faktisches berufen konnte. Handke kniff zweimal, einmal inhaltlich und einmal formal.
New Journalism und Autoren-Journalismus legitimierten und forderten die subjektive Perspektive: teilnehmender Journalismus, Information, bei der der Schreibende Teil der Erkenntnis ist. Das verhalf dem journalistischen Schreiben zu Perspektive und Aspektreichtum. Zugleich zeitigte es eine Subjektivierung, die in purer Unverbindlichkeit oder bloßer Originalität stecken blieb. Als ob das Privat-Persönliche als Maßstab genüge. Meinungspresse heißt nicht, dass die eigene Meinung wichtiger ist als das, worüber man sich eine Meinung bildet.
Literatur und Journalismus sind sich aber auch nähergekommen, soweit der Schriftsteller seine Rolle als gesellschaftlich-politische Verpflichtung verstand. Eine Konzeption, die in einem Land willkommen war, in dem das Pädagogische schon immer zur Legitimierung von Literatur und Kunst genutzt wurde.
Wie der Journalismus von Buchdeckeln träumt, kennt die Literatur den Traum, einmal mit dem Wort wirken zu können –
der Gesellschaft ein J’accuse entgegenschleudern. Die Bereitschaft für eine Anklage war gelegentlich so groß, dass der heilige Zorn sich auf die Suche nach einem Anlass machen musste.
Niklaus Meienberg schuf mit seinen Berichten eine eigene literarische Form der Reportage. Und wie sich die Rolle eines Schriftstellers als praeceptor Helvetiae in Medienbeiträgen niederschlägt, lässt sich in den Sammelbänden von Adolf Muschg lesen: Die Schweiz am Ende. Am Ende die Schweiz und O mein Heimatland!. Gibt es nicht auch, was man einen mündlichen Journalismus nennen könnte? Gegenwort von Otto F. Walter enthält Reden, die er anlässlich von Manifestationen und Protestaktionen hielt; was in Mundart gesprochen, wurde in der Publikation in hochdeutscher Fassung veröffentlicht.
Wenn in den Neunzigerjahren die Autoren nicht mehr in gleichem Maß und mit gleichem Gewicht wie in den Siebziger- und Achtzigerjahren Jahren sich zu Wort meldeten, hat das mit der Änderung der politisch-ideologischen Situation zu tun. Das gilt nicht nur für die Schweiz. Man darf sich an die Jahre erinnern, als die terza pagina des Corriere della Sera italienischen Schriftstellern als Forum diente, auch an das Aufsehen mag man sich erinnern, als der Artikel eines Schriftstellers (Pier Paolo Pasolini) nicht auf der dritten Seite erschien, sondern auf der Frontseite.
Das Ende des Kalten Krieges bedeutete zwar ein Ende der militanten Stellungnahmen in einer Zweifronten-Welt, anstelle von Ideologie Pragmatik und statt Manifest-Unterschriften Analysen. Die Probleme waren damit nicht aus der Welt geschafft, in deren Namen die Ideologien einander bekämpften – soziale Problematik hat keine modische Aktualität. C.A. Loosli, dieser »unliterarische Schriftsteller«, machte sich einst aufgrund seiner Anstaltserfahrungen zum Anwalt der Benachteiligten (nachzulesen in Ihr braven Leute, nennt euch Demokraten), in unseren Jahren desgleichen Mariella Mehr, wenn sie sich für die »Fahrenden« einsetzt (Rückblitze).
Nach 68 war das moralische Engagement so opportun wie es dies vor 68 schon immer gewesen war – seit der Zeit, als der Bänkelsang das Zeitungslied ablöste, als »Zeitung« noch mündliche Nachricht hieß, als die Illustrierte aus einem einzigen Druckblatt bestand. Bis zu Schriftsteller-Publizisten wie Kurt Tucholsky. Oder um Pro-memoria-Beispiele zu geben: Anton Čechov hat in seinem Bericht über die Insel Sachalin, der 1893 in der Zeitschrift Russisches Denken erschien, die Zustände auf der Verbannteninsel gebrandmarkt und mit seiner Veröffentlichung Reformen erwirkt. Nicht minder hat André Gide die Öffentlichkeit mobilisiert, indem er nach seinen Reisen in Afrika die französische Kolonialpolitik bloßstellte.
Wie könnten Journalismus und Literatur voneinander lassen, da sie ja beide Geschöpfe des gleichen Ursprungs sind, der Sprache –
sowenig es Literatur schlechthin gibt, gibt es keinen Journalismus schlechthin. Die Medienpräsenz von Autoren kann und konnte recht unterschiedlich sein – Annemarie Schwarzenbach war für ihre Berichterstattung mit der Kamera unterwegs, Anne Cuneo arbeitet als Filmemacherin, Dante Andrea Franzetti als Auslandkorrespondent, Jürg Acklin als Mitglied eines Frageteams bei der Kultursendung Sternstunde im Deutschschweizer Fernsehen, Peter Zeindler ist Moderator des Zürcher »Bernhard Littéraire«, Eveline Hasler als Kolumnistin und Martin Suter als Kolumnist, Étienne Barilier hat seine Fernsehkritiken unter dem Buchtitel Un monde irréel herausgegeben.
Die analytische Begabung für einen Leitartikel ist was anderes als die Fähigkeit, ein Geschehnis oder ein Erlebnis anschaulich darzustellen, das Communiqué, das streng objektausgerichtet ist, steht neben dem Ich der Kolumne, das Infotainment neben dem essayistischen Journalismus.
Unweigerlich kommt es auch zur Verführung. Die Literarisierung kann sich stilistisch äußern, indem der Zeitungsschreiber sich selber als Muse küsst und so blumig wird, dass vor lauter Lust an der Metapher die Information auf der Strecke bleibt. Da das Deutsche sich für verbale Neuschöpfungen eignet, nährt es die Illusion, mit einem Neologismus sich das Denken ersparen zu können. Eine beliebte Literarisierung manifestiert sich bei der Titelei: neben dem Sachtitel ein Fantasietitel, auch wenn, wie beim Sexappeal oft, das Versprechen nicht gehalten wird. Zudem die Mode, den Stabreim zu pflegen, indem man verschiedenartige Nachrichten unter einen Hut bringt: Gekonnt, geglaubt, gefeuert – Beispiele journalistischer Aufmacherprosa.
Wie sollte die Literatur vom Journalismus lassen, schließlich gibt es in den Zeitungen die Begegnungsspalten des Feuilletons –
wohl nicht zufällig stammt die Bezeichnung aus dem Französischen. Aus einer Zeit, als mit dem Aufkommen der Tagespresse auch der Kulturjournalismus an Bedeutung gewann und Frankreich eine führende Rolle übernahm für all das, was »unterm Strich« erschien. Am Beginn der journalistischen Moderne stehen illustre Namen. Charles Baudelaire hat neben den berühmt gewordenen Kunstkritiken auch Buchrezensionen veröffentlicht, ein Lyriker, der bekannte, dass das Genie beim Alltag in die Lehre gehen soll; er hatte sich für Edgar Allan Poe eingesetzt, der sich seinerseits verhasst machte wegen seiner Verrisse zeitgenössischer Lyrik. Mit den Causeries du lundi hat Charles-Augustin Sainte-Beuve vorgemacht, welches Niveau man mit einer wöchentlichen Rubrik halten kann, aber auch ein Beispiel dafür bietend, mit welcher Eloquenz man sich irren kann.
Mit Feuilleton wird sowohl ein Ressort wie eine Gattung bezeichnet. Ein Terrain, wo die Literatur angestammten Platz fand.
Einmal als Ort der Diskussion, indem sich Autoren mit den Werken anderer Autoren auseinandersetzen, der Schriftsteller als Kritiker oder als Informant – von unbestrittenem Gewinn, wenn Ilma Rakusa über slawische Literatur orientiert oder Felix Philipp Ingold über die internationale Avantgarde, wenn Al Imfeld über die afrikanischen Literaturszenen schreibt oder Jürg Laederach über zeitgenössische angelsächsische Literatur und Musik.
Das Feuilleton aber auch als Ort, wo Literatur mit Originaltexten auftreten kann. Mit der Chance des Feuilletonromans ist es allerdings vorbei. Unter Werner Weber waren in der Beilage »Kunst und Literatur« der NZZ regelmäßig Proben aus dem zeitgenössischen literarischen Schaffen vorgestellt worden, eine Reihe von Autorinnen und Autoren kamen damit zum ersten Mal zu Lesern.
Natürlich können literarische Zeitschriften diese Funktion von Erstvermittlung übernehmen, aber wegen ihrer geringen Auflagen richten sie sich nur an ein kleines Publikum. Zeitschriften übrigens, die weitgehend von Schriftstellern betreut oder ins Leben gerufen wurden. Jacques Chessex hat mit Bertil Galland Écriture gegründet, und Christoph Geiser war Mitbegründer von drehpunkt. Die Roman- und Theaterautoren René Zahnd und Jean-Louis Kuffer zeichnen als verantwortliche Redaktoren von Le Passe Muraille, Werner Bucher boxt seit über zwanzig Jahren Orte durch, Peter Stamm redigiert die Vierteljahresschrift Entwürfe. Ein singulärer Fall war Unsere Meinung, die Einmann-Zeitschrift, die R.J. Humm von 1948 bis 1977 herausgab.
Nun gibt es ein journalistisches Podium, das sich um kein Ressort zu kümmern braucht, die Kolumne, die sich wie kaum eine zweite Sparte für literarischen Journalismus eignet. Urs Widmer hat die PS, die er während anderthalb Jahren für die Schweizer Illustrierte verfasste, im Buch vereint Auf auf, ihr Hirten, die Kuh haut ab!. Bei Peter Bichsel wurde die Kolumne stilbildend zu einem literarischen Genre; er hat seinen Geschichten zur falschen Zeit die Kolumnen von 1990 bis 1994 folgen lassen: Gegen unseren Briefträger konnte man nichts machen.
Die Kolumne ermöglicht einem Autor Präsenz: Die Tessiner Literaturszene wäre ohne die Rubrik von Piero Bianconi im Eco di Locarno profilloser gewesen, genau wie wenn Giorgio Orelli nicht mehr seine vierzehntäglichen Kommentare in der Azione schreiben würde. In welchem Maß die Kolumne eine feste und vom Publikum geschätzte Einrichtung ist, dafür bieten die brasilianischen Medien ein Beispiel mit den cronicas. Kaum ein Autor von Belang, der nicht in einer Zeitung oder Zeitschrift seine Kolumne hätte.
Nun bedeutet die Kolumne auch eine Chance, die nationale und nationalsprachliche Grenze zu überschreiten. In Le Temps wechseln sich in der Chronique d’écrivain die Franzosen Jean Rouaud und François Bon mit den Schweizern François Debluë und Sylviane Dupuis ab. In der Weltwoche der Österreicher Josef Haslinger und die Amerikanerin Donna Leon mit dem Israeli Meir Shalev und der Kroatin Dubravka Ugrešić. Man kann hinzufügen: Dem Italiener Antonio Tabucchi steht eine Rubrik in El País zur Verfügung.
Die Kolumne ist ein Idealfall journalistischer Präsenz eines Autors: wenn sich stilistische Freiheit mit der carte blanche der Gesinnung vereinen kann.
Stiehlt der Journalismus, ungeachtet dessen, der Literatur die Show –
da war von literarischer Seite zu hören, dass wir in einer Zeit des »Feuilletonismus« leben, als ob die Zeitung wie ein Fluch über der Literatur laste, seichte Feuilleton-Kultur, wie Hermann Hesse sie verdammte, eine bezeichnend deutsche Prägung, die wie in der Musik sich kein U für ein E vormachen lassen will.
Grundsätzlicher waren die kulturkritischen Überlegungen, wonach das moderne Pressewesen der Literatur mindestens streckenweise den Garaus machte. Walter Benjamin war überzeugt, dass in der Moderne das Erzählen durch »Information« ersetzt werde. Robert Musil notierte, dass mit der Zeitung (die das Neue bietet) das Erzählen und damit der Roman in die Krise geraten ist.
Doch war nicht ein Ende des Erzählens annonciert, sondern die Prosa sah sich gezwungen, sich auf ihre eigenen Voraussetzungen zu besinnen. Beide können erzählen, der Journalismus wie die Literatur, aber der Journalismus wird dies diskursiv und argumentativ (und damit gegenargumentativ) tun, es bleibt der fabulierenden Inspiration ein weites Feld, da die Literatur das Wort nicht informativ verwendet.
In Fortsetzung negativer Bilanzierung hat man davon gesprochen, dass auf ein schöpferisches Zeitalter ein sozialkritisches folgte, dessen Errungenschaft der Journalismus ist, der sich unter dem Diktat der Informatik über die Medien hinaus aller Kulturbereiche bemächtigte. Demzufolge, ganz im Zeichen bloßer Reaktion, die »Remythologisierung«, und dies zu einem Zeitpunkt, da sich nach wie vor Mythen aufs Hartnäckigste gegen alle In-Frage-Stellung behaupten und als ideologische Fixationen jeglicher Art Ausblick versperren. Aber Erfahrung und Gegebenheit bleiben: Soweit wir von der Welt Kenntnis nehmen und sich mit ihr Einsicht und Verantwortlichkeiten abzeichnen, geschieht dies dank vermittelter Erkenntnis. Nicht das Vermitteln und das Vermittelte sind das Problem, sondern ob wir lernen, mit Information umzugehen – das gilt für den, der sie gibt, so gut wie für den, der sie zur Kenntnis nimmt.
»Weltläufigkeit«
Reisen …
ca. 1974
Die Seele reise langsam, heißt es; weshalb reist sie dann? Die Seele brauche Zeit, sie müsse sich einfühlen und akklimatisieren. Das bedeutet wohl, dass sie im Zeitalter der Jets immer noch auf die Postkutsche eingestellt ist. Aber was, wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin, und die Seele reist in der Kutsche nach; dann kommt sie vielleicht an, wenn ich schon wieder weg bin. Diese Seele hat umzulernen.
Es ist gerade der rasche Szenenwechsel, der mich am heutigen Reisen fasziniert – eben noch in einer mitteleuropäischen Stadt und ein paar Stunden später in einer andern Kultur. Und dieser Szenenwechsel betrifft auch die Natur. Eben noch Frühling, und schon landet man im Winter. Man lässt die Jahreszeiten umgekehrt ablaufen, oder man überhüpft eine Jahreszeit, man fliegt aus dem Herbst direkt in den Frühling. Natürlich schließt dies das Reisen mit dem allmählichen Abfahren einer Landschaft nicht aus, die langsamen Übergänge von einem Landschafts- und Vegetationstypus in einen andern. Es ist jene Kunst des Reisens, welche unsere Großväter vorzüglich beherrschten. Und es wäre ein überflüssiger Verzicht, diese Art des Reisens einfach wegzuwerfen. Es ist eine Möglichkeit, aber eben nur eine. Und fatal wird es dann, wenn sie gar ausgespielt wird als die bessere und schönere Form des Reisens. Fatal, wenn man damit die schockartige, übergangslose Form des Reisens von heute verdammen will.
Das rasche Umsteigen von Jahreszeit zu Jahreszeit und von Kultur zu Kultur entspricht unserer allgemeinen Erfahrung, dass die Welt immer unteilbarer wird und dass wir diese Welt nur bewältigen können, indem wir uns Rechenschaft geben über ihre Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit. Dieses Reisen entspricht im Grunde der Art, wie wir die Neuigkeiten am Radio oder am Fernsehen entgegennehmen – da wird auch nicht eine vorbereitende Brücke geschlagen, um von den Rassenunruhen zur Schönheitskonkurrenz überzugehen.
Sicherlich, man ruht mit dem Auge nicht mehr so ausführlich auf einem Hügel oder einem Bach, aber man erlebt dafür die Gegensätzlichkeiten oder noch besser: das Anderssein. Vielleicht nicht in erster Linie die Stadt, die man anfliegt, diese nur als Anlass, um sie in Beziehung zu andern Städten zu setzen. Und damit stellt sich eine neue Form des Erlebnisses ein.
Dabei ist es möglich, Entdeckungen zu machen. Nicht nur Neues zu entdecken, sondern Dinge, die man kannte.
So geschah es in diesem Sommer, ich entdeckte in Zürich etwas Altbekanntes. Ich kam aus Rio. Nun bin ich ein Mensch, der ohne Uhr auskommen will. Städte haben ihren Rhythmus, und man kennt dann eine Stadt, wenn man ohne Uhr weiß, allein von ihrem Mouvement her, was für Zeit es in der Stadt geschlagen hat. Aber ich war irritiert. Es war hell und noch Tag, und dabei war es schon halb sieben und acht oder halb neun. Bis ich mir dann den Grund der Irritation erklärte.
In den Tropen, da fällt die Nacht ein, direkt und übergangslos, um fünf beginnt sie sich abzuzeichnen, und um sechs ist sie da. In diesem Zürich aber stellte sie sich ganz allmählich ein, zögernd und abwartend und doch kommend. Sie dämmerte heran, und ich entdeckte plötzlich die Dämmerung. Und es war eine Entdeckung, die ich bewusst zu genießen begann. Es gab plötzlich wieder die Abende, jenes Zwischending von Tag und Nacht. Dank eines abrupten Übergangs hatte ich, paradoxerweise, die Übergänge entdeckt. So entdeckt man über das andere, was einem schon längst gehörte.
Vom polygamen Umgang mit Städten
Die Faszination der Gleichzeitigkeit menschlicher Möglichkeiten
1994
Unvorstellbar von Städten zu reden, ohne dass mir gleich das Wort »urban« einfällt. Allerdings in einer Bedeutung, die es immer mehr verliert, wenn überhaupt noch besitzt.
»Urban« hieß einmal »kultiviert«, »verfeinert« oder »weltmännisch«. Heute jedoch bezeichnet das Wort alles, was generell die Verhältnisse der Stadt und ihren Problembereich ausmacht.
Wenn Christo »urbane Projekte« plant, hat dies nichts mit »Kultiviertheit« zu tun, sondern damit, dass er nicht Landschaftliches, sondern Bauobjekte verpacken will, die sich in einer Stadt befinden – ob den Pont-Neuf in Paris oder das Reichstagsgebäude in Berlin.
In Wörterbüchern lässt sich der Bedeutungswandel nachschlagen. Heinsius, der für die Geschäfts- und Lesewelt im letzten Jahrhundert Konversationswörter auflistete, verstand unter urbanisieren »feinsittig machen«. Man würde auf unseren Bauämtern Verlegenheit hervorrufen, fragte man die Beamten, wie sie es bei ihrer Arbeit mit der Feinsittigkeit hielten. Sie könnten ihrerseits Wörterbücher konsultieren; noch immer fänden sie für urban »kultiviert« und als zweite Bedeutung »städtisch«; urbanisieren hieße ganz in ihrem Sinn »einen Ort oder eine Ansiedlung städtisch machen«. Damit dürfte klar sein, dass man Baurechte vergeben und Zonen festlegen kann, ohne feinsittig sein zu müssen.
Dass das Wort urban schlechthin für »kultiviert« steht, mag einen merkwürdig berühren, wenn man an ein heutiges Schlagwort denkt wie die »Unwirtlichkeit der Städte«, konfrontiert mit der alarmierenden Frage: ob Städte überhaupt noch bewohnbar sind.
Der Satirejournalist Juvenal hat als einer der Ersten den Unerträglichkeitskatalog einer multikulturellen Metropole in Verse gebracht. Das Verkehrschaos (»Wagen biegen in scharfer Wendung um die Straßenecken, und die Treiber schimpfen laut, wenn ihre Herde nicht weiterkann«) und die Kriminalität (»kein Verbrechen und keine Untat der Willkür fehlt«); schuld daran sind die Zuwanderer aus dem Orient (»Zu unseren Hügeln strömte Sybaris, Rhodos, Milet und in frecher Trunkenheit Tarent«), und in dieser »vergriechten Stadt«, im Rom des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, sind selbst die Prostituierten nicht mehr einheimisch-bodenständig: Es ist am besten, man flieht aufs Land, denn dort »kann man ein ganzes Haus kaufen für das, was man in Rom als Miete für eine Wohnung bezahlt«, demnach empfiehlt Juvenal: »Verliebe dich in deine Hacke … und lebe als Hüter eines gepflegten Gemüsegartens.«
Nicht dass einem die Klagen von einst über die eigenen Leiden hinweghelfen, aber sie zeigen, dass man mit ihnen nicht allein dasteht und nicht einmal so originell ist. Um sich ein komplexeres Bild von der guten alten Zeit zu erwerben, lohnt es sich, in einem Verbrecherlexikon nachzulesen. Die europäischen Großstädte sind erst Anfang letzten Jahrhunderts zu der Einrichtung gekommen, die wir Kriminalpolizei heißen. Um London als Beispiel zu nehmen: Die Stadtbürger hatten vorher selber für Sicherheit und Habe zu sorgen; sie engagierten zu ihrem Schutz thief-takers; diese »Dieb-Schnapper« verstrickten sich ihrerseits in Korruption wie die später halbamtlichen runner, welche Bürger als eine Art Privatdetektive mieteten. Als Scotland Yard 1829 geschaffen wurde, schätzte man in London die Zahl derer, welche ausschließlich von Raub und Diebstahl lebten, auf 30000. Mit den Bobbys kam London zu der Kriminalpolizei, wie sie Paris seit Kurzem mit der »Sûreté nationale« besaß, einer eigenen Abteilung für Verbrechensbekämpfung innerhalb einer Polizeiorganisation, die bis anhin vorwiegend politisch für Ordnung gesorgt hatte. Der Mann, der die Sûreté organisierte, ein ehemaliger Straffälliger, engagierte Exkriminelle, überzeugt, dass man am wirkungsvollsten auf Verbrecher Verbrecher ansetzt – eine homöopathische Methode, die eine eigene Form der Resozialisierung darstellt.
Einem jüngeren Bericht der Schweizerischen Vereinigung städtischer Polizeichefs ist zu entnehmen, dass sich die Gewaltkriminalität auf städtische Gebiete konzentriert. Daraus kann nicht geschlossen werden: je weiter weg von der Stadt, umso größer die Unschuld; mangelnde Gelegenheit war noch nie Ausweis von Tugend. Die Untersuchung bestätigt vielmehr, dass städtische Gebiete für Kriminalität und Dunkelagieren jeglicher Art günstigere Voraussetzungen schaffen.
In dem Maße, wie »städtisch« als »urban« für »kultiviert« stand, bezeichnete der Gegensatz »bäuerlich« oder »bäuerisch« das »Unkultivierte« – das Ungehobelte und Grobe, und dies in allen europäischen Sprachen. Der Norditaliener beschimpft nach wie vor den Südländer als Bauerntölpel, als terrone. Der Bauer erlebte auf der Bühne und zwischen Buchdeckeln die unterschiedlichsten Travestien, stets eine komische Figur, ob als Millionär oder zuletzt als Astronaut. Er, der so leicht hereinzulegen ist, wie der Bauernfänger meint, auch wenn dieser mit Bauernschläue rechnen muss. Aber Bauernfußball spielt man stilistisch nun einmal nicht in der Liga A. Und der Bauer frisst nicht, was er nicht kennt, selbst wenn es Kartoffeln sind; aber hinterher hat der dümmste Bauer die größten. Er mag sich darüber freuen und singen, aber wenn er singt, jauchzt er dazu.
Als Arroganz äußert sich hiermit ein Sprachgebrauch, der Verhältnisse überdauerte, aus denen er hervorgegangen ist. Die Redeweisen spiegeln eine historische Situation, in welcher eine ländliche und eine städtische Gesellschaft gesondert nebeneinander lebten. Die Stadtmauern markierten die Trennungslinie einer sozialen und kulturellen Dualität.
Die Entwicklung hob die Unterschiede auf. Einmal dadurch, dass als Folge der Aufklärung die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde. Zudem glichen sich Ausbildungs- und Arbeitsstil in dem Maße an, als die Landwirtschaft sich technisierte; der Konsum weckte und deckte Bedürfnisse, die sich kaum nach Stadt und Land unterschieden. Und die modernen Kommunikationsmittel bieten den gleichen Informationsstand.
Die Mauern selber fielen, als man die Befestigungsanlagen schleifte, als anstelle der Wehrgräben Ringstraßen angelegt wurden; der Brunnen stand nicht mehr vor dem Tore und das Tor selber in der Stadt. Es galt, der Stadt Platz zu schaffen, und sie machte davon Gebrauch – planlos und spekulierend, weitete sich aus und wucherte in die Region hinein, mit Wohnvierteln, Industriezonen und Niemandsland. Es entstand etwas Neues, das weder Stadt noch Land ist, nicht mehr Stadt, aber städtisches Gebiet, die Agglomeration. Bei diesem Agglomerationsprozess verlor das Zentrum seine Bedeutung. Nicht nur wegen des Wegzugs in die Vororte, was im Falle amerikanischer Städte zur Verslumung der City führte. Das Zentrum wurde relativiert durch das, was sich an neuen Zentren in den städtischen Gebieten heranbildete, sofern die Agglomeration nicht gewillt war, sich als reine Schlafstadt zu verstehen oder sich einer Hierarchie von Mutterstadt und Satellitenstadt zu fügen.
Die Städte machten eine Entwicklung mit, welche darüber hinaus auch die Geografie der politischen Machtzentren veränderte, die ihre Absolutheit verloren. »Verlust der Mitte« geht die konservative Klage; aber es ist ein demokratisierender Prozess.
Soll dies heißen, dass eine Agglomerationskultur im Entstehen ist, sodass neben die Urbanität von einst eine Suburbanität von heute (oder morgen) treten wird – als Ergänzung und Ausweitung oder gar als Ablösung? Sosehr die Stadt die Nicht-Stadt verachtete, sie wertete die Unkultur des Bauern zugleich als Unverdorbenheit und Ursprünglichkeit. Bevor Europa in Amerika den »edlen Wilden« entdeckte, feierte es auf dem eignen Kontinent die edle Unschuld des Landmannes.
Ein Vergil bekundete mit seinem Lehrgedicht Landbau viel praktische Kenntnis. Aber der Großstädter lieferte dem Großstadtmüden das schicke Credo: et ego in Arcadia – das Simple als letztes Raffinement, was immer die Boutique dafür verlangt. Auch die, welche nach Vergil behaupteten, sie seien in Arkadien gewesen, waren so wenig wie er in dieser rückständigen Gegend Griechenlands, von wo die Bewohner wegen der misslichen Lebensverhältnisse schon in der Antike in die Städte auswanderten.
Das ländliche Idyll ist eine Erfindung der Städter; dafür liefert die Schweiz europäische Beispiele. Nicht Bergler begannen die Alpen zu besingen. Es war ein Städter wie Albrecht von Haller; er staffierte die Sennen mit Unschuld aus; erst in der zweiten Fassung seiner Gedichte konzedierte er ihnen Sündhaftigkeit. Und ein Städter wie Salomon Gessner machte keinen Hehl daraus, dass Misere und Plumpheit der damaligen Bauern keine Vorlage abgaben für die schöne Dichtung seiner Bestselleridyllen.
Anderseits hat die Stadt stets vom Land geträumt, als sei dies der Garten Eden, aus dem die Bewohner vertrieben wurden und denen nichts anderes übrig blieb, als sich im Schweiß des Angesichtes in Städten einzurichten. Das Land bot als ad-interim-Paradies eine Erholungspause. Der grüne Traum kann sich zur voreiligen Erlösung verführen lassen, zu Idyllen, die nicht außerhalb gesucht werden, sondern im eigenen Innenleben. Dann wird der Hausfrauenurbanismus mobilisiert, der einen Blumentopf hier aufstellt und dort eine Reihe von Pflanzenkübeln. Mit dem, was als Verschönerung ausgegeben wird, können Städte um ihr Schönstes gebracht werden, um Plätze. Kaum eine Stadt, zu der einem nicht gleich ein Platz einfällt: die Praça do Comércio in Lissabon oder die Place Stanislas in Nancy oder … Plätze, die als städtebauliches Ensemble konzipiert, auch als solches wirken und die nicht auf Begrünung angewiesen sind. Der Platz vor dem Petersdom gewinnt weder an Schönheit noch an Wärme, wenn man vor jede Säule ein Geranium aufstellt.
Es ist etwas anderes, Terrain für Schrebergärten zur Verfügung zu stellen, als aus der Stadt selber einen Schrebergarten zu machen. Natürlich lockte die Vorstellung einer Gartenstadt, aber sie entsprach eher einer Wohnstadt als einer Metropole. Natürlich kennt auch diese ihre Gartenträume – von Vorgärten oder botanischen Gärten, vom Belvedere und von Rabatten und Grünanlagen. Und sie wird nicht auf die Bäume verzichten, die ihre Straßen und Uferwege säumen, und wird Parks anlegen, ob streng geometrisch oder in englischer Manier. Die Stadt hatte ihre eigene Natur zum Schaffen, eine kreierte Natur; ihre Landschaft ist Landschaftsarchitektur. Aber die Stadt hat schon vom Sprachlichen her Probleme. Wir reden von »Stadtlandschaften«. Wir verdanken einem fiktiven Lexikon von Kurt Marti den Ausdruck »Stadtschaften«. Hätte ich ein spezifisches Wörterbuch des Urbanen zusammenzustellen, nähme ich diesen Ausdruck vorbehaltlos auf. In dem Vokabular fände man unter »s« auch smog und sicher skyline. Die Silhouette als Visitenkarte; die Skyline als Versprechen, auch wenn die Stadt mit der Horizontallinie nie verrät, woran sie hinterm Horizont leidet.
Zu meiner frühesten Stadtschaft gehören Hinterhöfe und Mietskasernen mit ihren Balkonen – Bilder präzis wie Kindheitserinnerungen. Und die aus einem Viertel, das man kaum zitiert, ginge es um Zürichs Urbanität. Aber ich habe in diesem Quartier der Arbeiter und Kleinbürger jene ersten Erfahrungen gemacht, die mich zum überzeugten Städter werden ließen und zu einem Städtesucher. Ist es nicht bezeichnend, dass dieser Städter zunächst nicht von einer Stadt spricht, sondern von einem Viertel? In seinem Falle lag es jenseits der Sihl, ein Außerhalb, das in Stadtkreise aufgeteilt war. Die Stadt selber lag woanders, am anderen Ufer. Als er die Stadt kennenlernte, richtete er sich erneut in Vierteln ein und kennt andere Viertel höchstens vom Durchfahren oder punktuell.
Die gleichen Erfahrungen machte er als Städtesucher. Spricht er von Paris, der ersten Metropole, die er kennenlernte, wird er gleich auf das Quartier Latin zu sprechen kommen. Er wird später regelmäßig in ein anderes Viertel zurückkehren, ins Marais. Und er wird eines Tages Belleville zu einem seiner Viertel machen, nicht nur wegen einer Bekanntschaft, sondern weil er hier das multikulturelle Paris in seiner ganzen vitalen Spannung antrifft.
Aber Paris bleibt so wenig wie andere Städte eine Stadt der Viertel. Schon wegen der Veranstaltungskalender und Arbeitsprogramme nicht. Es lockte eine quartierüberschreitende Methode, die nicht mit Absichten zu tun hatte: das Flanieren. Eine städtische Gangart, wie sie die Großstadt erfand, im Treiben sich treiben lassen, teilnehmend und für sich, auf nichts Besonderes aus und doch mittendrin. Und er, den man auf keinen Vita-Parcours brächte und der vor jedem Wanderweg scheut, legt Kilometer zurück, eine Kommunikation, bei der die Füße den Augen sehen helfen. Dieses Flanieren ließ sich in Paris vorzüglich üben und später auf andere Städte übertragen. Es gibt Städte, denen unser Städtebesucher nur viertelweise beikam. Aber wiederum bezeichnend, dass er New York sagt und Manhattan meint. Banal festzuhalten, dass das Village ein anderes New York ist als das an der zweiundsiebzigsten Straße und dieses nochmals anders als Midtown.
Richtiger wäre es, im Falle von Manhattan nicht von Vierteln zu reden, sondern von Nachbarschaft. Von einer neighbourhood, die vielleicht nur ein paar Straßenzüge umfasst und die sich verantwortlich fühlt für den überblickbaren Umkreis.
Was sich hier und auch anderswo als Quartiergeist manifestiert, mag man als Pendant zur Agglomeration verstehen, Gegengewicht zu einem Zentrum, das nicht mehr alles im Griff hat. Und in der Tat lassen sich eine Reihe von Problemen in Quartierregie lösen. Fragwürdig wird es, wenn der Quartiergeist Autonomes anstrebt und sich nicht länger als Teil eines Ganzen versteht, eine Quartieroper funktioniert so wenig wie eine Quartieruniversität. Und fatal wird es, wenn Quartiermentalität international verbindlich mitreden möchte, auf Überblickbares pocht und limitierte Verantwortung predigt und damit Abschottung legitimiert. Das ändert nichts daran, dass wir als Bürger einer Stadt immer zugleich Provinzler eines Viertels sind; daraus resultiert nicht notwendigerweise ein Chauvinismus des Lokalen.
Und unser Städtebesucher würde seiner eigenen Stadt zugutehalten, dass sie klein genug ist, dass man, wenn’s darauf ankommt, jedermann kennt, aber auch groß genug, damit man anonym bleiben kann – eine Stadt kennt Anonymität nicht nur als Einsamkeit, sondern auch als unbehelligtes Fürsichsein.
Er, der die eigne Stadt von einem Viertel aus entdeckt, wird als Städtesucher zu einem Entdecker von Vierteln. Auch von einem, das er flieht. Dann, wenn sich Hotel an Hotel reiht, durch tropisch ausstaffierte Rasenflächen getrennt, ein abgesteckter Bezirk, auf den Kuala Lumpur stolz ist. Aus solcher Abgeschirmtheit muss man ausbrechen und eine Unterkunft suchen, von wo man in den Betrieb des Lebens stößt, tut man einen Schritt aus der Hotelhalle. Dafür bietet sich nur downtown an. Und nicht nur in dieser Stadt. Ein Downtown, dessen Geschäftigkeit nicht auf die Fremden angewiesen ist.
Bei diesem Umgang mit Städten fällt auf, wie wichtig die Ankunft wird. Zwar mag die Frage, ob Luft-, Wasser- oder Landweg, theoretisch erscheinen; bei großen Distanzen bleibt nur das Flugzeug. Mit ihm kommt man im Hinterhof an, bis auf die wenigen Städte, deren Flugplätze sich in der Stadt befinden wie im einstigen Westberlin oder noch in Hongkong. Vororte und Industriezonen vermitteln den ersten Eindruck, und da sich diese weltweit angleichen, kann der erste Eindruck charakterlos ausfallen. Daran ändert nichts, dass der Flughafen auf Repräsentanz bedacht ist, wie dies einst der Bahnhof war, der mit der Oper ein städtisches Symbol der Bourgeoisie abgab.
Aber dann ist es eben doch ein Flugzeug, dem man eine großartige Ankunft verdankt: wenn in der Abendsonne beim Anflug Rangoon unter einem erglänzt. Und man staunt ein zweites Mal, wie die leuchtenden Bedachungen von Tempeln und Klosteranlagen am Horizont eine goldene Stadt verheißen. Eine goldene Stadt, wie dies einmal auch Bangkok war. Dort aber werden die Tempel und Chedis von Hochhäusern erdrückt, sie behaupten sich hinter ummauerten Bezirken und sind zu einem insularen Dasein verurteilt.
Aber müsste man sich Bangkok nicht vom Wasser her nähern, von einem Fluss, den man sich nicht nur für diese Zeremonie weniger verdreckt und malträtiert wünscht. Die »Mutter aller Wasser« war auch die »Mutter aller Wasserwege«. Nicht jede Stadt, die ans Wasser gebaut wurde, richtet sich darauf aus. Lissabon und seine Konkurrentin Bordeaux zählen zu denen, die ihre Existenz dem Wasser verdanken. Da ihre Häfen nur an einem Flussufer gebaut wurden, muss man ans andere Ufer gehen, um der Stadt voll ins Gesicht zu schauen.
Die Ankunft lässt sich inszenieren. Im Falle von Rio de Janeiro sieht das Script vor, dass man mit einem Boot aufs Meer hinausfährt, gleich umkehrt, am Zuckerhut vorbei in der Bucht ankommt, an welcher die Stadt gegründet wurde und an der sie Geschichte machte, bevor Copacabana ihr den Prospekt stahl. Doch die Topografie mit Hügelketten, Berggipfeln, Buchten und Lagunen, die Stadt, wie sie sich den Anhöhen entlang hinaufwindet, das wird erst vom Flugzeug aus erschaubar, und anderseits macht einem erst der Landweg klar, wie rasch hinter dem bebauten Terrain der dampfende Urwald beginnt. Das mehrfache und unterschiedliche Ankommen erlaubt Städtekomparatistik. Unterwegs nach Los Angeles auf einem Highway und nie wissend, ob man schon angekommen ist oder etwa schon gar durch. Und dann vom Flugzeug aus der Blick in eine horizontlose Ferne, ein Lichtermeer, das nirgendwo aufhört und nirgendwo anfängt. Im Vergleich dazu Manhattan, eine festumrissene Insel, der Blick in Schluchten und Täler, welche die Wolkenkratzer mit Beton, Stahl und Glas formieren. Eine Stadt der Vertikalen am Atlantik, und am Pazifik eine der Horizontalen; dort unentwegt im Auto und hier viel Zeit im Lift verbringend. Auch zwei verschiedene Möglichkeiten zu spinnen: einmal Platz genug auch für extravagante Neurosen, und einmal ein aggressives Verhalten, da sich auf knappem Raum der eine Komplex stets an dem der andern reibt.
Mag sein, dass mehrfach Ankommenwollen ein Eingeständnis dafür ist, dass wir nirgendwo endgültig ankommen, sodass jede Rückkehr in eine Stadt stets eine neue Art des Ankommens ist, was auch für die Heimkehr in die eigne gilt.
Nun macht man sich Gedanken übers Ankommen, wenn man dem Charakter einer Stadt gerecht werden möchte. Aber woher soll man wissen, was für einen Charakter sie hat und ob sie nicht mehr als nur einen besitzt? Wäre da nicht ein Knigge dienlich? Einer, der sich für den Umgang mit Städten der Umgangsformen annimmt. Bei einem solchen Städtesuchen muss man mit skeptischen Fragen rechnen. Wäre der Städtesucher aus geschäftlichen Gründen unterwegs, leuchtete das ein. Oder auch wegen dieses oder jenes vielleicht sogar kulturellen Anlasses. Und auch Ferien sind ein legitimer Anlass, und sei es nur ein Städteflug nach Rom: vier Tage, drei Übernachtungen, Halbpension und für den Besuch des Vatikans eine Zusatznacht. Aber wozu Städte sonst?
Bei dieser Frage könnte ein schweizerischer Unterton mitschwingen, eine Skepsis gegenüber der Stadt und gar gegenüber einer größeren, und erst recht, wenn dies Zürich ist, das mit seiner Agglomeration von einer Million ein Verhältnis zur Deutschschweiz hat wie Paris zu Frankreich oder London zu England. Nein – es gilt kleiner zu sein, als man ist, und wenn’s nur darum geht, den Schein zu wahren. Es ist kein Zufall, dass Gottfried Keller Seldwyla bewusst »eine gute halbe Stunde von einem schiffbaren Fluss angepflanzt« hat, »zum deutlichen Zeichen, dass nichts daraus werden solle«.
Ist es nicht bezeichnend, dass Schriftsteller, die aus dem ausbrechen, was sie als Enge empfanden, zu Autoren von Städten wurden: Paul Nizon mit Barcelona und Paris und Jürg Federspiel mit New York? Und sollte es nicht minder aufschlussreich sein für die momentane Situation, dass mit der jüngsten Schriftstellergeneration die Landschaft erneut Einzug hält in der Literatur? Landschaftliches war immer literaturwürdiger als Städtisches. Wo der Asphalt anfängt, hört die Heimat auf. Ein Schriftsteller, der sich als kritischer Geist versteht, propagierte während der Europa-EG-Debatte das »weltoffene Dorf mit Flugplatz« als schweizerische Zukunft.
Neben diesem Ideologiekitsch nimmt sich die Broschüre Achtung: die Schweiz aus den frühen Sechzigerjahren revolutionär aus. Max Frisch gehörte zu denen, die als Pilotprojekt die Gründung einer Stadt vorschlugen. Im Rückblick überrascht es, wie stark das helvetische Credo dieses Unternehmens war: »Wir müssen etwas Eigenes, etwas Schweizerisches tun«, es sollte eine »heutige Manifestation schweizerischer Lebensform« werden, und »was wir wollen: die Schweizerstadt und das Schweizerland«. In dieser schweizerischen Musterstadt unseres Jahrhunderts hätte das Wort »urban« nicht viel zu suchen gehabt. Da war keine Zeile zu finden von kultureller Potenz, und auch kein Hinweis auf die städtischen Einrichtungen, deren die Kultur bedarf. Geplant war eine Stadt für fünfzehntausend Bewohner. Da hatte ein Le Corbusier noch anders ausgeholt. Die Stadt, die er Anfang der Zwanzigerjahre als Projekt in Paris vorstellte, war für drei Millionen gedacht. Und er war auch bereit, sie mit der Radikalität des Idealisten zu verwirklichen: Er hätte für die Realisierung halb Paris abgerissen und halb Moskau.
Mag sein, dass beim Städtesuchen die Vorstellung einer idealen Stadt mit lockt. Was für Triumphe an Fantasie sind mitzuerleben, wenn Architekten, Philosophen und Theologen sich vorbildliche Gemeinschaften ausdachten. Sosehr die Stadt als Kunstwerk das ästhetische Empfinden beglücken mag, der lebendige Mensch in ihr stört. Und kein kreativer Mensch wird sich je mit dem zufriedengeben, was ein für alle Mal als perfekt gilt und somit unabänderlich ist. Das Zeitlos-Utopische bringt sich selber um die Zukunft.
Mag sein, dass wir im Geheimen auf der Suche nach einem »himmlischen Jerusalem« sind. Und wir können es dort finden, wo wir selber es nicht erwarten und wo andere es nicht vermuten. »Die große weiße Stadt auf der grünen Ebene, mit den zwei hohen, roten Kirchtürmen und den vielen schönen Landhäusern weit umher. Mein Gott, wie erschien mir alles so schön – eben wie Mailand, oder viel mehr noch wie ich mir die Stadt Gottes, das himmlische Jerusalem dachte.« Für Jakob Stutz, den Schriftsteller aus dem Zürcher Oberland, hieß das »himmlische Jerusalem« Winterthur, über das er 1853 schrieb: »Ja, was uns doch mit der Kindheit verloren geht. Jetzt würde mir die größte und schönste Weltstadt nicht so herrlich erscheinen. Nein, jenes Winterthur sehe ich in der Welt nicht mehr.« Aber auch wenn man sich nicht auf die Suche nach einem »himmlischen Jerusalem« macht, bewahrt man sich die Neugierde für alle nichtgebauten und nur erträumten Städte. Und nichts hindert einen daran, Italo Calvino zuzuhören, wenn er dem chinesischen Kaiser von »unsichtbaren Städten« erzählt.
Eine einzige Modellstadt habe ich kennengelernt, Brasília. An ihrem zehnten Geburtstag. Voll Bewunderung für die Architektur. Nicht völlig überzeugt von dem stringenten Funktionalismus. Erregend waren die Barackenstädte, die wild und ungeplant um die Stadt entstanden. Hier meldeten sich Erwartungen und Leiden, die größer waren, als das Reißbrett ahnte.
Aber die Frage bleibt im Ohr: Wozu die Suche nach all den Städten? Die Frage klingt um so ungeduldiger, als sie sich an jemanden richtet, der einst ein »Hohelied der Städte« anstimmte. Als ich das tat, wusste ich nicht, dass es dafür einmal eine Gattung gab, in der Antike wie im lateinischen Mittelalter, das »Städtelob«, die »laudes urbium«.
Und die Frage »Wozu auf Städtesuche gehen« kann inquisitorischer lauten: »Genügt Ihnen die eigene nicht?«
Wenn ich nun sage, dass dies zutrifft, heißt das nicht, dass man eine Stadt als Kompensation oder als Ersatz sucht, als würde das wahre Leben woanders stattfinden. Die Suche gilt nicht dieser oder jener Stadt, sondern der Stadt selber, von der die eigene eine Variante ist.
Was sich als Untreue gegenüber der einen oder der andern ausnimmt, ist die Treue zu all dem, was einst und heute sich als Stadt realisierte, was unterging und was sich behauptete, was denkbar ist und was wir zu unserem Lebensraum machen müssten.
Unvermeidlich, dass ein Suchen und Zurkenntnisnehmen Ausdruck einer polygamen Leidenschaft ist, die will, dass es die Stadt gibt, und die weiß, dass es nie nur die eine und einzige geben wird. Die Liebe gilt der Stadt als der größtmöglichen Gleichzeitigkeit menschlicher Möglichkeiten. Eine Gleichzeitigkeit, die herausgefordert wird, da anstelle der homogenen Stadt, die nie so homogen war, wie sie behauptete, eine Stadt tritt, in der unterschiedlichste Rassen und verschiedene Kulturen Lebensraum beanspruchen. Gleichzeitigkeit aber ergibt sich nur, wenn erkannt wird, dass die Möglichkeit des einen die des andern ermöglicht und dass die einen Möglichkeiten sich in dem Maße entfalten, wie sich andere verwirklichen können. Darin beruht die Kulturträchtigkeit der Stadt und die Chance einer Neubestimmung von Urbanität.
Lusitanische Welt
Portugal und die »portugiesische Welt« – Geschichte und Aktualität
1983
O mundo português, die portugiesische Welt, ein Begriff, so bedeutungsvoll für die Portugiesen, aber sonstwo, auch bei uns, kaum bekannt. Diese portugiesische Welt möchten wir vorstellen. Wir versuchen zu zeigen, inwiefern die portugiesische Welt Welt ist, was sie an Realität und Vorstellung ausmacht, wie sie sich ausnimmt, als Geschichte und Aktualität.
Ein Interesse für dieses Thema könnte sich aus Folgendem ergeben: Sofern unsere eigene Geschichte europäische Geschichte ist, ist sie auch portugiesische Geschichte; denn mit Portugal, diesem Land am Rande Europas, begann jene Entwicklung, die aus europäischer Geschichte Weltgeschichte machte; mit ihm fing eine Epoche an, in der wir uns noch mittendrin befinden, nur dass Europa nicht mehr wie bisher die Geschicke der andern allein bestimmt, sondern die andern unser Geschick mitbestimmen.
Relikte und Erinnerungen
Portugiesische Welt – damit können zunächst Länder gemeint sein, in denen heute Portugiesisch (oder noch Portugiesisch) gesprochen wird. Zählt man auf, wird die Sprache von 130 Millionen Portugiesen in Europa, Lateinamerika, Afrika und Asien gesprochen. Wir lassen jene Portugiesen auf der Seite, die in die USA ausgewandert sind und wo zum Beispiel in New Jersey Portugiesen ihre Feste der Santos populares wie des heiligen Antonius feiern.
Allerdings kann das Portugiesische auf dieser Weltkarte unter Umständen ein merkwürdiges Dasein fristen. Etwa, wenn wir an Malakka denken. Malakka, an der Südwestküste Malaysias, war für einige Jahrzehnte in den Händen der Portugiesen, bis diese es an die Holländer abtreten mussten. Noch immer leben dort Nachkommen der Portugiesen, etwas über tausend Fischer. Natürlich Katholiken. Deshalb werden zu ihrer Betreuung Priester aus Portugal hingeschickt. Wir staunten nicht schlecht, als wir einen dieser Padres im Umgang mit seinen Schützlingen erlebten. Der Padre klärte uns auf: Die Fischer würden ein Portugiesisch aus dem 16. Jahrhundert reden, die Sprache der Entdecker, er wolle nicht mit seinem modernen Portugiesisch ihr altes stören. So unterhielt sich der Padre aus dem Norden Portugals mit den Nachkommen der portugiesischen Entdecker auf Englisch.
Man darf in dem Zusammenhang gleich darauf hinweisen, dass im Fernen Osten im 16. Jahrhundert Portugiesisch die lingua franca war. Es hat demnach in verschiedenen asiatischen Sprachen Spuren hinterlassen. Auch im Wortschatz des Indonesischen – eine Reminiszenz daran, dass die Portugiesen sich vorübergehend auch dort niedergelassen hatten, wo später das Batavia der Holländer lag und heute das Djakarta der Indonesier liegt.
Portugiesische Welt ist zunächst einmal eine Welt der bloßen Relikte.
Die Erinnerungen sind auf der Landkarte zu finden. Mit einer Reihe von Namen. Sei es einer wie Lagos, die Hauptstadt Nigerias. Der Name erinnert an Lagos an der Südküste Portugals; eine Stadt, die für den Schiffsbau wichtig war und wo der erste schwarze Sklavenmarkt in Europa abgehalten wurde. Oder sei es, dass ein Teilstaat und ein Fluss in Venezuela »Portuguesa« heißt, nur weil dort einst eine Portugiesin sich eingerichtet hatte.
Die Erinnerung findet sich nicht nur auf den Landkarten, sondern auch in Chroniken. Etwa in einer ceylonesischen. Darin wird von der Ankunft der ersten Portugiesen berichtet: Sie tranken Blut (natürlich Wein), und sie aßen Steine (natürlich Brotfladen) und gingen in ihren Rüstungen unruhig auf und ab. Schon bei einer der ersten Begegnungen zwischen Abendland und Osten fiel den Asiaten auf, dass die Europäer ein anderes, nämlich ein nervöseres Verhältnis zur Zeit hatten.
Und nicht nur auf der Landkarte und in Chroniken sind Erinnerungen da, sondern auch auf Paravents. Auf jenen Paravents, die heute in einem Museum in Tokio und in Porto und Lissabon zu sehen sind. Auf ihnen haben japanische Künstler die Ankunft portugiesischer Schiffe dargestellt: das erste Auftreten von Portugiesen in Japan, jener Südwestbarbaren, wie die Japaner sie bezeichneten; denn diese Weißen beherrschten das Höflichkeitszeremoniell nicht, und, wie geschrieben wurde, sie passten ihre Leidenschaft ihren Trieben an.
Nicht nur auf Landkarten, in Chroniken oder auf Paravents sind Erinnerungen da, sondern auch auf einer Grabplatte wie einer im Süden Portugals aus dem Jahr 1453: Johan Vaz Corte, Real-Navigador, Senhor von Terceira und Neufundland.
Nicht überall, wo Portugiesen hinkamen, entstand portugiesische Welt.
Das berühmte Beispiel dafür, dass dies nicht der Fall ist, bietet Magellan. Im Dienste Madrids ging dieser Portugiese nicht mit seinem portugiesischen Namen »Fernão Magalhães« (1480–1521) in die Geschichte ein, sondern mit seinem spanischen. Ihm gelang als Erstem eine Weltumseglung; er selber kehrte zwar nicht zurück, aber eines seiner Schiffe. Er wurde auf Cebu getötet, auf einer jener pazifischen Inseln, die später Islas Felippinas nach König Philipp heißen sollten. Ein Portugiese legte die Voraussetzungen dafür, dass Spanien, der Erzkonkurrent Portugals, dank der Philippinen zu seiner einzigen Kolonie in Asien kam. Und ein anderer Portugiese in spanischen Diensten drang als Erster nordwärts über Mexiko vor, in jenes Gebiet, das heute Kalifornien heißt; erst zweihundert Jahre nach dieser Expedition von Cabrilho (†1543) bauten die Spanier an diesem Teil der Pazifikküste ihre Missiones und Forts.
Portugiesische Welt, das ist eine, zu der über diese und andere Beispiele hinaus ein Hof von Reminiszenzen und Relikten gehören, Verballhornungen und Vergessenes, aber diese portugiesische Welt ist ja nicht nur Vergangenheit, sondern auch Aktualität, vielgesichtig und vielproblematisch.
Der Atlantik wird portugiesisch
Sicherlich – die portugiesische Welt, sie ist das Ergebnis von Geschichte:
Das Ergebnis einer Geschichte, die damit anfing, dass Portugal, das als erstes Land zu nationalen Grenzen kam, mit der Eroberung von Ceuta (1415) in Nordafrika über diese nationalen Grenzen und damit über den Kontinent hinausging und so ein vierkontinentales Imperium aufbaute.
Das Ergebnis einer Geschichte, die damit aufhörte, dass Portugal als einstiges Mutterland wieder ein europäisches Land wurde, aber eines, zu dessen Territorium heute die »vorgelagerten Inseln« zählen, wie die Azoren und Madeira im Atlantik heißen, und das gleichsam als historisches Souvenir Macau an der Südküste Chinas besitzt.
Gute hundert Jahre hatte es gedauert, bis Portugal dieses vierkontinentale Imperium aufgebaut hatte – angefangen mit dem systematischen Auskundschaften der afrikanischen Westküste, dem Vordringen ihr entlang Kap um Kap bis zu dem, das ursprünglich Kap der Stürme hieß und wegen der psychologischen Kosmetik in das »Kap der Guten Hoffnung« umgetauft wurde, die Umfahrung dieses Kaps, die Entdeckung des Seewegs nach Indien durch Vasco da Gama, die Kontrolle dieser Route und somit die Möglichkeit, den Arabern den Gewürzhandel, das Geschäft des Jahrhunderts, zu entreißen.
Auf Handel waren die Portugiesen vorerst aus und nicht auf territoriale Erweiterung, diese stellte sich gleichsam im Nachhinein mit der Logik der Sieger ein. Entsprechend der Handelskonzeption wurde ein Netz von Stützpunkten und Faktoreien errichtet: von der ostafrikanischen Küste quer durch den Indischen Ozean nach Goa an der Westküste Indiens, und von dort über Ceylon nach Malakka; dort trennten sich die Routen, südostwärts zu den eigentlichen Gewürzinseln wie Timor und Richtung Nordosten nach Macau.
Innerhalb dieses Handelssystems bildete Brasilien von Anfang an eine Ausnahme. Noch heute geht der Streit, ob Brasilien per Zufall oder gezielt entdeckt worden sei. Jedenfalls landete dort Pedro Álvares Cabral 1500 auf einer Fahrt nach Indien. Dieses Brasilien hatte vorerst nichts anderes zu bieten als Land, wenn auch fruchtbares. Die portugiesische Krone ging erst einige Jahrzehnte später an die Administrierung.
Was von Anfang an auf Brasilien zutraf, sollte auch später gelten. Die Eroberung und Erschließung des Hinterlandes geschah nicht so sehr aufgrund militärischer Expeditionen, wie dies im Lateinamerika der Spanier der Fall war. In Brasilien blieb der Initiative des Einzelnen oder der ad-hoc-Gruppe Entscheidendes überlassen. Die Bandeirantes, die nach der bandeira, dem Fähnchen, hießen, um das sie sich scharten, drangen in dieses Hinterland vor, in manchen Punkten den nordamerikanischen Pionieren vergleichbar, und wie in Nordamerika vollzogen sich die entradas, diese »Expeditionen«, nicht ohne Vertreibung oder Ausrottung der Indios. Im Falle Brasiliens spielte die Versklavung, das heißt die Jagd nach Arbeitskräften, eine zusätzliche Rolle.
Hundert Jahre also hatte es gedauert, bis ein Imperium zustande kam, von dem es auch hätte heißen können, dass die Sonne darin nie unterging – gute hundert Jahre von dem Moment an, als Gil Eanes 1433 über das Kap Bajador hinausfuhr, das non plus ultra der afrikanischen Küste, bis zu dem Zeitpunkt, als sich die Portugiesen 1555 in Macau niederließen.
Die Weltkarte wird kleiner
Viermal länger, nämlich vierhundert Jahre dauerte es, bis dieses Weltreich auseinandergefallen und aufgelöst war und Portugal als jenes europäische Land übrig blieb, als das wir es heute kennen.
Die Auflösung vollzog sich mit militärischen Niederlagen und freiwilligem Verzicht, mit nationaler Erneuerung und wirkungslosem Protest, mit Guerillakrieg und einer demokratischen Revolution – Kontinent um Kontinent wurde abgebaut.
Zunächst ging das asiatische Reich verloren. Der »Indien-Staat«, Estado da India, war ein vager Begriff für etwas, das von der ostafrikanischen Küste bis zur Südküste Chinas reichte. Verloren gingen Stützpunkte in Ceylon, Malaysia und Indonesien. Zwar blieben andere wie Goa, Timor und Macau. Aber die raison d’être des Indien-Staates hatte ja nicht auf territorialem Besitz beruht, sondern auf einem Handelsnetz. Dieses aber hatten die Holländer durchbrochen; somit verlor der Indien-Staat seine Bedeutung, obwohl es punktuell bei territorialem Besitz blieb.
Die Portugiesen verloren hier nicht nur wirtschaftlich und militärisch, sondern auch nautisch-technisch. Sie sind nicht die Einzigen, die erfahren mussten, dass es leichter ist, den ersten Platz einzunehmen, als ihn auch zu behaupten. Systematisch, technisch wie wissenschaftlich, hatten sie den Schiffsbau vorangetrieben und die moderne Nautik entwickelt; sie waren die erstrangigen Schiffsbauer geworden. Aber sie bauten ihre Schiffe immer größer und für reichere Ladung. Indessen aber verfertigten die Holländer wendige und kleinere Schiffe. Die Portugiesen verloren nicht nur das Monopol des Gewürzhandels, sondern auch das der Seetüchtigkeit.
So katastrophal aber auch der Verlust in Asien war, er wurde durch einen anderen Kontinent, nämlich durch Brasilien, wettgemacht. Brasilien war zum führenden Zuckerproduzenten geworden. Dort hatte sich eine koloniale Agrarwirtschaft auf Sklavenbasis herangebildet. Eine Gesellschaftsform, die in einem architektonischen Ensemble Ausdruck fand, wie man ihm heute noch im Nordosten Brasiliens begegnen kann: ein Ensemble von Herrenhaus und Sklavenhütte, dazu gehörte die Zuckersiederei und die Kapelle, in der Mitte der Platz mit dem Kreuz und dem Pfahl, an dem die Sklaven gezüchtigt wurden. Herrenhaus und Sklavenhütte (Casa grande e senzala) gab den Titel ab für ein Standardwerk der brasilianischen Soziologie und Historiografie; Gilberto Freyre hat mit diesem Buch einen wegweisenden Beitrag zum Verständnis Brasiliens geschrieben.
Zu dem Zeitpunkt, als Portugal seinen Gewürzhandel definitiv verlor, wurde in Brasilien Ende des 16. Jahrhunderts und Anfang des siebzehnten Gold und Diamanten gefunden. Damit holte Brasilien nach, was die spanischen Besitzungen in Lateinamerika bereits hinter sich hatten. Diese Funde kamen auch für Brasilien zur rechten Zeit, nachdem diesem mit dem Anbau von Zuckerrohr auf Antilleninseln wie Kuba empfindliche Konkurrenz erwachsen war. Die Gold- und Diamantenfundminen brachten einen neuen Boom. Das Schwergewicht verlagerte sich von einer Agrarwirtschaft zur Minenwirtschaft. Die Hauptstadt wurde von Bahia nach Rio de Janeiro verlegt, das näher jener Provinz lag, die heute noch als Teilstaat Minas Gérais, »Allgemeine Minen«, heißt.
Dieses Brasilien (und damit Lateinamerika) ging nicht verloren, sondern wurde aufgegeben. Als Folge der Napoleonischen Kriege hatte sich der portugiesische Hof nach Rio abgesetzt. Während die spanischen Kolonien sich von ihrem europäischen Mutterland mit Unabhängigkeitskriegen lösten, war es ein portugiesischer König, der die Unabhängigkeit von Brasilien ausrief. Brasilien wurde in der Folge ein Kaiserreich, das bis zum Ende des 19. Jahrhunderts dauerte, auch dies ein Gegensatz zu den Republiken im einstigen spanischen Amerika.
Nach dem Verlust der Wirtschaftsbasis im Indischen Reich war Brasilien eingesprungen, nachdem Brasilien aufgegeben worden war, wurde dieser Verlust durch nichts wettgemacht. Portugal hatte nicht nur seine wichtigste koloniale Einnahmequelle verloren, sondern auch sein wichtigstes Absatzgebiet.
Am Ende noch Afrika
Es gab nach wie vor die Besitzungen in Asien und in Afrika. Wie hätte Portugal eine irgendwie kohärente Kolonialpolitik betreiben sollen, da das Land selber von Krise zu Krise taumelte und sich mit Putschs und in Fraktionskämpfen aufrieb. Daran änderte sich auch nicht viel, als in Portugal 1910 die Republik ausgerufen wurde. Seit dem Verlust Brasiliens war der Staatshaushalt nie mehr in Ordnung gekommen. Das war erst der Fall, als 1928 ein Wirtschaftsprofessor aus Coimbra, António de Oliveira Salazar, sich der Staatsfinanzen annahm und über den Amtsweg des Finanzministers seine Diktatur des estado novo, des »neuen Staates« errichtete. Er stabilisierte in der Tat die Finanzen, aber er stabilisierte auch die sozialen Verhältnisse. Seine Philosophie der Bescheidung und sein Antigeschichts- und Antientwicklungs-Credo versuchte er mit einer Wirtschaft zu verwirklichen, die sich aufs Nationale beschränkte, das galt für das Mutterland wie für die Kolonien. Es war eine Politik der Abkapselung, ein Rückzug in historische Größe.
Aber als nach 1945 weltweit die Dekolonisierung einsetzte, als auch in den afrikanischen Besitzungen Portugals Unabhängigkeitsbewegungen ihre Forderungen stellten und sie zum bewaffneten Kampf übergingen, sah sich Salazar gezwungen, die von ihm selbst gebauten Barrieren zu durchbrechen. Er musste sowohl Portugal wie die afrikanischen Besitzungen für Investitionen und damit Fremdeinflüssen öffnen, um die Wirtschaft irgendwie anzukurbeln. Aber alle Reformversuche, auch die seines Nachfolgers Marcelo Caetano, kamen zu spät. Der Kolonialkrieg belastete am Ende den Staatshaushalt bis zu vierzig und fünfzig Prozent. Gegen die Guerilla war nicht aufzukommen.
Die Militärs, welche den Kolonialkrieg nicht gewinnen konnten, beendeten ihn, indem sie das Kolonialreich liquidierten. Und gleichzeitig machte Portugal nach einer fünfundvierzigjährigen Diktatur den Schritt in die Demokratie mit seiner Revolution der Nelken vom 25. April 1974.
Damit war ein vierhundertjähriger Prozess beendet: Als letzter Kontinent des kolonialen Imperiums war Afrika unabhängig geworden mit den Staaten Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, den Kapverdischen Inseln und São Tome und Príncipe. Portugal, die erste Kolonialmacht Europas, war auch seine letzte gewesen; diese letzte Kolonialmacht aber stand nach Abschluss ihrer Kolonialgeschichte in ihrem Heimatkontinent als eines der ärmsten Länder da. Und somit stellte sich einmal die Frage, was hat die portugiesische Welt Portugal eingebracht.
Von den Gewürzen zur Ideologie
Solange Portugal den Gewürzhandel kontrollierte, hatte ihm dieser Reichtum eingebracht. Nicht nur Lissabon zeugt dafür mit seinen Palästen, Kirchen und Klöstern. Diese Zeit fand ihren künstlerischen Ausdruck in einem Stil, den man nach Manuel dem Glücklichen »manuelisch« heißt und für den das Kloster von Belém oder die Christusburg in Tomar oder die capelas imperfeitas, die »unvollendeten Kapellen«, von Batalha großartiges Zeugnis ablegen. Portugals Beitrag zur Bildenden Kunst Europas ist nicht einer der Architektur oder der Malerei und Plastik, sondern einer der Ornamente, eines Schmuckwerks, das allerdings so weit ging, dass es Architektur werden konnte, ein Ornament, das als Motive die Flora und Fauna der Entdeckungsfahrten mit einbezog und für welches das Schiffstau ein symbolisches Element abgab.
Sosehr Portugal von seinem Gewürzhandel profitiert hatte, im Falle Brasiliens war dies nur noch bedingt der Fall. Sicherlich erlaubte Brasiliens Gold den Bau einiger Repräsentativbauten, und ohne das brasilianische Gold hätte Pombal nicht das 1755 von einem Erdbeben zerstörte Lissabon wiederaufbauen können. Aber was aus Brasilien kam, kam nicht der nationalen Wirtschaft zugute, sondern das Geld ging zur Hauptsache nach England, um Importe von dort zu bezahlen. »Wein gegen Stoff«, so lautete die Devise des Methuenvertrags, den Portugal und England 1703 geschlossen hatten. Portugal konnte seinen Wein, vor allem Portwein, verkaufen, dafür verpflichtete es sich, aus England die Textilien zu beziehen. Damit blieb jeder Ansatz für eine Industrialisierung unterlassen, und dies in einem Land, das trotz seiner Agrarwirtschaft Nahrung einführen musste.
Portugal, das mit seiner portugiesischen Welt in der Welt immer noch eine Kolonialmacht spielte, wurde zu Hause zusehends ein halb koloniales Land.
Wie sehr Anspruch und Realität auseinanderklafften, wurde Portugal bewusst, als es 1890 zu einem »Ultimatum« kam. Als die europäischen Staaten im letzten Drittel des letzten Jahrhunderts an die Aufteilung Afrikas gingen, geschah dies nach dem Grundsatz, dass jemand nur Anspruch auf Territorium hat, das sich auch