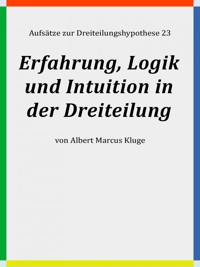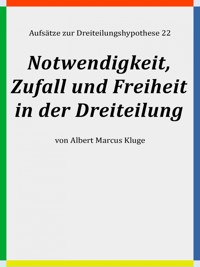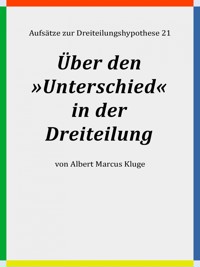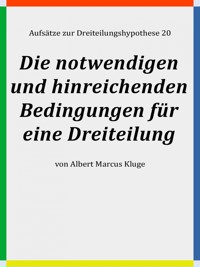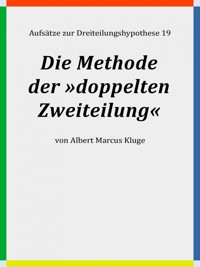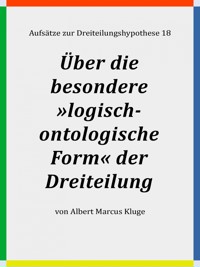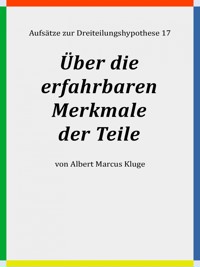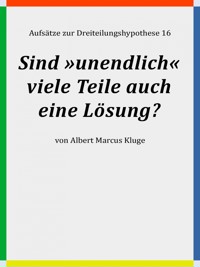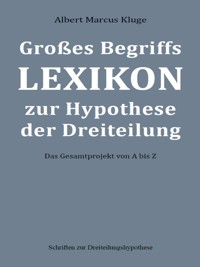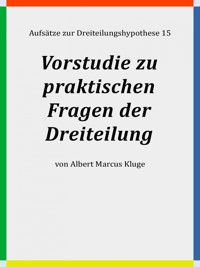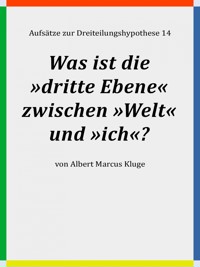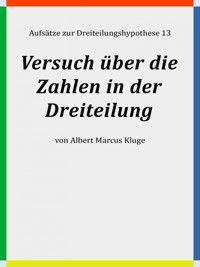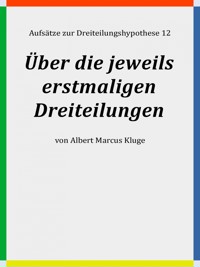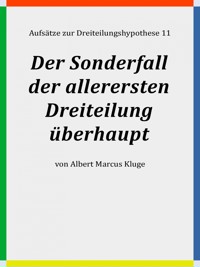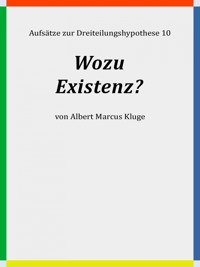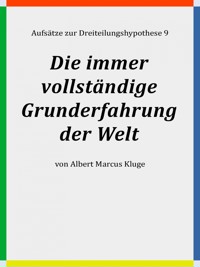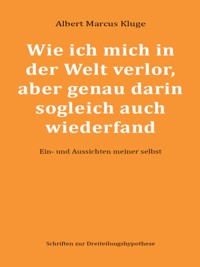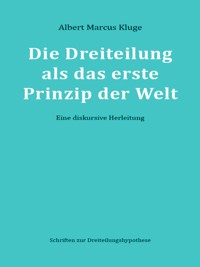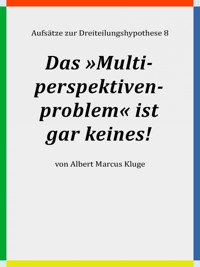
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das »Multiperspektivenproblem« innerhalb der »Dreiteilungshypothese« ist die Frage, wie verschiedene die Welt Erfahrende die gleiche unhintergehbare »Grunderfahrung« dieser Welt machen können, die sie machen müssen, um der Unhintergehbarkeit der Welt als dem erkenntnistheoretischen Fundament der Dreiteilungshypothese nicht zuwiderzulaufen. Die Lösung liegt vereinfacht gesagt in der Trennung eines »ich« der Ersten-Person-Perspektive, als zugleich einer allgemeinen Perspektive von gewissermaßen außerhalb der Welt auf die Welt, von einem »Ich« in der Dritten-Person-Perspektive, als zugleich einer jeweils besonderen Perspektive innerhalb der Welt. Der Text erfordert einige basale Vorkenntnisse zur Theorie, wie sie etwa die »Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese« bietet, z. B. in Kluge 2022 ff.: »Großes Begriffslexikon zur Hypothese der Dreiteilung«. Mehr Informationen auf: www.dreiteilungshypothese.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 36
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das »Multiperspektivenproblem« ist gar keines!
Start
Allgemeines Vorwort zu dieser Aufsatzreihe
Das »Multiperspektivenproblem« ist gar keines!
Über das »Projekt Dreiteilungshypothese«
Weitere Veröffentlichungen zur Dreiteilungshypothese
Über den Autor
Impressum
Allgemeines Vorwort zu dieser Aufsatzreihe
In den Untersuchungen zur „Dreiteilungshypothese“ tauchen immer wieder spezielle Fragen auf, deren Bearbeitung den gesteckten Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellung unzulässig weit überschreiten würde, die aber dennoch nicht so umfangreich sind, dass sie gleich eine eigenständige Schrift ausfüllen könnten, weshalb sie in dieser Reihe in einem dafür geeigneteren Aufsatzformat abgehandelt werden sollen. Die einzelnen Texte erfordern zu ihrem besonderen Verständnis in der Regel einige Vorkenntnisse zur Theorie der Dreiteilung beziehungsweise wenigstens die Bereitschaft, sich solche begleitend anzueignen. Eine dahingehend hilfreiche Begleitlektüre zu allen Aufsätzen, mit vielen Hinweisen zur weiteren Vertiefung, ist das „Große Begriffslexikon zur Hypothese der Dreiteilung“, und für den allerersten Einstieg, darin die „Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese“. Die Aufsätze werden unregelmäßig erscheinen und wegen ihrer zumeist geringen Seitenanzahl zunächst nur als E-Book veröffentlicht. Die ersten sieben dieser Arbeiten sind mittlerweile aber auch schon in einem gedruckten Sammelband niedergelegt.
Albert Marcus Kluge
Das »Multiperspektivenproblem« ist gar keines!
Abriss: Das „Multiperspektivenproblem“ innerhalb der „Dreiteilungshypothese“ ist die Frage, wie verschiedene die Welt Erfahrende die gleiche unhintergehbare „Grunderfahrung“ dieser Welt machen können, die sie machen können müssen, um der Unhintergehbarkeit der Welt als unerlässlichem erkenntnistheoretischen Fundament der Dreiteilungshypothese nicht zuwiderzulaufen. Dies bereits in den „Grundlagen“ (Kluge 2019) aufgeworfene Problem konnte zwar schon in den „Einsichten“ (Kluge 2021) und der „Einfaltung“ (Kluge 2021a) gelöst werden, dort jedoch im Rahmen einer viel umfassenderen Fragestellung, sodass die besondere Beantwortung dieser wichtigen Detailfrage dabei vielleicht etwas unter die Räder kam. Die Lösung des „Multiperspektivenproblems“ liegt vereinfacht gesagt in der ontologischen Trennung eines „ich“ der Ersten-Person-Perspektive, die zugleich als eine allgemeine Perspektive von gewissermaßen außerhalb der Welt auf die Welt aufzeigbar ist, von einem „Ich“ in der Dritten-Person-Perspektive, die zugleich mit einer jeweils besonderen Perspektive innerhalb der Welt einhergeht. Der Text erfordert einige basale Vorkenntnisse zur Theorie, wie sie etwa die „Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese“ bietet, z. B. in Kluge 2022 ff.: „Großes Begriffslexikon zur Hypothese der Dreiteilung“.
Inhalt: Einleitung - I. Die unhintergehbare Grunderfahrung der Welt - II. Der Multiperspektiveneinwand - III. Wie ich und wo ich mich selbst im Verhältnis zur Welt erfahre beziehungsweise zu verstehen habe - IV. Mit der Verallgemeinerung der gewonnenen Erkenntnisse auf beliebig viele die Welt Erfahrende zur vollständigen Auflösung des Multiperspektivenproblems - V. Dennoch verbleiben offene Fragen - Schluss - Literatur
Einleitung
a) Das „Multiperspektivenproblem“ ist der vielleicht schärfste Einwand gegen das erkenntnistheoretische wie metaphysische Fundament der „Dreiteilungshypothese“, welches in der unhintergehbaren „Grunderfahrung“ von allem Vielen wie Verschiedenen überhaupt in der Welt besteht. Kann „ich“ doch sicherlich nicht stets das Gleiche wie „andere“ erfahren und können diese „anderen“ doch wohl nicht stets das Gleiche wie „ich“ erfahren, womit eine behauptet allgemeine Grunderfahrung der Welt für alle die Welt Erfahrenden aber stets nur unvollständig sein kann. Ohne die immer unhintergehbare Vollständigkeit der Grunderfahrung der Welt ist die Ableitung der „Dreiteilungshypothese“ daraus aber nicht mehr zwingend aufzeigbar, weder die „Rückführung“ des Vielen auf immer weniger Vieles und auf schließlich nur Eines noch der „ontologische Urknall“ der Teilung dieses nur Einen in erstmals genau drei Seiende und dann fortgesetzt in wiederum jeweils drei Seiende, die so begründete „Hypothese über die Dreiteilung der Welt“.
b) Die besondere Schärfe des Einwands zielt dabei weniger darauf ab, dass doch nicht alle Erfahrenden stets alles erfahren können, also nicht alle immer jeweils das Gleiche erfahren können, sondern vor allem darauf, dass selbst wenn dies irgendwie zu rechtfertigen ist, beziehungsweise gerade wenn dies irgendwie zu rechtfertigen ist, also alle Erfahrenden die Welt immer vollständig und untereinander immer als die gleiche Welt erfahren, es sich dann doch um nur ein einziges die Welt Erfahrendes handeln würde, entgegen der natürlichen Annahme vieler und die Welt jeweils irgendwie anders Erfahrender. Kurz: Wie können viele verschiedene Perspektiven auf eine gemeinsame Welt immer vollständig sein? Das ist das hier aufzuklärende „Multiperspektivenproblem“.