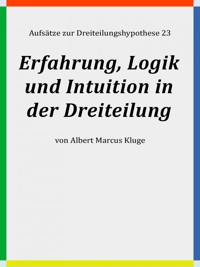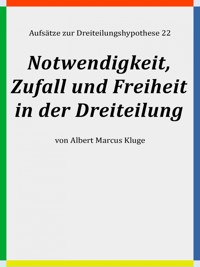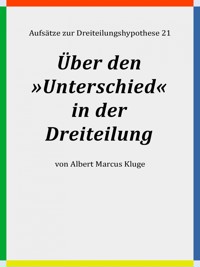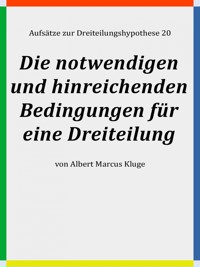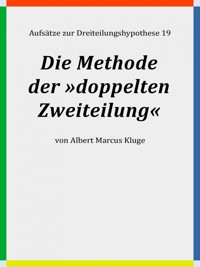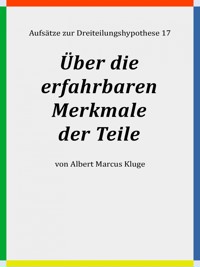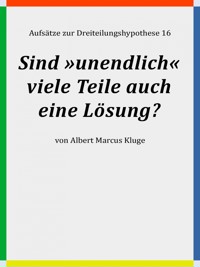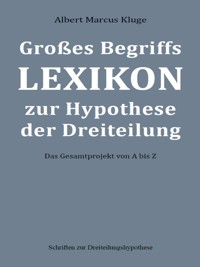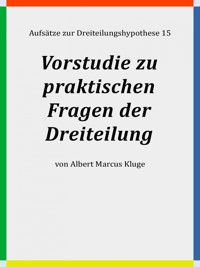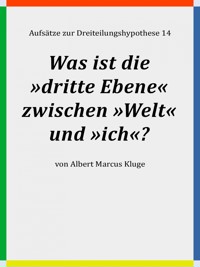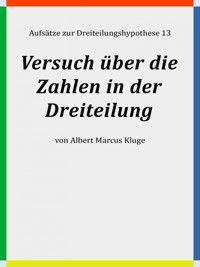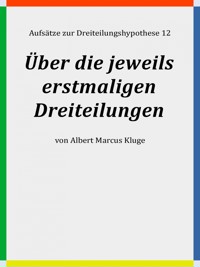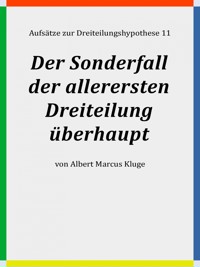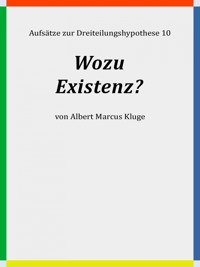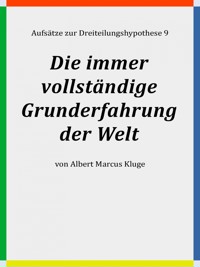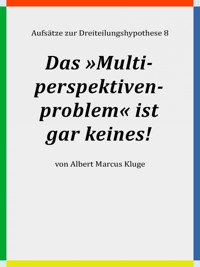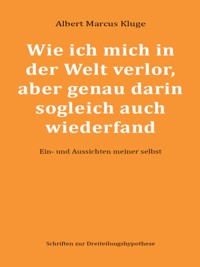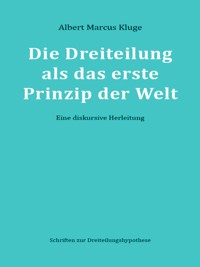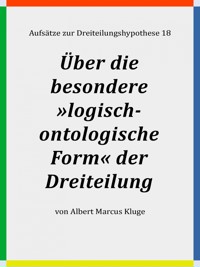
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die besondere »logisch-ontologische Form« im Ergebnis der drei Teile einer hypothesengemäßen Dreiteilung, etwas vereinfacht ausgedrückt, in zwei einander Gegenteilige und einem dazu Neutralen, gewährleistet die allseitige Verschiedenheit und damit überhaupt erst die Vereinzelung eines jeden Seienden. Im Zusammenspiel von logischer Zweiteilung und ontologischer Dreiteilung bestimmt letztlich allein diese Form die exakten Relationen der drei Teile untereinander. Trotz dieser theoretisch-formalen Strenge sind die praktisch-sachlichen Zusammenhänge der Teile aber nicht ganz so eindeutig, da sie von Vorgaben abhängig sind, die außerhalb dieser Form zu machen sind und zunächst einmal in eine solche Form zu überführen sind. Diese notwendige Operationalisierung der Vorgabedaten ist zwar vornehmlich die Aufgabe einer Einzelfallprüfung, doch lassen sich gleichwohl dazu auch ein paar hilfreiche allgemeinere Überlegungen anstellen, die der logisch-ontologischen Form vielleicht nicht ganz so offensichtlich zu entnehmen sind. Im Rahmen der gegenwärtig verstärkten Anwendungsorientierung dieser Aufsatzreihe sollen hier einige solcher theoretisch-praktischen Kontaktmomente etwas näher beleuchtet werden, bei weitem nicht erschöpfend, aber soweit schon geeignet zur Eröffnung neuer Wege und zu einem besseren Verständnis der Problematik, welches später auch einer erfolgreicheren Verarbeitung konkreter Daten zugutekommen sollte oder wenigstens Ansätze dafür bieten könnte, passende Lösungsverfahren aufzufinden bzw. weiterzuentwickeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 42
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelbild
Allgemeines Vorwort zu dieser Aufsatzreihe
Über die besondere »logisch-ontologische Form« der Dreiteilung
Über das »Projekt Dreiteilungshypothese«
Weitere Veröffentlichungen zur Dreiteilungshypothese
Über den Autor
Impressum
Allgemeines Vorwort zu dieser Aufsatzreihe
In den Untersuchungen zur „Dreiteilungshypothese“ tauchen immer wieder spezielle Fragen auf, deren Bearbeitung den gesteckten Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellung unzulässig weit überschreiten würde, die aber dennoch nicht so umfangreich sind, dass sie gleich eine eigenständige Schrift ausfüllen könnten, weshalb sie in dieser Reihe in einem dafür geeigneteren Aufsatzformat abgehandelt werden sollen. Die einzelnen Texte erfordern zu ihrem besonderen Verständnis in der Regel einige Vorkenntnisse zur Theorie der Dreiteilung beziehungsweise wenigstens die Bereitschaft, sich solche begleitend anzueignen. Eine dahingehend hilfreiche Begleitlektüre zu allen Aufsätzen, mit vielen Hinweisen zur weiteren Vertiefung, ist das „Große Begriffslexikon zur Hypothese der Dreiteilung“, und für einen allerersten Einstieg, darin die „Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese“. Die Aufsätze werden unregelmäßig erscheinen und wegen ihrer zumeist geringen Seitenanzahl zunächst nur als E-Book veröffentlicht.
Albert Marcus Kluge
Über die besondere »logisch-ontologische Form« der Dreiteilung
Abriss: Die besondere »logisch-ontologische Form« im Ergebnis der drei Teile einer hypothesengemäßen Dreiteilung, etwas vereinfacht ausgedrückt, in zwei einander Gegenteilige und einem dazu Neutralen, gewährleistet die allseitige Verschiedenheit und damit überhaupt erst die Vereinzelung eines jeden Seienden. Im Zusammenspiel von logischer Zweiteilung und ontologischer Dreiteilung bestimmt letztlich allein diese Form die exakten Relationen der drei Teile untereinander. Trotz dieser theoretisch-formalen Strenge sind die praktisch-sachlichen Zusammenhänge der Teile aber nicht ganz so eindeutig, da sie von Vorgaben abhängig sind, die außerhalb dieser Form zu machen sind und zunächst einmal in eine solche Form zu überführen sind. Diese notwendige Operationalisierung der Vorgabedaten ist zwar vornehmlich die Aufgabe einer Einzelfallprüfung, doch lassen sich gleichwohl dazu auch ein paar hilfreiche allgemeinere Überlegungen anstellen, die der logisch-ontologischen Form vielleicht nicht ganz so offensichtlich zu entnehmen sind. Im Rahmen der gegenwärtig verstärkten Anwendungsorientierung dieser Aufsatzreihe sollen hier einige solcher theoretisch-praktischen Kontaktmomente etwas näher beleuchtet werden, bei weitem nicht erschöpfend, aber soweit schon geeignet zur Eröffnung neuer Wege und zu einem besseren Verständnis der Problematik, welches später auch einer erfolgreicheren Verarbeitung konkreter Daten zugutekommen sollte oder wenigstens Ansätze dafür bieten könnte, passende Lösungsverfahren aufzufinden bzw. weiterzuentwickeln. - Vorkenntnisse der Beispiele aus dem Grundlagenband zur Dreiteilung von 2019 wären zum besseren Verständnis dieser Arbeit hilfreich, sind aber keine unverzichtbare Voraussetzung.
Inhalt: Einleitung - I. Die »logisch-ontologische Form« in der Theorie - II. Die Bestimmung der »LOF« in der Praxis - III. Allgemeines Teilungs- und besonderes Formkriterium - IV. Zum problematischen Status des besonderen Dritten - V. Eine Typisierung der »LOF« in Trivialbeispielen - Schluss - Literatur
Einleitung
a) Im vorherigen Aufsatz (Kluge 2025a) wurden die erfahrbaren besonderen Merkmale der Seienden als solche untersucht, mit dem Ergebnis, dass die Seienden selbst als die Merkmale der Seienden zu verstehen sind, in den jeweiligen Relationen der Seienden untereinander. In diesem Aufsatz werden die Relationen zwischen den Merkmalen der Seienden selbst genauer betrachtet, insbesondere der drei Teile im Ergebnis einer jeden hypothesengemäßen Dreiteilung, deren logische beziehungsweise ontologische Ordnung eine ganz besondere Charakteristik aufweist, die so benannte „logisch-ontologische Form“ der Dreiteilung (nachfolgend gelegentlich mit „LOF“ abgekürzt), das zentrale Thema der vorliegenden Untersuchung.
b) Diese Form, darstellbar sowohl durch zwei miteinander verknüpfte logische Zweiteilungen als auch durch eine ontologische Dreiteilung, bei der sich alle drei Teile zugleich voneinander durcheinander unterscheiden, jeweils aus einem diesen Teilen zugrunde liegenden Ganzen heraus, bestimmt die drei Teile in der Sache, entsprechend ihren Merkmalen. Was in der Theorie noch recht leicht aufgezeigt werden kann, macht dagegen in der Praxis, mit konkret vorgegebenen Daten, recht große Schwierigkeiten, da die logisch-ontologische Form kein eigenes Datum ist, welches den Vorgabedaten immer schon mitgegeben ist, sondern aus den Vorgabedaten immer erst noch herausgelesen beziehungsweise herausgearbeitet werden muss. Oder mit anderen Worten: Die Vorgabedaten lassen sich zumeist nicht einfach irgendwie direkt in die besondere Form einsetzen, sondern sind dafür noch zu interpretieren.
c) Für diesen finalen Operationalisierungsschritt, zur geeigneten Anwendung der logisch-ontologischen Form auf die Vorgabedaten, sind im Rahmen der Gesamtuntersuchung zur Dreiteilungshypothese bislang schon mehrere Überlegungen angestellt worden, die in dieser Spezialuntersuchung zusammengetragen, aufbereitet und weiterentwickelt beziehungsweise ergänzt werden sollen. Ziel dieses Aufsatzes ist es, entsprechend nützliche Hilfsmethoden aufzuzeigen und damit weitere vorbereitende Arbeiten zur Lösung konkreter praktischer Probleme zu leisten, die später insbesondere dem geplanten „Praxisband“ zur Dreiteilungshypothese zugutekommen sollen.
d) Die hier näher zu behandelnde Problematik dreht sich also nicht um eine ungenügende Datenvorgabe und um technische Brechungsschwierigkeiten, die sich mit umfangreicheren und genaueren Vorgaben lösen ließen, sondern um Fragen, die einer zusätzlichen Interpretation der Vorgaben bedürfen, die mit der bloßen Form allein nicht beantwortet werden können, vor allem die Begründung der zu treffenden Auswahl aus den „drei Varianten der doppelten Zweiteilung“, wovon eben nur eine die besondere logisch-ontologische Form dieser Dreiteilung ist. Dass uns diese besondere Form in der Praxis gelegentlich sofort offensichtlich ist, ist noch keine hinreichend befriedigende Erklärung ihrer Gültigkeit beziehungsweise sollte nicht gänzlich unreflektiert als eine solche betrachtet werden.
e) In Kapitel I