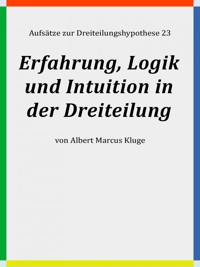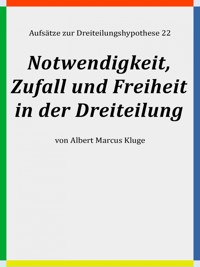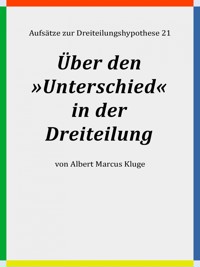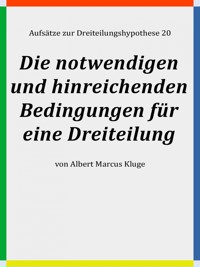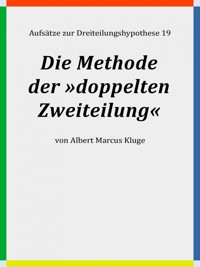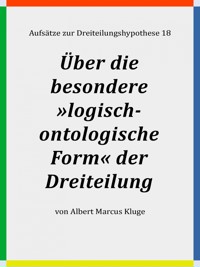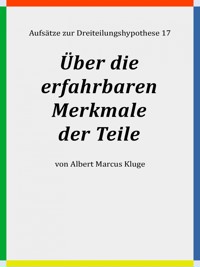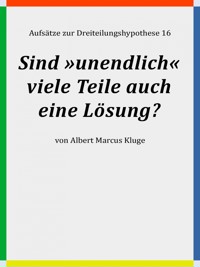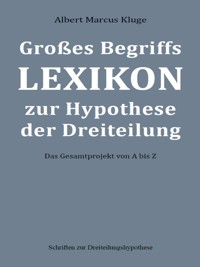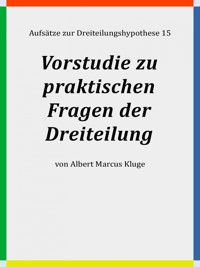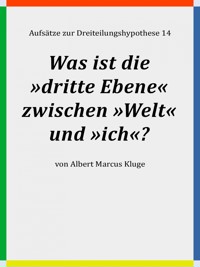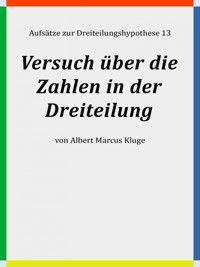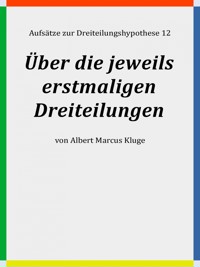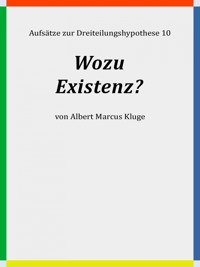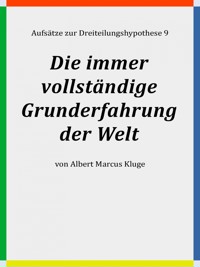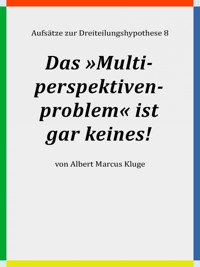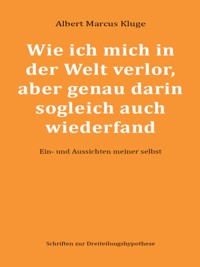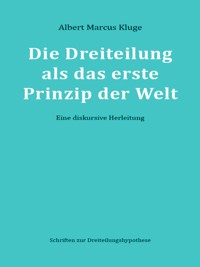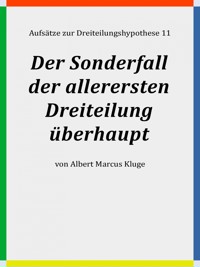
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die allererste Dreiteilung überhaupt in erfahrbar Seiendes, der auch so benannte »ontologische Urknall«, nimmt eine einmalige Sonderstellung unter allen Dreiteilungen im Rahmen der Dreiteilungshypothese ein, erfolgt diese doch nicht wie alle späteren Dreiteilungen aus einem Seienden, sondern aus einem Nichtseienden heraus. Dieses Nichtseiende, »nur Eine« oder auch »Erste Eine«, hat seinen ontologischen Status, gemäß dem umgekehrten Existenzpostulat, dabei nicht deshalb, weil es sich von was auch immer wie auch immer anderem Nichtseienden oder Seienden nicht unterscheidet, sondern weil es zu Beginn gar keine anderen ontologischen Größen gibt, von denen es sich auch nur unterscheiden könnte. Ohne Seiendes im Anfang ist damit auch kein zeitlicher Verlauf der allerersten Dreiteilung erforderlich wie bei allen anderen Dreiteilungen danach, mit weiteren Konsequenzen. Vor allem diese sieben Merkmale sind für die allererste Dreiteilung bisher zumeist noch unzureichend verstanden und sollen hier genauer beleuchtet werden: Das nicht existierende Erste Eine, sowohl als Nichtexistierendes wie in der Begründung wie als Bezugspunkt für die Teile im konkreten Teilungsverfahren, der nicht zeitliche allererste Teilungsverlauf, die somit scheinbar nicht erforderlichen zwei Zwischenseienden darin, die im Teilungsergebnis gleich vier Nichtseienden für nur drei Seiende sowie die Akausalität der allerersten Teilung. Dabei gelingt es aufzuzeigen, dass die allererste und die gewöhnliche Dreiteilung einander sehr viel ähnlicher sind als bislang angenommen. Mehr Informationen auf: www.dreiteilungshypothese.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Sonderfall der allerersten Dreiteilung überhaupt
Start
Allgemeines Vorwort zu dieser Aufsatzreihe
Der Sonderfall der allerersten Dreiteilung überhaupt
Über das »Projekt Dreiteilungshypothese«
Weitere Veröffentlichungen zur Dreiteilungshypothese
Über den Autor
Impressum
Allgemeines Vorwort zu dieser Aufsatzreihe
In den Untersuchungen zur „Dreiteilungshypothese“ tauchen immer wieder spezielle Fragen auf, deren Bearbeitung den gesteckten Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellung unzulässig weit überschreiten würde, die aber dennoch nicht so umfangreich sind, dass sie gleich eine eigenständige Schrift ausfüllen könnten, weshalb sie in dieser Reihe in einem dafür geeigneteren Aufsatzformat abgehandelt werden sollen. Die einzelnen Texte erfordern zu ihrem besonderen Verständnis in der Regel einige Vorkenntnisse zur Theorie der Dreiteilung beziehungsweise wenigstens die Bereitschaft, sich solche begleitend anzueignen. Eine dahingehend hilfreiche Begleitlektüre zu allen Aufsätzen, mit vielen Hinweisen zur weiteren Vertiefung, ist das „Große Begriffslexikon zur Hypothese der Dreiteilung“, und für einen allerersten Einstieg, darin die „Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese“. Die Aufsätze werden unregelmäßig erscheinen und wegen ihrer zumeist geringen Seitenanzahl zunächst nur als E-Book veröffentlicht.
Albert Marcus Kluge
Der Sonderfall der allerersten Dreiteilung überhaupt
Abriss: Die allererste Dreiteilung überhaupt in erfahrbar Seiendes, der auch so benannte „ontologische Urknall“, nimmt eine einmalige Sonderstellung unter allen Dreiteilungen im Rahmen der Dreiteilungshypothese ein, erfolgt diese doch nicht wie alle späteren Dreiteilungen aus einem Seienden, sondern aus einem Nichtseienden heraus. Dieses Nichtseiende, „nur Eine“ oder auch „Erste Eine“, hat seinen ontologischen Status, gemäß dem umgekehrten Existenzpostulat, dabei nicht deshalb, weil es sich von was auch immer wie auch immer anderem Nichtseienden oder Seienden nicht unterscheidet, sondern weil es zu Beginn gar keine anderen ontologischen Größen gibt, von denen es sich auch nur unterscheiden könnte. Ohne Seiendes im Anfang ist damit auch kein zeitlicher Verlauf der allerersten Dreiteilung erforderlich, wie bei allen anderen Dreiteilungen danach, mit weiteren Konsequenzen. Vor allem diese sieben Merkmale sind für die allererste Dreiteilung bisher zumeist noch unzureichend verstanden und sollen hier genauer beleuchtet werden: Das nicht existierende Erste Eine, sowohl als Nichtexistierendes wie in dessen Begründung wie als Bezugspunkt für die Teile im konkreten Teilungsverfahren, der nicht zeitliche allererste Teilungsverlauf, die somit scheinbar nicht erforderlichen zwei Zwischenseienden darin, die im Teilungsergebnis gleich vier Nichtseienden für nur drei Seiende sowie die Akausalität der allerersten Teilung. Dabei gelingt es aufzuzeigen, dass die allererste und die gewöhnliche Dreiteilung einander sehr viel ähnlicher sind als bislang angenommen. - Gute Vorkenntnisse zur Theorie, insbesondere zur gewöhnlichen, dynamischen Dreiteilung, dem „ontologischen Körper“ sind unverzichtbar. Einen hilfreichen Überblick zur Theorie bietet die „Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese“, in Kluge 2022 ff.: „Großes Begriffslexikon zur Hypothese der Dreiteilung“, mit weiteren Verweisen.
Inhalt: Einleitung - I. Der letzte Schritt der Rückführung alles erfahrenen Vielen auf anfänglich nicht erfahrbar nur Eines - II. Die allererste Dreiteilung aus einem Nichtseienden in drei Seiende in formaler Hinsicht - III. Die gewöhnliche Dreiteilung aus einem Seienden in drei Seiende zur Referenz - IV. Die allererste Dreiteilung als einmaliger Sonderfall - V. Noch vor der allerersten Dreiteilung - Schluss - Literatur
Einleitung
a) Der in der bisherigen Untersuchung des „Gesamtprojekts Dreiteilungshypothese“ oft genannte „Sonderfall“ der allerersten Dreiteilung überhaupt in Seiendes in der Welt ist mit seinem Ursprung in einem Nichtseienden nicht nur irgendeine Ausnahme gegenüber den gewöhnlich in einem Seienden verankerten Dreiteilungen, sondern ist die besondere Dreiteilung, die alle gewöhnlichen Dreiteilungen überhaupt erst begründet und ist die besondere Dreiteilung, die selbst ohne eine dieser noch vorhergehenden Dreiteilung begründet wurde, allein aus erkenntnistheoretischer wie ontologischer Notwendigkeit.
b) Die Bedeutung der allerersten Dreiteilung, dem wegen deren zentraler Stellung in der Theorie auch so benannten „ontologischen Urknall“, für die daraus folgende „Dreiteilungshypothese“, dass jede Unterscheidung von erfahrbar Seienden notwendig im Rahmen von Dreiteilungen erfolgt, ist kaum zu überschätzen möglich, hinsichtlich der genaueren Bestimmung des Seienden als solchen sowie der Ableitungen daraus, noch weit über das Seiende hinaus. Auch wenn die schon erzielten Erkenntnisse darüber zur formalen Aufstellung der Dreiteilungshypothese bereits grundsätzlich hinreichend waren, sind noch einige sachliche Unklarheiten verblieben, die einer weiteren Untersuchung insbesondere der metaphysischen Anfangsbedingungen von allem überhaupt entgegenstehen. Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die noch vorhandenen Erklärungslücken zu benennen und wenn möglich auch gleich zu schließen, was unerwarteterweise weitgehend gelingen wird.
c) In Kapitel I wird zunächst zum konkreten Einstieg in das Thema der erkenntnistheoretische Weg der „Rückführung“ des mit der „Grunderfahrung“ erfahrenen Vielen wie Verschiedenen der Welt auf das nicht erfahrbare „Erste Eine“ im letzten Schritt dafür genauer unter die Lupe genommen, zumal dieser „letzte Schritt“ ontologisch bereits in den Geltungsbereich der allerersten Dreiteilung fällt und so Vorbedingungen für diese festlegt. Von Interesse ist hier vor allem die genaue formale wie sachliche Begründung des gemäß „umgekehrtem Existenzpostulat“ nicht existierenden Ersten Einen als die vorerst alleinige ontologische Basis für die daraus dann entstehenden ersten drei Seienden der allerersten Dreiteilung überhaupt.
d) In Kapitel II wird die allererste Dreiteilung in erfahrbar Seiendes für die daraus abzuleitende Hypothese hinreichend in minimaler Weise begründet, darin nur genau drei Teile sich überhaupt, nämlich voneinander und durcheinander erfahrbar unterscheiden können und gemäß „Existenzpostulat“ existieren können. Bereits aus dieser ersten „Dreiteilung“ überhaupt lässt sich auch schon eine genauere metaphysische Struktur im inneren Vollzug der Dreiteilung beschreiben, in drei so benannten „Symmetriebrüchen“ aus dem Ersten Einen heraus, zunächst in Drei, dann in drei Verschiedene, aber nur als Verschiedene noch nicht (endgültig) Verschiedene, schließlich in drei verschiedene Seiende, in der besonderen logisch-ontologischen Form zweier Gegenteiliger und einem dazu Neutralen.
e) In Kapitel III wird zum Zwecke des Vergleichs mit dem Sonderfall der allerersten Dreiteilung die in allen weiteren Fällen „gewöhnliche Dreiteilung“ vorgestellt, aus einem Seienden in drei Seiende, der wegen seiner hochdynamischen Eigenschaften auch so benannte „ontologischer Körper“, mit einem „Zeitmoment“ zwischen dem einen Seienden als zu teilendem Ganzen und den drei Seienden als den dazu gehörenden Teilen, damit nicht hypothesenwidrig vier Seiende gemeinsam erfahren werden können, was über das Zeitmoment hinweg zu einem ständigen „Hin-und-Her“ zwischen Ganzem und Teilen führt, die sich als solche gegenseitig begründen und so überhaupt erst als die Teilung eines Ganzen in drei Teile verstanden werden dürfen. Auch lässt sie auf diese Weise das zu teilende Seiende als gewissermaßen die Ursache einer Teilung in drei Seiende als Wirkung verstehen. Zudem müssen zwischen Ganzem und Teilen noch zwei so benannte „Zwischenseiende“ angenommen werden, zur Begründung eines kontinuierlichen Prozesses im Entstehen und Vergehen von Seiendem, zwischen Einem und Dreien beziehungsweise zwischen Seiendem und Nichtseiendem, im Vollzug jeder gewöhnlichen Dreiteilung.
f) In Kapitel IV