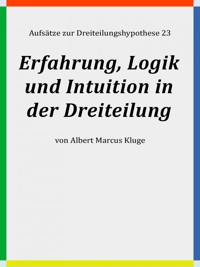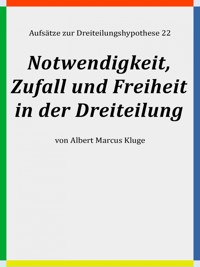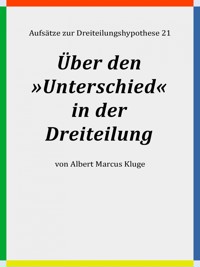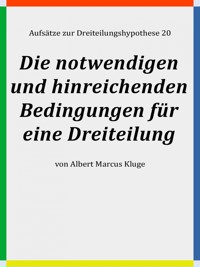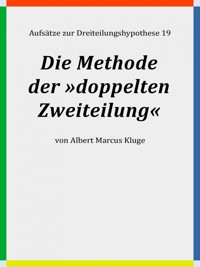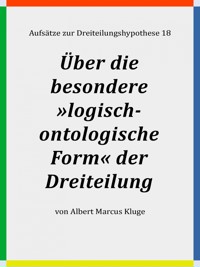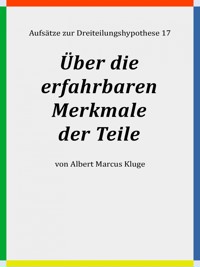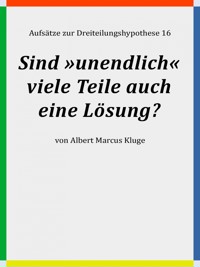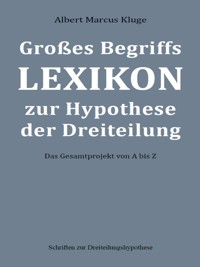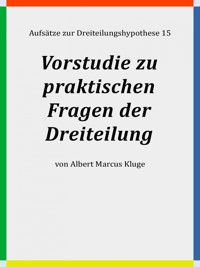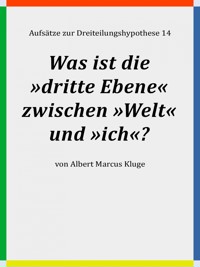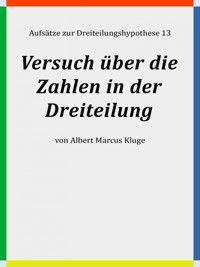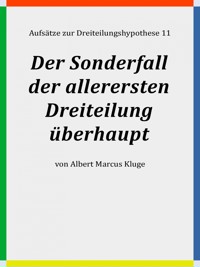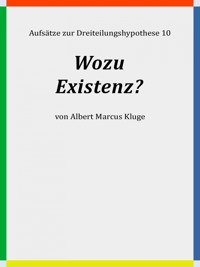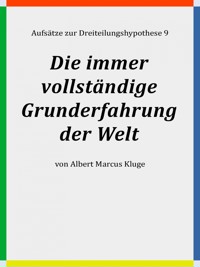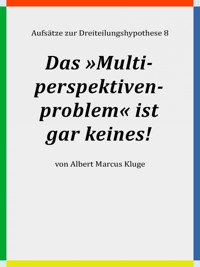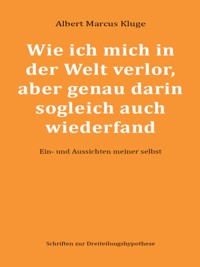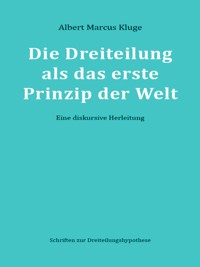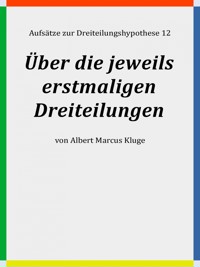
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Während in der »wiederholten Dreiteilung«, dem auch so benannten »ontologischen Körper«, »Ganzes« und »Teile« für diese Dreiteilung bereits aufeinander bezogen bestimmt sind, aus dem Ganzen die Teile entstehen und die Teile wieder zum Ganzen werden, startet die »erstmalige Dreiteilung« weder bereits in einem »Ganzen« noch hat sie schon dessen »Teile« zum Ziel, sondern soll diese erstmalige Dreiteilung das Ganze und die Teile einer Dreiteilung überhaupt erst als solche bestimmen, woran die wiederholte Dreiteilung dann dauerhaft anschließen kann. - Zwar entsteht die erstmalige wie die wiederholte Dreiteilung aus Seiendem in Seiendes, aber genau genommen wiederholt aus Nichtseiendem, d. h. nicht das später erst Seiende, und erstmalig aus Ununterscheidbarem, d. h. noch nicht einmal nicht Seiendes. Doch wie ist die erstmalige Dreiteilung so überhaupt zu verstehen, wenn nicht schon auf später Seiendes bezogen? Die vorliegende Untersuchung zeigt auf, was auf dem Boden der bisherigen Erkenntnisse zur Dreiteilungshypothese aufzeigbar ist, wobei theoretische Lücken fundamentaler Natur unvermeidlich bestehen bleiben. - Dieser Aufsatz schließt direkt an den vorhergehenden an, dessen Kenntnis zwar nicht vorausgesetzt wird, doch sehr hilfreich wäre. Insbesondere sind Vorkenntnisse zur wiederholten Dreiteilung bzw. zum »ontologischen Körper« aber unverzichtbar, auch wenn dieser skizzenhaft nochmals nachgezeichnet wird. Mehr Informationen auf: www.dreiteilungshypothese.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 43
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über die jeweils erstmaligen Dreiteilungen
Start
Allgemeines Vorwort zu dieser Aufsatzreihe
Über die jeweils erstmaligen Dreiteilungen
Über das »Projekt Dreiteilungshypothese«
Weitere Veröffentlichungen zur Dreiteilungshypothese
Über den Autor
Impressum
Allgemeines Vorwort zu dieser Aufsatzreihe
In den Untersuchungen zur „Dreiteilungshypothese“ tauchen immer wieder spezielle Fragen auf, deren Bearbeitung den gesteckten Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellung unzulässig weit überschreiten würde, die aber dennoch nicht so umfangreich sind, dass sie gleich eine eigenständige Schrift ausfüllen könnten, weshalb sie in dieser Reihe in einem dafür geeigneteren Aufsatzformat abgehandelt werden sollen. Die einzelnen Texte erfordern zu ihrem besonderen Verständnis in der Regel einige Vorkenntnisse zur Theorie der Dreiteilung beziehungsweise wenigstens die Bereitschaft, sich solche begleitend anzueignen. Eine dahingehend hilfreiche Begleitlektüre zu allen Aufsätzen, mit vielen Hinweisen zur weiteren Vertiefung, ist das „Große Begriffslexikon zur Hypothese der Dreiteilung“, und für einen allerersten Einstieg, darin die „Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese“. Die Aufsätze werden unregelmäßig erscheinen und wegen ihrer zumeist geringen Seitenanzahl zunächst nur als E-Book veröffentlicht.
Albert Marcus Kluge
Über die jeweils erstmaligen Dreiteilungen
Abriss: Während in der „wiederholten Dreiteilung“, dem auch so benannten „ontologischen Körper“, „Ganzes“ und „Teile“ für diese Dreiteilung bereits aufeinander bezogen bestimmt sind, aus dem Ganzen die Teile entstehen und die Teile wieder zum Ganzen werden, startet die „erstmalige Dreiteilung“ weder bereits in einem „Ganzen“ noch hat sie schon dessen „Teile“ zum Ziel, sondern soll diese erstmalige Dreiteilung das Ganze und die Teile einer Dreiteilung überhaupt erst als solche bestimmen, woran die wiederholte Dreiteilung dann dauerhaft anschließen kann. - Zwar entsteht die erstmalige wie die wiederholte Dreiteilung aus Seiendem in Seiendes, aber genau genommen wiederholt aus Nichtseiendem, d. h. nicht das später erst Seiende, und erstmalig aus Ununterscheidbarem, d. h. noch nicht einmal nicht Seiendes. Doch wie ist die erstmalige Dreiteilung so überhaupt zu verstehen, wenn nicht schon auf später Seiendes bezogen? Die vorliegende Untersuchung zeigt auf, was auf dem Boden der bisherigen Erkenntnisse zur Dreiteilungshypothese aufzeigbar ist, wobei theoretische Lücken fundamentaler Natur unvermeidlich bestehen bleiben. - Dieser Aufsatz schließt direkt an den vorhergehenden an, dessen Kenntnis zwar nicht vorausgesetzt wird, doch sehr hilfreich wäre. Insbesondere sind Vorkenntnisse zur wiederholten Dreiteilung bzw. zum „ontologischen Körper“ aber unverzichtbar, auch wenn dieser nochmals skizzenhaft vorgestellt wird.
Inhalt: Einleitung - I. Die im Erfahren ständig wiederholteDreiteilung - II. Die für das Erfahren notwendig erstmaligeDreiteilung - III. Vom Ununterscheidbaren über die erstmaligen Teile zum erstmaligen Ganzen dieser Teile - Schluss - Literatur
Einleitung
a) Die „erstmalige Dreiteilung“ beziehungsweise der erstmalig errichtete „ontologische Körper“ liegt in der Gesamtuntersuchung zur Dreiteilungshypothese immer noch weitgehend im metaphysischen Dunkel verborgen. Während der bereits aktive ontologische Körper in seinem ständigen dynamischen temporalen „Hin-und-Her“ zwischen einem Seienden im Ausgang der Dreiteilung und drei Seienden im Ergebnis dieser Dreiteilung, als einem „Ganzen“ und drei „Teilen“, eine darin sich wechselseitig stützende Begründung findet, besteht noch eine große Erklärungslücke dahingehend, wie diese ontologische Dynamik überhaupt erstmals in Gang gesetzt wird.
b) Eine tiefere metaphysische Begründung für die jeweils erstmaligen Dreiteilungen kann aber auch in dieser speziellen Abhandlung darüber noch nicht gegeben werden, dafür wären noch viele weitere Überlegungen in Angriff zu nehmen, etwa zu einem wie auch immer „Anfang“ als solchem überhaupt, was schon weit über das lediglich formale Entstehungsverfahren hinausgeht, ohne dass auch nur in Aussicht gestellt werden könnte, dass weitere Erklärungen auch wirklich zu einer abschließenden Lösung der Problematik zu führen vermögen. Diese Diskussion muss irgendwann später an anderer Stelle geleistet werden. Was hier aber getan werden kann, ist das formale Verfahren der erstmaligen Entstehung von erfahrbar Seienden einer Dreiteilung Schritt für Schritt zu beschreiben, soweit dieses überhaupt irgendwie beschreibbar ist, und wenn nicht die Erklärungslücke, so doch wenigstens die Beschreibungslücke zu schließen, die bislang noch gelassen wurde.
c) In Kapitel I soll dafür zunächst nochmals die Funktionsweise der wiederholten Dreiteilung, des „ontologischen Körpers“, dargelegt werden, aber weniger seine ausgefeilte Begründung, was an anderen Stellen der Gesamtuntersuchung bereits hinreichend oft geschehen ist (grundlegend schon in Kluge 2019: insb. Kap VI, sehr ausführlich in Kluge 2022, kurz zusammengefasst etwa jüngst in Kluge 2023i: Kap. III), sondern als Zielvorgabe und Vergleichsbasis für die erstmalige Dreiteilung. In Kapitel II werden nochmals die wenigen bisherigen Erkenntnisse zur erstmaligen Dreiteilung zusammengetragen (s. ebd.), insbesondere auch zur Rolle des so benannten „Ununterscheidbaren“ dabei, woran die gesamte Begründung der Dreiteilungsontologie überhaupt hängt. In Kapitel III schließlich werden die neuen Erkenntnisse zur erstmaligen Dreiteilung präsentiert und im initialisierenden Gang durch ihren kompletten erstmaligen Teilungszyklus aufgezeigt und erläutert.
I. Die im Erfahren ständig wiederholteDreiteilung
a) Die bereits „wiederholte Dreiteilung“, der schon errichtete und aktive „ontologische Körper“, das im Erfahren über ein unteilbares „Zeitmoment“ hinweg dynamische „Hin-und-Her“ zwischen einem „Ganzen“ und drei „Teilen“, genauer: zwischen einem „existierenden Ganzen“ und drei „existierenden Teilen“ beziehungsweise zwischen drei „(noch) nicht existierenden Teilen“ und einem „nicht (mehr) existierenden Ganzen“, mit zwei „weder Seienden noch Nichtseienden“ beziehungsweise zwei „Zwischenseienden“ im Übergang, begründet sich in ihren wechselseitigen ontologischen Größen vollständig selbst, welche sich alle aus Notwendigkeiten für eine Erfahrung überhaupt von Seiendem ableiten lassen, eine Erfahrung, die wir offensichtlich immer voraussetzen dürfen, worauf erneut im Detail genauer einzugehen, wir hier aber weitgehend verzichten und vor allem nur die besonderen ontologischen Funktionen dieser Größen dabei nochmals nachzeichnen wollen.
b) Das „Zeitmoment“ zwischen Ganzem und Teilen, beziehungsweise dem einen zu teilenden Seienden vor