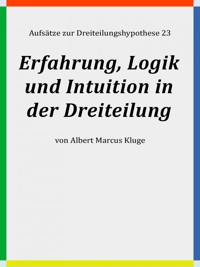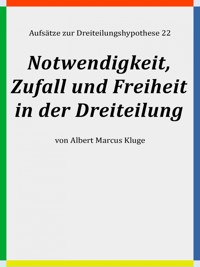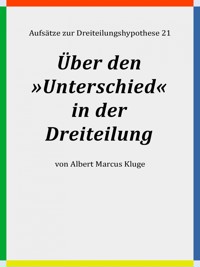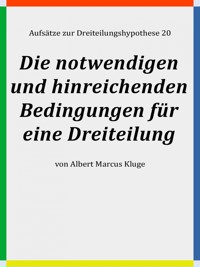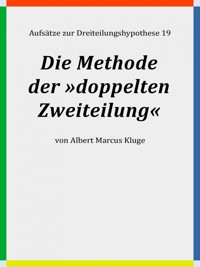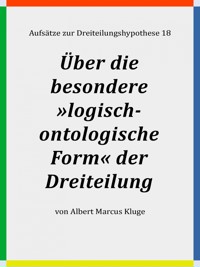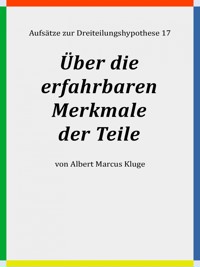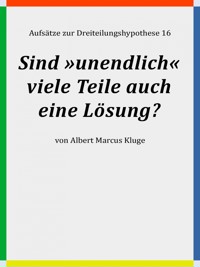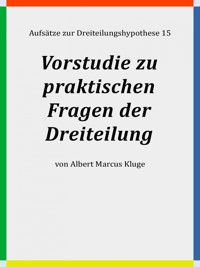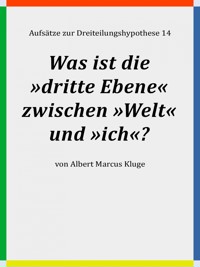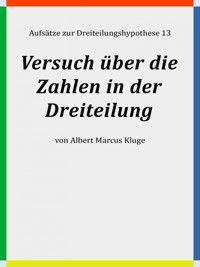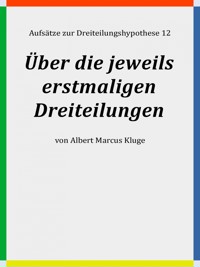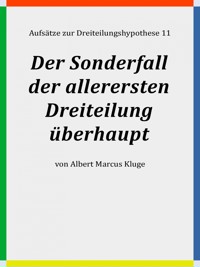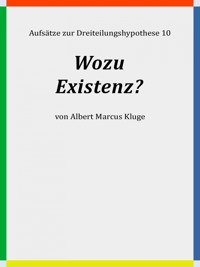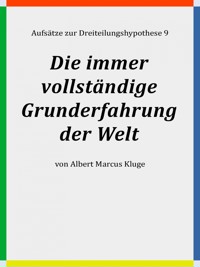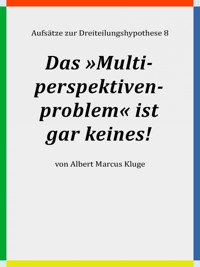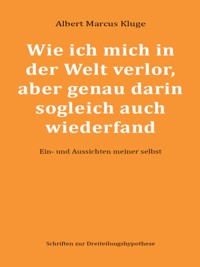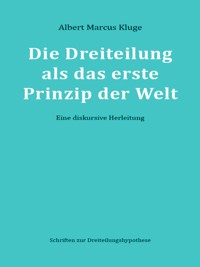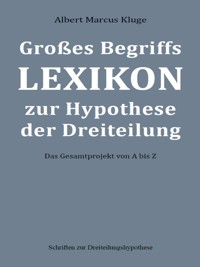
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das »Große Begriffslexikon« bietet einen aktuellen Ein- und Überblick zur immer umfangreicher werdenden Theorie der »Dreiteilungshypothese«. Die fast 300 Begriffe darin sind dabei vor allem folgenden acht dazu bereits veröffentlichten Schriften entnommen: Den »Grundlagen« (2019), der »Herleitung« (2020), den »Einsichten« (2021), der »Einfaltung« (2021), den »Denkgesetzen« (2022), den »Vielteilungen« (2022) sowie den beiden »Aufsatzsammelbänden« (2023 und 2024) mit zusammen 15 Aufsätzen zu Spezialfragen. Eine den Stichworten vorangehende »Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese« soll zuvor die Hauptidee, die Ziele, die Methoden und die bisherigen Ergebnisse dieser Theorie in ihrem Zusammenhang vorstellen. Auf der Basis dieses Überblicks zur Gesamtuntersuchung kann das Lexikon mithilfe der zahlreichen Querverweise darin sogar fast schon als eine eigenständige Schrift gelesen werden. Es ist geplant, das Lexikon und die »Kurze Einführung« darin stets auf dem neusten Stand zu halten und bei Erscheinen neuer Arbeiten oder Erlangung neuer Erkenntnisse entsprechend zu überarbeiten. Um eine solche Funktion praktisch zu gewährleisten, wird dieses Begriffslexikon bis auf weiteres nur als leicht aktualisierbares E-Book erscheinen. Mehr Informationen auf: www.dreiteilungshypothese.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Start
Vorwort zur 4. Auflage
Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese
Hinweise zum praktischen Gebrauch dieses Wörterbuchs
Siglen- und Abkürzungsverzeichnis
Stichworte von A bis Z
Index
Ausführliche Inhaltsverzeichnisse
Alle Arbeiten zur Dreiteilungshypothese
Über den Autor
Impressum
Vorwort zur 4. Auflage
Die seit der Veröffentlichung der so benannten „Grundlagen“ von 2019 immer umfangreicher gewordene und immer weiter anwachsende „Hypothese über die Dreiteilung der Welt“, kurz „Dreiteilungshypothese“, lässt es sinnvoll erscheinen, die darin explizit oder auch nur implizit verwendeten Begriffe in einer allgemeinen Übersicht zusammenzustellen, zur Verständnis verbessernden Begleitung bei der Lektüre der bislang erschienen Schriften und Aufsätze. Eingefügt wurden zudem einige kleinere Extrabeiträge. Eine allen Stichworten vorangestellte „Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese“ soll in kompakter Form die Hauptidee, Ziele, Methoden und die bisherigen Ergebnisse dieser Theorie näherbringen. Es ist vorgesehen, das Wörterbuch und die „Kurze Einführung“ nach Möglichkeit stets auf dem neuesten Stand zu halten, weshalb es dieses Lexikon bis auf weiteres auch nur als leicht zu aktualisierendes E-Book geben wird. Für die nunmehr vierte Auflage wurden wieder viele neue Begriffe aufgenommen sowie die alten Begriffe nochmals gründlich durchgesehen.
Berlin, 10. Mai 2024
Albert Marcus Kluge
Kurze Einführung in das Gesamtprojekt Dreiteilungshypothese
Leicht überarbeitete und erweiterte Version 4.0, März 2024
von Albert Marcus Kluge, Berlin
Abriss: Die „Hypothese über die Dreiteilung der Welt“, kurz meist die „Dreiteilungshypothese“ genannt, ist eine ontologische Unterscheidungstheorie, mit deren Hilfe die großen Fragen der traditionellen Metaphysik nach „Welt“, „Mensch“ und „Gott“ sowie insbesondere auch nach dem „Seienden“ angegangen und schließlich auch beantwortet werden sollen. Aus der empirischen Grunderkenntnis heraus, dass alles, was ist, auch verschieden voneinander ist, und umgekehrt alles, was nicht ist, nicht verschieden voneinander ist, sowie nicht verschieden davon ist, was ist, lässt sich ein fundamentaler logisch-ontologischer Kalkül ableiten, mit dem sichere Aussagen über Seiendes überhaupt und deren Relationen zu anderen Seienden gemacht werden können: die „Dreiteilung“! Die in der Konsequenz daraus zwingend zu folgernde „Hypothese“ besagt nun, dass ausnahmslos alles wie auch immer in unserem Erfahren unterschiedene Seiende diesem Kalkül genügen muss. Aufgabe des auf diesem Fundament aufsetzenden „Gesamtprojekts Dreiteilungshypothese“ ist es, diese zunächst nur formale Erkenntnis zur Beantwortung der metaphysischen Fragen, und zwar allein in einer sich gewissermaßen selbst explorierenden Weise, nach und nach auszubauen sowie mit sachlichen Inhalten zu verbinden. Die Arbeit zur Erfüllung dieser Aufgabe hat aber gerade erst begonnen. Dieser einführende Aufsatz verlangt keine besonderen Vorkenntnisse zur Theorie, gleichwohl die Bereitschaft, sich auf die Komplikationen logischen wie metaphysischen Denkens einzulassen, und zwar ohne die ungeduldige Erwartung auf sofort allgemein verständliche oder gar schon anwendungsbereite Ergebnisse.
Inhalt: Vorbemerkung - I. Zur Idee und Methodik des Projekts - II. Die Herleitung der Hypothese - III. Die statische Dreiteilung - IV. Die dynamische Dreiteilung - V. Entstehen, Vergehen und Kausalität - VI. Die Welt und ich und der Ursprung von allem - VII. Logik und Ontologik - VIII. Anwendung und Selbstanwendung der Hypothese - Schluss - Alle Veröffentlichungen
Vorbemerkung
Diese „Kurze Einführung“ vermag als eine solche nur einen ersten groben Überblick zur mittlerweile schon hochkomplexen „Dreiteilungshypothese“ zu vermitteln, einer Theorie, die zudem selbst erst lediglich an der Oberfläche ihres Betrachtungsgegenstandes zu kratzen vermag, der aus nicht weniger als allem überhaupt besteht. Die Untersuchung zur Dreiteilungshypothese ist vorerst auch nur auf sich selbst ausgerichtet und geht der Auseinandersetzung mit anderen Theorien zum selben Thema noch aus dem Wege, um eine solche später aus einer gefestigteren Position heraus zu suchen. Darüber hinaus fehlt der Theorie bislang auch noch jede Kritik von außen und ist bis auf weiteres allein der natürlicherweise nur einschränkten Selbstkritikfähigkeit des Autors ausgesetzt.
I. Zur Idee und Methodik des Projekts
a) Die „Hypothese über die Dreiteilung der Welt“, auch nur die „Hypothese der Dreiteilung“ oder die „Dreiteilungshypothese“, oder ganz kurz nur die „Hypothese“ bzw. nur die „Dreiteilung“ genannt, ist eine ontologische Unterscheidungstheorie zur Unterscheidung von Seienden als solchen voneinander, mit der auf dem Boden einer allumfassenden und unhintergehbaren „Erfahrung einer Vielheit von Verschiedenen“, mithin der ganzen „Welt“, nach notwendigen Bedingungen für eben diese erkenntnistheoretisch anfängliche „Grunderfahrung“ gesucht wird, wobei deren fundamentalste notwendige Bedingung die zuerst daraus abgeleitete metaphysisch anfängliche Hypothese selbst ist. Sind die prinzipiellen Relationen des Seienden zum Seienden aufgedeckt, können daraus weitere Erkenntnisse über den fundamentalen Aufbau der Welt, ihren Ursprung und letzten Grund sowie die Rolle des Menschen darin abgeleitet werden, in Beantwortung der großen Fragen der traditionellen Metaphysik, dem finalen Ziel des Gesamtprojekts.
b) Gemäß dem Anspruch von Metaphysik, auf der Suche nach endgültigen Antworten, nicht nur nach vorläufigen, die bei nächster Gelegenheit ihre Gültigkeit wieder verlieren können, muss das methodologische Vorgehen beim Auf- und Ausbau der Theorie das strengst mögliche sein: Ein konsequentes Begründen aus einem unbezweifelbaren und unhintergehbaren Anfang heraus, immer nur von innerhalb der bereits gewonnenen Ergebnisse, Schritt für Schritt in Einzelbeweisen abgesichert, durch logische Argumentation, gegebenenfalls ergänzt durch offensichtliches Erfahren sowie auch gestützt auf intuitive und selbstevidente Einsichten. Eine Engführung in der Erkenntnisgewinnung, die keinen Platz für Spekulationen irgendwelcher Art bietet. Lediglich eine widerspruchsfreie Behauptung oder ein nur möglicher Nutzen für die Theorie sollen noch keine schon hinreichenden Begründungen für eine neue Erkenntnis darin sein, sondern erst, wenn auch deren ontologische Notwendigkeit sinnvoll aufgezeigt werden kann.
c) Über einen sicheren Anfangspunkt und eine strenge Methodik hinaus, beziehungsweise zuvor und dafür, müssen aber gleichwohl auch ein paar Grundbegriffe für die kommende Argumentation einfach festgelegt werden, welche letztlich allein auf intuitive beziehungsweise selbstevidente Erkenntnisse gegründet sind. Wenn so in einer ersten begrifflichen Festlegung „Erfahren“ fundamental als lediglich ein „Unterscheiden“ von darin „Verschiedenem“ verstanden wird, einfach in jeweils „dieses, nicht jenes“, und das so unterschiedene Verschiedene, genau darin es voneinander unterschieden verschieden ist, als ebenso „Existierendes“ postuliert wird, ist auch schon alles bereitet für den Anfang beziehungsweise die beiden Anfänge in der Herleitung der Hypothese und ihrem Dreiteilungskalkül, dem erkenntnistheoretischen und dem ontologischen Anfang.
II. Die Herleitung der Hypothese
a) Gilt nun also gemäß dem so benannten „Existenzpostulat“ die Bestimmung „sein heißt verschieden sein!“, die wechselseitige intuitive Gleichsetzung von „Seiendem“ mit erfahrenen „Verschiedenem“, sowie „Erfahren“ als damit prinzipiell lediglich ein entsprechendes „Unterscheiden“ von eben genau darin „Verschiedenem“, können wir bereits die Behauptung aufstellen, dass, wenn wir überhaupt etwas erfahren, mithin Seiendes voneinander unterscheiden, wir so notwendig immer alles überhaupt erfahrbar Verschiedene voneinander unterscheiden, mithin alles überhaupt Seiende in der „Welt“. Das ist die „Grunderfahrung“ der Welt, als die Erfahrung einer unhintergehbaren „Vielheit von Verschiedenem“, das erkenntnistheoretische Fundament der gesamten Theorie.
b) Fragen wir hierfür nach einem Erkenntnisanfang in unserem tatsächlichen Untersuchen, stellen wir fest, immer schon angefangen zu haben, im Unterscheiden von allem überhaupt, Vielem wie Verschiedenem, im Erfahren dessen, worin wir den Erkenntnisanfang zu bestimmen versuchen, ohne dafür genauer angeben zu müssen, was dabei bislang alles unterschieden erfahren wurde. Diese „Grunderfahrung“ ist so aber nicht nur unvorhergehbar, sondern ist ganz allgemein und in jeder Hinsicht unhintergehbar und ist in dieser Abstraktion der gesuchte erkenntnistheoretische Anfang in der Hypothesenbildung.
c) Denn jede Annahme von erfahrenem Verschiedenen unterscheidet dieses Verschiedene eben damit zugleich wenigstens genauso wie angenommen. Und jede Annahme von nicht erfahrenem Verschiedenen unterscheidet dieses entweder dennoch mit eben dieser Annahme genauso wie angegeben, was die Annahme widerlegt, oder unterscheidet solches Verschiedenes wie eben angenommen nicht, womit es in unserem Erfahren aber auch gar nicht fehlt. Wir erfahren gewissermaßen keine Lücken und erfahren deshalb immer alles überhaupt! Die „Grunderfahrung“ beziehungsweise die Beschreibung unseres tatsächlichen Erfahrens wie Unterscheidens der Vielheit des Verschiedenen der Welt ist immer vollständig.
d) Die darauf aufsetzende intuitive Gleichsetzung alles erfahrbar „Verschiedenen“ mit allem „Seienden“ (bzw. allem „Existierenden“, was in der Dreiteilungshypothese begrifflich austauschbar verwendet wird) ist dabei gleichwohl keine willkürliche. Da, ohne eine Definition des „Seienden“ schon vorauszusetzen, jede logische Bestimmung des „Seienden“ ebenso scheitert wie dessen empirische Aufweisung, bleibt nur, entweder ganz auf einen Existenzbegriff zu verzichten und nur mit dem bloß „Verschiedenen“ weiterzumachen, was der Hypothese aber grundsätzlich keinen Abbruch tun würde, oder der vielleicht zwingenden Einsicht zu folgen, dass das, was existiert, sich auch von allem anderen unterscheiden muss, und das, was sich unterscheidet, darin es sich unterscheidet, auch existieren muss, wenn denn eine solche Intuition auch wirklich besteht und nicht nur ein Wunschdenken ist.
e) Da wir nun innerhalb der „Grunderfahrung“ offensichtlich ständig Veränderungen erfahren, dies aber nur möglich ist, indem wir die gewissermaßen „alte Grunderfahrung“ und die gewissermaßen „neue Grunderfahrung“ wie auch immer genau verstanden miteinander vergleichen, vermehrt sich das Viele der Grunderfahrung damit einhergehend auch ständig. Diese ständige „Veränderungsvermehrung“ des erfahrenen Vielen einer Grunderfahrung in immer mehr erfahrenes Vieles legt es nahe anzunehmen, dass jeder erfahrenen Vielheit umgekehrt eine Grunderfahrung von stets weniger Vielem vorangegangen ist. Diese Weise einer „Rückführung“ des Vielen auf immer weniger Vieles konsequent fortgesetzt, ging allem erfahrenen Vielen letztlich (bzw. erstlich) nur Eines voran, welches aber nicht mehr verschieden von etwas anderem sein kann und damit auch nicht erfahren werden kann und in Nichterfüllung des Existenzpostulats damit auch nicht existiert.
f) Um nun von diesem nur Einen wieder zum Vielen zu kommen, müssen wir dieses erste Eine numerisch formuliert wieder vermehren beziehungsweise, wie wir dies einander formal gleichsetzend nennen wollen, teilen: Eine „erste Teilung“ in zunächst angenommen zwei verschiedene, also zwei erfahrbare, also zwei existierende Teile, scheitert jedoch am so fehlenden Unterschied zwischen diesen beiden, der ja dafür auch verschieden von diesen beiden sein muss, mithin annahmewidrig ein weiteres existierendes Teil sein müsste. Eine erste Teilung in angenommen drei Teile wäre möglich, wenn immer ein Teil die jeweils anderen beiden Teile voneinander unterscheidet, sodass sich alle drei Teile voneinander wie durcheinander unterscheiden und somit existieren. Eine erste Teilung in angenommen vier oder mehr Teile scheitert erneut grundsätzlich, da es keine weitere Lösung dafür gibt, alle Teile von allen anderen Teilen durch alle anderen Teile zu unterscheiden.
g) Wenn also allanfänglich von nur Einem ausgegangen wird, aus dem Vieles entstehen können muss, und weder die Teilung in zwei Teile noch die Teilung in vier oder mehr Teile eine Lösung bietet, die Teilung in drei Teile aber eine mögliche Lösung bietet, dann ist die allererste Teilung notwendig eine Teilung in genau drei Teile, eine „Dreiteilung“! Dieses die Hypothese initialisierende „schlagende Argument“ für einen so benannten „ontologischen Urknall“ aus allanfänglich einem Nichtseienden in erstmals drei Seiende, kann nun erneut auf die nachfolgenden Teilungen angewendet werden, nun der bereits entstandenen Seienden in weitere Seiende, die aus den gleichen Gründen ebenfalls Dreiteilungen sein müssen, usw., für alle nachfolgenden Teilungen, kurz: Jede Teilung ist eine Dreiteilung!
h) Der im Untersuchen erkenntnistheoretische Anfang in der Grunderfahrung der Vielheit des Verschiedenen der Welt ließ sich zurückführen auf ein allem vorausgehendes erstes Eines, der ontologische Anfang von allem, aus dem dieses Viele hervorgegangen sein muss, in einer allerersten Dreiteilung und dieser nachfolgenden Dreiteilungen, bis wieder die vollständige Vielheit des Verschiedenen der erkenntnisanfänglichen Grunderfahrung erreicht ist. Daraus folgt zwingend, dass, was auch immer wie auch immer überhaupt existiert, nur als ein Teil einer solchen Dreiteilung existiert. Das Seiende aus jeder erfahrenen Unterscheidung in Verschiedenes, mithin alles Seiende der ganzen Welt überhaupt, muss grundsätzlich irgendwie innerhalb von auseinander hervorgehenden und miteinander verknüpften Dreiteilungen verstanden werden können. Das ist die „Hypothese über die Dreiteilung der Welt“!
i) Behauptet wird mit dieser Hypothese aber nicht, dass nunmehr alle anderen Unterscheidungstheorien falsch sind, es sei denn, diese behaupten ausdrücklich ontologische Teilungen mit weniger oder mehr als genau drei Teilen, oder erheben einen anderen hypothesenwidrigen metaphysischen Anspruch. Behauptet wird vielmehr, dass schon immer gemäß der Dreiteilungshypothese unterschieden wurde, ungeachtet des dabei vielleicht völlig anderen Wortlauts einer Unterscheidung. Die Dreiteilungshypothese ist von ihrem Selbstverständnis her lediglich eine deskriptive Theorie, keine präskriptive.
j) Zentrale Aufgabe in dieser ersten, theoriebildenden Phase der Gesamtuntersuchung zur Dreiteilungshypothese ist es nun zunächst, genau diese Behauptung eines fundamentalen dreiteiligen Zusammenhanges von allem mit allem in jeder Hinsicht aufzuzeigen: Für die einzelne Dreiteilung, die Relationen der drei Teile untereinander und deren Relationen zu ihrem jeweiligen Ganzen, und zudem, wie solche Dreiteilungen praktisch aufzuweisen sind. Für Relationen vieler Dreiteilungen zueinander sowie deren Teile zueinander, und so auch für Seiendes überhaupt, über das bloße Existenzpostulat hinaus. Sowie nicht zuletzt auch für die Relationen alles Seienden der „Welt“ zu einem all dies erfahrenden wie auch immer „Ich“ und wie dies alles wieder zusammengehalten wird und was wiederum deren gemeinsamer Ursprung ist, soweit dieser angebbar ist.
III. Die statische Dreiteilung
a) Aus dem „ontologischen Urknall“, der allerersten Dreiteilung in die ersten drei erfahrbar Seienden überhaupt, lassen sich Erkenntnisse zum gewissermaßen inneren Aufbau einer jeden Dreiteilung ableiten, sowie insbesondere auch zu den Dreiteilungen über diese allererste Dreiteilung hinaus, die dieser nachfolgen und aus dieser hervorgehen. Indem wie vor weiter konsequent ausgewertet wird, was unter der Voraussetzung, dass vieles verschiedenes Seiendes überhaupt erfahren werden können muss, notwendig zu geschehen hat, damit allanfänglich aus einem ersten nicht verschiedenen Nichtseienden heraus drei verschiedene Seiende entstehen, bzw. für alle weiteren Teilungen dann aus Seienden heraus entstehen.
b) Die Teilung eines Ganzen in drei verschiedene Teile lässt sich in drei so benannten „Symmetriebrüchen“ beschreiben, gewissermaßen kontinuitätsbeendende Veränderungen in Richtung des Teilungsverlaufs, die aufeinander auseinander erfolgen. Erster Symmetriebruch: von Eins auf Drei. Zweiter Symmetriebruch: von Drei auf drei Verschiedene. Dritter Symmetriebruch: von drei Verschiedenen auf schließlich drei verschiedene Seiende. Im ersten Symmetriebruch findet nur die rein numerische Vermehrung statt, numerisch Drei sind dabei noch nicht auch schon drei Verschiedene. Im zweiten Symmetriebruch werden die numerischen Drei zu drei voneinander durcheinander Verschiedenen, die aber nur als solche gerade noch nicht voneinander verschieden sind. Im dritten Symmetriebruch wird die Kontinuität der drei nur Verschiedenen nochmals gebrochen, in drei nunmehr endgültig voneinander Verschiedene, mithin in drei verschiedene Seiende.
c) Der dritte Symmetriebruch allein, in das Endergebnis einer jeden Dreiteilung, lässt sich dabei noch genauer beschreiben als vom zweiten Symmetriebruch ausgehender Übergang in eine „besondere logisch-ontologische Form“ von zwei besonderen, einander kontradiktorisch gegenteiligenTeilen und einem besonderen, zu diesen beiden Teilen gemeinsam kontradiktorisch gegenteiligen Teil, beziehungsweise, da dies ohne ein echtes Gegenteil ist, einem gewissermaßen neutralenTeil. Da sich gemäß dem zweiten Symmetriebruch die drei Teile voneinander und durcheinander unterscheiden, werden im Teilungsprozess mit Bezug auf das zu teilende Ganze drei verschiedene Unterscheidungen getroffen, mit jedem Teil als Unterschied für die jeweils anderen beiden Teile als voneinander Unterschiedenen. Diese drei Unterscheidungen sind als solche aber gerade nicht verschieden voneinander und fallen in nur einer einzigen Unterscheidung von zwei besonderen Unterschiedenen und einem besonderen Unterschied zusammen, mithin den genannten besonderen zwei Gegenteiligen und dem besonderen einen Neutralen, gleichwohl sich alle drei Teile weiterhin voneinander durcheinander unterscheiden!
d) Aus den drei Symmetriebrüchen und ihrem gemeinsamen Ergebnis in der besonderen logisch-ontologischen Form lassen sich direkt drei „Dreiteilungsbedingungen“ ableiten, mit denen sich konkrete Dreiteilungen bestimmen lassen, und lässt sich daraus zudem eine einfache Methode ableiten, die Erfüllung solcher Bedingungen auch in logisch-ontologischer Strenge zu überprüfen. Dem ersten Symmetriebruch ist zu entnehmen, dass es sich für eine Dreiteilung gemäß der Hypothese (offensichtlich) immer um genau drei Teile handeln muss. Dem zweiten Symmetriebruch ist zu entnehmen, dass sich diese drei Teile voneinander durcheinander unterscheiden müssen, indem etwa immer zwei Teile nur durch das jeweils dritte Teil überhaupt als zwei voneinander verschiedene Teile verstanden werden können. Dem dritten Symmetriebruch ist zu entnehmen, dass von den drei Unterscheidungen eine Unterscheidung bereits eine besondere sein muss, in zwei besondere gegenteilige Teile und ein besonderes neutrales Teil, in Erfüllung eines besonderen Kriteriums nur mit dieser besonderen Unterscheidung.
e) Dank der notwendig besonderen Form einer Dreiteilung kann diese mit zwei einfachen, miteinander verknüpften, nacheinander und auseinander hervorgehenden kontradiktorischen Zweiteilungen beschrieben werden, einer so benannten „doppelten Zweiteilung“, die zusammengenommen im Ergebnis der Dreiteilung zu zwei einander konträren Teilen und einem dazwischen liegenden dritten Teil führen. Aus einem Ganzen heraus muss dafür in einer „ersten Zweiteilung“ in ein Teil und dessen kontradiktorisches Gegenteil unterschieden werden können und in einer „zweiten Zweiteilung“ aus diesem Gegenteil heraus (mit Notwendigkeit) in die beiden weiteren Teile kontradiktorisch unterschieden werden können. Aus den auf diesem Wege drei möglichen Varianten einer solchen „doppelten Zweiteilung“ muss nun nur noch diejenige besondere Variante auszuwählen sein, deren „erste Zweiteilung“ ein besonderes, letztlich gegenteilsloses beziehungsweise neutrales Teil und deren „zweite Zweiteilung“ zwei besondere, einander gegenteilige Teile beschreibt, in einer Weise, die sich von den anderen beiden Varianten irgendwie aufzeigbar absetzt.
f) Ein einfaches Beispiel zur Illustration der Erfüllung der „Dreiteilungsbedingungen“ bzw. der „Methode der doppelten Zweiteilung“, zum Nachweis einer konkreten Dreiteilung gemäß der Hypothese, bieten etwa die „Ganzen Zahlen“. Die Ganzen Zahlen lassen sich leicht aufteilen in die positiven Zahlen, die negativen Zahlen und die (gewissermaßen neutrale) Zahl Null. Damit teilen sich die Ganzen Zahlen offensichtlich in gewissermaßen drei Teile, was so schon die erste Bedingung erfüllt. Da die Begriffe „positiv“, „negativ“ und „neutral“ sinnvoll nur im allseitigen Zusammenhang zu verstehen sind, also immer ein Begriff die jeweils anderen beiden Begriffe überhaupt erst verstehen lässt und in diesem Sinne voneinander unterscheidet, unterscheiden sich alle drei Teile voneinander durcheinander, was die zweite Bedingung erfüllt. Offensichtlich liegen die drei Teile in einer besonderen logisch-ontologischen Form vor, von zwei einander besonderes Gegenteiligen, den positiven und negativen Zahlen, und einem gegenteilslosen besonderen Neutralen, der Null, was die dritte Bedingung erfüllt. Damit sind die „Ganzen Zahlen“ im beschriebenen Sinne als eine korrekte Dreiteilung gemäß der Hypothese aufgezeigt.
g) Da sich nicht übermäßig schwer aufzeigen lässt, dass die „doppelte Zweiteilung“ in ihrer besonderen logisch-ontologischen Form bereits alle drei Bedingungen für eine korrekte Dreiteilung gemäß der Hypothese formal erfüllt, kann die Dreiteilung der Ganzen Zahlen damit auch, und viel einfacher, an zwei auseinander hervorgehenden und miteinander verknüpften Zweiteilungen aufgezeigt werden, die dieser besonderen Form genügen: Mit einer ersten Zweiteilung der Ganzen Zahlen in die Null und alle Zahlen, die nicht Null sind, und in einer zweiten Zweiteilung, nunmehr der Zahlen, die nicht Null sind, in die positiven und die negativen Zahlen. Von den drei möglichen Varianten einer doppelten Zweiteilung der Ganzen Zahlen entspricht diese doppelte Zweiteilung offensichtlich auch schon der besonderen logisch-ontologischen Form einer damit hypothesengemäß nachgewiesenen Dreiteilung.
h) Anders als bei der traditionellen Unterscheidung, die davon ausgeht, dass der Unterschied zwischen zwei damit Unterschiedenen einem dieser beiden Unterschiedenen irgendwie besonders zugehört und dem anderen ausdrücklich nicht zugehört, befindet sich bei der trichotomen Unterscheidung der Unterschied gemäß der Dreiteilungshypothese gewissermaßen „zwischen“ den beiden durch diesen und in diesem Unterschied Unterschiedenen. Mithilfe der Methode der doppelten Zweiteilung kann so jeder „Unterschied“ auch als „Gegenteil des Gemeinsamen der beiden Unterschiedenen“ beschrieben werden. Die Methode der doppelten Zweiteilung wird nicht zuletzt deshalb zum wichtigsten praktischen Werkzeug überhaupt in der weiteren Exploration der Dreiteilungshypothese. Denn auch auf jeder Beschreibungsebene gilt ja das oberste Diktum der Hypothese, dass alle erfahrenen Unterscheidungen immer Unterscheidungen im Rahmen einer Dreiteilung oder vieler miteinander verknüpfter Dreiteilungen sind.
IV. Die dynamische Dreiteilung
a) Das Unterscheiden der drei Teile einer gewöhnlichen Dreiteilung voneinander durcheinander, aus einem zu teilenden Ganzen heraus, erfordert ein Erfahren von Ganzem und Teilen, mithin von vier Seienden, was voneinander durcheinander, gemäß der Hypothese aber unmöglich ist. Nun existiert das Ganze zwar nicht mehr, wenn die Teile existieren, beziehungsweise existieren die Teile noch nicht, wenn das Ganze existiert, sodass mit einem solchen Nacheinander im Erfahren von Ganzem und Teilen eine hypothesenwidrige Vierfachunterscheidung gar nicht erforderlich wäre. Doch ist das entsprechend notwendige logischeNacheinander von Ganzem und Teilen nicht notwendig auch schon ein empirischesNacheinander von entweder erfahrenem Ganzem oder erfahrenen Teilen. Und selbst wenn dies doch irgendwie zu rechtfertigen wäre, wie bleibt dennoch der zum Unterscheiden der Teile notwendige wechselseitige Bezug von Ganzem und Teilen erhalten?
b) Da ein hypothesenkonformes Unterscheiden möglich sein muss, um denn überhaupt Seiendes erfahren zu können, was wir offensichtlich können, muss das Nacheinander von Ganzem und Teilen nicht nur ein logisches, sondern auch ein empirisches Nacheinander sein, bei dem die Teile noch nicht erfahren werden können, wenn das Ganze erfahren wird, und das Ganze nicht mehr erfahren werden kann, wenn die Teile erfahren werden. Das, was nun das nur logische Nacheinander von Ganzem und Teilen zu einem auch empirischen Nacheinander macht, gleichwohl deren ebenso notwendigem empirischen Zusammenhang nicht entgegensteht, nennen wir „Zeit“, beziehungsweise im Einzelfall einer gewöhnlichen Dreiteilung auch ihr „zeitliches Moment“ oder kurz „Zeitmoment“. Der Begriff dieser (ontologischen) „Zeit“ wird auf diese Weise überhaupt erst begründet und ist nur darin überhaupt begründet.
c) Der notwendig empirische Zusammenhang muss, ungeachtet der vordergründigen Trennungsfunktion des zeitlichen Moments, über dieses Zeitmoment hinweg bestehen können, und zwar in beide Richtungen des Teilungsprozesses. Denn nicht nur ist ein Ganzes nur Ganzes als ein Ganzes von Teilen, sondern sind auch die Teile nur Teile als die Teile eines Ganzen. Der notwendige Erfahrungszusammenhang von Ganzem und Teilen, über die Zeit hinweg, den wir herstellen können müssen, um überhaupt Teile voneinander unterscheiden zu können, was wir offensichtlich können, erfolgt also in einem permanenten gewissermaßen „Hin-und-Her“ vom Ganzen zu den Teilen und von den Teilen wieder zurück zum Ganzen, solange, wie dies für diese Unterscheidung erforderlich ist.
d) Eine gewöhnliche Dreiteilung, also jenseits der allerersten, läuft damit grob skizziert folgendermaßen ab: Ein existierendes Ganzes, als das Teil einer vorherigen Dreiteilung, teilt sich im Laufe eines zeitlichen Moments, wie auch immer genau, in drei existierende Teile. Wobei im Zwischenergebnis nur des „zweiten Symmetriebruchs“, im bloßen Unterscheiden voneinander durcheinander, darin die drei Teile als nur verschieden gerade noch nicht verschieden sind und so auch noch nicht existieren, sondern gewissermaßen überall sind, wo die nach dem dritten Symmetriebruch dann endgültig verschiedenen Teile sind, nur nicht diese Teile selbst sind, somit gewissermaßen einen (ontologischen) „Raum“ für diese Teile bilden.
e) Diese einzelne gewöhnliche Dreiteilung innerhalb von „Raum“ und „Zeit“ bzw. diese einen „Raum“ und eine „Zeit“ überhaupt erst fundierende Dreiteilung, in ihrem empirisch notwendigen „Hin-und-Her“ zwischen einem Ganzen und dessen drei Teilen, nennen wir (um der, wie sich zeigen wird, dabei hochdynamischen Spannung unter den vier Seienden besonderen Ausdruck zu verleihen) einen „ontologischen Körper“. Dieser „ontologische Körper“ ist das theoretische Herzstück in der metaphysischen Erschließung und Beschreibung der Dreiteilungshypothese, darin er statische und dynamische Aspekte des Seienden in sich vereint und so zentraler Impulsgeber für den weiteren Ausbau der Gesamttheorie ist, über die nur einzelne Dreiteilung hinaus, auch für viele miteinander verknüpfte Dreiteilungen, letztlich sogar für die ganze Welt.
f) Die in jeder gewöhnlichen Dreiteilung, beziehungsweise in jedem ontologischen Körper, dem „ersten Symmetriebruch“ (von Eins zu Drei) zuzuordnende „Zeit“ und der dem „zweiten Symmetriebruch“ (von Drei zu drei Verschiedenen) zuzuordnende „Raum“ sind dabei zu ergänzen durch eine dem „dritten Symmetriebruch“ (von drei nur Verschiedenen zu zwei Gegenteiligen und einem Neutralen) zuzuordnende (ontologische) „Materie“, die als jeweils völlig einzigartig für jedes Seiende zu verstehen ist und für die letztendliche Vereinzelung eines Seienden verantwortlich ist, jenseits jeder Gemeinsamkeit der Seienden im ersten und vor allem im zweiten Symmetriebruch. Auch wenn die Begründung von „Materie“ und die Entstehung des „Seienden“ so mit dem dritten Symmetriebruch zusammenfallen, sind sie ausdrücklich nicht einander gleichzusetzen. Für diese Bestimmungen von „Zeit“, „Raum“ und „Materie“ in der Erklärung des Seienden können in etwas philosophischerer Terminologie auch die funktional entsprechenden Begriffe „Werden“, „Sein“ und „Wesen“ verwendet werden.
g) Der „ontologische Status“ des erfahrbaren „Ganzen“ und der erfahrbaren „Teile“ ist gemäß Existenzpostulat („sein heißt verschieden sein“) stets „seiend“. Der ontologische Status von „Raum“ beziehungsweise „Sein“, im Ergebnis des zweiten Symmetriebruchs, ist, gemäß der Umkehrung des Existenzpostulats („nicht sein heißt nicht verschieden sein“), demnach „nicht seiend“. Der ontologische Status von „Zeit“ beziehungsweise „Werden“, während des ersten Symmetriebruchs, zwischen Ganzem und Teilen, weder mit dem einen noch dem anderen zusammenfallen dürfend, ist so eben „weder seiend noch nicht seiend“, kurz „zwischenseiend“. Der ontologische Status von „Materie“ beziehungsweise „Wesen“, im Ergebnis allein des dritten Symmetriebruchs, kann weder „seiend“ noch „nicht seiend“ noch „zwischenseiend“ sein, um seiner Aufgabe der letztlichen Vereinzelung des Seienden zu genügen und ist dafür als „ununterscheidbar“ anzunehmen, an seinem innerhalb der besonderen Form einer jeden Dreiteilung dennoch einzigartigen wie unterscheidbaren „ontologischen Ort“.
h) Im Sonderfall der allerersten Dreiteilung überhaupt, dem „ontologischen Urknall“, wird kein „ontologischer Körper“ gebildet, da das zu teilende Ganze nach Voraussetzung kein Seiendes ist und deshalb kein zeitliches Moment benötigt wird, um dieses Ganze im Erfahren von den Teilen getrennt zu halten. Gleichwohl erlaubt dieser Sonderfall die ersten drei Seienden auch ohne erfahrbar Ganzes zu unterscheiden, weil als einzige Ausnahme allein für diese allerersten drei Teile kein erfahrbar Ganzes besteht und diese drei Teile gerade damit und genau darin dennoch eindeutig aufeinander bezogen sind.
V. Entstehen, Vergehen und Kausalität
a) Zunächst ein unverstandenes Rätsel ist es, wie mit einer gewöhnlichen Dreiteilung ein Ganzes überhaupt in drei Teile geteilt werden kann, ohne dafür schon irgendwie in drei Teile geteilt zu sein, das so benannte „Teilungsparadoxon“. In der bereits wiederholtenDreiteilung, dem „ontologischen Körper“, wird dafür festgestellt, dass die drei nach der Teilung existierenden Teile vor der Teilung eben „nicht existierende Teile“ waren und als solche im zu teilenden Ganzen gewissermaßen bereits vorlagen, ausgerichtet auf die später existierenden Teile. Es lässt sich sogar erklären, wie diese noch nicht existierenden Teile überhaupt erst in das zu teilende existierende Ganze hineinkamen, mithilfe des so benannten „Zeitparadoxons“:
b) Da das zeitliche Moment im ontologischen Körper ausdrücklich nur zwischen dem Ganzen und den Teilen bestimmt ist, vergeht keine Zeit zwischen dem Ganzen und dem Zeitmoment wie auch keine Zeit zwischen dem Zeitmoment und den Teilen, das „Zeitparadoxon“ der Dreiteilungshypothese in seiner fundamentalen Form. Da das zeitliche Moment zudem nur zwischen Ganzem und Teilen als jeweils Existierenden erforderlich bestimmt ist, lässt sich ableiten, dass die drei nicht existierenden Teile die zeitliche Barriere zwischen existierendem Ganzen und existierenden Teilen zu überschreiten vermögen, in beide Richtungen, die so benannte „Raumexpansion“ beziehungsweise „Rückläufigkeit des Nichtseienden“, was das Teilungsparadoxon für wiederholte Dreiteilungen auflöst.
c) Für eine erstmalige Dreiteilung, noch vor Errichtung eines ontologischen Körpers, funktioniert diese Lösung aber nicht, denn auf was sollten noch nicht existierende Teile, als solche, im existierenden zu teilenden Ganzen bereits ausgerichtet sein, wenn nicht auf eben diese als später existierende Teile? Das zu teilende Ganze darf so noch nicht einmal als bereits ein „Ganzes“ von „Teilen“ verstanden werden. Da Teilungen aber dennoch irgendwie möglich sein müssen, ihr Ergebnis in der Grunderfahrung liegt uns ja vor, werden für eine erstmalige Dreiteilung, zunächst rein funktional verstanden, bereits drei „ununterscheidbare Teile“ angenommen, welche als ebenso relationslose Teile das Teilungsparadoxon einfach ignorieren.
d) Aus den beiden Lösungen des Teilungsparadoxons ergeben sich nun spektakuläre metaphysische Konsequenzen: Wird in einer wiederholten Dreiteilung, einem dynamischen ontologischen Körper, das zu teilende Ganze als „Ursache“ der Teile und diese als „Wirkung“ verstanden, wird das Ganze so erst zu einem Ganzen im Vollzug der Teilung in die Teile, wird das eine Seiende, welches sich in drei Seiende teilt, gewissermaßen erst nachträglich zu einem Ganzen und damit zur Ursache der Teile, beziehungsweise entsteht die Ursache der Teile gewissermaßen erst mit der Teilung in diese! Und ist in einer erstmaligen Dreiteilung, noch vor Errichtung des ontologischen Körpers, überhaupt keine Kausalität verstehbar, und bleibt die Entstehung von Seienden aus Seienden letztlich, beziehungsweise erstlich, immer ursachenlos! Gleichwohl wir, als Untersuchende stets nur Nachbetrachtende, immer von einer Ursache ausgehen können, ja sogar ausgehen müssen!
e) Ein wieder Vergehen des entstandenen Seienden ist formal eigentlich recht einfach zu verstehen, im „Her“ des ontologischen Körpers von den Teilen zurück zum Ganzen, oder auch im „Hin“ des gegebenenfalls nachfolgenden ontologischen Körpers, nun eines Teiles als Ganzes daraus hervorgehender Teile. Die wiederholte Dreiteilung lässt das Seiende aber gewissermaßen nie endgültig vergehen, sodass alle zwischen den Zeitmomenten einmal entstandenen Seienden gewissermaßen für immer erhalten bleiben. Das Zeitparadoxon macht zudem klar, dass Seiendes nicht allein zwischen gegebenenfalls zwei Zeitmomenten besteht, sondern paradoxerweise bereits schon im Zeitmoment davor und immer noch im Zeitmoment danach.
VI. Die Welt und ich und der Ursprung von allem
a) Aus den ersten drei Seienden der allerersten Dreiteilung heraus, dem „ontologischen Urknall“, müssen weitere Seiende in weiteren Dreiteilungen entstehen, um die „Vielheit des Verschiedenen“ der „Grunderfahrung“, also die offensichtlich erfahrene Vielheit von Seiendem über nur drei Seiende hinaus erklären zu können. Wie auch immer genau dabei die Verknüpfungen der zahllosen Dreiteilungen untereinander zu verstehen sind, können gestützt auf die bisherigen Erkenntnisse aus der Begründung der Dreiteilungshypothese im Allgemeinen und aus der Beschreibung der einzelnen Dreiteilung im Besonderen einige zentrale Bestimmungen des fundamentalen metaphysischen Aufbaus der „Welt“ abgeleitet werden:
b) Die auseinander hervorgehenden und miteinander verknüpften Dreiteilungen, die „trichotomen Vielteilungen“, können Vielheiten beliebiger (aber immer ungerader) Anzahlen von Seienden begründen, allein begrenzt durch die maximale Vielheit in der Grunderfahrung von allem überhaupt. Die raumzeitlichen Verhältnisse im „ontologischen Körper“ erlauben dabei die stets hypothesenkonforme Vermehrung des Seienden in der Addition alles jemals entstandenen Seienden, weil durch „Raum“ und „Zeit“ alles Seiende nicht nur überhaupt erst erfahrbar voneinander getrennt wird, sondern so alles Seiende ebenso auch erfahrbar miteinander verbunden wird, mit dem „Hin-und-Her“ über jeweils das selbe Zeitmoment hinweg sowie dem gegenseitigen Unterscheiden im jeweils selben Raum, per saldo gewissermaßen „raumzeitlos Zugleich“. Die so verstanden maximalgroße „trichotome Allteilung“ alles in Dreiteilungen miteinander verknüpften Seienden überhaupt, ist damit also ebenso die „trichotome Grunderfahrung“ all dieses Seienden, was die Hypothesenbildung genau genommen überhaupt erst richtig abschließt, indem das ontologische Ende aller Teilungen in Seiendes wieder an den erkenntnistheoretischen Anfang all dieses erfahrenen Seienden gebunden wird.
c) Die „Welt“ selbst, in ihrem Anfang für alles Seiende wie stets auch als Ganzes alles Seienden, existiert dabei nicht. Für das „ursprüngliche Ganze“ als nicht verschiedenes und nicht existierendes nur Eines im ontologischen Urknall ist dies klar und eine einmalige (wenngleich vor jeder Teilung erstmalig viel komplexer zu begründende) Ausnahme gegenüber allen weiteren zu teilenden Ganzen. Aber auch als ein so benanntes „überall seiendes Ganzes“: Da der „Raum“ als „überall seiend“, wo die Teile sind, nur nicht diese selbst seiend, und als „nicht existierender Raum“ zu verstehen ist, gilt ein solcher „Raum“ ebenso als ein „nicht existierendes Ganzes“ dieser Teile, das diese Teile nach der Teilung in Einem zusammenhält. Und dies trifft nicht nur leicht einsichtig für jede einzelne Dreiteilung zu, sondern etwas schwerer einzusehen, gleichwohl eindeutig aufweisbar, für alle Ergebnisse aller Dreiteilungen, mithin alles Seiende überhaupt zusammengenommen zu, da sich die nicht existierenden Räume beziehungsweise die nicht existierenden Ganzen aller Dreiteilungen aller Seienden als solche ja nicht voneinander unterscheiden und über alle allein für Seiendes geltenden zeitlichen Barrieren hinweg in nur einem einzigen nicht existierenden Ganzen miteinander gewissermaßen „verschmelzen“.
d) Dass die „Welt“, die doch eines der großen metaphysischen Erklärungsziele in der Gesamtuntersuchung zur Dreiteilungshypothese darstellt, nicht existiert, ist dabei nicht nur überhaupt kein ernsthaftes Problem, sondern im Gegenteil sogar eine ontologische Grundvoraussetzung, um diese nämlich überhaupt explorieren zu können! Denn würde die „Welt“ existieren, warum auch immer, obwohl wir sie nicht von etwas anderem unterschieden erfahren können, könnten wir über diese „Welt“ als etwas Ganzes gar keine mit einer Erfahrung übereinstimmende Aussage machen. Da die „Welt“ aber nicht existiert, beziehungsweise gerade weil sie nicht existiert, können wir indirekt sehr wohl eine gewissermaßen erfahrungsgestützt gültige Aussage über diese „Welt“ machen und berechtigterweise dann auch weitere Erkenntnisse daraus über sie ableiten.
e) Wobei wir auch mit dieser umfassenden Einsichtnahme in die Welt weder aus dem oder aus den Ganzen der Welt noch aus ihren oder aus deren Teilen etwas Gewisses über eine mögliche Zukunft der Welt ableiten können, sondern immer nur in ihre Vergangenheit blicken. Wobei nicht bestritten wird, dass ein vorhergesagtes und ein eingetroffenes Ereignis eine Übereinstimmung miteinander aufweisen können, sondern lediglich, dass es sich dabei um eine Vorhersage handeln kann. Denn soweit das Vorhergesagte und das Eingetroffene, als Seiende, miteinander übereinstimmen, ist es weiterhin das Vorhergesagte an dessen unverrückbarem ontologischen Ort in der Vergangenheit und handelt es sich damit um keine Vorhersage, und soweit diese nicht miteinander übereinstimmen, ist das Eingetroffene offensichtlich nicht das Vorhergesagte und handelt es sich damit natürlich auch um keine Vorhersage. Dass diese Erkenntnis unserer offensichtlichen Alltagserfahrung möglicher Vorhersagen widerspricht, ist eine andere Frage.
f) Das, was nun alles Seiende in der „Welt“ erfährt, indem es dieses von allem anderen Seienden darin unterscheidet, also „ich“, bin selbst kein solches Seiendes, da ich mich selbst aus unterscheidungslogischen Gründen nicht von irgendetwas anderem unterscheiden kann. Woraus mit der Umkehrung des Existenzpostulats die wohl sehr verstörende Erkenntnis folgt: „ich existiere nicht!“ Um mich selbst von etwas anderem zu unterscheiden, müsste ich mich nämlich teilen, kann mich als so Geteiltes aber nicht mehr als noch Ungeteiltes unterscheiden. Ein unauflösbares Problem. Glücklicherweise, denn würde ich mich von etwas anderem unterscheiden können, mich so selbst erfahren können, existierte „ich“ in der „Welt“ und wäre bei jeder Unterscheidung von drei Seienden einer Dreiteilung als ein ebenso Seiendes gewissermaßen immer mit dabei, was mit der Hypothese, insbesondere ihrer Herleitung aus nur einem Nichtseienden, schwerlich zu vereinbaren gewesen wäre.