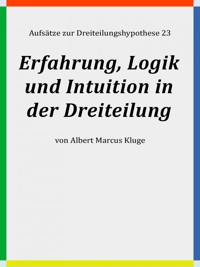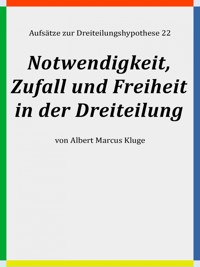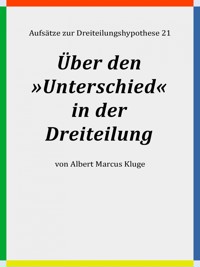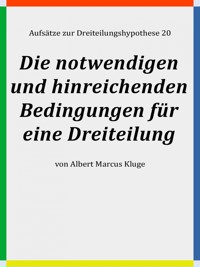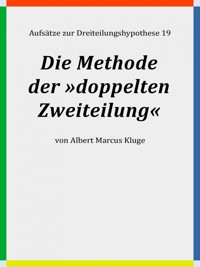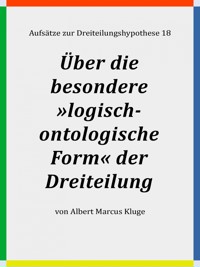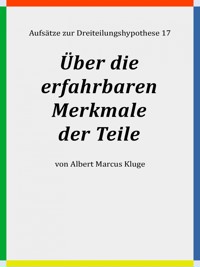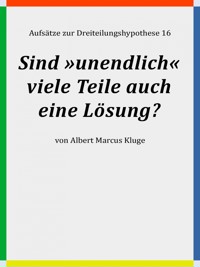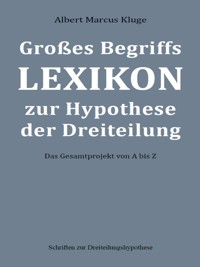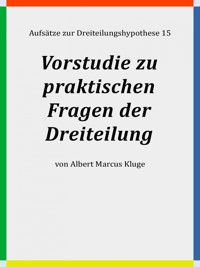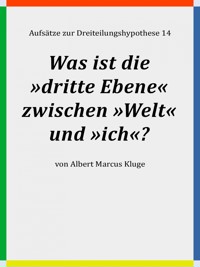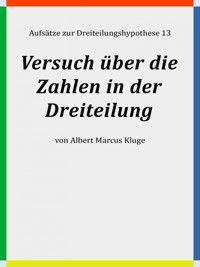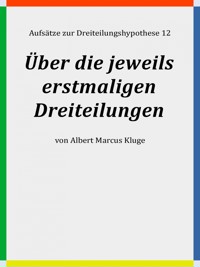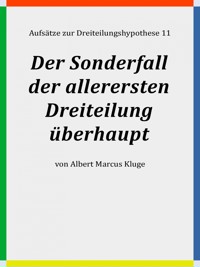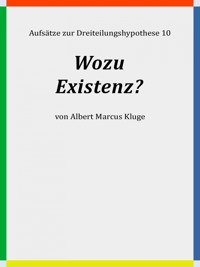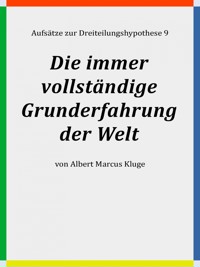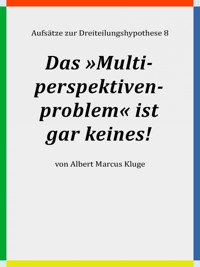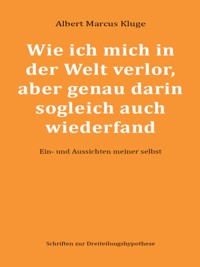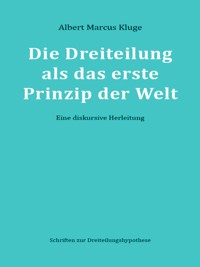
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit der »Dreiteilung als dem ersten Prinzip der Welt« wird behauptet, dass alles, was in der Welt existiert, nur als ein Teil von drei Teilen existiert, die notwendig zusammen gehören und in einer ganz bestimmten logisch-ontologischen Relation zueinander stehen. Die diese Behauptung begründende Herleitung wurde bislang aber nur sehr knapp erläutert (»Hypothese über die Dreiteilung der Welt«, BoD 2019) und soll nun erstmals ausführlich beschrieben werden. Der inhaltliche Leitfaden ist dabei folgender: Ausgehend von der unhintergehbaren »Grunderfahrung« einer Vielheit von Verschiedenem, von allem überhaupt, sowie der Feststellung einer mit jeder erfahrenen Veränderung stetigen Vermehrung dieser Vielheit, können wir begründen, dass jeder Vielheit immer weniger Vieles vorhergegangen sein muss und so eine »Rückführung« des Vielen rechtfertigen, die erst bei nur Einem endet, aus dem alles Viele, in einem gewissermaßen »ontologischen Urknall« irgendwie hervorgegangen sein muss, was, weil sich das aus dem Einen entstehende Viele ja irgendwie voneinander unterscheiden muss, nur über fortgesetzte »Dreiteilungen« möglich ist, da sich nur in diesen die jeweiligen drei Teile überhaupt, nämlich voneinander und durcheinander unterscheiden können, woran alle anderen Teilungsversuche scheitern. Gegen diese Herleitung lassen sich natürlich zahlreiche Einwände erheben, die aber nicht hinreichen, die Grundidee der Dreiteilungshypothese zu Fall zu bringen! - Korrektur gelesene Neuauflage der Erstausgabe von 2020. Weitere Informationen auf: www.dreiteilungshypothese.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Dreiteilung als das erste Prinzip der Welt
Start
Vorwort
Einstieg und Überblick
I. Die Erfahrung einer Vielheit von Verschiedenem
II. Die Rückführung der Vielheit auf eine Einheit
III. Die Entstehung der Vielheit aus der Einheit
Ergebnis und Ausblick
Impressum
Vorwort
Die in meinem letztjährig erschienenen Grundlagenbuch zur „Hypothese über die Dreiteilung der Welt“ (BoD 2019) nur sehr kurz gefasste Herleitung der zentralen Behauptung wird in der hier vorliegenden Arbeit nochmals einer eingehenden Prüfung unterzogen. Da die dafür im geplanten Fortsetzungsband dieser Untersuchung zunächst vorgesehenen, lediglich ergänzenden Bemerkungen zur bestehenden Fassung aber schnell einen so viel größeren Umfang als der Basistext selbst angenommen haben, entschied ich mich irgendwann für eine gleich komplette Neuformulierung der gesamten Herleitung sowie ihre gesonderte Veröffentlichung. Damit kann diese Ergänzungsschrift auch als eine erste Einführung in die Theorie von der Dreiteilung überhaupt und ihre (d. h. natürlich meine) vielleicht doch recht gewöhnungsbedürftigen Gedankengänge dienen, in der Hoffnung, dass diese im Nachvollzug ebenso überzeugend sind wie sie es beim Schreiben für mich waren. Besondere Kenntnisse aus dem Grundlagenbuch werden nicht vorausgesetzt. Gleichwohl erfordert das Verständnis der Herleitung der Hypothese, mehr noch als schon die bisherige Kurzversion, und auch ungeachtet der dafür verwendeten ungezwungenen Sprache und Darstellung, die ausdauernde Bereitschaft, sich mit einigen sehr komplizierten und abstrakten Überlegungen auseinanderzusetzen. Das gehört nun mal unvermeidbar zum besonderen Geschäft der Metaphysik. Ein ständiges Mühen, welches durch den daraus zu erwartenden Erkenntnisgewinn aber mehr als wettgemacht werden sollte.
Berlin, 12. September 2020
Albert Marcus Kluge
Einstieg und Überblick
Die Frage nach der Welt und allem überhaupt - Die drei Untersuchungsschritte bis zur Hypothese - Über das gesuchte erste Prinzip und die metaphysische Methode
A: Die alten Fragen der Metaphysik, was die Welt ist, ob sie einen Ursprung hat und was dem Menschen in ihr zukommt, sind philosophische Fragen fundamentaler Natur, die nicht nur nach einer Antwort verlangen, die uns lediglich vorläufig zufriedenstellt, damit wir auf dieser Grundlage an den wie auch immer viel drängenderen Problemen der Philosophie weiterarbeiten können, sondern sind Fragen, die darüber hinaus immer auch nach einer Antwort verlangen, mit welcher zugleich ein Anspruch auf deren universale und ewige Geltung erhoben wird. Einer Antwort, die so prinzipieller Natur ist, dass sie dem, was auch immer gegenwärtig wie zukünftig gegen sie vorzubringen ist, zu widerstehen vermag. Nach weniger, als nach einem solchen unangreifbaren „Prinzip der Welt“ zu verlangen, aus dem beziehungsweise mit dem allesüberhaupt ableitbar sein soll, wäre den Fragen gänzlich unangemessen. Nach noch mehr zu verlangen, auch nach dem nicht Prinzipiellen zu verlangen, wäre dagegen ein Griff ins Unendliche, aus dem wir immer neue Erkenntnisse schöpfen würden und nur zu einer universalen Antwort kämen, wenn wir auch tatsächlich nach allem fragen könnten, was aber gewiss jenseits unserer Möglichkeiten liegt. - Wie aber können wir dann auch „nur“ ein Prinzip von allem aufzufinden hoffen, wenn wir gar nicht nach allem fragen können? Müssen wir denn nicht alle Teile der Welt kennen, um mit ihnen eine prinzipielle Aussage über die Welt als Ganzes machen zu können? Und ja nicht nur alle gegenwärtigen Teile, sondern auch alle vergangenen und sogar alle zukünftigen? Uns bleibt so scheinbar nichts anderes übrig, als uns von der Hoffnung auf prinzipielle Aussagen über alles und damit auch von einer Beantwortung der metaphysischen Fragen grundsätzlich zu verabschieden und uns eben doch auf bestenfalls pseudo-prinzipielle Aussagen über eben nicht alles zu beschränken. - Ist dem wirklich so? - Ausgangspunkt der Theorie, welche hier nun vorgestellt werden soll, ist die diesem Urteil entgegenstehende Feststellung, dass wir eine unumstößliche Aussage über alles durchaus machen können, auch wenn uns dieser offensichtliche Umstand zunächst völlig belanglos erscheint, nämlich: dass alles voneinander verschieden ist! - Gelänge es uns, dies verbindlich aufzuzeigen, und dann daraus, dass alles voneinander verschieden ist, abzuleiten, wie alles voneinander verschieden ist, in einer für alles fundamentalen Art und Weise, hätten wir auch schon eine prinzipielle Aussage über die Welt aufgefunden, die wir gegebenenfalls bereits als ihr „erstes Prinzip” verstehen dürfen oder der wir ein solches Prinzip vielleicht entnehmen können. - Genau diesen Nachweis wollen wir hier in drei aufeinander aufbauenden Untersuchungsschritten erbringen, die zunächst nur kurz angedeutet seien, um den Argumentationsgang zu skizzieren. - Im „ersten Schritt“ werden wir die behauptete Feststellung der Verschiedenheit von allem voneinander in eine wissenschaftlich haltbare und handhabbare Fassung bringen. Im „zweiten Schritt“ werden wir die verschiedene Vielheit von allem auf eine dieser vorhergehende, nicht mehr verschiedene Einheit zurückführen. Und im finalen „dritten Schritt“ werden wir aus dieser Einheit heraus, durch Unterscheidungen in der Einheit beziehungsweise durch Teilungen der Einheit, wieder zur Vielheit zu gelangen versuchen, wobei die logischen und ontologischen Notwendigkeiten auf diesem Wege uns die Art und Weise solcher Teilungen in einer ganz bestimmten Form zwingend vorschreiben werden, die wir dann „Dreiteilung“ nennen. Mit dieser „Dreiteilung“ soll dann das „Prinzip der Welt”, das „erste Prinzip“ überhaupt, gefunden sein! - Soweit die Planung. - Mit der Auffindung eines ersten Prinzips allein sind wir natürlich noch lange nicht am Ziel der Untersuchung, wohl aber am Ende ihrer fundamentalen Begründung hier. Erst bei weiteren Gelegenheiten werden wir auf dann sicherem Boden aufsetzend, nach und nach eine umfassendere Theorie entwickeln, mit der wir in einem metaphysischen Gesamtprojekt auch die eingangs genannten fundamentalen Fragen angehen und beantworten wollen.
B: Bevor wir in die Einzelheiten gehen, nochmals grundsätzlich zu dem Rahmen und der Zielsetzung der angekündigten Ableitung darin. Unter „Metaphysik” versteht man doch eine besondere Wissenschaft, die, vereinfachend gesagt, darauf aus ist, hinter dem, was uns mehr oder weniger offensichtlich ist, hinter dem, was wir erfahren oder zu erfahren glauben, unmittelbar oder mit den Mitteln der gewöhnlichen Wissenschaften, Strukturen zum Vorschein zu bringen, die dem Vordergründigen irgendwie innewohnen und diesem gewissermaßen seinen Halt geben. Welche Rolle spielt dabei nun genau ein solches „erstes Prinzip“, nicht nur das Hintergründige zu strukturieren und allgemeine Aussagen über dieses zu machen, sondern damit ebenso auch über das Vordergründige und sogar über ganz Bestimmtes aus unserer Erfahrungswelt? Denn darum geht es doch wohl nicht zuletzt, wenn Metaphysik keine Wissenschaft nur für sich selbst sein will, was sie so allerdings praktischerweise unangreifbar machen würde!
A: Mit der hier abzuleitenden fundamentalen Allaussage, dem von uns gesuchten „ersten Prinzip“, dem „Prinzip der Welt“, ist zunächst einmal mehreres gemeint: Dieses „erste Prinzip“ soll ein „erstes Prinzip“ nicht nur im Sinne eines für alles anfänglichen Prinzips sein, aus dem heraus alles entspringt, sondern vor allem auch im Sinne eines alles durchdringenden Prinzips, welches auch für alles aus einem Anfang erst Hervorgegangene ebenso gilt, und nicht zuletzt auch im Sinne eines für alles obersten Prinzips, das für alles auch das wie auch immer bedeutendste ist. Die Offenlegung eines solchen „hintergründigen“ ersten Prinzips in unserer „vordergründigen“ Erfahrungswelt und die Aussagen, die wir mit diesem sowohl über dieses Hintergründige selbst als auch über das diesem Vordergründige machen, gehen dabei miteinander einher. Streng genommen können wir ja immer nur vom erfahrenen Vordergründigen ausgehen, so wie wir hier gleich auch ausdrücklich ansetzen werden, wenn das metaphysisch Hintergründige eben das sein soll, was uns nicht unmittelbar zugänglich sein kann. Die zunächst scheinbar unüberwindliche Distanz zwischen den beiden Ebenen wird auf diese Weise geradezu zwangsläufig überbrückt und sichert damit die Möglichkeit sinnvoller Aussagen über das Hintergründige vom Vordergründigen aus überhaupt. Denn was auch immer wir metaphysisch Hintergründiges freizulegen glauben, mag in der in der Logik der Behauptung zwar ausdrücklich von metaphysischen Grundannahmen ausgehen, wurzelt jedoch erkenntnistheoretisch gewiss immer irgendwie im erfahrenen Vordergründigen! Schon mit der begründeten Behauptung eines solchen hintergründigen ersten Prinzips allein, was ja hier unser Thema sein wird, behaupten wir auch vordergründig etwas über Ursprung, Aufbau und Bedeutung von allem. Was sicherlich nicht wegen der grundsätzlichen Verbindung der Ebenen auch schon wahr oder relevant sein muss, was wir natürlich auch irgendwie nachzuweisen haben. - Das „erste Prinzip“ im anfänglichen Sinne können wir lediglich theoretisch aufweisen, wofür wir gleich den Grundstein legen wollen. Das „erste Prinzip“ im durchgehenden Sinne ist dagegen auch praktisch überprüfbar, da, wenn dieses nach Voraussetzung überall gilt, auch in konkret Vordergründigem, das Hintergründige sichtbar gemacht werden können sollte, wofür wir aber erst an anderer Stelle, und erst auf dem Ergebnis dieser Herleitung aufbauend, die entsprechenden Methoden werden entwickeln können. In diesem Sinne werden wir das „erste Prinzip” dann auch als ein universales und gewissermaßen „metaphysisches Werkzeug“ kennenlernen, mit dem sich grundsätzlich alles untersuchen lässt. Das „erste Prinzip“ im obersten Sinne schließlich ist nicht ebenso durch mehr oder weniger einfache Ableitungen aufweisbar, sondern kann sich bestenfalls, und sollte sich auch, immer wieder bewähren, hinsichtlich der finalen metaphysischen Ziele, auf die wir uns im Laufe des gesamten Projektes langsam vorarbeiten wollen. - So viel dazu. - Auch wenn dieser lediglich Grundriss für ein erstes Prinzip sicherlich viele weitere Nachfragen provoziert, halte ich eine ausführlichere Diskussion über die erkenntnistheoretischen und metaphysischen Rahmenbedingungen der folgenden Ableitung für unangebracht, solange die Argumentation zur Bildung der „Hypothese über die Dreiteilung der Welt“ noch gar nicht vorgeführt wurde, womit wir jetzt beginnen wollen!
I: Die Erfahrung einer Vielheit von Verschiedenem
Der erkenntnistheoretische Anfang - Die Grunderfahrung der Welt - Das Unhintergehbarkeitsargument: Wir erfahren keine Lücken! - Das Multiperspektivenproblem - Das Problem der Existenz und die intuitive Gewissheit von Existenz - Das Existenzpostulat: Die Gleichsetzung von Verschiedenem und Existierendem im Erfahren
A: In diesem ersten Schritt von dreien werden wir zunächst den erkenntnistheoretischen Anfangspunkt der nachfolgenden Herleitung begründen, den wir im Erfahren einer Vielheit beziehungsweise Verschiedenheit von allem erblicken. Nach der Erläuterung und Diskussion der Einzelheiten werden wir diese uns so eigentlich noch recht belanglos erscheinende Erkenntnis durch die postulierte Gleichsetzung von allem vielen Verschiedenen mit allem Existierenden in eine ontologisch gehaltvollere Aussage überführen. - Um also eine Metaphysik aufzubauen, die auch strengsten Ansprüchen genügt, benötigen wir zum Auffinden eines „ersten Prinzips“, um dieses mit größtmöglicher Zuverlässigkeit zu bestimmen, für unser Erkennen, zunächst einen allumfassenden und unhintergehbaren Ausgangspunkt. Ein solcher muss natürlich „allumfassend“ sein, denn wir streben ja eine Allaussage über die Welt an. Aber ein solcher muss auch „unhintergehbar“ sein, und möglichst nicht nur in dem Sinne, dass wir die darin behauptet allgemeine Aussage in keinen empirisch oder logisch begründbaren Zweifel zu ziehen vermögen, sondern auch in dem Sinne, dass uns diese unmittelbar einsichtig ist, uns jedes versuchte Argumentieren gegen sie von vornherein als völlig aussichtslos erscheint. Einen solchen erkenntnistheoretischen Anfang wollen wir nun darin sehen, dass wir die Welt immer als eine Vielheit von Verschiedenem erfahren, genauer gesagt darin, dass wir alles immer als eine Vielheit von Verschiedenem erfahren, was wir dann „die Welt” nennen. Alles zur Welt Gehörende ist irgendwie unterschieden von allem anderen zu ihr Gehörenden und wird von uns im Erfahren dieser Vielheit von Verschiedenem erfasst, nichts geht darüber hinaus, nichts bleibt dahinter zurück. Der Ausgangspunkt besteht kurz gesagt in der aus einer solchen unhintergehbaren „Grunderfahrung“ folgenden scheinbar trivialen Erkenntnis, dass alles voneinander verschieden ist! - Klären wir zuerst die Begriffe und das genaue Verständnis dieser Aussage.
B: Also, mir ist schon der Begriff der „Welt“ nicht ganz einsichtig. Wenn diese „Welt“ gewissermaßen die Summe alles Verschiedenen sein soll, gehört sie dann nicht auch mit zur „Welt“, denn wir unterscheiden diese ja ebenfalls irgendwie, was aber ganz offensichtlich zu einem Widerspruch führt?
C: Gleich mehreres: Was in dieser Aussage „Vielheit“ heißt, kommt mir noch völlig problemlos vor, was „Verschiedenes“, intuitiv auch, hätte ich dennoch gerne etwas präziser ausgeführt, und was mit „Erfahren“ gemeint ist, lässt sich zwar aus der Aussage heraus irgendwie erahnen, das Verschiedene unterscheiden oder so ähnlich, sollte aber auch noch eindeutiger formuliert werden. Aber dann zum Zusammenhang des Erfahrens von Verschiedenem und dem Verschiedenen selbst: Ist damit gemeint, wir unterscheiden voneinander, was sichbereits unterscheidet, oder unterscheidet sich, was wir erst darin unterscheiden? Im ersten Fall wäre der Zusammenhang zwar vollständig, aber wohl nicht notwendig, im zweiten Fall zwar notwendig, aber doch nicht vollständig.
D: Mich würde vielmehr interessieren, inwiefern „wir“ denn „immer“ und „alles” erfahren sollten? Das ist doch ganz offensichtlich nicht so, schon gar nicht unmittelbar einsichtig gewiss so. Und über die Bedeutungen dieser Begriffe gibt es doch auch wohl kaum irgendwelche Uneinigkeit.
E: Vielleicht noch dieses: Ich habe den Begriff jetzt, glaub ich, gar nicht ausdrücklich gehört, aber es geht beim Erfahren beziehungsweise bei der Vielheit des Verschiedenen der Welt doch wohl immer um „Existierendes“, oder? Wonach dann aber alles, was wir irgendwie erfahren, auch irgendwie existiert, wonach also, da wir alleserfahren, auch allesexistiert, was doch eine sehr problematische Behauptung wäre, und gewiss nicht der gesuchte sichere Anfang im Erkennen.
A: Gut, das sollte erst einmal reichen. - Ich möchte, um einem unnötig in die Irre leitenden Denkfehler vorzubeugen, mit dem letzten Einwand beginnen und danach auf die anderen eingehen. - Es wäre ein grobes Missverstehen der Aussage über die „Grunderfahrung“ anzunehmen, es würde in dieser mit dem Erfahrenvon Verschiedenem bereits ein Erfahren von Existierendem behauptet. Dem ist ausdrücklich nicht so! Die eingangs angekündigte Gleichsetzung von erfahrenem Vielen beziehungsweise Verschiedenen mit Existierendem gehört nicht zur „Grunderfahrung“, sondern ist nur indirekt aus dieser ableitbar, auf dieser aufbauend, mithilfe weiterer Überlegungen. Diese Zurückhaltung ist für einen sicheren Erkenntnisanfang zwingend geboten, da wir nicht voraussetzen können, was denn überhaupt mit „Existenz“ gemeint ist, um auf dieser Basis dann eine Gleichsetzung zu begründen. Wir werden darauf etwas später noch genauer eingehen. Hier nur schon der Hinweis, dass „Existenz“ beziehungsweise „Existieren“ beziehungsweise „Existierendes“, und so weiter, sicherlich nicht allein aus Erfahrung heraus bestimmt werden kann. Aber auch nicht lediglich aus einer Logik heraus, ohne denn dafür bereits vorauszusetzen, was und was wie „existiert“, beziehungsweise umgekehrt, wir nicht logisch bestimmen können, was und was wie „existiert“, ohne schon eine Bestimmung von „Existenz“ beziehungsweise „Existieren“ beziehungsweise „Existierendem“ aus einer Logik heraus zu besitzen. Weshalb eine andere Lösung gefunden werden muss.
E: Wir können doch Existierendes erfahren?!
A: Ja, durchaus, aber nicht als Existierendes. Erfahren heißt Unterscheiden von Verschiedenem, sagten wir. Um auf diese Weise Existierendesals solches zu erfahren, müssten wir dieses im Vielen Verschiedenen also unterscheiden können, und zwar unterscheiden können von nichtExistierendemals solchem, müssten damit nicht Existierendes als solches unterscheiden, also erfahren können. Eine steile Behauptung, die wohl jeden denkbar sinnvollen Existenzbegriff wie auch jedes sinnvolle Erfahrungsverständnis bei Weitem überreizen dürfte.
E: Und mit der Erfahrung einer „Vielheit von Verschiedenem“ haben wir diese Probleme nicht? Einen Begriff von „Verschiedenem“ haben wir ja auch nicht. Zudem unterscheiden wir ja nicht „Verschiedenes“ von „nicht Verschiedenem“. Mit der gleichen Überlegung wie gerade für das „Existierende“ könnten wir so also auch „Verschiedenes“ nicht erfahren.
A: Wir brauchen im Erfahren weder einen Begriff von „Verschiedenem“ noch müssen wir dieses als solches erfahren können, müssen also neben „Verschiedenem“ nicht „nicht Verschiedenes“ erfahren können, um überhaupt voneinander Verschiedenes erfahren zu können. Denn „Verschiedenes“ ist aus sich selbst heraus immer schon verschieden voneinander, und wir erfahren dies auch zweifellos genau so. Gleiches wäre über das „Viele“ zu sagen. Wir haben offensichtlich auch kein Problem dabei, „Vieles“ und „Verschiedenes“ als untrennbar miteinander verbunden zu erfahren, auch wenn wir Untersuchende die Begriffe dazu voneinander trennen können. Unser „Erfahren” ist so völlig zweifellos unaufhebbar mit dem „Vielen” und dem „Verschiedenen” verknüpft, einander voraussetzend. Und dass wir „Erfahren”, ist uns damit natürlich ebenso zweifellos und schon ohne einen Begriff dafür gewiss, was uns den erkenntnistheoretischen Anfang in der Erfahrung einer Vielheit von Verschiedenem sichert.
E: „Vieles Verschiedenes“ ist, was wir im Erfahren unterscheiden und „Erfahren“ meint, in Vieles Verschiedenes zu unterscheiden, wodurch uns das Viele Verschiedene, mit dem Erfahren, dem wir in diesem Erfahren selbst gewiss sein können, ebenso gewiss ist, ohne dass wir diese Begriffe schon vor dem Erfahren für dieses Erfahren benennen müssten.
A: Ja, auf den Punkt gebracht, genau so.
C: Wobei die entsprechenden Begriffe, „Vieles” und „Verschiedenes” und „Erfahren”, aber dennoch genau geklärt werden müssen, um denn die darin begründete „Grunderfahrung“ auch überhaupt für weitere Überlegungen verwenden zu können, und nicht nur im bloßen Erfahren zu verbleiben.