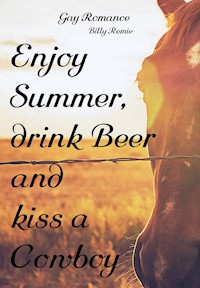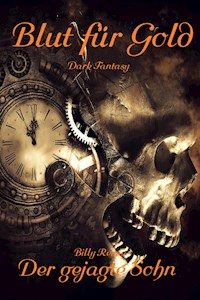Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Legenden aus Nohva 3
- Sprache: Deutsch
Sie nahmen ihm alles. Sein Zuhause. Seine Familie. Seine Kindheit. Sie ermordeten seine Mutter und seine Geschwister. Seit zehn Jahren ist er auf der Flucht, Wut und Rache treiben ihn an, blind vor Zorn kennt er weder Gnade noch Mitgefühl, Liebe ist ihm fremd. Er ist der Schattenwolfprinz, der junge Anführer einer gefürchteten Söldnertruppe; den letzten wahren Barbaren Carapuhrs. Sein geliebtes Land vom eigenen König verkauft, das eigene Volk versklavt. Er hat nur ein Ziel, nämlich den König stürzen und das Land vom Kaiserreich befreien. Ausgerechnet unter seinen Feinden begegnet er der Liebe, an die er nie geglaubt hat und vor der er sich verschließt. Aber hinter dem jungen Assassinen, der ihn von Beginn an fasziniert, steckt viel mehr als er glaubt, denn dieser konnte ihm zum Sieg verhelfen. *Gay Dark Fantasy (No-Romance) "Ein Dark Fantasy Abenteuer, das von einem zutiefst zerrissenen Geist und dunklen Mächten erzählt."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 887
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Billy Remie
Das Tagebuch des Schattenwolfprinzen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Anmerkung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Epilog
Impressum neobooks
Anmerkung
Ich begann dieses Buch eigentlich als ›Sonderband‹, doch nach längeren Grübeleien habe ich mich entschlossen, diesen Dark Fantasy Band als Teil der Reihe aufzunehmen. Anders als in den Vorteilen geht es hier weniger um Liebe, als viel mehr um Hass. Obwohl es natürlich ganz wie gewohnt eine Liebesgeschichte geben wird, jedoch setzte ich bei diesem Band mehr auf Spannung als auf Romanze. Es war als ein ›kleines Experiment‹ gedacht. In dieser Geschichte nimmt und ein "Antiheld" mit auf seine blutigen Abenteuer und lässt uns mittels seines Tagebuchs an seinen düsteren, tief verletzten Gedanken und seiner finsteren Philosophie teilhaben. (Und auch wenn ich hier die Erzähler-Sicht aufgab, sind die Gefühle und Gedanken des Protagonisten nicht die meinen.)
Ich wollte dies nur anmerken, um Verwunderungen meiner Leser vorzubeugen. In der Fortsetzung geht es wieder im gewohnten Stil weiter. Ich wünsche natürlich trotzdem ein schönes Lesevergnügen.
Für neue Leser, die noch keinen Band der Reihe kennen: Dieser "eigentliche" Sonderband kann gänzlich ohne Vorkenntnisse gelesen werden. Jedoch habe ich einige überraschende Elemente eingebaut, über die der Leser nur stolpert, wenn er die Figuren und Handlungen aus den Vorteilen kennt. Trotzdem sollte keine Verwirrung aufkommen, denn ich bemühte mich sehr, wichtige Ereignisse kurz zu wiederholen, sodass sich neue Leser in meiner fiktiven Welt gut zurecht finden sollten.
Eines muss ich zum Schluss noch loswerden. Vielen lieben Dank an meine Leser, die schon die Vorteile so überaus großzügig bewertet haben. Ihr seid toll, vielen Dank.
Und jetzt endlich viel Spaß beim Lesen.
Prolog
Sie warfen ihn in eine dunkle Kerkerzelle.
»He!« Eagle rappelte sich auf, sie hatten ihn übel zugerichtet, doch trotz der Schmerzen in seinem zertrümmerten Gesicht, gelang es ihm sich gegen die Gittertür der Zelle zu werfen. »Was soll das?«, rief er den königlichen Wachen nach. Er rüttelte an den Stäben. »Ich habe nichts verbrochen! Ich bin ein unschuldiger Mann!«
Sie gingen und ihre Schritte verklangen in den kahlen Fluren des königlichen Kerkers.
»Mist!« Eagle trat gegen die Zellentür und fluchte gleich darauf erneut, weil er sich den Zeh gestoßen hatte. Er tanzte auf einem Bein, den anderen Fuß hielt er umklammert bis der Schmerz abklang und er erleichtert zu einer Ecke unterhalb eines kleinen, vergitterten Fensters hinkte. Ausatmend ließ er sich auf den Hintern fallen und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie hatten ihm nur ein dünnes Leinenhemd und seine Hose gelassen, sogar die Stiefel hatten sie ihm weggenommen. Dreckige Geier! Eagle spuckte auf den Boden.
Aber er konnte nur sich selbst für diese Lage verantwortlich machen. Gegen den guten Rat seiner Mutter war er aus seiner sicheren Festung geschlichen und hatte sich auf und davon gemacht, um die Welt zu sehen. Er war zwanzig Sommer alt und hatte abgesehen von den sicheren Wänden und Mauern seines Zuhauses noch nichts anderes gesehen; er hatte nach Abenteuern gesucht.
Jedoch hatte er bemerkt, dass er für Abenteuer nicht vorbereitet gewesen war. Er konnte weder jagen noch ein Feuer entzünden, noch sonst irgendetwas, das ihm beim Überleben geholfen hätte. Nachdem seine Vorräte zu Ende gegangen waren, hatte er Hunger gelitten, außerdem waren seine Silbermünzen ausgegangen, weshalb er sich kein Zimmer in einem Gasthaus hatte leisten können.
Eagle hatte aus Not gehandelt, als er sich auf dem Mark einen Apfel angeeignet und dann in den Ställen geschlafen hatte. Niemand hatte ihn darüber aufgeklärt, dass er König Rahff den Zweiten höchstpersönlich bestiehl – und dass es verboten war, in dessen Ställen zu schlafen.
Jetzt saß er in dieser blöden Zelle fest und konnte nur hoffen, dass seine Mutter ihn vielleicht irgendwie wieder freikaufen konnte.
Erneut wurde im Kerker die Tür geöffnet und Eagle erhob sich bereits, weil er hoffte, sie würden ihn wieder gehen lassen. Vielleicht war König Rahff ja gnädiger, als von ihm behauptet wurde.
Jedoch zerstreuten sich Eagles Hoffnungen, als keine Wachen, sondern gepanzerte Ritter in glänzenden Rüstungen hereinkamen. Sie schleiften einen bewusstlosen Mann zur Nebenzelle, der Gefangene blutete aus einer Kopfwunde.
Die Gittertür quietschte, als sie geöffnet wurde. Die Ritter der Königsgarde warfen den Mann in die Zelle, der reglos auf der Seite liegen blieb. Etwas fiel aus der Kleidung des Gefangenen und rutschte über den Boden in die Nähe der Gitterstäbe, die Eagles Zelle von der anderen trennte.
Die Ritter schienen es nicht zu bemerken, sie verschlossen die Zelle und verließen den Kerker wieder, einer der beiden pfiff dabei fröhlich vor sich hin, obwohl er gerade einen Todgeweihten seinem Schicksal überlassen hatte. Denn König Rahff ließ alle Gefangenen hinrichten, ob Dieb oder Mörder, der König schlachtete alle Verbrecher ab. Selbst jene, deren einziges Verbrechen es war, der falschen Religion oder Rasse anzugehören, denn König Rahff vertrat das Gesetz der Kirche, und diese kannte keine Gnade, nur Fremdenhass.
Eagle wartete ab, bis die Tür geschlossen wurde. Dann ging er zur Gitterwand.
»Hallo?« Eagle sank auf die Knie und betrachtete den anderen Mann. »Geht es Euch gut?«
Der Mann blieb reglos auf dem Boden seiner Zelle liegen. Vielleicht war er betrunken und hatte im Vollrausch die Wachen angegriffen? Aber warum wurde er dann von Rittern der Garde hereingeschleift? Er stank auch nicht nach Alkohol, obwohl Eagle Erbrochenes an ihm riechen konnte.
»He, du!«, rief er lauter.
Es tat sich nichts.
Eagle fuhr sich durch sein rotblondes Haar und seufzte unzufrieden. Er hätte dem Mann gerne geholfen, das lag in seiner Natur, er half jedem, auch Fremden, vor allem jenen, die verletzt waren. Doch er kam leider nicht an den reglosen Mann heran.
Da der andere Mann nicht aufwachte, langte Eagle nach dem Gegenstand, den er verloren hatte. Er presste das Gesicht gegen die Eisenstangen und streckte den Arm in die Nebenzelle. Seine Finger angelten die Kante und er zog den Gegenstand näher.
Es war ein zerschlissenes, kleines Buch.
Eagle setzte sich mit dem Rücken an die Gitterstäbe und fuhr über den ledernen Einband. Er wirkte stark abgenutzt und feucht. Er schlug das Buch auf. Mit dunkler Tinte hatte jemand in krakeliger Handschrift seine Gedanken festgehalten. Eagle rutschte näher zur vergitterten Öffnung, die sich direkt unterhalb der Zellendecke befand. Er setzte sich ins Licht und begann zu lesen ...
1
Den ersten Schritt zur Veränderung erkennen wir erst, wenn er bereits gemacht wurde.
»Sucht ihn!«, knurrte der Kommandant der Stadtwache. Seine dunkle Stimme grollte über die nackten Steinwände des Tempels. »Findet den Eindringling!«, forderte er von seinen Männern.
Ich duckte mich tiefer in die Nische hinter der geöffneten Holztür, durch die der Kommandant mit seinen Wachleuten gekommen war, und ärgerte mich darüber, dass er mich Eindringling nannte.
Meine Hand wanderte zielsicher zu dem Schwert an meinem Hüftgurt und umklammerte eisern seinen Griff. Den Kommandanten hätte ich ohne Schwierigkeiten überwältigen können, er stand mit dem Rücken zu meinem dunklen Versteck, er hätte mich nicht einmal kommen sehen. Aber ich war allein gegen sechs weitere Wachen, die in silbernen Rüstungen steckten, während ich nur dünnes Leder am Leib trug.
Zu riskant!
Ich besann mich und ließ vom Griff meines Schwertes ab. Ich verhielt mich ruhig.
In geduckter Haltung und mit gezogenen Waffen schlichen die Wachen tiefer in den Raum. Sie stanken nach Fisch und Met, was mich annehmen ließ, dass ich sie bei ihrem Abendmahl aufgeschreckt hatte. – Es war ein blöder Fehler meinerseits gewesen, gegen einen Krug zu laufen und Lärm zu machen. Aber mit Verfolgern im Nacken gewann meine Unternehmung an Reiz. Ich hatte nichts gegen Herausforderungen, im Gegenteil, ich bevorzugte sie.
Vielleicht hatte ich mit Absicht auf mich aufmerksam gemacht, um hinterher sagen zu können, ich hatte mich wehren müssen.
Die Wachen durchkämmten nun einen heimtückischer Raum, eine Ruhestätte für die Toten, mit vielen Versteckmöglichkeiten. Ich hätte überall lauern können.
Die Fackeln warfen Licht, und Licht warf Schatten. So konnte ich verfolgen, wohin die Wachen gingen.
Ich wartete nicht lange, als sie außer Reichweite waren, und löste mich aus meinem Versteck. Lautlos, dank leichtem Schuhwerk, schlüpfte ich hinter der Tür hervor und verschwand durch diese aus dem Raum. Ich gelangte in einen Flur und zog eilig die Tür zu.
Die Wachen hatten das Quietschen der Scharniere vernommen und ich konnte ihre Rufe und ihre schweren Schritte hinter der Tür hören.
Ohne zu zögern nahm ich den Kerzenständer, der neben der Tür im Flur gestanden hatte, und benutzte ihn als Türverriegelung. Es funktionierte, die Wachen rannten gegen die Tür, die nicht nachgab.
Über meine eigene List schmunzelnd, wandte ich mich ab und ließ das wütende Brüllen des Kommandanten hinter mir.
Aber jetzt musste ich mich beeilen, denn das Holz der Tür würde nicht ewig dem Stoßen und den Klingen der Wachen standhalten.
Ich rannte durch den Flur und durchschritt einen offenen Doppeltürbogen aus bläulich schimmerndem Gestein. Jemand ehrenwerteres als ich wäre bestimmt staunend stehen geblieben und hätte die Schönheit der unter der Erde liegenden »Halle der Toten« bewundert, die ich nun mit meinen unwürdigen Füßen betrat und entweihte. Ich hingegen machte mir nicht viel aus dem Schimmer, der mir entgegenstrahlte. Wenn mir irgendetwas keinen Vorteil einbrachte, hatte es auch nicht meine Aufmerksamkeit verdient.
Was mir hingegen einen Vorteil sichern sollte, jedenfalls laut Menard, dem Schamanen, war die Steintafel auf der Anhöhe, die sich nun über meinem Kopf erstreckte.
Tageslicht fiel durch einen Spalt im Gestein herein und beleuchtete das Grabmal, das auf dem Felsvorsprung vor vielen Jahrhunderten errichtet worden war. Ich konnte Staubkörner in dem Sonnenstrahl erkennen, und Schnee rieselte durch den Riss auf mich herab. Hier war es kälter als in den Tempelräumen – und ich schmeckte frische Luft.
Zwei Treppen führten links und rechts zu dem Grabmal hinauf.
Ich nahm die steinernen Stufen zu meiner Linken, immer zwei auf einmal. Schnell gelangte ich nach oben.
Hinter dem Grabmal befand sich ein Raum. Einst eine Krypta, doch nun fand ich dort ein Bett und einen provisorisch zusammengeschusterten Tisch mit einem mickrigen Stuhl, die beide von der Armut eines einfachen Mönchs zeugten.
Auf dem Tisch fand ich Schriften mit Forschungsdaten, leere Schriftrollen und Schreibfedern. Das Feuer, das in einer Ecke entfacht worden war, war schon lange erloschen. Ein Kessel mit kaltem Eintopf hing über der kalten Kohle.
Ich ging weiter und steuerte auf das Grabmal zu. Vor der steinernen Tafel war die Erde ausgehoben, ein gefrorener Haufen braunen Grunds lag daneben. Auf der anderen Seite stand ein Sarg aus schwarzem Stein.
Mit großen Schritten stampfte ich auf den Sarg zu. Auf dem Deckel stand tief in den Stein gemeißelt: »Störe die Ruhe des ehrenwerten Priesters Odilo, und die Verdammnis wird über dich hereinbrechen.«
Ich stemmte die Hände gegen den Sargdeckel und schob ihn auf. Mit vor Anstrengung verzerrter Stimme knurrte ich: »Ich bin die Verdammnis!«
Nur schwer ließ sich der Stein bewegen, aber ich gab nicht auf. Als er sich ein Stück öffnete, schlug mir der modrige Geruch des Sarginneren entgegen. Aber ich hatte weiß Gott schon Schlimmeres gerochen.
Je weiter ich den Sarg öffnete, je kälter schien es um mich herum zu werden. Ich glaubte den Boden vibrieren zu spüren, und die Wände des Gewölbes wackeln zu sehen, aber es konnte auch an dem Kraftaufwand liegen, den ich anwandte um Erfolg zu erzielen, und musste nichts mit Magie zutun haben.
Magie fürchtete ich nicht. Sie war ebenso leicht zu bekämpfen und zu besiegen wie ein Mann mit einem Schwert. Man musste nur wissen, wie.
Trotzdem presste ich noch einmal entschlossen hervor: »Ich bin die Verdammnis!«
Und mit einem Ruck fiel endlich der schwere Deckel vom Sarg. Staub flog mir ins Gesicht, als Luft in das Innere des Steinkastens drang.
Ich wedelte mit der Hand vor meinem Gesicht, bis ich wieder eine klare Sicht hatte. Durch den Flur drangen die Geräusche der Wachen zu mir, die dabei waren, die Tür einzutreten.
Ich hatte nicht mehr viel Zeit.
Als der Staub sich verzogen hatte, und ich den Toten im Sarg betrachten konnte, breitete sich ein Lächeln auf meinen vollen Lippen aus.
»So besonders seht Ihr gar nicht aus, oh hoher Priester Odilo«, sagte ich spöttisch zu der Mumie, deren eingefallener Körper in einem prunkvollen Priestergewand aus blauem Samt steckte. – Ich hatte keinen Respekt vor den Toten. Magie schien den Körper weitestgehend erhalten zu haben. Ketten aus massivem Gold und verzierte Edelstahlringe zierten den Leichnam.
»Das benötigt Ihr wohl nicht mehr.« In aller Seelenruhe nahm ich dem Priester die Wertgegenstände ab und ließ sie in meinen Taschen verschwinden, während die Wachen die Holztür einschlugen.
Es ärgerte mich, dass sie mich zu hetzen versuchten. Ich hätte mich ihnen nur zu gerne entgegengestellt und sie rücksichtslos kalt gemacht. Abgeschlachtet. Aufgeschlitzt wie Tiere. Nur weil ich der Auffassung war, dass es niemand zu wagen hatte, mich drängen zu wollen. Schon gar nicht, wenn ich einen wichtigen Auftrag zu erledigen hatte.
Sie hätten vor mir knien sollen. Alle. Die ganze Stadt. Sie hätten bei meinem Anblick erzittern sollen! Doch ich bezweifelte, dass sie auch nur ahnten, wer ich bin.
Nachdem ich auch das teure Samtgewand an mich genommen hatte, zog ich einen Dolch hervor und beugte mich ein letztes Mal über die Mumie. Mit einem zufriedenen Grinsen ritzte ich eine Botschaft in den Toten, als plötzlich die Tür aufbrach.
Ich konnte das Krachen des zerbrechenden Holzes durch den Flur hallen hören. Sofort richtete ich mich auf.
Während die in schwerer Rüstung steckenden Füße der Wachen durch den Flur rannten, wandte ich meine Aufmerksamkeit auf die steinerne Tafel des Grabmals.
Doch ich konnte den Sinn hinter den Worten nicht verstehen, also wirbelte ich herum und rannte zurück in den verlassen Schlafraum.
Eilig schnappte ich mir eine unbeschriebene Papierrolle vom Tisch und ein Stück Kohle aus der Feuerstelle. Zurück an der Steintafel drückte ich das Papier auf die eingemeißelten Worte und fuhr mit der Kohle darüber, um eine einigermaßen leserliche Kopie anzufertigen, da mir die Zeit fehlte, es säuberlich mit Tinte und Schreibfeder abzuschreiben.
Ich war noch dabei, das Papier schwarz zu färben, als die ersten Wachen die Steinstufen empor rannten.
»Da ist der Eindringling!«, rief eine jungenhafte Stimme.
Eine älter klingende Wache fügte hinzu: »Schnappt ihn euch!«
Sie kamen von Links und Rechts und kesselten mich ein.
Dachten sie jedenfalls.
Ich hechtete einfach über die Steintafel und sprang ungeachtet der Höhe den Vorsprung hinunter in die Halle.
Der Aufprall tat mir in den Knien weh, aber ich war höhere Sprünge gewöhnt und meine Gelenke waren noch jung. Außerdem belebte Schmerz meinen Körper.
Ich drehte mich noch einmal um, weil ich es mir nicht nehmen wollte, in die verblödeten Gesichter der verdutzten Wachen zu blicken.
Sie konnten mich leider nicht selbstgerecht grinsen sehen, da mein Gesicht vermummt war. Auch über meinem goldenen Haar hing eine Kapuze, die verhinderte, dass sie mich irgendwann auf der Straße wiedererkannten. Aber ich hoffte, sie würden aus meinen blassblauen Augen herauslesen, dass ich mich über sie amüsierte. Und sollte sich mein Weg je wieder mit einem dieser Männer kreuzen, hoffte ich, sie würden diese Augen wiedererkennen, wenn ich mit einer Klinge in der Hand über ihnen ragte und triumphierte.
Ich vollführte eine possierliche Verbeugung, ehe ich mich abwandte und davoneilte.
Hinter mir brüllte der Kommandant der Stadtwache zu seinen Männern: »Was steht ihr hier so rum? Na los, schnappt ihn! Schnappt ihn! Hinter her!«
Mein schwarzer Umhang flatterte hinter mir wie eine Fahne im Wind, während ich durch die Räume des Tempels wieder nach draußen eilte. Ich rollte die Schriftrolle mit der Kopie der Grabmalinschrift zusammen und steckte sie mir unter meinen Brustharnisch aus dunklem Bärenleder.
Doch wieder nach draußen zu gelangen war weniger einfach als erhofft.
Mir wurde von weiteren Wachen der Weg abgeschnitten, die mit Fackeln und gezogenen Schwertern eine enge Treppe empor rannten. Ich sah ihre Schatten und hörte ihre Schritte, einschließlich des Klapperns ihrer schweren Rüstungen, noch bevor sie mich wahrnahmen.
Ich hatte keine Wahl, ich musste zurückweichen, ehe sie mich entdeckten.
In einem Raum, der als Schlafkammer für Mönche diente, fiel mir ein Fenster ins Auge. Ich zögerte nicht, mir einen Fluchtweg zu schaffen.
Ich nahm einen Stuhl und warf ihn durch das Buntglas, das sofort zersprang. Der eisige Wind Carapuhrs wehte mir ins Gesicht. Ich liebte diese Kälte.
Der von mir verursachte Lärm lockte die Wachen zu mir.
Von der Straße darunter hörte ich erschrockene Ausrufe, und als ich aus dem Fenster kletterte, konnte ich sehen, dass ich eine junge Frau mit dem Stuhl getroffen hatte. Sie lag umringt von Menschen auf dem gepflasterten Weg der steinernen Stadt, unter ihrem Kopf breitete sich langsam eine dunkelrote Blutlache aus und ein kleines Mädchen mit blonden Locken – offenbar ihre Tochter – stand schockiert daneben.
Ich könnte jetzt behaupten, es täte mir leid. Aber ich will nicht lügen, es war mir einfach egal. Wenn es mir einen Vorteil verschafft hätte, dann hätte ich die ganze Stadt niedergebrannt. Lächelnd. Denn in meinem Leben stand ich mir selbst am nächsten, größtenteils weil mir beigebracht wurde, dass ich nur mir selbst vertrauen kann. Na ja, abgesehen davon wollten mich ohnehin alle anderen tot sehen. Kaltherzig zu sein bedeutete für mich: Überleben.
Ich schwang beide Beine über den Fenstersims, und schnitt mich am zerbrochenen Glas, mein Lederhandschuh füllte sich mit meinem eigenen Blut. Ich begrüßte den Schmerz, er sandte ein wohliges Kribbeln durch meinen Körper. Ich spürte Schmerz – ich lebte noch; was nicht selbstverständlich war.
Hinter mir eilten die Wachen in den Raum.
»Da ist der Eindringling!«, riefen sie.
Ach ne, dachte ich mir genervt, und fragte mich insgeheim, warum manche Männer das Bedürfnis hatten, immer alles, was sie taten oder sahen, zu kommentieren. Vor allem wenn es ohnehin offensichtlich war.
Unter mir positionierten sich weitere Stadtwachen. Mit Bögen. Geschosse flogen mir entgegen. Ich wich einem Pfeil aus, der in den Raum flog und eine Wache zwischen den Augen traf, die mich gerade von hinten hatte packen wollen.
Ich richtete mich auf, gab einer weiteren Wache einen Fußtritt und stieß sie damit gegen zwei ihrer Kameraden. Alle drei gingen in den Raum zu Boden. Eine andere Wache stieß mit dem Schwert nach mir, ich warf mich halb zur Seite, baumelte kurzzeitig in der Luft, konnte mich aber am Fensterrahmen festhalten.
Der Schwertstich ging es Leere, ich packte das Handgelenk der Wache und zerrte sie durch das Fenster.
Brüllend fiel der junge Mann. Sein Schädel zerplatzte auf dem Gestein zu meinen Füßen.
In Ordnung, sagte ich gedanklich zu mir selbst, nach unten war eine schlechte – wenn nicht sogar eine ganz bescheuerte – Idee. Es sei denn ...
Ich fixierte mit meinen durchdringenden Augen einen Bogenschützen, der mit einem Pfeil auf mich zielte. Seine Augen wurden groß, als ich mich auf ihn fallen ließ.
Mein Gewicht riss ihn zu Boden, sein Körper federte meinen Aufprall ab, doch er war noch bei Bewusstsein.
Ich packte seinen Kopf, der in einem Helm ohne Visier steckte. Er blinzelte mir ängstlich in die Augen, als ich ihn ansah und charmant lächelte. »Danke«, sagte ich höflich, weil er mich – mehr oder weniger unfreiwillig – aufgefangen hatte. Meine Mutter hatte mir Manieren beigebracht, ich wollte sie nicht beleidigen, indem ich einfach alles vergaß, was sie mich gelehrt hatte.
Dann schlug ich seinen Kopf auf den gepflasterten Weg und er wurde ohnmächtig.
Ich richtete mich auf und wollte den steilen Weg zum Südtor der Stadt hinunter hechten, als ein weiterer Schütze vor mir auftauchte.
Ergebend hob ich ein Stück meine Hände und wich zurück.
»Ergib dich, Dieb!« Die Spitze seines Pfeils zeigte auf meine Brust, ich hätte gern verhindert, dass sie mich durchbohrte.
»Dieb?« Ich sah mich um, als könne er unmöglich mich damit meinen. »Ich sehe hier keinen Dieb.« Eigentlich hatte ich ja auch nichts gestohlen. Zumindest nichts, was der Stadt und dem Jarl gehörte, ich hatte nur den Tempel und einen Toten bestohlen. Und eigentlich war ich auch kein einfacher Dieb.
»Ergebt Euch, Jungchen«, forderte der Bogenschütze. »Ihr habt keine Chance zu entkommen.«
Ich brach in Gelächter aus. Das irritierte die Wache.
Plötzlich wurde ich tot ernst: »Abwarten!« Ich zog mein Schwert.
Der Bogenschütze ließ den Pfeil sausen. Er traf mich in der Schulter, mein Arm wurde leicht zurückgeworfen, und ich brüllte auf.
Triumphierend grinsend, glaubte der Schütze, dass er mich getroffen hatte.
– Hatte er auch.
Er dachte, das hielte mich auf.
– Tat es aber nicht.
Der arme Narr hatte ja keine Ahnung, dass der Schmerz eine Art Lebenselixier war, das mich wachrüttelte und mich stärker machte. Ich liebte den Schmerz, solange er mich nicht umbrachte.
Mit dem Pfeil in meinem Körper, der glücklicherweise nicht in jener Schulter steckte an der mein Schwertarm hing, stürmte ich auf die Wache zu. Ich zerschlug mit dem Schwert seinen Bogen, packte den blauen Wappenrock – der über seiner Rüstung gespannt war – und stach ihm meine Klinge direkt durch den Kehlkopf schräg nach oben in sein Hirn. Mein Schwert durchbrach seinen Schädel, tote Augen starrten mir entgegen. Immerhin hatte ich ihm einen schnellen Tod gewährt. Eine Gnade, die ich wirklich nicht vielen meiner Opfer zuteilwerden ließ.
Ich zog mein Schwert heraus und ließ den toten Körper zu Boden fallen. Schreiende Frauen, die zuvor mit sicherem Abstand zugesehen hatten, rannten in alle Himmelsrichtungen davon, ihnen folgten mit noch schrillerem Geschrei viele Männer.
Ich grinste zufrieden.
Sie hatten Glück, das ich kein Sadist war, ansonsten wäre ich ihnen hinterhergerannt, aber ich tötete niemals willkürlich. Blut durfte nur vergossen werden, wenn es einem Zweck diente, ich hatte meine Prinzipien – wenn auch nicht viele.
Hinter mir hörte ich die Horde der Stadtwache herannahen und ich beschloss, zu fliehen.
Flink und leichtfüßig rannte ich durch die Stadt, die steilen Wege hinab in Richtung Südtor.
Ich stellte mir vor, wie Derrick nervös im Sattel saß und vor der Stadt sein Pferd auf und abtraben ließ, während er den Aufruhr unbeteiligt verfolgen musste. Ich hoffte, dass sie ihn noch nicht mit mir in Verbindung gebracht hatten.
Um den Wachen zu entkommen, nahm ich ungewöhnliche Wege. An Häuserwänden entlang, über Dachziegel, durch den kleinen Bach, der aus dem Berg floss und die Stadt spaltete.
Am Stadttor warteten bereits Wachen auf mich, aber ich wollte gar nicht durch das Tor. Sie sahen ziemlich verblüfft aus, als ich dank meiner besonderen Leichtfüßigkeit die Mauer hochklettern konnte.
Ich stieß noch eine Wache von der Mauer, ehe ich auf der anderen Seite hinuntersprang und auf den dunkelhaarigen Reiter zu rannte, der sein schwarzes Ross im rechten Moment wendete. Meinen eigenen Gaul ließ ich einfach zurück, er stand zu weitentfernt, als das ich ihn in angemessener Zeit erreicht hätte.
Atemlos warf ich mich hinter Derrick auf den breiten Pferderücken und hätte den stattlich gebauten Krieger beinahe aus dem Sattel gerissen.
»Deine Schulter!«, rief Derrick zu mir nach hinten. Er machte sich wohl Sorgen wegen des Pfeils darin.
»Mir geht’s gut«, versicherte ich ihm. Ungeachtet der Schmerzen riss ich den Pfeil aus meiner Schulter und ließ ihn fallen, meinen Arm würde ich eine Weile nicht richtig bewegen können, aber das war mir im Moment egal.
»Los! Los! Verschwinden wir hier!«, hetzte ich Derrick.
Dieser stieß die Hacken in die Flanke seines Hengstes und wir flogen mit donnernden Hufen den aus dem Tor eilenden Wachen davon.
Pfeile verfolgen aber verfehlten uns.
»Was hast du getan?«, schrie Derrick erbost.
Ich musste mich an ihm festhalten, um nicht vom Pferd zu fallen. Der Ritt war hart und ich hopste auf dem großen Gaul herum wie eine Puppe auf einem Fass, das auf einer wilden Strömung schwamm. Schnee wirbelte unter den monströsen Hufen des Pferdes auf und streifte über meine Wangen, der eisige Wind um uns herum ließ meine hellen Bartstoppeln gefrieren, und Derricks schulterlange, verzottelten Locken wehten mir immer wieder ins Gesicht. Ich war so genervt, dass ich Derricks Frage überhörte und versuchte, mich davon abzuhalten, ihm wegen seines nervigen Reitstils einen Dolch in den Rücken zu rammen.
Ich hätte ihn einfach aus dem Sattel reißen und ihn zurücklassen sollen, das hätte mir wenigstens einen kleinen Vorsprung eingebracht. Aber das wäre nur unnötige Verschwendung einer starken Schwerthand gewesen, die ich mir in meiner momentanen Lage nicht erlauben durfte.
Außerdem … Derrick war leider nicht zu ersetzen, aber Gott behüte, dass er das je erfuhr.
Ich warf einen Blick über die Schulter, während wir den Berg hinunter galoppierten und auf eine Fläche flachen Ödlands zuhielten. Die steinerne Stadt namens Bons geriet immer mehr in den Hintergrund, doch ihre Wachen mit den blauen Wappenröcken, auf denen ein Umriss des Berges gestickt war, verfolgten uns weiterhin.
»Beeil dich mal«, brüllte ich Derrick ins Ohr.
»Ich tue, was ich kann«, gab Derrick gelassen zurück.
Er kannte mich schon lange und ließ sich selten von mir provozieren, was mich wiederum verärgerte, ich wollte nicht durchschaubar sein, nicht einmal für Derrick, der am längsten bei mir war.
Wir gelangten in einen Engpass. Neben uns erstreckten sich hohe Felswände mit lockerem Geroll. Derrick hielt, auf meinen Befehl hin, an.
Wir warteten kurz, bis die Wachen uns fast eingeholt hatten, dann gab Derrick der Flanke seines Pferdes erneut einen Tritt, und ich brüllte in die Schatten: »Jetzt!« – Ich gab das Zeichen.
Derrick und ich ritten durch den Engpass und als die Wachen uns folgten, lösten meine Waffenbrüder die Falle aus und die Männer der Stadtwachen wurden gemeinsam mit ihren teuren Pferden unter dreckigen Felsbrocken zerquetscht.
Ich schlug aufgeregt gegen Derricks Schulter. »Dreh um! Dreh um!«
Derrick wendete den Hengst, der schnaubend auf der Stelle tänzelte.
Mit leuchtenden Augen sah ich dabei zu, wie loses Geröll den Engpass füllte.
Meine Männer kamen aus den Schatten, sie stiegen auf ihre Pferde und ritten auf uns zu.
Ich rutschte von Derricks Pferd.
Die Bruderschaft hielt vor mir an. Eine Schar verachtenswerter Männer, einer hässlicher als der andere, starrten grimmig zu mir herab.
»War das alles?«, brummte Lazlo ›das Narbengesicht‹ verdrossen.
Ich hatte ihm den Namen gegeben, ich habe all meinen Waffenbrüdern ihre Namen geben, als ich mich zu ihrem Oberhaupt ernannt hatte. Damals war ich gerade mal erst elf Sommer alt gewesen. Meine Männer waren raue Mistkerle unter denen ich mich behauptet hatte. Ich habe sie zu einer Bruderschaft geformt, sie schuldeten mir ihre Treue. Wer nicht bereit gewesen war, mir zu folgen – einem Jungen zu folgen –, hatte sterben müssen. So handhabte man das eben auf der Straße. Der Stärkere überlebt. Ich war vielleicht körperlich nicht stärker, dafür aber geistig. Ich hatte eben einen starken Willen.
Ich finde, ich hatte diese Hunde gut unter Kontrolle. Allerdings verstand ich unter »Kontrolle« wahrscheinlich auch nicht das, was ein normaler und gesetzestreuer Bürger Carapuhrs darunter verstehen würde.
Lazlo spuckte einen großen Schleimklumpen auf den Boden. Er hatte Glück, das er es nicht direkt vor meinen Füßen getan hatte, ansonsten hätte ich es als Beleidigung empfunden und ihn eigenhändig in zwei geteilt.
Ich ignorierte ihn und stampfte hinüber zu Kostja ›dem Zarten‹; oder wie ich ihn gerne nannte: Kostja ›der Benutzte‹.
Er saß mit seinem dürren, schlaksigen Körper im Sattel eines vitalen braunen Gauls.
Ich schubste den Jungen – der nur zwei Jahre jünger war als ich – aus dem Sattel, und steckte meinen eigenen Fuß in den Steigbügel. Ohne auf Kostja zu achten, der sich auf der anderen Seite wieder aufrappelte, schwang ich mich in den Sattel.
Erst jetzt wandte ich mich an Lazlo: »Hast du etwas anderes erwartet, mein Bruder?«
Lazlo schnaubte, dabei verzog sich einer seiner Mundwinkel zu einem schiefen Lächeln, und die Kerben seiner pockenartigen Narben wurden noch tiefer.
Oft dachte ich daran, dass aus ihm wahrscheinlich ein recht ansehnlicher Mann geworden wäre, hätte er durch die Pockenkrankheit diese Narben nicht davongetragen. Aber es war auch nicht sein Gesicht, das mir gefallen musste, sondern seine Fähigkeiten.
»Sprich dich aus, mein Bruder«, forderte ich scheinbar gelassen, doch jeder, der mich kannte, konnte den drohenden Unterton in meiner ansonsten melodischen Stimme heraushören.
Lazlo fuhr sich mit abgewandtem Blick durch sein rotbraunes Haar. »Wir haben uns ... Beute erhofft«, gestand er schließlich. »Beute, die man zu Silber machen kann.«
»Ah«, machte ich, als verstünde ich ihn nun. Aber ich hatte zuvor schon gut verstanden.
Die anderen Brüder warfen sich stumme Blicke zu. Sie teilten Lazlos Ansicht, das konnte ich ihnen ansehen, doch sie wagten es nicht, mir das mitzuteilen.
Kluge Entscheidung.
»Also, mein Bruder ... « Ich lenkte mein Pferd, das ich Kostja abgenommen hatte, neben Lazlos und zog einen Dolch.
Lazlo schluckte, als ich die Spitze der Klinge über sein mit dunklen Stoppeln überzogenes Kinn kratzen ließ.
»Vielleicht ... gewinnt das ja deine Zustimmung.« Mit einer geschickten Handbewegung warf ich den Dolch kurz in die Luft und fing ihn an der Klinge wieder auf. Ich reichte Lazlo den goldenen und mit Edelstein verzierten Dolchgriff.
Ich grinste.
Lazlos erwiderte zögerlich mein Grinsen und nahm den Dolch an sich, den ich aus dem Tempel mitgenommen hatte.
»Und für meine anderen Brüder ... « Ich wendete mein Pferd und leerte meine Taschen. Schmuck und das Priestergewand fielen auf den schneebedeckten Boden.
Sofort sprangen die habgierigen Brüder aus den Sätteln und prügelten sich um die Beute, die ich ihnen mitgebracht hatte.
Ich ergötzte mich an dem Anblick, wie sie auf den Knien vor den Hufen meines Pferds miteinander rangelten.
Derrick trieb sein Pferd neben meines, die beiden Hengste keiften sich kurz an, ehe wir sie unter Kontrolle bringen konnten.
»Sagte Menard nicht, du sollst dich rein schleichen und mit einer Abschrift des Grabmals des Drachenflüsterers zurückkommen?«, fragte Derrick amüsiert.
Ich zeigte ihm kurz die Papierrolle, die ich beschützend an meinem Körper transportierte, und zwinkerte meinem alten Freund dann zu. »Habe ich doch. – Eine originale Kopie der Inschrift des Grabmals des Priesters Odilo, besser bekannt als der Drachenflüsterer.«
»Menard sagte auch, du sollst weder töten noch stehlen«, erinnerte sich Derrick.
»Ich kann doch nicht ohne Geschenke zu meinen Brüdern zurückkehren«, schmunzelte ich.
Derrick nickte zustimmend.
Meine erheiterte Miene wurde plötzlich hart, als ich anfügte: »Außerdem gibt mir niemand Befehle. Nicht einmal dieser uralte Schamane Menard.«
Vom Berge ertönte das Röhren eines Horns und ich blickte zur steinernen Stadt hinauf.
Sie war so groß, dass sie selbst vom Fuße des Berges gigantisch wirkte. Sie war der Berg.
»Sie rufen Verstärkung«, wusste Derrick. »Und warnen die umstehenden Truppen der Elkanasai.«
Die Elkanasai waren das spitzohrige Volk, das Carapuhr vor zehn Jahren besetzt hatte. Und sie waren meine größten Feinde.
Ich nickte, während ich mir gleichzeitig vorstellte, wie die Wachen von Bons meine Nachricht fanden, die ich in die entkleidete Mumie eingeritzt hatte. Auf deren Bauch stand nun: »Die Pest auf euer aller Häuser, Verräter!«
Ein helleres Horn antwortete. Die Elkanasai.
Ein Trupp war ganz in der Nähe. Nun blickten auch meine Waffenbrüder auf.
»Wir sollten gehen«, sagte Derrick nervös. Sein Pferd tänzelte, als sich die Anspannung von Reiter auf Tier übertrug.
Ich hasste es, dass er sich anmaßte, mir ständig seine Vorschläge zu unterbreiten. Aber er hatte Recht.
Mich dürstete es nach dem Blut meiner Feinde, aber ich hatte nur die wenigstens meiner Brüder bei mir und es wäre nicht klug, sich dem Feind zu stellen, wenn man unterlegen war.
Ich warf noch einen hasserfüllten Blick über den Berg, von dessen Gipfel das Horn der Elkanasai erklungen war. Dann zerrte ich an den Zügeln meines Pferdes und knurrte meine Söldnertruppe herrisch an: »Verschwinden wir hier!«
Ohne zu zögern warfen sie sich auf ihre Pferde. Derrick nahm sich ein Herz und zog Kostja auf sein Ross.
Wut flackerte in mir auf. Jene Wut, die ich selten kontrollieren konnte.
Was fiel Derrick ein, einfach Kostja zu helfen, wenn ich bereits entschieden hatte, dass er ebenso gut zu Fuß gehen konnte?
Ich konnte es nicht ausstehen, wenn Derrick dort Güte zeigte, wo ich kaltherzig war.
Eine Frechheit!
Aber ich konnte mich selbst bezwingen und den Dämonen in mir Einhalt gebieten.
Zumindest vorerst.
»Vorwärts!«, trieb ich meine Männer an und ritt ihnen wütend voraus.
Wütend über Derrick, wütend über mich, weil es mich wütend machte, und wütend, weil ich ein weiteres Mal vor meinen Feinden fliehen musste, statt mich ihnen entgegen zu stellen.
Wut war ein in mir allgegenwärtiges Gefühl, aber so war es nicht schon immer gewesen.
2
Zwölf Jahre zuvor ...
Derrick war ein schmutziger Bauernjunge ohne jegliche Manieren, der jedoch große Träume hatte. Eines Tages wollte er sich einen Platz in der königlichen Armee Carapuhrs sichern. Er wollte ganz weit nach oben, er wollte Kommandant oder sogar Hauptmann werden. Doch seine hochgesteckten Ziele waren für ihn nicht zu erreichen.
Glaubte er.
Derrick war bereits siebzehn Jahre alt. In Carapuhr wurden Jungen aber schon mit zwölf in die Armee eingezogen. Ihm fehlten ganze fünf Jahre Erfahrung und wichtiges Training. Dabei wäre er ein guter Soldat geworden. Doch sein Vater, ein armer Bauer, hatte andere Pläne mit ihm gehabt und versteckte seinen talentierten Sohn vor den Soldaten des Königs. Weil er ihn für die Feldarbeit benötigte. Damit er seine Familie über den Winter bringen konnte, hatte Derricks Vater behauptet, sein Sohn sei gestorben.
Derrick war der einzige Sohn unter fünf Schwestern. Er unterschied sich sehr von anderen Jungen und hatte keine Freunde. Ihn interessierten die Nöte seiner Familie nicht, so war es auch nicht ungewöhnlich, dass er mit siebzehn genug von seinem einfachen Leben hatte und seine Familie ohne schlechtes Gewissen verließ.
Sein Weg führte ihn ohne Umwege direkt zur königlichen Burg.
In der unteren Stadt lebte er einige Monate im Schatten der Burg als einfache Gassenratte. Was er dort erlebt hatte, würde er nicht einmal unter Folter erzählen. Nur soviel sei verraten: In der Unteren Stadt, Heimat aller Schurken, war ein junger Bursche nichts weiter als eine freilaufende Hure. Aber Derrick hatte es überstanden, hatte die Monate überlebt, wurde zäher durch seine Erfahrungen.
Der Hunger trieb ihn schließlich in die wohlhabende Hohe Stadt, doch er war kein geschickter Dieb. Er hätte sich lieber von Beginn an als Söldner verdingen sollen.
Er wurde erwischt, als er einem Adeligen den Silberbeutel vom Gürtel schneiden wollte.
Derrick floh – aus Mangel an geographischen Kenntnissen – in die falsche Richtung und wurde in die Burg getrieben, wo gerade ein großes Fest stattfand, auf dem alle angesehenen und hochrangigen Jarls, Barone, Fürsten und welche Titel es noch so gab, zugegen waren.
Alle waren in hellem Aufruhr, als wäre ein Wildschwein aus Versehen bei einer Treibjagd mitten in eine Menge Tournierbesucher gerannt.
So im Etwa stellte sich Derrick auch an. Er rutschte auf den ungewohnt glatten Böden der königlichen Burg aus und riss einige Gegenstände um. Er richtete eine Verwüstung an, über die noch heute die alten Damen empört berichten.
Aber er war trotz seiner Panik nicht unfähig. Er war flink, auch wenn er fiel. Derrick konnte sehr hoch springen, er wies Gerissenheit auf, als er Regale umwarf um die Wachen daran zu hindern, ihn zu verfolgen. Er war klug genug, nicht zu kämpfen, wo ein Kampf zwecklos gewesen wäre. Er hatte Talente, mit denen sich keine Leibwache des Königs ausweisen konnte. Talente, die man sich nur auf der Straße aneignete.
An diesem Tag glaubte Derrick, er wäre in sein Verderben gerannt, aber er irrte sich. Er irrte sich gewaltig. Denn an diesem Tag traf er auf mich. Und ich rettete ihm das Leben.
Im Gegenzug verlangte ich nur, dass er mir seines verschrieb.
3
Wer einen getretenen Hund provoziert, muss mit dem Biss des Todes rechnen.
Carapuhr. Land des Schnees. Heimat der Barbaren. Meine Heimat.
Ich ging in die Hocke und fuhr mit den Fingerspitzen über die lose Schneedecke. Ein Sturm hatte über Nacht unsere Spuren verwischt.
Darauf konnte ich mich stets verlassen: darauf, dass mein Land mir treu blieb. Das es mich vor meinen Feinden beschützte. Mich versteckte.
Mein Land, meine Heimat, war meine größte Liebe. Wobei ich erwähnen sollte, dass ich ansonsten keine Sympathien für irgendetwas oder irgendwen hegte. Carapuhr war meine einzige Liebe. Eine Liebe, die mittlerweile tiefer reichte als die Liebe zu meiner Mutter, die nicht mehr unter uns weilt.
»Das sieht übel aus, mein Bruder.«
Ich hob den Blick und schirmte meine Augen mit der verletzten Hand ab, da mich die Morgensonne blendete. Die weiße Schneedecke brannte sich in meine Augäpfel.
Derrick, der mit Egid Einauge – den Namen hatte er seit unserer ersten Begegnung – an einem entfachten Lagerfeuer saß, deutete mit einem Kopfnicken auf meine nackte Schulter.
Mir konnte die Kälte nichts anhaben, ich war hier geboren und aufgewachsen. Neunzehn Jahre hatte ich bereits auf dem Buckel, und Schnee und Eiswind konnten meine dicke Haut kaum durchdringen.
Zugegeben, ich war seltsamerweise schmerzresistenter als andere Männer. Immer wieder wurde ich bestaunt, wenn ich mit verheerenden Wunden immer noch kämpfen konnte. Ich redete mir gerne ein, dass es an meiner mentalen Stärke lag, dass ich Schmerz anders wahrnahm als meine Begleiter, dass ich einfach Unwillens war, Schmerz zuzulassen. Ob es stimmte, vermochte ich jedoch nicht zu sagen.
Ich blickte auf die Wunde in meiner Schulter, sie schien sich entzünden zu wollen. Es machte mich wütend, dass mein Körper mich derart verriet. Wieso war er nicht in der Lage, sich selbst zu heilen? Der Pfeil hatte wohl eine rostige Spitze gehabt, oder ich hatte mir den Schaden selbst zugefügt, als ich ungeachtet der Folgen den Pfeil einfach herausgerissen hatte.
Ich knirschte mit den Zähnen.
Conni kroch hinter mir aus meinem Zelt. Schwester Conni, die schöne Barbaren-Conni, die zu meiner Bruderschaft zählte. Die Conni, die mit ihren sechsunddreißig Jahren meine Mutter hätte sein können. Jene Conni, die manchmal das Lager mit mir teilte, seit sie mich damals, als ich noch ein Junge gewesen war, auf ihres gelockt hatte.
Gerne behauptete sie mit ihrer rauen, lüsternen Stimme, sie habe mir die »Unschuld« genommen. Mich ärgerte diese Behauptung und mir juckten jedes Mal die Finger, wenn sie sich anmaßte, zu behaupten, an mir wäre je etwas unschuldig gewesen.
Ja, sie war die erste Frau gewesen, die mich berührt hatte, aber niemand hätte mir eine »Unschuld« nehmen können, wenn ich nie zuvor so etwas wie Unschuld besessen hatte.
Conni ging mir allmählich auf die Nerven. Ich bestieg ihren wollüstigen, weiblichen Körper nur, weil sie die einzige Frau unter uns war. Nach all den Jahren schien sie jedoch anzunehmen, ich hätte eine Schwäche für sie. Aber ich besaß keine Schwächen. Nicht eine einzige. Jeder war entbehrlich, vor allem Conni.
An diesem Morgen hätte ich mich ihr beinahe entledigt, als sie aus dem Zelt kam und sofort fürsorglich rief: »Ich helfe dir mit der Wunde!«
Sie wollte an mir vorbei zum Feuer, wohl um Utensilien zu besorgen.
Ich erhob mich und schlug ihr mit dem Handrücken ins Gesicht. Ihr schmales Gesicht flog herum, ihre verfilzten, langen, blondroten Haare folgten.
Das Geräusch, das meine Hand auf ihrer Wange verursachte, dieses Klatschen, war herrlich und wie Musik in meinen Ohren. Ich spürte, wie die Wut verflog und meinen Brustkorb freigab. Ich hatte nicht übel Lust, sie zu verprügeln. Aber ich war ja kein Monster.
»Derrick, mach mal eine Dolchklinge heiß«, trug ich meinem Freund auf.
Wenn es um die Versorgung meiner Wunden ging, ließ ich stets nur Derrick an mich heran. Conni hatte das auf die harte Weise lernen müssen. Dummes Ding!
Es interessierte keinen der Brüder, dass ich Conni geschlagen hatte. Unter uns Männern war ihr gewiss schon Schlimmeres widerfahren. Vor allem dann, wenn wir lange unterwegs und weit und breit keine einzige Menschenseele in Sicht gewesen war. Als einzige Frau unter schlimmen Schurken musste man sich eben behaupten können. Es war nicht meine Schuld, wenn Conni sich mal nicht wehren konnte und gegen ihren Willen genommen wurde. Sie hätte uns ja auch verlassen können.
Am amüsantesten fand ich es, wenn Manolo der Berg – der Name beschrieb wohl deutlich genug seine äußerliche Erscheinung – sie benutzte. Weil ich wusste, das Conni ihn nicht leiden konnte. Oft machte sie fiese Witze über sein bulliges Gesicht, das dem eines Stiers nicht unähnlich war. Meiner Meinung nach verdiente sie es, gerade von ihm gebumst zu werden.
Ich schubste Conni in den Schnee, sie hielt sich noch immer die Wange, als sie mit hasserfüllter Miene auf dem Boden landete. Dann ging ich zu Derrick und Egid Einauge und setzte mich zu ihnen.
Derrick hielt die heiße Dolchklinge hoch.
»Einauge, halt mich fest«, trug ich Egid auf, weil ich wusste, dass ich Derrick umbringen wollen würde, sobald er meine Wunde ausbrannte, obwohl ich ihn darum gebeten hatte.
Die Pranken des großen Egid legten sich um meine Oberarme. Ich nickte Derrick zu, der mit einem – man konnte es fast schon sadistisch nennen – Grinsen das heiße Eisen auf meine Wunde drückte.
Ich hielt Blickkontakt mit Derrick, der es genoss, mir Schmerzen zuzufügen. Aber versteht mich nicht falsch, er hasste mich nicht, er fügte anderen Männern einfach nur gerne kontrollierte Schmerzen zu. Das machte ihn immer fröhlich.
Die ersten Augenblicke spürte ich kaum etwas, aber dann fraß sich der Schmerz durch mich hindurch und ich brüllte aus zusammengebissenen Zähnen.
Ich hätte ihn wirklich am liebsten umgebracht.
Es roch nach verbranntem Fleisch – nach meinem verbrannten Fleisch.
Als es vorbei war, trat Lazlo das Narbengesicht zu uns und zog genüsslich den Duft ein. »Ah ... köstlich.«
Ich lachte humorlos auf. Gleich darauf verlangte ich von ihm zu erfahren: »Verfolgen sie uns?«
Lazlo war unser Späher und ich erwatete von ihm Perfektion. Gut, ich gestehen, ich verlangte von allen meinen Männern Perfektion. Wir waren zu wenige um uns Fehler zu erlauben. Unsere Feinde machten Fehler, wir aber nicht. Das erlaubte ich nicht.
Lazlo schüttelte gelassen den Kopf, er ließ sich am Feuer nieder. »Nein, nein. Hier ist weit und breit niemand.« Sein Blick zuckte zu Conni, die noch im Schnee saß und wegen mir schmollte. Lazlo zog die Nase hoch – er hatte ständig Schnupfen – und fragte mich: »Bist du fertig mit ihr?«
Ich überging die Frage, als ich wissen wollte: »Ist es noch weit bis zum nächsten Gasthof?«
»Nein«, antwortete Lazlo. »Bis zum Mittag sind wir dort.«
Ich nickte zufrieden. Dann deutete ich auf Conni und sagte zu Lazlo: »Nimm sie dir. Aber beeil dich, wir brechen bald auf.«
Mit einem lüsternen Grinsen ging Lazlo auf Conni zu.
Conni zog einen Dolch. Lazlo lachte.
Sie kämpften.
Lazlo wurde verletzt und Conni rannte davon.
»Ich wusste, dass das passiert«, lachte Derrick neben mir.
»Versuch du doch dein Glück und fang sie wieder ein«, rief Lazlo sauer. Fluchend wischte er sich das Blut von der Hand, durch die Conni ihre Dolchklinge gestoßen hatte.
Derrick schüttelte nur den Kopf, denn Derrick fasste Conni nicht ein. Aber nicht, weil er Mitleid mit ihr gehabt hätte, er ekelte sich nur vor benutzten Frauen. Jedenfalls behauptete er das stets.
Mir war das egal, ich bestieg alles. Ich hätte auch mit einem Astloch vorliebgenommen, wenn es denn eng und warm gewesen wäre. Viel Freude empfand ich dabei ohnehin nicht, mir ging es nur darum, den stetigen Druck in meinen Lenden loszuwerden. Und das konnte ich bei Conni ebenso gut wie ich es bei unberührten Frauen oder einer bezahlten Hure loswerden konnte. Am liebsten mochte ich es ohnehin, wenn sie sich wehrten. Aber Conni werte sich nicht, nicht einmal, wenn ich sie schlug oder sie würgte. Sie hatte für mich über die vielen Jahre einfach an Reiz verloren. Während mir als Junge nur ihre großen Brüste und ihr warmes Fleisch genügt hatten, spürte ich nun immer mehr, dass ich mehr benötigte als das.
Aber meine fleischlichen Gelüste waren mir ohnehin nicht so wichtig. Wie gesagt, solange ich irgendwo Druck loswerden konnte, war ich zufrieden, wenn auch nicht befriedigt.
Wichtiger war mir nur, mein Leben endlich drastisch zu verändern. Es war an der Zeit, dass ich zurückeroberte, was mir nun rechtmäßig zustand.
Und zwar mir allein.
Ich stand auf und drängte meine Männer zur Eile. Ich schickte Lazlo, damit er Conni zurück zerrte. Ich kannte sie, sie würde uns nicht verlassen, egal was wir ihr antaten. Sie war vom gleichen Schlag, sie war auch eine Schurkin, eine Schwester, sie brauchte uns. Und ich vergeudete kein nützliches Leben, wenn es nicht unbedingt von Nöten war.
»In zwei Wochen müssten wir zurück bei Menards Zuflucht sein«, vermutete Derrick, als wir nebeneinander auf unsere Pferde stiegen.
Ich ließ meinen Blick über das Waldgebiet wandern, das sich vor uns erstreckte. »Meinst du?«, fragte ich gedankenverloren, mein Gesicht war unergründlich und spiegelte nicht die Ungeduld wieder, die ich seit einigen Monaten nicht mehr auszuhalten versuchte.
Ich ließ sie einfach zu.
Menard war schuld an meiner schlechten Laune. Er bremste mich aus, ich wusste nur noch nicht, wieso mich der Mann, der mir einst wie ein Vater gewesen war, an meinen Plänen zu hindern versuchte.
Ich drehte Derrick das Gesicht zu und sagte: »Es wird Zeit, das wir heimkehren, Sir Derrick Einar.«
Und ich sprach nicht von der Zuflucht des Schamanen.
»Alles zu seiner Zeit«, sprach Derrick auf mich ein. »Vielleicht spuckt der Alte noch etwas Nützliches aus.«
»Das hoffe ich.«
Oh, und wie ich hoffte, dass er noch etwas ausspucken würde.
***
»Unser Land ist vom Feind besetzt und Menard schickt mich in Tempel um Abschriften anzufertigen.« Ich schüttelte verdrossen den Kopf, meine Arme waren vor meiner Brust verschränkt und die Gerüche aus der Küche des Gasthauses kitzelten mir in der Nase.
Was war das? Wildbret? Mir lief das Wasser im Mund zusammen, ich hatte seit Tagen nichts Warmes mehr gegessen.
»Der Feind besetzt unser Land nicht«, warf Derrick ein, der vor mir saß und ebenso hungrig aussah wie ich. »König Amon hat sich mit dem Feind verbündet«, erinnerte er mich. »Wir gehören jetzt zum Kaiserreich der Elkanasai.«
Ich schlug wütend die Faust auf den von Kerben gezeichneten Tisch, die einzelne Kerze, die uns Licht spendete, hüpfte dabei einmal und drohte, umzukippen.
Derrick verstummte.
Ich konnte nicht genau sagen, ob ich wütend darüber war, weil er mich daran erinnerte, das Carapuhr sich unterworfen hatte, oder weil er den Namen des Mannes ausgesprochen hatte, den ich zu meinem Erzfeind ernannt hatte, nachdem er meine Familie abschlachtete.
König Amon ... Dieser Verräter, der sein eigenes Volk verkaufte, nur um sich weiterhin König nennen zu können. Wenn der alte Mann Mut gehabt hätte, dann wäre er den zahlreichen Armeen der Elkanasai trotz seiner Unterlegenheit entgegengetreten, statt sich auf ein feiges Abkommen einzulassen.
Gut, man sollte ihm zugestehen, dass er dadurch viele unschuldige Leben vor dem Tod bewahrt hatte. Allerdings lebte die Hälfte dieser verschonten Leben nun in Sklaverei. Denn das ist es, was die Elkanasai mit Menschen machten. Sie versklavten uns.
»Carapuhr ist noch nicht verloren«, knurrte ich und lehnte mich zurück.
Mein Blick durchforstete das düstere Innere des Gasthauses. Seit dem frühen Nachmittag besetzte ich mit meiner Truppe aus siebenundsiebzig Mann – Conni eingeschlossen – dieses Gebäude und den angrenzenden Hof. Nur meine engsten Vertrauten hatten das Privileg mit mir im warmen Inneren an Tischen zu sitzen, alle anderen durften bei den Tieren hausen.
»Das sage ich auch gar nicht«, hörte ich Derrick erwidern.
Ich sah ihn an. Sein Antlitz machte mich wütend. Es machte mich oft wütend, ich wusste aber nicht einmal, wieso. Sein Gesicht war mittelmäßig. Markant. Ohne besondere oder abscheuliche Merkmale, die mich stören könnten. Derrick war äußerlich betrachtet durchschnittlich. Weder hässlich noch besonders hübsch. Aber irgendetwas in seinem Gesicht machte mich wütend. Wenn ich ihn ansah, brodelte Zorn in mir. Die Wut bezog sich nicht auf ihn, sondern auf mich selbst. Aber genau das war es, was mich daran störte.
Durchforschend betrachtete ich ihn, auf der Suche nach der Lösung dieses Rätsels, aber ich fand nichts, was mich im Besonderen zornig machte. Alles ärgerte mich gleichermaßen. Seine grauen Augen, die mich an die Silberklinge meines kostbaren Schwerts erinnerten, ebenso die langen, dunklen Wimpern, die sie umrandeten, und die unaufdringliche Nase mit der abgerundeten Spitze, die ein wenig nach oben zeigte und seine Nasenlöcher groß erscheinen ließ, die ebenholzfarbenen, schulterlangen Locken, die Ohren, die weder abstanden noch seltsam eng am Kopf lagen, die Lippen, die weder voll noch schmal waren.
Derrick runzelte die Stirn. »Ist was?«
Ich atmete gereizt ein und aus.
Derrick lehnte sich zurück. Er spürte, dass er der Grund war, wegen dem ich kurz davor war, die Beherrschung zu verlieren.
»Mein Bruder«, Derrick sprach ruhig, was mich wiederum noch mehr verärgerte, »wir werden schon noch einen Weg finden, die Elkanasai zu vertreiben.«
»In ein paar Jahren bin ich ein alter Mann«, gab ich kopfschüttelnd zurück, »was kann ich dann noch ausrichten, Derrick?«
Derrick wollte wissen: »Was willst du tun?«
Mit dieser Frage hatte er mich wieder besänftigt. Derrick maßte sich nicht an, mir zu sagen, was das Beste wäre oder was ich seiner Meinung nach tun sollte, jedenfalls vermied er es, wenn ich ohnehin mieser Laune war.
Ich zuckte mit den Schultern, nun nervte mich meine eigene Unfähigkeit. Ich wusste es nicht, so schwer es mir fiel, es zuzugeben, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Menard war mein engster Vertrauter, ich würde sogar soweit gehen, ihn als Freund zu bezeichnen. Aber weshalb bremste er mich so aus?
Als hätte er meine Gedanken belauscht, vermutete Derrick: »Vielleicht hat er nur Angst um dich.«
»Angst ist etwas, das wir uns nicht leisten können«, gab ich zurück. Ich hatte mich oft genug in meinem Leben der Angst hingegeben, es war an der Zeit, zurückzuschlagen, egal welche Verluste ich zu erwarten hatte. Angst würde mich nicht aufhalten ... nein, nicht mehr.
»Entweder sterben für die eine Sache, die uns am leben hält ...«, murmelte ich.
»Oder wir opfern alles um zu siegen«, beendete Derrick mein Gemurmel.
Ich nickte mit Blick auf den Tisch. Es war bereits Nacht und wir saßen schon viele Stunden an den Tischen dieses Gasthofes. Wir hätten an diesem Tag eine viel größere Strecke zurücklegen können, doch solange ich noch nicht entschieden hatte, was ich mit Menard anfangen sollte, wollte ich mich nicht beeilen.
Der alte Mann durfte ruhig mal etwas länger auf seine Schriften warten.
»Was hat er damit vor?«, fragte ich und sah über den Tisch hinweg Derrick an.
Mein alter Freund zuckte verwirrt mit den Achseln.
»Mit der Schriftrolle«, half ich ihm auf die Sprünge. »Was will Menard damit?«
»Um was geht es in der Grabinschrift?« Derrick beugte sich über den Tisch.
Ich holte die Papierrolle hervor und breitete sie auf dem Tisch aus. Es war schlecht zu lesen, aber ich konnte mich noch an die Worte erinnern und las sie vor: »Hier ruht Priester Odilo, der zu den Drachen flüstern konnte, er sprach ›Hroar‹, und sie kamen.«
Derrick sah mich mit verständnislosen Augen an. Für einen Augenblick hatte er den blödesten Gesichtsausdruck den ich bis dorthin gesehen hatte. Jedem anderen hätte ich in dieses leere Gesicht geboxt, aber bei Derrick musste ich mir ein Grinsen verkneifen.
»Hroar?«, fragte Derrick verwirrt.
»Das Brüllen eines Tieres«, vermutete ich.
Derrick runzelte skeptisch seine Stirn.
Die Tochter des Wirts lief an unserem Tisch vorbei und brachte fünf volle Krüge mit schäumendem Met zu meinen Männern. Sehnsüchtig blickte Derrick ihr nach.
»Wenn sie dich reizt, dann nimm sie dir doch«, sagte ich zu ihm, mein Blick war weiterhin auf die Inschrift gerichtet.
Was bedeuteten diese Worte? Würde ich Drachen anlocken, wenn ich in den Himmel brüllte? Unsinn! Es hatte seit Jahrzehnten keine Drachen mehr in Carapuhr gegeben. Aber was wollte Menard mit dieser Information? Es musste ein höherer Sinn dahinterstecken. Menard hatte mich gelehrt, das hinter jedem Wort in einer Abschrift eine zweite Bedeutung innewohnen kann. Nichts ist offensichtlich, hatte er gesagt.
Es beunruhigte mich, das ich nicht wusste, was der Schamane vorhatte. Nach allem, was ich erlebt hatte, konnte ich davon ausgehen, dass diejenigen, die mir am nächsten standen, mich hintergehen würden. Und abgesehen von Derrick, stand mir Menard am nächsten. Ich vertraute ihm nicht, weil er Vertrauen verlangte.
»Ich sah dem Met nach, nicht der Frau«, grinste Derrick.
Als die Tochter unseres unfreiwilligen Gastgebers wieder an uns vorbeilief, hielt ich sie auf.
Erschrocken schnappte sie nach Luft, als ich einfach ihr Handgelenk packte und sie grob auf meinen Schoß zog.
»Dann nehme ich sie«, beschloss ich und rollte die Schriftrolle wieder zusammen.
Die schlanke Frau versuchte sich zu wehren, das arme Ding hatte ja keine Ahnung, dass sie damit das Feuer in meinem Blut erst richtig entfachte. Sie versuchte, mich zu beißen und ich begann zu schnurren wie ein Stubentiger.
Doch bevor es schön werden konnte, platze ein großer, dunkelhaariger Hüne aus der Küche und stampfte auf mich zu.
Belustigt grinste ich ihm entgegen, ich stand nicht einmal auf.
»Lass sie los, du Widerling!«, brüllte er mir entgegen.
Auf halben Weg wurde er von Egid Einauge gerammt und zu Boden geworfen.
Ich zog einen unsichtbaren Hut von meinem Haupt und neigte meinen Kopf zum Gruße. »Der Namenlose«, stellte ich mich freundlich vor. »Und der Mann, dem Ihr gleich zu Willen sein werdet, ist mein Bruder Egid Einauge.«
»Ich bring dich um!«, brüllte der überwältigte Hüne, während er niedergedrückt wurde.
Ich konnte aus den Augenwinkeln Derrick schwer schlucken sehen, während er entsetzt dabei zusah, wie Egid mit seiner Beute verschwand.
Ich lächelte wissend. »Nun geh schon!«
Derrick sah mich an.
Ich nickte Egid hinterher. »Lass ihn nicht allein den ganzen Spaß haben.«
Derrick lehnte ab. Er nickte auf die junge Frau mit dem kurzen, roten Haar, die ich mit einem Arm locker festhalten konnte, obwohl sie sich wehrte. »Was ist mit ihr?«
»Immer willst du, was ich habe!«, konterte ich mit gespielter kindlicher Stimme.
Derrick und ich brachen in Gelächter aus.
»Komm schon, mein Bruder«, bat Derrick und wischte sich eine Lachträne aus den Augenwinkeln, »lass deine Laune nicht an ihr aus.«
Ich atmete tief durch ... und ließ sie los.
Die junge Frau stolperte von mir weg und wirbelte dann irritiert erneut zu unserem Tisch herum. Ich und Derrick stützten uns auf die Tischplatte und sahen gelassen zu ihr hinauf.
»Dann hätte ich gerne zwei volle Krüge Met und für mich und meine Männer das Beste, was Eure Küche zu bieten hat, meine Schöne.«
Sie wusste einen Moment nicht, ob sie mich hassen oder mich anhimmeln sollte, als ich ihr mein charmantes Lächeln schenkte.
Doch sie besann sich wieder und räusperte sich. »Wo ist mein Bruder?«, fragte sie und blickte zur Tür, durch die Egid mit dem Küchenjungen verschwunden war.
Derrick und ich tauschten Blicke aus, wir schmunzelten.
Ich wandte mich mit einem Schulterzucken wieder an die junge Frau. »Er geht gerade auf einen wilden Ritt, nehme ich an.«
Derrick schnaubte amüsiert.
Die junge Frau wusste nicht, ob sie bleiben oder nach ihrem Bruder sehen wollte.
»Bitte, geh nur, Teuerste«, forderte ich sie auf. »So wie ich unseren Egid kenne, wird es ihn nach einer Nachspeise verlangen, wenn er fertig ist.«
Meine Männer grölten vor Lachen.
Derrick mischte sich ein: »Oder Ihr geht und holt unsere Bestellung.« Er klang eindringlich ... führsorglich. Dieser gefühlsduselige Narr!
Sie schluckte schwer, während sie nachdachte.
»Kommt schon, so schwer kann das doch nicht sein!« Ich stand auf und legte ihr einen Arm um die Schulter. Plaudernd lenkte ich sie zu meinen Männern. »Entweder du versorgst mich und meine ehrenwerten Brüder mit Speis und Trank, oder«, ich legte meine Lippen an ihr Ohr und senkte die Stimme zu einem verheißungsvollen Flüstern, »wir vernaschen dich.«
Derrick lachte dunkel an unserem Tisch, doch er klang ebenso nervös wie die junge Frau aussah, denn er wusste, dass ich nicht scherzte.
Erneut schluckte die junge Frau, während ihr Blick über meine Männer schweifte. Lazlo juckte es schon in der Hose, ich konnte sehen, wie er sich mit zur Hilfenahme seiner Hand platz im Schritt verschaffte. Manolo der Berg leckte sich gierig über die Lippen. Corin aus Cord – oder wie ich ihn gerne nannte: Corin ›kann nichts‹ aus Cord – öffnete bereits seine Hose.
Die junge Frau wandte sich aus meinen Griff und eilte zur Küche.
Meine Männer schienen enttäuscht.
»Und sie wahrt nie wieder gesehen«, sagte Derrick laut.
Ich lachte. Lachte brüllend. Viel zu laut. Ein irres Lachen. Meine Männer sahen mich irritiert über diese Stimmungsschwankung an, zumal Derricks Kommentar nicht halb so witzig gewesen war, wie mein Lachen vermuten ließ.
Ich verstummte jedoch, als plötzlich der Wirt mit einem gezogenen Schwert hinter mir stand.
»Der Teufel soll Euch holen!«, schrie er und schlug mit der Klinge nach mir.
Derrick sprang auf, er zog die Armbrust von seinem Rücken. Aber sein Eingreifen war nicht nötig. Der alte Mann hatte das Schwert nicht hart genug schwingen können, sodass ich die Klinge mit Leichtigkeit mit der Hand abfangen konnte.
Verblüfft darüber, dass ich mir ohne ein Zucken meiner Wimpern eine Schnittwunde hatte zufügen lassen, nur um das Schwert abzufangen, starrte der Alte mich an.
Ich presste die Hand zu, Blut quoll hervor. Mein Blut. Ich liebte die Wärme der dunkelroten Flüssigkeit, die meinen Arm hinab rann und von meinem Ellbogen tropfte.
Der alte Mann mit dem ergrauten Haar starrte mich entsetzt an.
Ich grinste ihm ohne Freude in seine fassungslose Miene und behauptete: »Ich bin der Teufel!«
Ich zog einen Dolch und wollte ihn abstechen.
»Mel!«
Derricks Stimme, die meinen Spitznamen aussprach, den ich so lange nicht mehr vernommen hatte, ließ mich sofort innehalten.
Mel ... Mel ... Meine Brüder hatten mich so genannt. Mein kleiner Bruder Melvin hatte mir den Namen verpasst, es war sein erstes Wort gewesen, weil er meinen vollen Namen damals nicht hatte aussprechen können.
Ich sah Derrick an, noch immer die Klinge des alten Mannes in der Faust haltend. Meine Augen waren wild, meine Nasenlöcher bebten. Ich war Blind vor Zorn.
Derrick senkte seine Armbrust. »Er ist nur ein alter Mann. Ein unwissender alter Mann.«
Ich atmete tief durch. Einmal. Zweimal. Und ein drittes Mal. Schließlich blickte ich dem alten Mann ruhig in die Augen. Ich steckte den Dolch wieder weg und nahm ihm das Schwert vorsichtig aus der Hand.
»Geht, alter Mann«, befahl ich ihm. »Nehmt Eure Kinder und Eure Frau, versteckt Euch, bis wir weg sind.«
Ich gab das Schwert an Kostja weiter, der damit davoneilte, bevor es ihn jemand streitig machen konnte. Ein gutes Schwert war kostbarer als Edelsteine, wenn man auf der Straße lebte.
»Der König wird Euch hinrichten«, zischte mir der alte Mann entgegen. »Er wird Euch jagen und Gerechtigkeit über Euch walten lassen.«
Kalter Hass durchströmte meine Venen, meine Augen wurden dunkel. Der Alte wich bei meinem Anblick erschrocken zurück.
»Abwarten«, presste ich hervor und musste mich erneut zurückhalten, keinen Unschuldigen ohne triftigen Grund niederzumetzeln. Das hätte gegen meinen eigenen Kodex verstoßen.
Ich musste mich selbst aufhalten, bevor ich dem Blutrausch verfiel.
»Ja, warten wir ab«, sagte ich entschlossener und grinste. »Euer König ist alt. Ein paare Jahre werde ich ihm noch entkommen können. Und wenn er dann endlich tot ist, ist niemand da, der den Thron besteigt. Wer fügt mir dann meine gerechte Strafe zu?«
»Der Thronerbe«, schleuderte er mir entgegen.
Meine Mundwinkel fielen herab. »Was sagt Ihr da?«
»Wisst Ihr es nicht?«, fragte mich der alte Mann.
Benommen schüttelte ich den Kopf. Laut Gerüchten waren alle rechtmäßigen Erben tot. Seit verfluchten zehn Jahren schon! Keiner kannte die Wahrheit, vor allem nicht dieser Fremde.
»Königin Pearl schenkte König Amon einen gesunden Sohn«, berichtete der alte Mann und triumphierte über meine entsetzten Gesichtszüge. »Vor zwei Jahren schon.«
Meine Hand umklammerte den Griff meines Schwerts. Meines Familienschwerts mit dem ich gewachsen war. Zusammengewachsen war. Es war ein Teil von mir, wie einer meiner Arme. Es gehörte einfach zu mir. Meine Hand packte so fest zu, dass sie zitterte.
»Das kann nicht sein«, hörte ich Derrick fassungslos flüstern.
»Zwei Jahre«, hauchte ich und wurde bleich. »Zwei Jahre ist der Erbe schon alt?«
Der alte Mann nickte.
Meine Augen versprühten Hass, als ich ihn ansah. »Und Ihr seid ein treuer Anhänger des Königs? Des Verräterkönigs?«
Die Augen des Alten zuckten ruhelos umher, als sich hinter mir meine Brüder erhoben. Ich konnte das Leder ihrer Rüstungen knirschen hören und das Erklingen der gezogenen Schwerter und Dolche.
Ich sah Wissen in den Augen des alten Mannes. »Ihr seid ein Rebell!«
Doch ich schüttelte den Kopf. »Nein, alter Mann. Ich bin die Gerechtigkeit!«
Ich zog mein Schwert und hob es weit über meinen Kopf. Der alte Mann duckte sich und hob abwehrend seine Arme.
»Nein!«, hörte ich Derrick rufen, und im nächsten Moment kreuzte seine Klinge die meine, noch bevor ich den Alten niederstrecken konnte.
Hasserfüllt starrte ich Derrick an, ich hatte große Lust, ihm die Schwertklinge in den Leib zurammen.