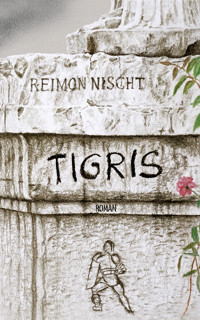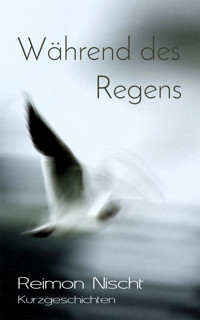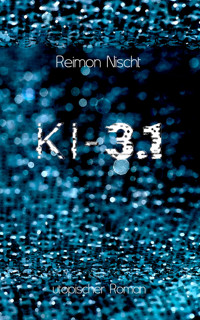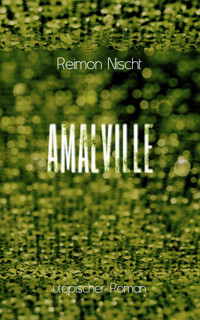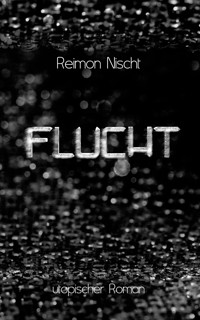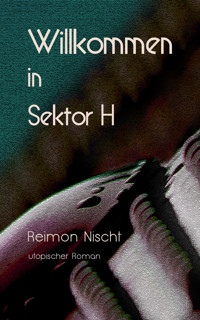2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vincent und Elodie leben in ihrer Ehe mehr neben- als miteinander. Auf einer Party entfernt sich Vincent vom Trubel und folgt einer musikalischen Fährte, die ihn in ein abgedunkeltes Zimmer führt. Ingmar stößt auf einer Wandertour durch die Wildnis auf unerwartete Hindernisse. Niklas bereut, daß er im verschneiten Norden ungebeten eine einsam gelegene Hütte betreten hat. Hanna träumt immer wieder von ihrem verstorbenen Mann, doch als sie eines Nachts abrupt aufwacht, ist sie nicht mehr allein in ihrem Zimmer. Rolf, der nach langer Zeit wieder einmal mit der Bahn fährt, wird von einer bemerkenswerten Neuerung überrascht. Dieser Band vereint 26 skurrile und kurzweilige Geschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Reimon Nischt
Das Zimmer
Skurrile Kurzgeschichten
Herausgegeben von:
www.bilderarche.de
© 2016, 2024 Reimon Nischt, Morierstr. 35a, 23617 Stockelsdorf
Inhalt
Besuch
Frau im Zug
Bekannte
Sackgasse
Naturfreund
Tradition
Ein Team
Pure Magie
Das Zimmer
Blaue Flecken
Jahrestag
Richard
Laufpartner
Mein Freund
Neues Zeitalter
Schwarz und glatt
Herbert
Der Grübler
Elch
Bahnfahrt
Entspannen
Wand
Der Gast
Quecksilber
Das Mädchen
Begegnung
Besuch
Hanna hört noch den Nachhall des Schreies, mit dem sie sich aus ihrem Traum befreit. Ruckartig setzt sie sich auf und stiert mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit. Seit ihr Mann Richard verstorben ist, geistert er durch ihre Träume. Zu Anfang hat sie gedacht, dies sei nicht weiter erwähnenswert, doch inzwischen ist sie sich nicht mehr so sicher. Der Traum heute ist intensiver gewesen als alle anderen zuvor. Erst meinte Hanna, Richards scheue Berührungen zu spüren. Dann fühlte sie ihre Körper zärtlich miteinander verschmelzen und zuletzt, als der Tod sie unwiderruflich auseinanderriss, fiel sie ins Bodenlose. Sie verlor ihn für immer.
Ihr verschwitztes Nachthemd klebt wie ein vom Regen durchnässtes Kleid an ihr.
„Mein Gott, ich muss mir was Trockenes anziehen“, murmelt sie vor sich hin.
„Führst du neuerdings Selbstgespräche, Hanna?“
Eine ruhige Männerstimme stellt ihr diese Frage. Für einen winzigen Moment setzt Hannas Herzschlag aus. Lieber hätte sie einen befreienden Schrei ausgestoßen, als zu erstarren.
„Wer ist da?“, fragt sie in einem Flüsterton, der nicht bis in die Ecke dringt, aus der die Stimme zu kommen scheint. Hannas Blick vermag das tiefe Schwarz des Raumes nicht zu durchdringen. Sie weiß nur, dass dort in der Ecke ihre Frisierkommode steht. Ist diese Nacht nicht dunkler als all die anderen zuvor?
Sie glaubt, eine Bewegung vor dem Spiegel zu erkennen, möchte sich ganz klein machen und verkriechen. Diese Angewohnheit aus längst vergangenen Kindertagen ist stärker als ihre Vernunft.
„Richard, bist du das?!“, ruft sie laut in den Raum, um sich Mut zu machen.
„Wen würdest du denn sonst in unserem Schlafzimmer erwarten?“
Die Antwort kommt prompt. Es ist die Stimme ihres Mannes und auch wieder nicht. Sie hört sich jünger an, doch der ironische Tonfall ist ihr geblieben.
„Ja, du bist es wirklich!“
Hanna hofft, ruhig zu klingen, nur ihre Hand, die tastend nach dem Lichtschalter der Nachttischlampe sucht, zittert. Ihr Blick ist immer noch auf den Unsichtbaren in der Ecke gerichtet. Endlich findet sie den Schalter.
Plötzlich zögert sie, ihn zu betätigen. Ist es die Angst vor der Gewissheit? Bevor sie sich weiter befragen kann, geht das Licht ohne ihr zutun an. Die Lampe beleuchtet die Stelle auf ihrer Bettdecke, wo sonst das Buch liegt, das sie vor dem Einschlafen liest. Ein Rest diffuser Helligkeit dringt bis zur Kommode in der Ecke vor. Das Licht erschafft eine neue Realität. Hanna fühlt sich verletzlich und senkt sofort den Blick. Ihre Augen klammern sich an das Weiß der Bettdecke, als suchten sie dort nach einem Hinweis, der sie aus dieser Situation befreien könnte. Doch wenn der Verstand einem Streiche spielt, ist alles vergebens.
Mit einer Forschheit, die ihrem Wesen nicht entspricht, langt Hanna zu ihrer Schlaflektüre auf dem Nachttisch.
„Du willst lesen, wo ich mir heute Nacht extra freigenommen habe?“
Das Buch fällt Hanna aus der Hand und flattert zu Boden. In die Enge getrieben, nimmt sie allen Mut zusammen und sieht ihren Mann an.
„Richard“, flüstert sie und dann wieder: „Nein, du bist so jung.“
Tonlos verlieren sich Hannas Worte im Raum. Ihre alten Augen haben schon einiges gesehen. Sie hat sich immer auf sie verlassen können. Bis jetzt.
Vor dem Spiegel ihrer Frisierkommode lehnt ein Foto, dessen vergilbte Ränder weit zurück in die Vergangenheit weisen. Das Bild zeigt die dreiundzwanzigjährige Hanna mit ihrem um vier Jahre älteren Richard als frisch vermähltes Paar. Ein halbes Jahrhundert liegt zwischen dem Tag ihrer Hochzeit und der Gegenwart. Doch der Mann auf dem Foto und der im Zimmer gleichen sich wie Zwillinge.
Hanna atmet tief durch und legt alle Unerschrockenheit, derer sie fähig ist, in ihre Stimme: „Was willst du von mir? Weshalb bist du hier, R...?“
Als Hanna den Namen ihres Mannes aussprechen will, ist ihre Zunge wie gelähmt, und sie verstummt. Schweigen füllt den Raum, da ihr Richard die Antwort schuldig bleibt. Stattdessen bewegt er sich langsam auf sie zu. Hanna drückt sich an das Kopfende des Bettes, bis das Holz knarrt. Wenn sie gekonnt hätte, wäre sie durch die Wand verschwunden.
„Du bist tot, Richard!“
Es klingt wie eine Beschwörung. Sie ist selbst erstaunt, als ihr Mann daraufhin stehen bleibt. Richard zögert einen Moment, bevor er den Abstand überwindet, der sie noch voneinander trennt. Aus seinem Blick ist jeglicher Spott verschwunden, den sie zuvor in seiner Stimme vernommen zu haben glaubte.
„Sieh mich nicht so an. Ich bin eine alte Frau. Geh wieder dahin zurück, woher du gekommen bist. Lass mich allein. Bitte.“
Hanna ist selbst über die Monotonie ihrer Worte erstaunt. Der Tote hat da mehr Leben in sich: „Das kann ich nicht! Nicht nach diesem Traum heute Nacht. Und du weißt das auch.“
„Wieso kennst du meinen Traum?“
„Die Antwort liegt in dir.“
„Nein, ich habe keine Ahnung, wovon du redest.“
„Das hast du schon früher gesagt und ich habe es immer bezweifelt.“
„Ich will doch nur wissen, was mir geschieht.“
„Widerborstig wie eh und je. Lass es einfach geschehen.“
Hanna erstarrt, als Richard sich über sie beugt. Maßlose Angst zerreißt sie. Ihre physische Erscheinung verharrt als leere Hülle unbeweglich im Bett und das, was ihr Wesen ausmacht, erhebt sich in den Raum. Aus dieser schwebenden Position heraus, beobachtet sie mit einer gewissen Neugierde, wie Richard seine Lippen auf ihre legt. Bei der Berührung empfindet sie nichts. Sie hatte mit allem gerechnet, nur damit nicht.
Hanna verschläft den halben Vormittag. Gewöhnlich steht sie mit den Hühnern auf. Doch heute sehen ihre ungläubigen Augen, dass es beinahe 10 Uhr ist. Sie will schon aufspringen, um die verschlafene Zeit wieder aufzuholen. Doch dann hält sie inne. Niemand erwartet sie. Wozu die Eile. Sie kann ihren Tagesablauf planen, wie es ihr beliebt. Entspannt sinkt sie ins Kissen zurück.
Hoch mit dir, Langschläfer!, spornt Hanna sich an, als sie gegen Mittag Hunger verspürt. Beim Aufstehen stolpert sie über ihr Buch und stößt es spontan unters Bett. Schon mit der Hand auf dem Türgriff blickt sie sich um, als hätte sie etwas vergessen und zuckt nur die Schultern, als es ihr nicht einfällt.
In der Küche angekommen, macht sie sich einen Kaffee und schlägt drei Eier in die Pfanne. Nur mit dem Nachthemd bekleidet, setzt sie sich an den Tisch und isst. Ihr Kopf fühlt sich leicht und frei an.
Frau im Zug
Alles ist Zufall. Dabei könnte ich es belassen. Doch ist es selten so simpel. Auf die Verkettung der Ereignisse kommt es an.
Holger würde mir da sicher zustimmen. Der ahnungslose Holger, der meinte, mich heute zum ersten Mal getroffen zu haben, ohne zu wissen, dass ich ihn schon einige Zeit im Visier habe. Als Familienvater mit trautem Heim passte er bestens in meine Zielgruppe.
Wie immer nahm Holger für seinen Weg zur Arbeit und zurück die Bahn. Dies gehörte zu seinem Alltag wie die Butter aufs Brot. Heute legte ich ihm, bildlich gesprochen, noch eine Chilischote hinzu. Vier Stationen vor seinem Ziel gab ich Holger davon zu probieren. Er folgte mir bereitwillig in meine Welt, in der ich allein agiere.
Als ich Holger wieder in seine Welt entließ, fehlten ihm die Worte, das Erlebte zu beschreiben. Stotternd suchte er nach klärenden Begriffen. Doch egal, was er sagte, es kam der Wahrheit nie näher als die Erde der Sonne. Irgendwann hörte ich nicht mehr hin, obwohl mein Interesse einzig seinem Erlebnis galt. Ich musste seine Sicht der Dinge erfahren. Doch Holger war noch viel zu durcheinander, um einen klaren Gedanken zu erfassen. Ich musste etwas Geduld aufbringen.
Obwohl er noch etwas schwach auf den Beinen war, schleppte ich Holger zu einem kleinen Bistro in der Nähe des Bahnhofs. Ich sah ihm an, dass er dringend etwas Starkes brauchte und bestellte für jeden einen doppelten Whisky. Das Lokal war allerdings so gut besucht, dass wir eine Weile auf unsere Getränke warten mussten. Als uns dann die bernsteinfarbene Flüssigkeit gebracht wurde, hatte Holger sein Glas schon ausgetrunken und das nächste bestellt, bevor ich meines überhaupt berühren konnte. Ich nahm die Zeitspanne, die zwischen dem Reichen des Drinks und dem Leeren des Glases lag, als Indiz für seinen labilen Gemütszustand. Holger hatte an dem Vorgefallenen noch mächtig zu beißen.
Nach dem zweiten Whisky war er aber bereit, mir alles zu erzählen, und ich folgte seinen Ausführungen aufmerksam. Das musste ich auch, denn er schien die Fähigkeit verloren zu haben, einen verständlichen Satz zu bilden. Daher griff ich ordnend ein und gab seinem Gestammel eine sprachliche Struktur.
„Ich saß allein in einem Abteil und versuchte, mich auf den Inhalt eines Artikels in der Geo zu konzentrieren. Vergeblich! Ich las bestimmt zehnmal ein und denselben Satz, ehe ich mir dessen bewusst wurde. Auch kein Beinbruch, sagte ich mir und hörte über mein Handy Musik.
Das Quietschen der Bremsen weckte mich. Ich setzte mich aufrecht hin und schaute zum Fenster hinaus. Bahnhöfe sind Orte mit festen Ritualen. Kaum sind die Leute angekommen, wollen sie so schnell wie möglich wieder fort. Und ich würde vier Stationen weiter ebenfalls zu ihnen gehören. Erneut lauschte ich meiner Musik.“
Die Bedienung kam wieder an unseren Tisch und wechselte die Gläser aus. Holger nahm ohne Hast einen kräftigen Schluck und berichtete weiter: „Auf dem Nebengleis fuhr ein Zug ein. Seine Waggons verstellten mir die Aussicht auf die Bahnhofstristesse. Bevor sich mein Geist wieder nach innen kehrte, sah ich im Waggon vis-a-vis eine Frau sitzen. Sie war, wie ich, allein in ihrem Abteil. Den Kopf leicht nach vorne geneigt, bot sie mir ihr Profil dar. Die Unbekannte las. Sie schien an ihrer Lektüre mehr Gefallen zu finden, als ich an meiner.“
Hier machte Holger eine Pause, nahm sein Glas in die Linke und drückte es an seine Stirn. Musste er nach den richtigen Worten suchen, oder war es nur eine Kunstpause, um sich wichtigzumachen?
„Ich bin für weibliche Schönheit empfänglich und konnte meine Augen bald nicht mehr von ihr abwenden. Warum fuhr dieses engelhafte Wesen mit der Bahn? Selbst der rüpelhafteste Taxifahrer würde sie, ohne einen Cent zu verlangen, überall hinbringen.
Ich wollte ihr nur in die Augen schauen. Doch den Gefallen tat sie mir nicht. Sie las immer noch in diesem blöden Buch. Mein Wunsch, ihre Augen zu sehen, steigerte sich ins Zwanghafte. Ich starrte wie gebannt zu ihr hinüber und hoffte, dass mein Blick die Kraft hatte, sie von dem Buch aufschauen zu lassen. Ich war überzeugt, hypnotische Kräfte zu besitzen. Schweißtropfen bildeten sich auf meiner Stirn. Glauben Sie mir, so etwas ist mir noch nie zuvor in meinem Leben passiert.“
Es fiel mir leicht, zustimmend zu nicken. Ich glaubte ihm.
„Einen nüchternen Moment lang erkannte ich mein irrationales Verhalten. Das war auch der Augenblick, in dem ich Musik hörte, die nicht aus meinem Handy kam. Musik, die mein ganzes Abteil zu füllen schien. Musik, die mir das Gefühl gab, dieser Unbekannten ganz nah zu sein.“
Holger schien mir ein ehrlicher Berichterstatter zu sein. Eine leichte Röte hatte sein Gesicht überzogen.
„Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke. Doch besser kann ich es nicht sagen. Plötzlich veränderte sich alles. Die Unbekannte sah mir direkt in die Augen. Es erging mir wie dem Kaninchen, das der hypnotischen Macht des Schlangenblickes erliegt. Anfangs begehrte ich dagegen auf, doch verließ mich meine Kraft wie heiße Luft einen undichten Ballon. Ich fühlte Sehnsucht und Trauer. Sehnsucht, weil ein süßes Ziehen mich zu ihr trieb und Trauer, weil ich, wenn ich nicht zu ihr gelangen konnte, sterben musste.
Das hört sich bestimmt unerträglich romantisch an, doch vorhin war es das einzig Gültige. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, doch meine Familie existierte nicht mehr für mich. Ich war dieser Unbekannten wie im Fieberwahn verfallen. Verzweiflung stieg in mir auf wie Nebel an einem frühen Herbstmorgen. Bevor ich ihr ganz erlag, sprang ich vom Sitz hoch, hechtete aus dem Abteil und stürzte mich auf den Bahnsteig. Die Treppe zur Überführung sprintete ich nach oben und war Sekunden später an der, die hinunter führte. Ein mächtiges Glücksgefühl breitete sich in mir aus. Doch beim Hinuntereilen wurde ich von Reisenden in normalem Tempo überholt. Tatsächlich bewegte ich mich in Zeitlupe. Ich ruderte durch Luft, die zum Schneiden dick war. Entkräftet kam ich unten auf dem Bahnsteig an. Mehr tot als lebendig schleppte ich mich zu ihrem Waggon.
Sie stand am Fenster und sah auf mich herab. Bewegungsunfähig starrte ich zurück. Ihre Lippen formten Worte, die ich nicht verstand. Plötzlich war es, als würde ihr Abbild aus meinem Gesichtsfeld gezogen. Das traf mich wie ein Fausthieb in den Magen. Nach Luft schnappend, wurde mir schließlich klar, dass ihr Zug losgefahren war. Ich hatte nicht nur das Signal des Schaffners überhört, sondern auch alle anderen Geräusche ausgeblendet.
Der Zug war weg und mit ihm die Unbekannte. Blind für meine Umgebung blieb ich verloren auf dem Bahnsteig zurück.“
Er schüttelte den Kopf und schaute mich an: „Kennen Sie den Film Ein Mann, den sie Pferd nannten?“
Wieder nickte ich ihm zu, denn ich ahnte, worauf er hinaus wollte. Die meisten meiner Probanden illustrierten ihre Situation mangels geeigneter Worte durch Filmszenen. Daher hatte ich mir im Laufe der Zeit eine umfassende Filmsammlung zugelegt. Der von ihm Genannte befand sich auch darunter.
„Ich meine den Initiationsritus, bei dem sich der Hauptdarsteller einer Mutprobe unterziehen muss. Ihm werden oberhalb der Brustwarzen Knochensplitter unter die Haut getrieben. Doch die Knochen dienen nur zur Befestigung von Seilen, an denen er schließlich in die Höhe gezogen wird. Das bloße Ansehen dieser Szene ist für mich schon qualvoll genug. Heute habe ich erfahren, welche Schmerzen es wirklich bereitet. Zwei Meter über dem Bahnsteig hängend zerrte das Gewicht meines Körpers an den Hautschlaufen über der Brust. Ich war ein Wesen aus Schmerz. Kurz vor dem Zerreißen der Haut verlor ich das Bewusstsein. Den Rest kennen Sie besser als ich.“
„Stimmt! Sie sind mir förmlich in die Arme gefallen“, sagte ich und verschwieg Holger das Wesentliche. Die Wahrheit würde ihn nur noch mehr verstören. Seine Geschichte war erzählt und ich hatte die Whiskys bezahlt.
„Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ich fühle mich schon besser.“
Das mochte so sein oder der Alkohol tat seine Wirkung. Da Holger den nächsten Zug erreichen musste, machte er sich bald auf den Weg. Draußen auf der Straße sah er sich zu mir um und winkte zum Abschied. Doch er winkte nur einem verlassenen Platz zu. Aus Erfahrung wusste ich, dass es für mich besser war, zu verschwinden. Es dauerte nur geraume Zeit, bis sie in mir die Frau im Zug wiedererkannten. In Wirklichkeit bin ich nicht so schön wie in ihrer Phantasie.
Erneut werde ich Schicksal spielen. Erneut habe ich mir einen Holger ausgesucht. Das liegt einfach daran, dass ich alle Männer, denen ich auf diese Art begegne, Holger nenne.
Das ist eine Marotte von mir. Und noch ein wenig mehr. Es geht auf ein denkwürdiges Ereignis aus meiner Schulzeit zurück. Im Chemieunterricht fiel einer meiner Mitschüler in Ohnmacht, weil er die Frage des Lehrers nicht beantworten konnte. Das war Holger. Alle Anwesenden waren entsetzt. Nur ich nicht. Mir kribbelte die Haut und die Härchen an meinen Armen richteten sich auf. Plötzlich konnte ich ohne Brille scharf sehen.
Seither weiß ich, dass mich Verzweiflung und seelische Qual anderer nährt. Der Wendepunkt in meinem Leben! Wollte ich nicht auf den Zufall angewiesen sein, musste ich lernen, dieses Phänomen selber herbeizuführen. Es kostete mich Jahre, herauszufinden, auf welche Art ich meine Opfer manipulieren konnte. Doch die Anstrengung hat sich gelohnt. Worte können das Hochgefühl, das mich erfüllt, nicht beschreiben. Es gleicht dem vergeblichen Versuch, Blinden die Farben näher zu bringen.
Meine Vorgehensweise ist immer die gleiche. Wie die Finger eines Taschendiebes in anderer Leute Taschen gleiten, schleichen sich meine Gedanken in ihre Köpfe. Während ich die Auserwählten einem Wechselbad der Gefühle aussetze, entziehe ich ihnen Lebensenergie. Diese Behandlung bringt sie nicht um, sondern macht sie nur schlanker. Das Erstaunliche daran ist die Erkenntnis, dass es mit Musik leichter geht. Sie ist zu meinem ständigen Begleiter geworden. Mit ihr experimentiere ich. Letzten Monat standen mir die schönsten Arien von Georg Friedrich Händel hilfreich zur Seite. Jetzt habe ich beschlossen, es einmal mit den Cello-Sonaten von Johann Sebastian Bach zu versuchen. Hoffentlich weiß Holger meine Bemühungen zu schätzen.
Bekannte
„Mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut.“
Das ist das Erste, was mir sofort einfällt, wenn ich an Mareike denke. Auch nachdem ich jetzt schon eine Weile nichts mehr von ihr gehört habe, bleibt diese Erkennungsmelodie in meiner Erinnerung haften.
Recht wenig, möchte ich meinen, wenn ich bedenke, Mareike einmal zu meinem Bekanntenkreis gezählt zu haben. Vergessen habe ich die Umstände, unter denen wir uns kennenlernten. Wahrscheinlich war sie die Freundin einer Freundin oder wie das halt so geht: Man wird einander vorgestellt, vergisst den Namen sofort und doch prägt sich etwas Charakteristisches ein, das hilft, die betreffende Person später wiederzuerkennen.
Wir sind uns danach immer wieder auf dem Wochenmarkt über den Weg gelaufen, haben uns kurz gegrüßt und unterhalten. Auf mein Hallo, wie gehts?, folgte stets die gleiche Antwort: „Mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut.“
Die Worte, schnell und ohne jegliche Betonung heruntergerasselt, erinnerten mich an Gedichtvorträge aus meiner Schulzeit, für die ich keine guten Noten bekommen hatte.
Anfangs nervte mich dieses Getue, doch schon bald erwartete ich es von ihr. Unsere Unterhaltungen hingegen sind Schall und Rauch. Redeten wir über weltbewegende Dinge? Unterzogen wir die spätkapitalistischen Auswüchse der postmodernen Gesellschaft einer kritischen Analyse? Ich weiß es nicht mehr. Nur ihre Begrüßungsfloskel hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie war für mich Mareikes Markenzeichen.
Niemals wäre ich auf den Gedanken gekommen, dass es sich dabei um einen Hilferuf handeln könnte. Nachdem wir uns einige Zeit nicht mehr über den Weg gelaufen waren, habe ich über Dritte erfahren, dass sie freiwillig aus dem Leben gehen wollte. Mareikes Abschiedsbrief klang optimistisch. Er war kürzer als meine Erinnerung an sie. Er lautete: „Jetzt geht es mir gut!“
Mehr stand nicht drin. Vielleicht hätte der Mann vom Notdienst zuerst diesen Brief lesen sollen, bevor er Mareike wiederbelebte. Ob sie ihn dafür hasst? Ich werde sie fragen, sollten wir uns demnächst begegnen. Nur was mache ich, wenn Mareike auf meine Begrüßung schnell und verstohlen antwortet: „Mir geht es gut, mir geht es gut, mir geht es gut.“
Sackgasse
Säße Niklas jetzt in einem Flugzeug und würde sich die norwegische Bergwelt von oben ansehen, fiele ihm bestimmt das kleine rote Auto auf, das in der Weite der verschneiten Landschaft verloren zu sein schien.
Leider war er der Fahrer des roten Autos und stand mit selbigem vor einer übermannshohen Schneewand. Er hätte auch am Ende der Welt angekommen sein können, es machte keinen großen Unterschied.
Nachdem Niklas in diese Straße eingebogen war, hatte er den Schlagbaum, der sie nach der ersten Biegung halbseitig sperrte, einfach umfahren. Im Nachhinein eine blöde Idee.
Jetzt war er mit seinem Latein am Ende. Ihm gelang es nicht einmal, das Auto zu wenden, geschweige denn, den Weg wieder zurückzufahren. Die Räder drehten durch, und der Wagen schlitterte unkontrolliert über die Straße, bis er mit der Beifahrerseite gegen den vorderen Schneewall prallte und zum Stehen kam. Prima geparkt, sagte sich Niklas, stieg aus und wühlte sich durch den Schnee nach oben.
Er betrat eine Märchenkulisse. Unberührte Landschaft, so weit das Auge reichte und im Hintergrund die höchsten Berge Norwegens. Er sah sich um. Der ganze Aufwand nur, um ihn zu entzücken.
Doch halt! Was war denn das? Ein Schornstein! Dann bemerkte Niklas auch das dazugehörige Haus, das an dem gerade noch aus dem alles verhüllendem Weiß herausragendem Dach zu erkennen war. Das Haus konnte nur unbewohnt sein. Nicht mehr lange, sagte er sich und brach zu einer Erkundung auf.
Obwohl sein Weg bergab führte, brauchte er für die Strecke endlos viel Zeit. Das Haus lag weiter entfernt, als es den Anschein gehabt hatte. Außerdem war die Art seiner Fortbewegung in dem tiefen Schnee, die mehr an Schwimmen als an Gehen erinnerte, nicht effizient.
Das Haus war von allen Seiten eingeschneit. Nur die Luke am Giebel schaute ihn einladend an, sodass er versuchte, sie mit Gewalt zu öffnen. Kurze Zeit später stellte Niklas sein unbeholfenes Tun ein. Mit bloßen Händen konnte er sich keinen Zutritt verschaffen.
Heute war Sonnabend und erst am Montag würden sich die Schneeräumfahrzeuge wieder sehen lassen. Das bedeutete, zwei Tage und Nächte im Schnee zu verbringen. Niklas war nicht unvorbereitet in den Norden gefahren. Er hatte alles Nötige dabei: Schlafsack, Isomatte, Kocher und Lebensmittel. Beinahe gehörte ihm auch eine Unterkunft. So kurz vor dem Ziel wollte er nicht aufgeben und kämpfte sich daher zu seinem Wagen zurück. Im Kofferraum fand er das richtige Werkzeug.
Mit einem Beil in der Hand stand Niklas eine Stunde später wieder vor der Luke. Diesmal hatte sie ihm nichts entgegenzusetzen und er konnte den Dachboden betreten. Durch die Öffnung drang genug Licht, um sich zu orientieren. Niklas stieg in einen kleinen Flur hinunter, von dem zwei Türen zu anderen Zimmern führten und eine nach draußen. Das kleine, vollkommen zugeschneite Fenster der Außentür sorgte für eine düstere Atmosphäre, die sich ähnlich einer partiellen Sonnenfinsternis auf sein Gemüt legte. Die Kälte im Haus ließ ihn frösteln.
Lag es an dem fahlen Licht oder an seinem verbotenen Tun, Tatsache war, er fühlte sich nicht allein. Vorsichtig öffnete Niklas eine der Zimmertüren. Im Raum herrschte die gleiche Dunkelheit wie im Flur und außer der Möblierung, die aus zwei Betten und einem Schrank bestand, war er leer.
„Natürlich ist hier niemand“, rief er laut hinein, um damit die Stille zu durchbrechen. Dann machte er kehrt und ergriff die Klinke der anderen Tür.
Beim Öffnen überkam ihn die Ahnung, einen Fehler zu begehen. Doch nichts in dem Raum wirkte bedrohlich, und um so weniger vermochte er sich sein ungutes Gefühl zu erklären.
Der Raum, als Wohnküche eingerichtet, verband auf schlichte Weise Funktion mit Gemütlichkeit. Eine Couch vor dem größeren der beiden Fenster und ein Tisch mit drei Stühlen vor dem kleineren gaben ihr Bestes, von seinem Besuch nicht überrascht zu sein. Auch die Bücher in den Regalen und die Fotos an den Wänden übten sich in Gleichgültigkeit.
Niklas ging zu den Büchern hinüber. Er sah Bildbände über die Jagd und einige Romane, deren Autoren ihm nichts sagten. Er überging sie mit Geringschätzung und betrachtete anschließend die Fotos. Es handelte sich um alte Familienbilder, die bei der geringen Helligkeit keine Details preisgaben. Er wandte sich ab.
Huschte da eben ein Schatten am Fenster vorbei? Niklas wirbelte herum. Nichts! Durch die schnelle Drehung verlor er das Gleichgewicht. Er ging zu Boden, riss einen Stuhl um und schlug mit dem Kopf hart gegen den Tisch. Mochte der Schatten Einbildung gewesen sein, der Schmerz war es jedenfalls nicht. Ihm schwanden die Sinne.
Niklas schlug die Augen auf und erschrak: Auf der Couch saß ein alter Mann.
In dem Bewusstsein, ein Eindringling zu sein, stotterte er eine Entschuldigung. Doch der Alte nahm keine Notiz von ihm. Niklas trat näher und sah, dass der Mann tot war. Auch gut, sagte er sich. Die Kälte im Raum hatte den Körper konserviert. Bewegung würde erst mit dem Einzug des Sommers in ihn kommen. So lange mochte ihm Niklas keine Gesellschaft leisten.
„Auf Wiedersehen, mein Freund“, rief er in den Raum hinein.
Bevor er auf dem Absatz kehrtmachte, hatte der Tote sein Aussehen geändert. Nach einer Schrecksekunde stand Niklas seinem Ebenbild gegenüber. Er sah zu, wie dieses Abbild zu altern begann. Trotz des Empfindens einer heraufziehenden Gefahr konnte Niklas sich dem Betrachten seiner eigenen Metamorphose nicht entziehen. Doch als er merkte, dass sein alterndes Ich dem Aussehen des Toten immer ähnlicher wurde, stockte ihm der Atem.
Schreiend kam Niklas wieder zu sich. Sein Kopf schmerzte und beim Betasten der Beule erinnerte er sich an den Sturz. Das leichte Schwindelgefühl ignorierend rappelte er sich vom Boden auf und blickte sich erstaunt um. War das noch derselbe Raum wie zuvor? Eine Veränderung schien während seiner Ohnmacht eingetreten zu sein. Die Gleichgültigkeit der Gegenstände hatte sich gewandelt. Eine beinahe greifbare Spannung lag in der Luft, die ihm einen trockenen Mund bescherte. Er musste schlucken. Eine unerklärliche Furcht vor dem Raum beschlich ihn.
Niklas hastete aus dem Zimmer und stieg die Leiter empor, griff sich das auf dem Dachboden zurückgelassene Beil und atmete tief durch. Mit neu durchflutender Energie eilte er den Hang zu seinem Fahrzeug hinauf. Jetzt galt es, das Auto aus der Eisrinne zu befreien. Nur wie?
Das Beil in der Hand verhalf ihm zu einem Einfall, den er, oben angelangt, gleich ausprobieren wollte. Er stürzte über den Schneerand auf die Straße hinunter, hockte sich flugs hin und schlug mit dem Beil das Eis vom Asphalt.
Kaum begonnen, merkte er, dass unter der Vereisung Schmelzwasser floss, was ihm erlaubte, größere Stücke mit weniger Kraftaufwand als erwartet, zu entfernen. Das musste er bis zur Anhöhe, die etwa einen halben Kilometer entfernt war, durchhalten. Doch zuerst schaffte er Platz, um das Auto zu wenden. Er setzte vor und wieder zurück. Unzählige Male. Es war ein mühsames Spiel, doch letztlich erfolgreich.
Niklas sah den Hügel hinauf, bevor er sich wieder seiner Arbeit zuwandte. Er schimpfte mit sich, wenn die Eisschicht noch fest am Boden haftete, was häufig in schattigen Kurven der Fall war. Dann spritzten die gefrorenen Splitter wie explodierende Granaten auseinander und rissen, wie tausend Nadelstiche, blutige Schrammen in seine Hände.
Niklas legte die Straße zweispurig in Reifenbreite frei. Nach einer halben Stunde, in der er ein Drittel des Weges bewältigt hatte, meinte er, sich genug geschunden zu haben. Jetzt wollte er wissen, ob sein Plan auch wirklich funktionierte.
Niklas fuhr langsam an. Die Räder griffen auf dem Asphalt, und der Wagen beschleunigte wie erhofft. Mit Tempo fünfzig fuhr er über das eisfreie Stück hinaus und verlor augenblicklich die Bodenhaftung. Der Wagen brach aus, schlug wie ein Rammbock in die seitliche Böschung ein und wurde unter dem herabstürzenden Schnee begraben.
Obwohl Niklas den Aufprall vorhergesehen hatte, konnte er nichts dagegen unternehmen. Als der Wagen auf keine Schalt- und Steuerversuche reagierte, rief er resigniert: „Das wars.“ Sekunden später schlug er gegen das Lenkrad. Wieder umgab ihn diffuses Licht und einen Moment lang wähnte er sich in die Hütte zurückversetzt. Er schüttelte seine Benommenheit ab. Mit dem Einlegen des Rückwärtsganges übernahm er wieder die Initiative. Sein Versuch, sich auf diese Weise zu befreien, scheiterte. Die Räder drehten erneut durch. Niklas stöhnte auf, weil er wusste, was auf ihn zukam.
Zuerst befreite er das Auto vom Schnee und anschließend lotste er es mit seiner bewährten Methode auf die trockene Fahrbahn. Zu klug, um durch weitere Experimente die Gefahr des Scheiterns heraufzubeschwören, kämpfte er sich innerhalb der nächsten Stunde den Weg frei. Als er den Schlagbaum passierte, an dem er nicht hätte vorbeifahren sollen, nahm er die Straße ins Tal, die ihn direkt zu einem Campingplatz führen würde. Dort wollte er eine Hütte mieten und zur Ruhe kommen.
Ich saß windgeschützt vor der Rezeption. Die Sonnenstrahlen hüllten mich in wohlige Wärme, während ich auf den nächsten Gast wartete. Obwohl der Campingplatz am Ufer eines Sees lag, war hier vor Saisonbeginn nicht viel los. Nur ein Caravan stand einsam auf dem grünen Areal.
Ich sah das rote Auto schon von Weitem, wie es sich durch die Serpentinen hinunter schlängelte. Als ich es aus den Augen verlor, wusste ich, dass es spätestens in einer Viertelstunde hier auftauchen würde.
Der Wagen kam früher an. Der Fahrer wirkte gehetzt. Er wollte nur eine Nacht bleiben und war mit einer einfachen Hütte zufrieden. Ich gab ihm den Schlüssel und sah ihm nach, bis er in dem Häuschen verschwunden war. Ich wartete einige Minuten, bevor ich bei ihm klopfte. Er öffnete sofort und ich zeigte auf das Anmeldebuch. Er hieß mich eintreten.
„Tut mir leid, dass ich Sie störe. Sie müssen noch unterschreiben.“
„Ich hatte mich vorhin schon gewundert, als Sie mir den Schlüssel so ohne Weiteres gaben.“
„Das war nicht so ohne weiteres.“
Er sah mich verdutzt an. Seine Mimik verriet mir, dass sich mein Äußeres zu verändern begann. Einen Moment lang waren wir Doppelgänger. Dann begann er zu altern.
„Hören Sie auf damit! Ich mache alles, was Sie verlangen. Hören Sie nur auf. Bitte!“
„Vielleicht habe ich tatsächlich eine Verwendung für Sie. Ich betreue mehrere Campingplätze. Haben Sie Interesse, mein Stellvertreter zu werden?“
„Jaaah!“
Ich stoppte mein Vorgehen und spürte seine Erleichterung. Dann tat ich, was ich immer tat. Ich genoss die Wandlung, die sich auf seinem Gesicht abzeichnete, als er merkte, dass ich ihn betrog und blankes Entsetzen seine Züge entstellte. Langsam aber stetig zog ich alles Leben aus ihm heraus.
Naturfreund
Ingmar hat es aufgegeben, dem permanenten Regen zu trotzen und sein Zelt aufgeschlagen. Er liegt auf seinem Schlafsack und lauscht dem Geräusch der auf die Plane prasselnden Regentropfen. Nur unter einem Blechdach kann es noch lauter sein. Da sein Zelt orange ist, bleibt ihm wenigstens der Anblick des tristen, grauen Himmels erspart. Es sollte ein Wochenendtrip in die Berge werden, und nun hält ihn dieser Regen gefangen.
Das ist jetzt schon seine zweite Enttäuschung. Ingmar öffnet sein Portemonnaie und zieht das Foto heraus, auf dem Grete, seine Freundin, abgebildet ist. Gemeinsam hatten sie die Wanderung geplant, doch weil ihr beruflich etwas dazwischen kam, musste er alleine losziehen. Ohne Grete fühlt er sich einsam. Daran kann auch das orangefarbene Zelt nichts ändern.
Ingmar erhebt sich von seinem Lager und lugt durch den Eingang ins Freie hinaus. Der Regen hat nachgelassen und spielt seine eintönige Weise auf dem Zeltdach. Trotzdem rechnet er nicht mit Besuch.
Beim erneuten Hinausspähen bemerkt Ingmar eine Blaumeise in einem benachbarten Baum. Aus Mangel an Alternativen verfolgt er ihr Tun. Die Meise schaut sich flink in alle Richtungen um. Ein Insekt in ihrem Schnabel gibt noch Lebenszeichen von sich. Sieh da, ein Gast mit Geschenk. Tatsächlich fliegt die Meise auf ihn zu. Doch im letzten Moment dreht sie zur Steinmauer ab, neben der Ingmar sein Zelt aufgeschlagen hat, und schlüpft in einen Spalt. Kurz darauf verlässt sie die Öffnung wieder und fliegt in hohem Bogen davon. Bevor Ingmar sich in sein Zelt zurückziehen kann, ist schon die nächste Meise im Anflug. Sie setzt sich ebenfalls auf einen Ast des Baumes und hält ringsum Ausschau. Augenblicke später fliegt sie die gleiche Stelle in der Mauer an. Für Ingmar gibt es keinen Zweifel, dass sich dort der Eingang zu ihrem Nest befindet. Auch diese Meise begibt sich nach Fütterung der Jungen wieder auf die Jagd nach weiteren Leckereien. Ingmar ist zu Gast im Meisenalltag.
Niesel fällt sanft zur Erde und das Zwitschern der kleinen Meisen ist zu hören. Die Lautstärke schwillt an, wenn die Altvögel mit Futter im Nesteingang erscheinen.
Ingmar verlässt das Zelt. Er hat den Nieselregen als seinen ständigen Begleiter akzeptiert. Am See füllt er einen Behälter mit dem klaren Wasser und geht zurück. Unter dem kleinen Vordach seines Zeltes bereitet er anschließend Tee zu.
Der Regen ist so fein, dass er das Gefühl hat, von einem Zerstäuber benetzt zu werden. Ingmar sucht sich einen bequemen Platz im Freien, von dem aus er den regen Flugverkehr der Meisen beobachten kann. Ihm kommt die Erkenntnis, mit seinem Zelt nicht Gast, sondern Störenfried in ihrem Alltag zu sein.
Bei seiner dritten Tasse Tee wird Ingmar von bleierner Müdigkeit befallen. Er muss all seine Kraft aufbringen, den Gewichten, die an seinen Lidern zerren, Paroli zu bieten. Mühsam kriecht er ins Zelt und fällt wie betäubt auf seinen Schlafsack.
Ingmar erwacht und erkennt seine Umgebung nicht wieder. Anfangs ist er so benommen, dass er meint, zu träumen, doch als die Welt nach mehrmaligem Reiben der Augen noch immer nicht den gewohnten Anblick bietet, bekommt er Herzrasen.
Ingmar zwingt sich zur Ruhe und versucht die Situation zu analysieren. Er ist nackt, was ihn wundert, da er gestern zu müde war, um sich auszuziehen. Er ist von grob gewebtem Material umgeben, das trotz seiner Nacktheit nicht kratzt. Die Welt um ihn herum ist in oranges Licht getaucht, was ihm als einziges bekannt vorkommt, da es ihn an sein Zelt erinnert.
Nach dem ersten Schreck gelangt er zu der Einsicht, sich immer noch in seinem Zelt zu befinden. Das grobe Gewebe ist anscheinend sein Schlafsack.
An den äußeren Umständen hat sich nichts geändert, nur er selbst ist nicht mehr der gleiche. Ingmar nimmt die ihm bekannte Welt aus einer ungewohnten Perspektive wahr, aus der eines Winzlings. Seltsamerweise beruhigt ihn diese Erkenntnis.
Ingmar fühlt sich wie ein Forscher in einer fremden Welt, streift durch das Gebirge seines Schlafsacks und sucht nach einer Abstiegsmöglichkeit. Am Rand der Kapuze angelangt, beugt er sich vornüber und zuckt zurück: Der Zeltboden befindet sich in schwindelerregender Tiefe. Unweit seiner Position entdeckt er ein herabhängendes Tau und ist dankbar, dass sein Schlafsack nicht mehr der neueste ist, da sonst alle Nähte fehlerfrei vernäht wären.
Ingmar hangelt sich bedächtig nach unten. Plötzlich verliert er den Halt und stürzt in die Tiefe. Sein Schrei ist so laut wie der Nieselregen des gestrigen Tages. Ihm passiert nichts. Er rappelt sich auf und steht neben einer schwarzen Wand, die nichts anderes als seine Isomatte ist. Ingmar ist halb so groß wie die Matte dick ist. Auf Zehenspitzen stehend misst er etwa einen Zentimeter.
Ingmar weiß, diese Verwandlung ist nicht real. Der größte Erfinder auf Erden, die Natur, hat mit der Spitzmaus ihr kleinstes Säugetier mit einem Gewicht von weniger als drei Gramm geschaffen, und das ist mindestens hundertmal mehr, als er auf die Waage bringt. Seine Schlussfolgerung lautet daher: Er träumt.
Er ist bereit für das neue Abenteuer. Von seinem Standort bis zum Zelteingang sind es nach neuem Maßstab geschätzte fünfzig Meter. Nur befindet sich die Öffnung so hoch über dem Boden, dass er eine Leiter benötigt. Ingmar sieht darin anfangs ein Problem, doch als er sich auf allen Vieren fortbewegt, bezwingt er den steilen Anstieg nach draußen mit der Souveränität eines Käfers. Er schlüpft durch die kleine Öffnung des Zeltverschlusses und wird von herrlichem Sonnenschein begrüßt. Die Mauer neben dem Zelt ist so gewaltig wie eine Burgbefestigung und der Baum so hoch wie das Empire State Building. Die Welt ist großartig und Furcht gebietend. Einzig die Sonne erscheint ihm wie zuvor. Nachdem er die Eindrücke in sich aufgesogen hat, wird ihm allmählich bewusst, wie verloren er ist. Eine unüberwindliche Weite trennt ihn von jeglicher Zivilisation. Er ist der Gnade der Natur ausgeliefert.
Doch seine Besorgnis wird von einer stärkeren Empfindung überlagert: Er hat Hunger. Und weil sich der Hunger so real anfühlt, stellt er sich die Frage, ob man träumend hungrig sein kann.
Ingmar hat keine Ahnung, wo er etwas Essbares finden kann. Die Vorstellung, eine Blattlaus verspeisen zu müssen, bereitet ihm Übelkeit. Vor lauter Ekel schüttelt er sich und hofft, bevor sich dieses Szenario bewahrheitet, aufzuwachen. Er wartet, doch nichts passiert, nur sein Hunger wird größer. Was für ein hartnäckiger Traum.
Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich auf Nahrungssuche zu begeben. Mit einem Sprung ins Vorzelt startet er das Unternehmen.
Ingmar liegt auf einem sich sacht im Wind wiegenden Blatt und lässt seinen gefüllten Bauch von der Sonne bescheinen. Seine Vorbehalte gegenüber Blattläusen waren unbegründet. Sie schmecken wie Pfannkuchen mit exotischer Füllung. Das ungewohnte Essen hat ihn schläfrig gemacht. Während er vor sich hin döst und sich über das gelöste Nahrungsproblem freut, bemerkt er eine Meise. Sie fliegt direkt auf ihn zu und wie beim letzten Mal erwartet er, dass sie kurz vor ihm abdrehen wird. Plötzlich füllt sie sein gesamtes Gesichtsfeld aus und schnappt nach ihm.
Ingmar wird von dem unerwarteten Angriff überrumpelt. Im Meisenschnabel fühlt er sich wie in einem mittelalterlichen Folterinstrument. Vor Schmerz muss er sich übergeben. Die Welt um ihn herum wird dunkel und er verliert das Bewusstsein.
Als Ingmar zu sich kommt, sitzt die Meise auf dem Ast, von dem sie gleich zum Nest hinüber fliegen wird. Ingmar weiß, dass er nur noch wenige Sekunden zu leben hat. Im nächsten Augenblick schwebt er über weit aufgerissenen Schnäbeln. Der Krach der kleinen Meisen, die gierige Monster sind, ist infernalisch. Im Angesicht des Todes zeigt Ingmar, was in ihm steckt: Er ist kein hilfloses Insekt. Er wird sich mit aller Kraft an den Schnabel des Nestlings klammern und dann ins Nest springen. Weiter reichen seine Überlegungen nicht.
Dann gibt ihn der Altvogel frei und er fällt in einen tiefen Schlund. Nahrung im Meisenalltag.
Tradition
Das Telefon klingelte, als ich gerade die Wohnungstür geöffnet hatte. Ich ließ meine Reisetasche fallen, lief ins Arbeitszimmer und hob ab.
„Du hast deine Ente im Gefrierschrank liegen lassen.“
„Oh Mann, jetzt werde ich anscheinend auch schusselig. Ich komme vorbei, wenn ich es einrichten kann.“
„Lass dir nicht zu lange Zeit. Die Ente muss in den nächsten zwei Monaten gegessen werden.“
Familientreffen sind anstrengend. Jedenfalls die Treffen unserer Familie. Nachdem wir das herausgefunden hatten, reduzierten wir die Zahl unserer jährlichen Zusammenkünfte. Wir sind eine Familie, die wunderbar funktioniert, wenn größere Entfernungen zwischen uns liegen. So brauchte mein Bruder Sven nicht mehr Baumaßnahmen an seinem Haus vorzuschieben, meine Schwester Marion keine plötzlich auftretenden Krankheiten und ich keine Wochenendarbeit.
Jetzt treffen wir uns einmal im Jahr zu Weihnachten. Jeder hält sich an diese stille Übereinkunft. Doch so gut die Verköstigung bei unserer Mutter stets ist, sehnen wir uns bald nach den eigenen vier Wänden zurück. In diesem Punkt stimmen meine Geschwister mit mir überein.
Naht der Abschied, suchen wir unsere Sachen und Geschenke zusammen. Mein Bruder vergisst immer, etwas einzupacken. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Kaum ist er mit seiner Familie vom Hof gefahren, ruft unsere Mutter: „Es ist doch nicht zu glauben, jetzt hat er seine Mütze vergessen!“
Es können ersatzweise auch ein Handschuh, eine Brille oder ein Buch sein. Mich wundert nur, dass unsere Mutter sich noch über diese Vergesslichkeit wundern kann.