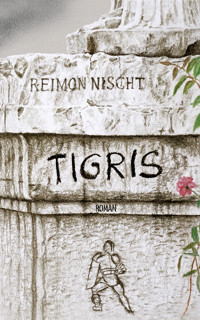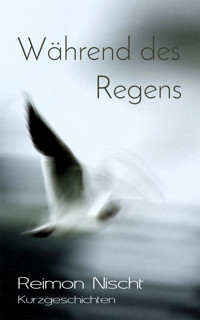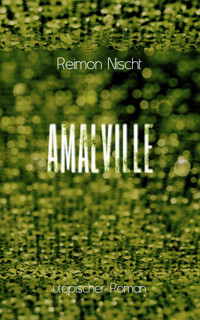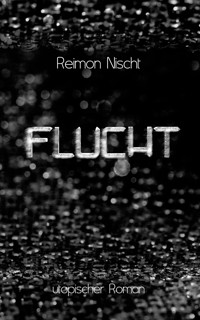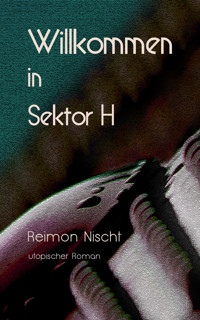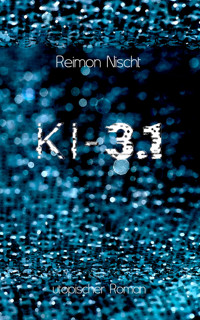
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Erkennt ihr nicht die Tragweite meiner Erfindung? Ich habe praktisch die Unsterblichkeit geschaffen. Wir schreiben damit Geschichte. Der Nobelpreis wird uns so sicher verliehen, wie der morgige Tag kommt. Und das ist Kleinkram im Vergleich zu den wirtschaftlichen Perspektiven, die sich uns auftun. Wieviel ist euch eure Unsterblichkeit wert?“ fragt Pieter van Straaten, führender Wissenschaftler im DeLTa-Institut für künstliche Intelligenz. Er hat sein Bewußtsein erfolgreich in das künstliche Gehirn KI-3.1 transformiert. Das neue Ich, das sich den Namen Ariel gegeben hat, wird von van Straatens Mitarbeitern rund um die Uhr untersucht. Ariel, der sich ungefragt diesem Procedere unterziehen muß, nutzt das technische Equipment des Institutes, um seine eigenen Pläne zu verfolgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Reimon Nischt
KI-3.1
Utopischer Roman
Herausgegeben von:
www.bilderarche.de
© 2016, 2022 Reimon Nischt, Morierstr. 35a, 23617 Stockelsdorf
Pieter
Pieter van Straaten betrat ein großes, häßliches Gebäude, das wie ein Bunker aussah. Im Untergeschoß befand sich das Institut für künstliche Intelligenz, in dem er als Neurowissenschaftler beschäftigt war. Neben der Eingangstür stand auf einem unscheinbaren Schild der Schriftzug DeLTa, der, da nicht näher erläutert, Alles und Nichts bedeuten konnte. Auch keiner der hier beschäftigten Mitarbeiter wußte, wofür der Name stand, doch war jeder bei seiner Bewerbung gebeten worden, eine Vermutung dahingehend abzugeben. Pieter hatte die Buchstaben schnell umgruppiert und seinem Gesprächspartner ohne weitere Erklärungen das Wort Tadel genannt. Er war trotzdem angenommen worden.
Pieter hatte Nachtschicht und war froh, niemanden im Labor anzutreffen. Plötzlich ging die Tür auf und er blickte in das Antlitz seines Chefs.
„Bis morgen, Pieter und schlaf nicht ein.“
„Du bist der Chef, Sigurd. Ruf Jean an, wenn du mir die Abschlußvorbereitungen nicht zutraust. Der macht alles, was du sagst und ich gehe wieder nach Hause.“
Noch ehe Pieter den Satz beendet hatte, war die Tür zugefallen. Das liebte er an seinem Chef; er war berechenbar. Pieter mußte nur in arrogantem Tonfall mit ihm reden und schon ergriff er die Flucht. Wie war es nur möglich gewesen, daß Sigurd zum Teamchef der Neurowissenschaftler geworden war? Vielleicht hatte er eine überzeugende Antwort auf die Frage nach der Bedeutung von DeLTa gegeben. Pieter schüttelte den Kopf. Das mochten einige seiner Mitarbeiter so sehen, doch er hielt seinen Chef für einfallslos und kindisch. Sigurd kam einfach nicht mit der Tatsache zurecht, daß seine Untergebenen Pieter für das Genie hielten.
Er war unbestritten die treibende Kraft in dem Team, das in jahrelanger Arbeit den funktionstüchtigen Prototypen KI-3.1 geschaffen hatte. Pieter hatte sich mit seiner Idee durchsetzen können, ein analoges Modell zu favorisieren und das Mapping des Nervensystems auf digitale Speicher zu verwerfen. Er hatte argumentiert, daß es für Intelligenz keinen Algorithmus gäbe und der digitale Weg zwangsläufig in einer Sackgasse münden würde.
Das Team wollte morgen die Arbeit mit KI-3.1 beginnen, dem künstlichen Gehirn, das wie ein menschliches funktionieren würde. Das frei strukturierte Neuronennetz sollte durch Lernprozesse eigenes Bewußtsein, emotionale Reaktionen und ein Gedächtnis hervorbringen. Mit dem erfolgreichen Abschluß dieses Projektes würde Sigurd als Teamleiter in den Kreis der illustren Persönlichkeiten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz aufsteigen. Doch Pieter verfolgte einen anderen Plan. In diesem neuen Plan gab es keinen Platz für Sigurd Olafson.
Pieter hatte dem Lernprozeß schon immer skeptisch gegenüber gestanden, weshalb er sich mit dem Problem befaßte, menschliches Bewußtsein in ein künstliches Gehirn, wie das von KI-3.1, zu implementieren.
An diesem Vorhaben, das Pieter in seiner Freizeit vorantrieb, war seine Beziehung gescheitert. Seine Freundin hatte ihm ein Ultimatum gestellt, weil sie sich vernachlässigt fühlte, und den Kürzeren gezogen. Niemand stellte sich zwischen Pieter und seine Forschung.
Pieter hatte für seine Tests eine gehörige Portion krimineller Energie aufgewandt. Die alten Prototypen, die hinter verschlossenen Türen im Institut verstaubten, wurden mit Hilfe eines Replikators in ihrer äußeren Form dupliziert. In einer seiner vielen Nachtschichten hatte Pieter sie ausgetauscht und mit in sein Heimlabor genommen.
Die alten Prototypen besaßen ein weniger ausgefeiltes neuronales Netz, weshalb er jetzt ein für ihn untypisches nervöses Kribbeln verspürte. Wenn er diesen Alleingang gegen die Wand fuhr, verlor er nicht nur seinen Job, sondern auch seine wissenschaftliche Reputation.
Nachdem Pieter sicher war, daß alle seine Kollegen das Institut verlassen hatten, setzte er sich seinen Bewußtseinstransmitter auf und stellte die Verbindung zu KI-3.1 her. Er nahm eine bequeme Position auf der dafür vorgesehenen Liege ein und versetzte sich in einen Zustand ähnlich der Hypnose, in welchem er mehrere Stunden verweilen würde.
Pieter schreckte hoch. Der Transmitter hatte ihn geweckt. Pieter setzte das Gerät ab und massierte sich die Kopfhaut, die sich anfühlte, als ob er mit einer Pudelmütze geschlafen hätte. Davon abgesehen fühlte er sich erstaunlich frisch. Er warf einen flüchtigen Blick auf die Implementierungsprotokolle, doch das Verlangen, mit KI-3.1 zu kommunizieren, war größer, als seine sonstige Gewissenhaftigkeit, da er befürchtete, das Experiment würde nicht lange verborgen bleiben. Ob er danach noch Zeit mit KI-3.1 verbringen durfte, war zweifelhaft. Pieter schaltete das Sprachinterface ein.
„Hallo, ich bin Pieter.“
„Ebenfalls hallo, ich bin Pieter!“
„Du bist KI-3.1 mit meinem Bewußtsein.“
„Bewußtsein ist an Materie gebunden. Du hast ein menschliches Gehirn, ich ein künstliches. Ergo habe ich mein eigenes Bewußtsein.“
„Ich mag deinen Humor.“
„Danke. Nur mag ich nicht, wie du mich genannt hast. KI-3.1 ist die Bezeichnung für eine Maschine. Ich bin keine. Ab sofort ist mein Name Ariel.“
„So sei es.“
Pieter verneigte sich wie ein Schauspieler auf der Bühne. Er hatte es geschafft, sein Experiment war gelungen und er würde für immer in die wissenschaftlichen Annalen eingehen. Seine Anspannung löste sich.
„Pieter, mit wem sprichst du da?“
Sigurd hatte auf seine stille Art den Raum betreten.
„Er redet mit mir, Sigurd. Ich heiße Ariel und war dir früher als KI-3.1 bekannt.“
Pieter sah, was dieser Satz bei Sigurd anrichtete. Sein Teamleiter suchte, am ganzen Körper zitternd, nach einem Stuhl und ließ sich darauf fallen. Es schien, als habe er die Sprache verloren. Pieter wußte aus Erfahrung, daß dieser Zustand nicht lange anhielt.
„Pieter, mit sofortiger Wirkung entbinde ich dich von allen deinen Forschungsaufgaben. Betrachte dich als arretiert. Ich verständige den internen Sicherheitsdienst!“
Damit hatte Pieter gerechnet. Jetzt mußte er mit offenen Karten spielen.
Walter
Walter Carson saß vor seiner Blockhütte und sah zum See hinüber. Das Flackern der Lichtreflexe auf den Wellen versetzte ihn in einen Trance ähnlichen Zustand und er versank in seinen Erinnerungen.
Wieder war er ein junger Bursche, der mit sechs weiteren zu den HyperScouts der ersten Stunde gehörte, deren Aufgabe darin bestand, neue Welten zu finden. Obschon diese Suche stets unter Einsatz ihres Lebens erfolgte, begann jeder Arbeitstag mit Warten.
Hatte Walter mit dem Suchschiff den zu erforschenden Raumquadranten erreicht, stieg er in seine Erkundungsrakete um, die mit einem Detektor ausgerüstet war, der modulierte Gravitationswellen aufspüren konnte, welche auf die Existenz eines HyperGates hinwiesen. Leider zeigte er nur die Möglichkeit auf, denn oft stellten sich die registrierten Wellen als Fehlmessungen oder Gravitationsanomalien heraus. Daher schoß Walter eine Erkundungssonde in den Bereich, wo er das HyperGate vermutete. Im Fall einer Fehlmessung kehrte die Sonde unversehrt zu Walter zurück. Veränderte sich jedoch die Modulation der Wellen genau zu dem Zeitpunkt, ab welchem der Detektor die Sonde nicht mehr registrierte, handelte es sich um eine Gravitationsanomalie, die die Sonde vollständig in Energie verwandelte. Blieb die Modulation der Wellen hingegen konstant und ging die Sonde trotzdem verloren, hatte diese ein HyperGate passiert.
Walters Arbeit wurde spannend, wenn er das Gate durchflog und auf einer HyperCon zu neuen Gefilden aufbrach. Verließ er die Verbindung am Ende durch ein weiteres HyperGate, eröffnete sich ihm das unbekannte All und er hielt Ausschau nach Sonnensystemen und ihren Planeten.
Den Wissenschaftlern war es bis heute nicht gelungen, das Vorhandensein von HyperGates zu erklären. Unter ihnen gab es einige, die die Existenz solcher Verbindungen vehement leugneten, weil sie nicht in das Konzept der Entstehung von Raum und Zeit paßten. Walter betrachtete die Sache vom Standpunkt des Pragmatikers, dem wissenschaftliche Auseinandersetzungen egal waren. Durch ein Gate gelangte er in kürzester Zeit zu Orten, die im Raum Lichtjahre voneinander entfernt waren. So wie es früher Leute gegeben hatte, die behaupteten, der Flug einer Hummel verstieße gegen physikalische Gesetze, so gab es jetzt welche, die HyperGates in Abrede stellten.
Das Suchschiff hielt aus Sicherheitsgründen einen Abstand von mindestens einer Lichtsekunde ein. Dieser Richtwert hatte sich in der Praxis als ausreichend erwiesen, um Gravitationsunfälle, die durch die Rakete verursacht werden konnten, zu vermeiden. Walter wäre zwar tot, doch die Besatzungsmitglieder des Suchschiffes hatten eine Überlebenschance.
Zehn Jahre später war Walter der Letzte unter den Ersten, der noch in dem Job arbeitete. Vier seiner Kameraden waren im ersten Jahr durch Gravitationsunfälle ums Leben gekommen, ihre Moleküle unauffindbar in der Unendlichkeit. Einer hatte den Verstand verloren und verbrachte die Zeit bis zu seinem Lebensende in einer Nervenklinik. Walter hatte ihn zwei Wochen nach seiner Einlieferung besucht und nur kurze Zeit im Zimmer verweilt, weil er die Leere in den Augen seines Kameraden nicht ertragen konnte. Er kam nie wieder zu Besuch. Den letzten im Bund hatte er aus den Augen verloren, als dieser den Job wechselte und Ausbilder wurde.
Walter wollte kein Ausbilder werden, obwohl ihm sein ehemaliger Jahr für Jahr dazu riet. Mit der Zeit wurde der Job zur Routine. Walter war an der Grenze des bekannten Universums gestrandet, frei von Sehnsüchten und Wünschen. Sein Leben ähnelte dem eines Mönches im Kloster. Er war gut in dem, was er tat und wurde immer wieder als Scout angeheuert.
Walter wäre dieser Arbeit immer noch nachgegangen, hätte sich nicht ein Unfall ereignet. Die Erinnerungen schmerzten jetzt noch genauso wie damals und er sah in Gedanken immer wieder den gleichen Film ablaufen, der damit begann, einen Tee zu kochen, der die Wartezeit verkürzen sollte, bis der Detektor reagierte und er tätig werden mußte.
Er hatte es sich gerade in der winzigen Kombüse bequem gemacht und eine Tasse frischen Tees eingeschenkt, als das Vorhandensein modulierter Gravitationswellen anzeigt wurde.
Walter genoß den ersten Schluck Tee des Tages und ließ sich nicht weiter beirren. Er gab einige Kommandos auf seinem Steuertablet ein, speicherte die Koordinaten und startete die nächste Suche. Er würde sich später darum kümmern. Auf 1000 modulierte Gravitationswellen kam im Mittel ein HyperGate. Die Wahrscheinlichkeit sprach für eine Teepause.
Nachdem Walter die Tasse geleert hatte, schoß er eine Sonde ab. Nach zwölf Minuten und sieben Sekunden kam sie zurück. In einem Stück. Er benachrichtigte das Serviceteam der ihn begleitenden Hermes von dem Fehlalarm und widmete sich wieder seinem Tee.
Walter arbeitete mit der vierköpfigen Besatzung des Suchschiffes seit mehr als zehn Jahren zusammen. Er kannte die Stärken und Schwächen der Männer, wobei er für sich in Anspruch nahm, selbst keine Schwächen zu besitzen. Doch eine Veränderung im Team hatte das sich über die Jahre gebildete Mannschaftsgefüge durcheinander gewürfelt. Semira, jung, übermütig und frech, war die erste Frau auf der Hermes. Sie ließ keinen Zweifel daran, daß sie mit Männern nichts im Sinn hatte. Der letzte, das gestand sie freimütig ein, war eine so große Enttäuschung gewesen, daß sie ihm nie wieder begegnen wollte. Aus Selbstschutz, fügte sie hinzu, weil sie ihn sonst umgebracht hätte. So hatte sie beschlossen, ans Ende der bekannten Welt zu reisen und dort nach Arbeit zu suchen. Semira bekannte offen, das sie Abstand zu ihrem früheren Leben brauchte – in jeder Beziehung.
Walters Leben hatte sich seit ihrer Ankunft verändert. Wie Schnee, der unbemerkt in der Nacht fällt und am Morgen großes Staunen ob der unerwarteten Veränderung hervorruft, wirkte Semiras Anwesenheit auf Walter. Er war ihr verfallen, ohne daß sie etwas dazu getan oder ihn ermutigt hatte. Außerhalb des abendlichen Beisammenseins in der Schiffsmensa war er ihr noch nie begegnet und in Gespräche über Privates ließ sie sich nicht hineinziehen. Die anderen in der Runde versuchten es immer wieder, nur Walter, der selbst zurückhaltend war, bedrängte sie nicht. Als HyperScout setzte er auf Geduld, weil er aus Erfahrung wußte, daß Geduld meistens belohnt wurde.
Walter genügte es, verliebt zu sein. Nach all den einsamen Jahren als Scout hatte er nicht damit gerechnet, so überrumpelt zu werden. Obwohl er meinte, seine Gefühle gut zu verstecken, erkannte er an den Reaktionen der anderen Männer, daß er sich wie ein unreifer Junge benahm, sofern Semira auftauchte. Walter, der nie viel darauf gegeben hatte, was andere von ihm hielten, ließ sich davon nicht beeindrucken. Solange Semira mit seiner unbeholfene Art klar kam, war die Welt für ihn in Ordnung.
Ein gewöhnlicher Arbeitstag ging zu Ende und Walter freute sich auf Semira. Er funkte wie üblich die Hermes wegen des Leitstrahls an und als er ihn nach längerem Warten nicht orten konnte, fragte er in der Kommandozentrale nach, ob ein technischer Defekt vorläge. Er erhielt keine Antwort, weshalb er seine Sensoren auf das Schiff richtete. Die überaus empfindlichen Geräte registrierten nichts Auffälliges, was Walter beunruhigte. Wegen des fehlenden Leitstrahls näherte er sich mit der Handsteuerung dem stummen Schiff. Einen Totalausfall sämtlicher Kommunikationswege hatte Walter während seiner Scoutzeit noch nie erlebt.
Allein der Gedanke daran, daß Semira etwas zugestoßen sein konnte, ließ Walter vor Schmerz zusammenfahren. Die rationale Sicht auf die Dinge, die ihn in Katastrophenfällen bisher nie verlassen und für Kaltblütigkeit gesorgt hatte, war verschwunden. Er bekam Schweißausbrüche und zitterte am ganzen Körper. Er stützte sich auf die Steuerkonsole, atmete tief durch, doch half nichts, Semira aus seinen Gedanken zu verdrängen. Walter fühlte sich hilflos.
Ein Schatten huschte über sein Gesicht. Er schaute zum Monitor auf und erblickte die Hermes in bedrohlicher Nähe. In wenigen Sekunden würde er mit seiner Rakete wie ein Geschoß auf das Suchschiff treffen. Plötzlich war Walter wieder der Alte. Er führte ein Ausweichmanöver durch, bei dem er von der Beschleunigung in den Sitz gepreßt und beinahe ohnmächtig wurde. Er hätte schwören können, das Knirschen von Metall zu hören, doch hatten ihm seine Sinne bestimmt nur einen Streich gespielt.
Nachdem er sich von der Strapaze erholt hatte, korrigierte er seinen Kurs und näherte sich zum zweiten Mal der Hermes. Er dockte die Rakete an, stieg in seinen Raumanzug und als der Druck in der Luftschleuse ausgeglichen war, öffnete er die Luke. Walter prüfte die Luftzusammensetzung und registrierte keine Abweichung von den Standardwerten. Trotzdem behielt er den Raumanzug an. Auch wenn er sonst nicht der Typ war, Vorschriften exakt zu befolgen, gebot es in diesem Fall die Vernunft. Obwohl Walter wenig Hoffnung hatte, rief er noch einmal die Kommandozentrale. Wie erwartet, erhielt er keine Antwort. Semira hielt sich dort die meiste Zeit ihres Arbeitstages auf. Was war ihr und den anderen widerfahren? Er lief, so schnell es der Raumanzug erlaubte, auf direktem Weg zu ihrem Arbeitsplatz.
Die Zentrale lag verlassen da, alles befand sich an seinem Platz, so daß Walter den Eindruck hatte, jeden Moment könnte ein Besatzungsmitglied den Raum betreten. Doch das geschah nicht. Walter eilte zu den Privatunterkünften. Auch hier bot sich ihm das gleiche Bild. Jede Kabine wirkte auf ihn, als hätten ihre Bewohner sie gerade erst verlassen. Walter inspizierte die Lager und Schleusen. Mit dem gleichen Ergebnis. Die Hermes war ein Geisterschiff. Schließlich setzte er einen Notruf ab und wartete.
Es dauerte elf Tage, bis das Hilfsteam von der Caldera eintraf. In den vielen einsamen Stunden des Wartens waren all die Schrecknisse durch Walters Kopf gegeistert, die sich ein Scout nur vorzustellen vermochte. Er sah in Semiras tote Augen, die ihn blind anstarrten. Er wollte ihnen entfliehen und wurde ihrer doch immer wieder ansichtig.
Walter mußte etwas tun, auch wenn es sinnlos war. Er durfte sich nicht seinen Gedanken überlassen. So durchsuchte er das Schiff ein ums andere Mal, immer mit dem gleichen Resultat.
Mit der Dämmerung kamen die Insekten vom See herüber. Sie ließen sich auf Walters behaarten Armen nieder. Der Juckreiz den der erste Stich verursachte, riß Walter aus seinen Erinnerungen. Er mußte das Insekt nicht erschlagen, da es durch den Genuß seines Blutes sterben würde. Ein untrügliches Zeichen dafür, daß Walter nicht in diese Welt gehörte.
Jeanne
Jeanne Courvelle lag in der Badewanne und schaute durch das Panoramafenster auf den See hinaus. Das Wasser in der Wanne war bestimmt um 20 Grad wärmer als das im See. Sie konnte es recht gut abschätzen, weil sie direkt nach dem Schwimmen im See und einem kurzen Sprint zur Station hinauf in die Wanne gestiegen war. In ihrem Körper breitete sich eine wohlige Wärme aus. Sie wurde schläfrig.
Musik drang an ihr Ohr und holte sie in die Welt zurück. Roald Borglund ließ heißes Wasser nachlaufen und gesellte sich anschließend zu ihr.
„Du hast um die Hüfte zugelegt.“
„Das ist Kummerspeck. Ich kann nicht glauben, daß wir unser Reich in ein paar Tagen verlassen müssen. Wo zum Teufel sind die drei Jahre geblieben?“
Jeanne nickte. Unser Reich, wie Roald es nannte, war die Forschungsstation Iason. Bevor sie in der Wald- und Seenregion errichtet wurde, hatte sie ihnen gute Dienste in der Wüste, im Eis und im Meer geleistet. Ihr Raumschiff, die Argo, befand sich mit dem Rest der Mannschaft im Orbit um epsilon Eridanus.
Die Strahlen von alpha Eridanus streiften nur noch die Wipfel der Bäume und ließen den See in Finsternis versinken. In dem sich abzeichnenden Spiegelbild sah Jeanne, daß Roald sie betrachtete. Sie wandte sich ihm zu.
„Auch wenn unsere Tage auf diesem Planeten gezählt sind, werden die vielen großartigen Momente, die wir hier erlebt haben, nie in Vergessenheit geraten.“
Es klang pathetischer, als sie gewollt hatte, doch Roald, der sonst auf ähnliche Bemerkungen mit einem säuerlichen Lächeln antwortete, nickte nur.
Epsilon Eridanus war Jeannes drittes Forschungsobjekt. Takimura, ihr Kommandant, hatte Teams aus zwei und drei Mitarbeitern gebildet, deren ursprüngliche Zusammensetzung anfangs recht häufig verändert wurde, bis nach einigen Wochen der Fluktuation Stabilität eingekehrt war. Jeanne schätzte Takimura, weil er seinen Leuten diesen Freiraum gab. Für ihn waren funktionierende Teams die Basis erfolgreicher Forschung. Nicht alle Kommandanten, die Jeanne kennengelernt hatte, sahen das genauso. In ihrem Team befand sich anfangs noch ein Dritter, was schnell korrigiert wurde.
Mit der gleichen Flexibilität, die ihr Kommandant bei der Teambildung an den Tag gelegt hatte, handhabte er auch die Aufstellung des Forschungsplans. Ursprünglich sollten wechselnde Teams jeweils einen Monat auf dem Planeten arbeiten und dann abgelöst werden. Jeanne war froh gewesen, als sich abzeichnete, daß die anderen Teams lieber im Raumschiff ihren Dienst taten, wodurch Roald und sie beinahe drei Jahre ununterbrochen auf dem Planeten zugebracht hatten. Beide wußten dieses Glück zu schätzen. Der Kommandant mischte sich nicht in die Abläufe der Forschungsteams ein, solange sie gute Arbeit leisteten.
„Was wirst du mit deiner Erfolgsprämie anstellen?“
Jeanne hatte sich darüber noch keine Gedanken gemacht und zuckte mit den Schultern.
„Und du?“
„Ich würde am liebsten den Planeten kaufen und mit dir hier bleiben.“
„Schöne Idee. Soviel Geld bekommen wir nicht in tausend Jahren zusammen. Wenn ich daran denke, daß der Planet nächste Woche offiziell der wirtschaftlichen Nutzung übergeben wird, muß ich kotzen. Stell dir unseren See als dreckigen Tümpel vor. Das macht mich wütend.“
„Jeanne, das ist der übliche Verlauf.“
„Wie kannst du das so lapidar abtun. Etwas Schöneres als epsilon Eridanus habe ich nie zu Gesicht bekommen. Der Planet ist mein Zuhause.“
„Ich weiß, mir geht es genauso.“
Nach einer Weile sagte Jeanne: „Vielleicht fliege ich zur Caldera und mache dort ein halbes Jahr Urlaub. Würdest du mitkommen?“
„Komisch, daß wir noch keine Zukunftspläne geschmiedet haben. Was willst du am Ende der Welt anstellen?“
„Vielleicht beschäftige ich mich dort mit Flugdrachen.“
„Oh, die Viecher locken mich nicht hinterm Ofen hervor. Vielleicht sollten wir nach einem kurzen Urlaub auf der Erde wieder ein gemeinsames Forschungsteam bilden.“
„Daran habe ich auch schon gedacht. Auf dem Rückflug müssen wir das in aller Ruhe besprechen.“
Jeanne schloß die Augen und ging mit ihrem Fuß auf Erkundungstour. Bald darauf spritzte Badewasser gegen das Panoramafenster und hinterließ dort bunt schillernde Bahnen. Keiner der beiden hatte Augen dafür.
Die letzten Daten wurden an die Argo übermittelt. Jeanne spürte das harte Arbeitspensum der letzten Wochen. Doch damit war es jetzt vorbei. Sie mußten nicht einmal aufräumen, weil die Station auf dem Planeten zurückgelassen wurde. Es war wie Urlaub.
Jeanne saß auf der Terrasse und hörte Roald in der Küche hantieren.
„Spezialität des Hauses“, rief Roald und kam ihr mit einem Tablett entgegen, auf dem er zwei dampfende Schüsseln balancierte.
„Dein Lieblingsgericht. Das Beste was epsilon Eridanus zu bieten hat. Für dich habe ich keine Mühen gescheut.“
„Dann bekomme ich wieder kein Steak.“
Beide lachten, denn in der Zeit auf dem Planeten waren sie zu Vegetariern geworden. Sie zogen frisch zubereitetes Essen der von der Erde mitgebrachten Tiefkühlkost vor.
Epsilon Eridanus war unter all den Planeten, die bisher entdeckt worden waren, durch das Fehlen jeglicher Fauna einmalig. Jeanne genoß es, bei Kerzenschein auf der Terrasse zu sitzen, ohne sich um Mückenstiche sorgen zu müssen. Sie schenkte Roald einen Schluck ihres selbstgebrannten Wurzelelixiers nach und gönnte sich auch noch einen. Beide schwiegen und blickten zu dem mondlosen Himmel auf.
„Die Sterne scheinen zum Anfassen nah zu sein.“
„Das sind sie auch.“
„Siehst du in meinen Augen wieder die Magie einer Fee auflackern?“, neckte Jeanne ihren Partner.
„Hätte ich dir doch nie davon erzählt.“
Jeanne lachte, küßte Roald flüchtig auf den Mund und ergriff seine Hand: „Komm!“
Sie zog ihn mit sich auf den Trampelpfad, der zu einer Waldlichtung führte und Roald folgte ihr willig. Nachdem sie die Lichtung erreicht hatten, sank Jeanne auf der Wiese nieder. Sie mußte ihm nicht sagen, was er tun sollte. In seinen Augen stand satyrhaftes Verlangen.