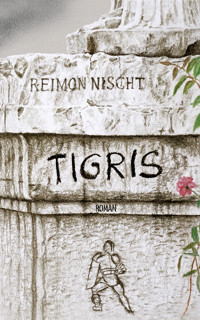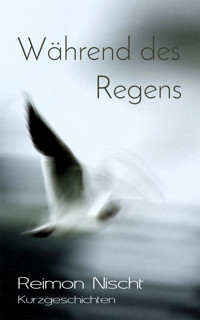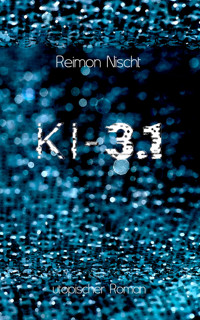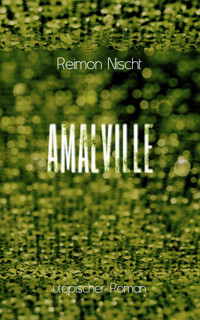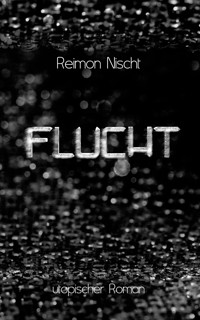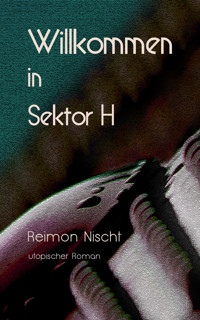3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann kehrt in das Dorf seiner Kindheit zurück. Seine Erinnerungen versetzen ihn in die späten 60er Jahre. Er begegnet seinem jüngeren Ich und erliegt der Illusion, dass sich Vergangenheit und Gegenwart überschneiden. So durchlebt er erneut Episoden aus seiner Kindheit: Er spürt die roten Striemen, die ihm Peitschen-Willy verpasst, erschrickt über die blinde Wut einer entfesselten Kuh und ist betroffen vom Unverständnis seiner Eltern. Doch vor allem begegnet er Marianne, dem ersten Mädchen, das er nicht für doof hält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Reimon Nischt
Letzter Besuch
Roman
Herausgegeben von:
www.bilderarche.de
© 2013, 2025 Reimon Nischt, Morierstr. 35 a, 23617 Stockelsdorf
Dorf
Reflexartig mache ich eine Vollbremsung. Der Wagen bricht auf dem Sandweg aus und kommt nur Zentimeter vor einem Busch am Feldrand zum Stehen. Eine Staubwolke hüllt mein Auto ein. Der Schreck sitzt mir immer noch in den Gliedern. Ich brauche nicht in den Rückspiegel zu sehen, um zu wissen, dass alles Blut aus meinem Gesicht gewichen ist: Ich habe einen Mann überfahren. Doch nein, das kann nicht stimmen! Es hatte keinen Aufprall gegeben und somit auch keinen Zusammenstoß. Dennoch hätte ich geschworen, dass dem so war. Ich sah den Mann ganz deutlich aus dem Nichts auftauchen. Selbst mein scharfes Bremsen hätte nicht verhindern können, dass sein Schädel an meiner Windschutzscheibe wie eine Melone zerplatzt wäre. Doch plötzlich war die Gestalt geistergleich verschwunden.
Ich öffne die Wagentür und steige mit weichen Knien aus. Wie die Hände eines Arztes einen Patienten abtasten, befühlen meine die Karosserie des Autos. Die Diagnose ist negativ. Das Auto weist nicht die kleinste Beule auf. Trotzdem blicke ich mich suchend um. Obwohl sich die Staubwolke verzogen hat, ist niemand zu sehen. Hinter dem Busch, vor dem ich jetzt stehe, lauert das Ortseingangsschild, wie ein Räuber mit dunklen Absichten. Das Schild sagt mir noch einmal, was ich auch so schon gewusst habe. Ich bin am Ziel der Reise, dem Dorf meiner Kindheit, angelangt. Mein Inneres kommt langsam zur Ruhe und ich spüre ein Gefühl von Vertrautheit.
Hier, am Rande des Ortes, stand früher in unmittelbarer Nähe einer dicken Eiche ein kleines, verlassenes Fachwerkhaus, das auf mich wirkte, als suche es Schutz unter dem weitausladenden Blätterdach. Keiner der Dorfbewohner vermochte zu sagen, was älter war, Haus oder Baum. Doch als das Haus vor vielen Jahren endgültig zerfiel, schien es, als ob die Eiche ihren Lebenswillen verloren hätte. Sie wurde vom ersten Herbststurm im darauffolgenden Jahr gefällt. Es gab viele Gründe, warum ich mich damals gerne in dem Haus aufhielt. Einer war das strikte Verbot meiner Eltern, es je zu betreten. Ein anderer, ungesehen meinem Forscherdrang nachzugehen. Das alte Gebäude widersetzte sich vehement meiner Erkundungsmethode, die darin bestand, alles auseinanderzunehmen, was nicht niet- und nagelfest war. Zartere Seelen würden behaupten, ich litt an Zerstörungswut, allein ich musste den Dingen auf den Grund gehen.
Plötzlich vernehme ich ein leises Geräusch. Jemand schleicht sich von hinten an. Bevor er mich übertölpeln kann, drehe ich mich blitzschnell um und traue meinen Augen nicht. Ein Junge quert die Straße genau dort, wo mein Auto steht. Und das im wörtlichen Sinne. Er geht geradewegs durch mein Fahrzeug hindurch, als ob es sich um eine Fata Morgana handeln würde. Während ich noch an meiner Wahrnehmung zweifele, löst sich das Auto vollends in Luft auf.
Irritiert beobachte ich das Geschehen weiter. Der Junge schlendert auf ein Haus zu, das vor einer Minute noch nicht dort gestanden hat und geht an einem Baum vorbei, der innerhalb der letzten Sekunde gewachsen sein muss. Haus und Baum erkenne ich wieder und den Jungen auch. Ich bin der Junge. Nachdem mich diese Erkenntnis nicht von den Beinen haut, beschließe ich, meinem jüngeren Ego unauffällig zu folgen. Welch absurde Situation! Doch soll ich mir diese Gelegenheit entgehen lassen, nur weil dies schlicht unmöglich ist? Nein! Die Vergangenheit hat keine Tore, durch die man eintreten kann, höchstens verschmutzte Fenster, die verschwommene Einblicke gewähren. Daran glaube ich noch immer, obwohl ich gerade Zeuge einer anderen Wahrheit werde.
Der Junge verschwindet jetzt im Haus. Ich folge ihm nicht, sondern verharre draußen vor der Tür. Nicht weil ich nicht wissen möchte, was geschehen wird, sondern weil ich es bereits weiß. Ja, es ist unglaublich! Meine Erinnerungen sind wieder so lebendig, als ob die Zeit stehen geblieben ist und ich neun Jahre alt bin.
Ich öffnete die Falltür im Boden der ehemaligen Küche und stieg vorsichtig in den Keller des Hauses hinab. Durch das kleine Fenster, das in Richtung Eiche hinausging, drang kaum Licht, was diesem Ort eine unheimliche Aura verlieh. Ich redete mir immer ein, hier einen Schatz finden zu können, weil ich glaubte, etwas Geheimnisvolles zu spüren, doch war der Ort nur kalt, feucht und muffig. Die rostigen Büchsen und zerschlagenen Bierflaschen, die sich im Laufe der Zeit ansammelten, zerstörten endgültig meine abenteuerlichen Vorstellungen. Der Keller war schäbig, doch hatte er mir schon manches Mal als Versteck gedient.
Zwar wusste ich bei Verstecken um die Notwendigkeit eines Fluchtweges, der mir hier fehlte, weil man nur durch die Luke im Küchenboden hinein und wieder hinaus gelangen konnte, doch sagte ich mir, ist eine Sache dreimal gut gegangen, wird sie bestimmt auch ein viertes Mal gut gehen. Wie falsch ich damit lag, zeigte sich, als jetzt die Falltür mit lautem Krachen zuschlug. Ehe ich überhaupt reagieren konnte, schnappte der Riegel ein. Gemeines Lachen, das sich langsam entfernte, drang zu mir nach unten. Dann herrschte Stille. Verständlich, dass mir etwas mulmig zumute war.
Hartnäckig hielt sich das Gerücht, es spuke in dem Haus. Wahrscheinlich hatten es die Erwachsenen in Umlauf gebracht, um Jungen wie mich von diesem Ort fernzuhalten. Wahr ist allerdings, dass der letzte Besitzer hier qualvoll starb. Nach einem wilden Saufgelage in der Dorfkneipe kämpfte er sich auf Händen und Füßen mühsam nach Hause, stolperte irgendwo im Dunkeln über eine Bierflasche, überlegte nicht lange, sondern kippte den Inhalt auf Ex hinunter und verreckte elendig. Keine Ahnung, was den Mann auf die Idee brachte, Salzsäure in einer Bierflasche zu lagern. Es zerriss ihm die Eingeweide.
Ging der Geist des Toten um? Nein, ich glaubte keine Sekunde an solchen Unsinn, denn das Lachen kam mir bekannt vor.
Fließend Wasser gab es noch nicht in unserem Dorf. Wer keinen Brunnen im Hof hatte, wurde mit Trinkwasser versorgt. Ein immer traurig dreinblickendes Pferd zog den Wasserwagen, auf dessen Kutschbock ein verdrießlicher, alter Mann saß, der Kinder nicht mochte. Natürlich ärgerten wir ihn. Willy Böhm, so der Name des Mannes, wurde für seine Wutausbrüche sowohl geliebt als auch gefürchtet. Er war zu langsam, um hinter uns herzulaufen, doch hatte seine Pferdepeitsche eine enorme Reichweite. Wenn er brüllte Euch Saubande werde ich helfen! wurde es Zeit, sich aus dem Staube zu machen.
Diesen Mann nun, den Peitschen-Willy, hatte ich im Verdacht, mich eingesperrt zu haben. Nur half mir das in meiner Situation nicht weiter. Später, wenn ich wieder frei wäre, würde ich Obst aus seinem Garten klauen und das Gemüse zertrampeln.
Doch nun stand ich als Gefangener vor dem Fenster, das den Blick in die Freiheit ermöglichte, ohne sie zu gewähren und schmiedete einen Plan für meinen Ausbruch. Eine Katze würde dieser Falle mit Leichtigkeit entkommen, mir blieb nur übrig, die von Feldsteinen eingefasste Fensteröffnung zu erweitern. So suchte ich mir eine geeignete Scherbe und kratzte den Mörtel aus den Fugen. Das bereitete mir keine Probleme. Schwieriger war es schon, die jetzt gelockerten Steine aus der Mauer zu zerren. Schließlich war die Öffnung groß genug, um mich hindurchzuzwängen.
Obwohl ich gerade einen Notausgang angelegt hatte und wieder frische Luft atmete, schwor ich mir, nie wieder den Keller zu betreten. Ich erkundete den Dachboden. Durch die wenigen Stellen im Dach, an denen Ziegel fehlten, drang kaum Licht herein. Ich musste mich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Der Boden war genauso eine Falle wie der Keller. Allerdings mit dem Vorteil, dass man durch eine knarrende Stufe gewarnt wurde, falls jemand hinauf kam. Da ich nun schon einmal hier oben war, sah ich mir die Giebelseiten genauer an. Es wäre schön, ein Fachwerksegment herauszubrechen, um mehr Licht hereinzulassen. Ich griff mir eine herumliegende Holzlatte und stieß zuerst auf die Wand ein. Danach setzte ich einen Hebel an. Das Ergebnis fiel radikaler aus als erwartet. Statt eines Segments stürzte der Giebel ein. Nachdem sich der Staub gelegt hatte, war der Dachboden von Licht durchflutet. Unbeabsichtigt hatte ich mir einen Fluchtweg geschaffen, denn nun konnte ich jederzeit vom Dach springen und Fersengeld geben, wenn es darauf ankam. Bei einer Höhe von über drei Metern gehörte schon eine gewisse Portion Mut dazu. Aber die hatte ich.
*
Die Neuigkeit vom offenen Dachgiebel teilte ich meiner Bande mit. Steffen, Dieter, Jürgen und Ralf schenkten mir anfangs keinen Glauben, doch als sie mein Zerstörungswerk sahen, staunten sie nicht schlecht.
Wir hingen entspannt im neuen Domizil herum und verzierten die Dachbalken mit Messerschnitzereien, als uns die knarrende Stufe warnte. Steffen stand der Treppe am nächsten. Er bekundete uns mit dem über die Lippen gelegten Zeigefinger, still zu sein und spähte vorsichtig um die Ecke.
„Los, abhauen, Giese!“, rief er. Mehr musste er nicht sagen. Mit drei Sprüngen war Steffen an der offenen Giebelseite angelangt und mit dem vierten schoss er vom Dachboden. Auch wir anderen gerieten in Bewegung. Jürgen und ich folgten ihm ohne zu zögern. Kaum hatten wir uns nach dem Sprung aufgerappelt, liefen wir in verschiedene Richtungen davon. Ich suchte in der Nähe Deckung, um das Geschehen weiter zu verfolgen. Ralf und Dieter befanden sich immer noch auf dem Dachboden. Kaum hatte ich ein Versteck gefunden, sah ich letzteren die Wand hinunterklettern. Dieter blieb an einigen rostigen Nägeln hängen und riss sich sein Hemd entzwei. Außerdem schien er sich am Handgelenk verletzt zu haben. Ich winkte ihm zu, doch ohne sich umzuschauen, rannte er schnell davon. Giese erschien jetzt auf dem Dachboden und gebärdete sich wie John Wayne, der Viehdiebe jagt.
In jedem Dorf gab es eine Person, die davon überzeugt war, dass ohne sie die Welt stehen bliebe. Bei uns hatte diese Rolle Giese, der Dorfschmied, inne. Er spielte gerne den großen Aufpasser und machte es uns damit leicht, ihn nicht zu mögen.
Einen vagen Moment lang glaubte ich an die Möglichkeit, Ralf könnte ein prima Versteck gefunden haben. Als ich ihn bald darauf zusammen mit Giese auftauchen sah, wusste ich, dass ich es mir nur gewünscht hatte. Der Schmied hielt Ralf bei den Ohren gepackt, dass ich meinte, ihm beim Wachsen zu zusehen. Dann verschwanden beide aus meinem Blickfeld, um Augenblicke später auf der Straße zu erscheinen. Ralf ging neben Giese wie ein Gefangener her. Sein Gesicht war verheult. Es nützte einem der beste Fluchtweg nichts, wenn man Angst hatte, ihn zu benutzen. Ich konnte ihm jedenfalls nicht mehr helfen.
Auf dem Weg nach Hause kletterte ich einer Laune folgend ausgerechnet auf die Linde an der Dorfstraße, die sich gegenüber Gieses Schmiede befand. Im Innern der Schmiede herrschte tiefe Dunkelheit. Nur der flackernde Feuerschein in der Esse und das Schlagen von Metall auf Metall verrieten Gieses Anwesenheit.
Ich dachte, das dichte Blätterdach der Linde würde mich vor den Blicken der Leute verbergen. Leider war meine Unsichtbarkeit nur eine Illusion, denn als ich es mir auf dem Baum bequem machte, kam der Schmied aus der dunklen Werkstatt direkt auf mich zu. Er baute sich breit und stämmig vor dem Baum auf. Trotz seiner Größe musste Giese nach oben blicken.
„Komm da sofort herunter!“
Was hatte er dagegen, dass ich friedlich auf einem Baum saß? Unbeeindruckt blieb ich weiterhin dort sitzen.
„Ich gehe zu deinem Vater, wenn du nicht augenblicklich runterkommst!“, drohte er mir. Konnte sich ein erwachsener Mann wirklich in so eine jämmerliche Petze verwandeln? Ich traute Giese alles zu und schwieg weiter. Das war auf jeden Fall klüger, als ihm frech zu kommen, sonst hätte er mich bestimmt vom Baum geschüttelt. Außerdem fiel mir kein Grund ein, weshalb mein Vater etwas dagegen haben sollte, dass ich auf einem Baum saß.
In der Art wollte ich antworten, als Giese von mir abgelenkt wurde. Der alte Konrad näherte sich uns. Wenn er nicht gerade durch die Felder wanderte, sah man ihn oft auf einer Bank vor dem Konsum sitzen. Seltener kam der Alte, wie eben jetzt, die Dorfstraße entlangspaziert. Er maß knapp anderthalb Meter und war bestimmt schon achtzig Jahre alt. Aber sein Blick war ungetrübt, und seine Augen starrten den um einen halben Meter größeren Giese herausfordernd an. Sie mochten sich nicht. Das war kein Geheimnis.
Auf unserem Dorffest zwei Wochen zuvor, waren sie sich zum letzten Mal begegnet. Damals stellte ich mir vor, wie schön es wäre, dem aufgeblasenen Giese die Luft abzulassen. Aber auf eine handfeste Idee kam ich nicht. Wie aus heiterem Himmel erschien der alte Konrad auf der Festwiese. Nachdem er sich umgesehen hatte, bahnte er sich einen direkten Weg zu Giese, baute sich vor ihm auf und betrachtete ihn herablassend.
„Du bist ein toller Kerl, das weiß hier jeder. Stark und kräftig. Aber ich habe hier etwas noch Stärkeres. Willst du mal probieren oder hast du Angst?“
Er reichte dem Schmied ein rotes, spitzes Etwas. Giese zögerte keine Sekunde, da er sich vor seinen Zuhörern keine Blöße geben wollte und biss zu. Alle Umstehenden sahen sofort die Veränderung. Dem Schmied traten plötzlich Tränen in die Augen. Sein Kopf wurde puterrot. Er begann nach Luft zu schnappen und sank auf die Knie. Während einige Leute nach dem Sanitäter riefen, reichte der alte Konrad dem am Boden Kauernden eine trockene Scheibe Brot. Wütend wurde sie ihm aus der Hand geschlagen. Der Schmied verlangte röchelnd nach einem Glas Bier. Ein Bier mochte das richtige Rezept gegen Durst sein, aber gegen das Feuer einer Peperoni konnte es nichts ausrichten. Der alte Konrad und Giese waren sich noch nie grün gewesen, doch dieser Vorfall markierte einen neuen Tiefpunkt in ihrer Beziehung.
Nun standen sie sich erneut gegenüber.
„Giese, du solltest dich lieber um den Jungen kümmern, der gerade mit deiner Ältesten im Stroh rumpimpert“, rief der Alte gelasen. Das Gesicht des Schmieds färbte sich abermals rot. Vor Zorn oder vor Scham wusste ich nicht zu sagen, denn der Ausdruck Rumpimpern war mir nicht geläufig. Da aber ein Junge im Spiel war, hatte ich eine ungefähre Vorstellung von dem, was da ablief.
Ohne sich weiter um mich zu kümmern, ging Giese wieder an seine Arbeit. Ich hörte ihn noch leise fluchen. Mit Sicherheit würde seine große Tochter heute Abend eine Überraschung erleben. Manuela war viel älter als ich. Doch da sie noch zur Schule ging, mochte sie sechzehn gewesen sein. Das war in etwa alles, was ich von ihr wusste.
Hatte der Alte wirklich etwas gesehen oder machte es ihm nur großen Spaß, den Schmied zu ärgern? Wahrscheinlich letzteres. Doch war der alte Konrad immer für eine Überraschung gut. Der Sache musste ich auf den Grund gehen. Wenn der Alte wie üblich an den Feldern entlangging, konnte er nur an zwei Strohmieten vorbeigekommen sein. Ich verließ meinen Platz vor der Schmiede, um Detektiv zu spielen.
Im Schutze der Büsche und Bäume näherte ich mich der ersten Miete. Nichts war zu sehen oder zu hören. Ich wollte schon zur nächsten gehen, als ich ein Rascheln vernahm. Es kam von oben. Da ich keine Leiter mit mir herumtrug, musste ich mir wieder einen Baum suchen. Knapp einen Steinwurf weit von der Miete entfernt stand eine alte Eiche. Von dort würde ich eine schöne Draufsicht haben.
Tatsächlich hatte ich im Kino schon schlechter gesessen. Meine Vermutung, was das Rumpimpern betraf, sah ich bestätigt. Da bewegte sich ein Junge mit einer bis zu den Knien herabgelassenen Hose auf einem die Beine weit gespreizt haltendem Mädchen, dessen Kleid bis zur Brust hochgeschoben war. Die Szene machte auf mich einen albernen Eindruck und im Stillen sagte ich mir, so wirst du dich nie verhalten. Doch Ernsthaftigkeit und Angestrengtheit der beiden zeigten mir, dass es da etwas geben musste, von dem ich bisher nichts verstand. So harrte ich der Dinge, die noch kommen mochten. Schließlich vernahm ich ein leises Stöhnen und die Dynamik des Jungen erlahmte. Er zog seine Hose hoch und legte sich neben dem Mädchen ins Stroh, das bereits ihr Kleid in Ordnung gebracht hatte. Viel konnte ich nicht vom nackten Körper des Mädchens erhaschen, aber das wenige, das ich sah, musste noch für Jahre reichen.
Nachdem die beiden den Tatort verlassen hatten, machte auch ich mich auf den Weg. Ich hatte mich ganz auf ihr Tun konzentriert und merkte erst jetzt, dass der Alte geflunkert hatte. Das Mädchen war gar nicht die Tochter des Schmieds. Trotzdem hatte Gieses Älteste, als sie nach Hause kam, nichts zu lachen. Ihren Unschuldsbeteuerungen wurde kein Glauben geschenkt. Der Schmied brachte ihr seine Vorstellungen von Moral und Anstand mit der Peitsche bei. Er schlug auf seine Tochter ein, als hätte er es mit einem störrischen Maultier zu tun. Manuela blieb eine Woche der Schule fern. In seinem Jähzorn hatte Giese den Bogen überspannt. Keinen Monat später verließ ihn seine Frau mit den beiden Töchtern. Seit jenem Ereignis war es mit der Herrlichkeit des Schmieds vorbei.
*
Neben Giese und Peitschen-Willy gab es noch den einarmigen Baumann, der sich gerne mit uns anlegte. Unsere Ausgelassenheit war ihm wohl ein Dorn im Auge. Er hatte Frau, Kind und Hund und war trotzdem (oder gerade deshalb) ein mürrischer Typ. Vielleicht lag es auch an seiner Kriegsverletzung. Mit siebzehn Jahren musste er während der letzten Kampfhandlungen an die Front. Eine Granate riss ihm den linken Arm ab. Ich kannte ihn daher nur mit Armprothese, von der allein die schwarze lederüberzogene Hand sichtbar war.
Trotz seiner Behinderung war er geschickt. Ohne Probleme konnte er Auto und Traktor fahren. Selbst beim Mähen mit der Sense blieb er nicht hinter den anderen zurück. Aus naheliegenden Gründen (oder Mangel an Fantasie) wurde er Einarmiger genannt. Ich fand, Schleicher hätte besser zu ihm gepasst, denn er näherte sich einem unbemerkt. Mir erging es jedenfalls so, als ich in der Kiesgrube unseres Dorfes an einer Wurzel hing und mich baumeln ließ.
Diese Kiesgrube, die von allen Sandkuhle genannt wurde, war ein beliebter Spielplatz. Sie war größer als ein Fußballfeld und schon so tief ausgebaggert, dass sich in der Mitte das Grundwasser sammelte. Es gab nichts Aufregenderes, als vom oberen Rand hinunter auf den Kies zu springen und wie ein Skifahrer in die Tiefe zu gleiten. Das machte Spaß! Und wie bei einer richtigen Abfahrt musste man heil ankommen. Ich war darin recht gut, doch einige meiner Spielgefährten verletzten sich hin und wieder.
Unter diesem Vorwand schlich sich Baumann oft unbemerkt an und verscheuchte uns laut fluchend. Dafür hatten wir überhaupt kein Verständnis. Um uns seinen Blicken zu entziehen, sprangen wir nicht mehr vom Rand in die Tiefe, sondern zogen uns an den aus der Erde ragenden Wurzeln von unten nach oben. Das Spiel war nicht weniger gefährlich als das andere, doch waren wir jetzt besser getarnt. Außerdem gab es genügend Verstecke, in denen wir uns verbergen konnten, sofern Baumann auftauchte.
Neulich hatten wir Dieter als Wachposten abgestellt, weil er seinen Arm in der Schlinge trug. Da er nur zuschauen konnte, wurde es ihm bald langweilig und er verdrückte sich, ohne uns anderen Bescheid zu sagen.
„Was treibst du denn da!“
Unerwartet donnerte Baumanns Stimme in meinen Ohren. Vor Schreck hätte ich beinahe die Wurzel, an der ich hing, losgelassen. Ich schaute mich um und musste feststellen, dass alle anderen Fersengeld gegeben hatten. Steffen, Ralf und Jürgen waren verschwunden, ohne mich vor Baumann zu warnen. Das machte mich wütend.
„Und was geht Sie das an?“, schrie ich zurück, während ich mich an der Wurzel nach oben zog. Leider kam ich mit meiner Antwort nicht zu Ende. Plötzlich packte mich etwas von hinten. Ich erschrak heftig und blickte mich erneut um. Sein Hund hing an mir. Wütend hatte er in meinen Lederhosenhintern gebissen. Ich nahm alle meine Kräfte zusammen und versuchte mit der zappelnden Last den oberen Rand der Sandkuhle zu erreichen. Allein ich schaffte es nicht. Dieses blöde Vieh war zu schwer.
Die Lösung des Problems ergab sich dann von selbst: Die Wurzel riss. Mit Schwung purzelten wir den Hang hinunter. Der Einarmige konnte nur noch der Kind-und-Hund-Lavine entgegenstarren. Augenblicke später wurde er von ihr niedergewalzt und außer Gefecht gesetzt.
Wie recht ich damit hatte, wurde mir erst bewusst, nachdem ich meine Augen von dem Dreck befreite, den die ausgerissene Wurzel über mich herabregnen ließ. Etwas Hellbraunes mit einer schwarzer Hand lag unweit von mir im Sand. Baumann hatte erneut seinen Arm verloren.
Für mich bedeutete es jedoch die Rettung. Der Hund hing nicht mehr an meiner Hose, sondern schnupperte bereits an der Prothese herum. Verwechselte er den Stumpf mit einem Knochen? Sein Irrtum war verzeihlich. Ich hätte die Prothese auch gerne berührt. Sie sah so glatt aus. Doch bald würde auch der dümmste Hund merken, dass er sich hatte austricksen lassen. Wen würde er sich dann als nächsten schnappen? Ich wartete nicht so lange. Mit Hunden hatte ich noch nie viel im Sinn. Meine Distanziertheit verwandelte sich nun in Abscheu. Falls dieses Gefühl einmal abflauen sollte, brauchte ich nur meine Lederhose zu betrachten. Zwei Löcher im Hosenboden zeigten mir sehr deutlich, wie gern mich einst ein Hund hatte.
*
Ein lauter werdendes Motorengeräusch näherte sich Steffen und mir. Ab und zu schauten wir uns suchend um, aber die Lärmquelle blieb vorläufig noch unsichtbar. Doch der tiefe, dröhnende Motorenklang war uns so vertraut wie die Schulklingel. Daher waren wir nicht überrascht, als vier Militärfahrzeuge in die Sandkuhle hineinfuhren. Steffen und ich ließen die Wurzeln, an denen wir baumelten, los und gingen zu den haltenden Wagen hinüber.
Unweit unseres Dorfes waren Russen stationiert. Keiner im Ort hat sie jemals Sowjetsoldaten genannt. Das war der offizielle Sprachgebrauch in der Schule, nicht der im alltäglichen Leben. Dann und wann kamen diese Soldaten mit ihren großen Lastern zu unserem Dorf, um jede Menge Kies zu holen, den sie für verschiedene Baumaßnahmen brauchten. Einen Bagger hatten sie nicht. Dafür ausreichend Schippen und Männer.
Wir grüßten auf Russisch. Die Soldaten lachten. Es waren alles junge, freundliche Burschen. Steffen und ich durften sich ihre Fahrzeuge von innen ansehen. Da gab es keine militärischen Geheimnisse. Einer der Fahrer tippte mit dem Finger auf seine Brust und rief mit breitem Grinsen Boris. Danach nannten alle seine Kameraden ihre Namen Wolodja, Sergej, Alexander.
Es war nicht leicht, sie auseinanderzuhalten. Die Uniform und die kurz geschorenen Haare raubten jedem etwas von seiner Individualität. Einige versuchten, diesen Eindruck wettzumachen, indem sie ihre Sachen mit einer gewissen Lässigkeit trugen. Bei Alexander gehörte die offene Jacke ohne Koppel zum Erscheinungsbild. Wolodja bevorzugte ein schief sitzendes Käppi, während Boris das Koppel tief über der halb geöffneten Jacke hängen ließ. Sergej traute sich am wenigsten, denn bei ihm waren nur die beiden obersten Hemdknöpfe offen. Diese lockere Anzugsordnung hatte nichts militärisches (die Soldaten der NVA wirkten dagegen wie aus dem Ei gepellt) und das gefiel mir.
Wir schauten ihnen beim Beladen der Fahrzeuge zu. Der Kies flog nur so durch die Luft und bald war die Arbeit getan. Boris winkte mit seiner Mütze und gab mir dann zu verstehen, bei ihm vorne mit einzusteigen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und nahm sogleich auf dem Beifahrersitz Platz. Steffen stieg bei Alexander ein.
Zuerst ging es mit Vollgas über glatten Asphalt. Wie gebannt schaute ich auf die Tachonadel. Wir fuhren mit steigendem Tempo. Die Nadel erreichte die 100, pendelte darüber oder blieb knapp darunter. Autofahren war für mich schon immer etwas Besonderes. Meine Eltern hatten kein Auto und Tante Anna fuhr mit ihrem Trabbi nie schneller als 80 km/h. Zeigte der Tacho richtig an, hatte ich meinen Geschwindigkeitsrekord gebrochen.
Nicht lange und der Straßenbelag wechselte zu Kopfsteinpflaster. Ohne vom Gas zu gehen, wurde weitergefahren. Mein Sitz verwandelte sich in ein Trampolin. Bei jedem Schlagloch hüpfte ich bis zur Wagendecke, fiel gleich darauf wieder auf den Sitz, um im nächsten Moment erneut in die Höhe geschleudert zu werden.
Mit Fug und Recht konnte ich behaupten, in diesem Auto zum ersten Mal geflogen zu sein. So viele blaue Flecken hatte ich bei keiner Prügelei erhalten. Trotzdem stand mir die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Wenn unsere Lehrer vom tapferen Sowjetsoldaten erzählten, hatte ich immer meine Russen aus der Sandkuhle vor Augen. Das waren die Guten. Das stimmte wirklich. Ich bin mit ihnen gefahren (und geflogen).
Doch es gab auch die Bösen, besser bekannt als Klassenfeinde. Schwerlich konnte ich mir unsere Westverwandtschaft als Bedrohung vorstellen. Auch der Sozialismus unter Ulbricht hätte sie nicht stärker deformieren können. Nannte sie mein Vater deshalb bucklig?
Kaum eine Woche nachdem ich mit Boris mitgefahren war, begegnete ich dem echten Klassenfeind. Er kam in dem tollsten Auto vorbei, das ich bis dahin je gesehen hatte. Es war militärgrün mit dunkel getönten Scheiben. Am vorderen Kotflügel (links oder rechts?) wehte ein amerikanisches Fähnchen. Der Straßenkreuzer fuhr zur Tankstelle gegenüber unserer Schulbushaltestelle.
Kaum hatte das Auto an der Zapfsäule angehalten, wechselte ich zur anderen Straßenseite, um nach dem Fahrzeugtyp zu sehen. Cadillac stand chromverziert am Heck. Plötzlich senkte sich das Fenster auf der Beifahrerseite mit leisem Geräusch.
Ich schaute auf. Keiner der anderen Schüler war mir nachgekommen. Sie standen alle abwartend an der Bushaltestelle. Ein Mann in Uniform machte mir Handzeichen. Vorsichtig näherte ich mich dem geöffneten Autofenster. Er rief mir etwas zu. Ich verstand seine Sprache nicht, doch klang das Gesagte freundlich. Seine tadellose Uniform hielt mich jedoch auf Distanz. So leicht ließ ich mich nicht einfangen. Schließlich reichte er mir ein Päckchen Kaugummi aus dem Fenster. Echter Westkaugummi! Für mich ganz alleine. Ich griff danach.
Das war er also, der Klassenfeind. Vielleicht konnte er einem Jungen nichts anhaben? Vielleicht musste man dafür erwachsen sein? Nun, damit hatte ich es nicht eilig. Mir war etwas viel Schöneres vergönnt, meine größte Kaugummiblase.
Familie
Der Knall der geplatzten Blase lässt mich mit der Hand über meinen Mund fahren. Da ich gar nichts kaue, bescheinigt dieses reflexartige Verhalten nur meine realistische Vorstellungskraft. Das mit dem Kaugummi muss dem anderen passiert sein. Ich stehe neben dem Ortseingangsschild und gehe zurück zu meinem Auto. Es hat sich wieder materialisiert. Ich überzeuge mich davon, indem ich die Tür öffne. Bevor ich einsteige, schaue ich mich um. Nirgends ist eine Menschenseele zu sehen, auch kein Geist aus der Vergangenheit.
Gemächlich fahre ich in den Ort hinein. Es ist nicht mehr das Dorf meiner Kindheit. Der Wandel hat alles erfasst. Unser Haus lag an einer von Linden gesäumten Kopfsteinpflasterstraße. Die beschauliche Allee musste einer baumlosen Asphaltpiste weichen. Viele Häuser wurden seit damals gründlich renoviert. Überall sehe ich neue Dächer, Fenster und Türen, die sich nicht zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen. Eine moderne Hässlichkeit ist zum Standard geworden.
Nur ein Haus wurde dem Verfall preisgegeben. Davor parke ich mein Auto und steige aus. Das Tor ist abgeschlossen, und da ich keinen passenden Schlüssel besitze, klettere ich hinüber. Das machte ich schon mit neun Jahren und kann es heute immer noch. Was für ein bescheuerter Einbrecher, steigt am helllichten Tag über einen Zaun!, werden die Leute denken. So etwas bleibt hier nicht verborgen, da bin ich mir sicher. Auch wenn die Häuser neu aussehen, die Menschen sind noch immer die alten.
Langsam gehe ich durch den verwilderten Garten und setze mich unter einen Baum. Sein Blätterdach hält die gleißenden Sonnenstrahlen ab. Entspannt lehne ich mich an den Stamm. Mein Blick schweift über das trockene Gras, gleitet zwischen den anderen Bäumen hindurch und bleibt an der Hecke, die die Grenze zum Nachbargarten bildet, hängen. Ich bin nicht alleine im Garten. In der Hecke geben Spatzen ein Konzert, das selbst einen Schönberg verstören würde. Trotz ihrer infernalischen Darbietung haben sie außer mir noch einen weiteren Zuhörer, eine Katze. Nur scheint mir diese eher an den Musikern als an der Musik interessiert zu sein.
Es ist ganz wie früher. Auch damals hatten Spatzen die Hecke zu ihrem Revier erkoren und machten einen Heidenlärm. Meine Katze, die Mausi, hockte tief geduckt im Gras und war hoch konzentriert, sodass man die unter ihrem Fell zuckenden Muskeln sehen konnte. Sprungbereit lauerte sie auf den einen, der vor lauter Lebensfreude vergaß, seiner Umwelt die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Das Herumschwirren der Spatzen, ihr in die Hecke hinein- und wieder herausfliegen, machte es der Mausi nicht leicht, sich auf ihre Beute zu konzentrieren. Trotz allem erwischte sie den einen oder anderen. Sie sprang dabei einen halben Meter hoch und schlug den Spatzen im Flug auf die Erde. Mit dem nächsten Satz hatte sie ihn gepackt und sein Leben war verwirkt.
Doch einmal passierte etwas, womit die Mausi nicht gerechnet hatte. Sie kauerte in ihrer üblichen Lauerstellung, als ich eine Bewegung wahrnahm, die aus der Sonne zu kommen schien. Unsichtbar für seine Opfer stürzte sich ein taubengroßer Vogel auf die Hecke. Zweige brachen. Urplötzlich erstarb das Spatzengezwitscher. Meine Mausi sprang erschrocken davon. Ich ging zur Hecke, aber der Sperber war bereits verschwunden. Fünf Minuten dauerte die Stille, dann hatten die Spatzen ihr Revier wieder in Besitz genommen.
Die fremde Katze hat das Interesse an den Vögeln verloren und pirscht sich in Richtung Haus. Ich erhebe mich ebenfalls und folge ihr. Seitlich an der Treppe zum Hintereingang steht eine kleine, leere Schüssel genau wie in früheren Zeiten. Dorthin geht die Katze und wartet.
„Hallo, meine Schöne“, sage ich zu ihr und hocke mich hin, um sie zu kraulen. Die Katze schnurrt mich an, wobei sie ihren kleinen Kopf gegen meine Hand drückt.
Plötzlich schaut sie zur Haustür auf. Ich folge ihrem Blick. Wie durch Geisterhand öffnet sich die Tür. Ein Einbrecher! Der Gedanke schießt mir unwillkürlich durch den Kopf. Ich spanne meine Muskeln an, doch wer erscheint in der Öffnung? Mein jüngeres Ich mit ein paar Wurstscheiben in der Hand. Schlagartig wird mir klar, dass ich die Mausi vor mir habe.
Warum das mein erster Gedanke ist, vermag ich nicht zu sagen. Mein zweiter veranlasst mich, neugierig durch das Küchenfenster zu schauen.
„Verdammt, seid ihr jung!“, rufe ich erstaunt, als ich meine Eltern sehe. Augenblicklich fahre ich mir mit der Hand über den Mund. Wer mich nicht sehen kann, sollte mich auch sonst nicht bemerken. Leider zu spät.
„Mausi, hast du das eben auch gehört?“, vernehme ich sogleich die Stimme des Jungen, der ich einst war. Ich gebe ihm keine Antwort, sondern schlüpfe durch den Türspalt nach innen und lasse den Frager beim Füttern seiner Katze draußen zurück. Kaum stehe ich in der Küche, erfasst mich ein leichter Schwindel.
„Hände waschen und an den Tisch.“
Meine Mutter meint wirklich mich und ich gehorche. Beiden Elternteilen ist der Austausch entgangen. Sie sehen in mir immer noch ihren neunjährigen Sohn. Bei dem Gedanken stocke ich. Neunjährig? Erst jetzt wird mir bewusst, dass die beiden Jungen (der vorhin im alten Haus und der eben vor der Tür) nicht gleichaltrig sind. Ich bin kaum eine Stunde hier und schon hat die Vergangenheit einen Zeitsprung gemacht. Ich akzeptiere das genauso wie die anderen absurden Begebenheiten. Was solls, dann bin ich eben ihr zehnjähriger Sohn.
Etwas befangen setze ich mich zu meinen Eltern an den Tisch.
„Wir bekommen einen Telefonanschluss“, verkündet mein Vater aufgeräumt.
Dass ich nicht lache. Telefon gab es damals nur in der Bürgermeisterei, in der Poststelle und im LPG-Büro.
„Was? Das glaube ich dir nicht“, antworte ich.
Dass ich nicht mit meiner Jungenstimme rede, scheint niemandem aufzufallen. Vielleicht ist daran mein voller Mund schuld.
„Kannst du aber. Wir stehen auf der Warteliste und kommen frühestens in zehn Jahren dran. Vielleicht auch erst in zwanzig.“ Dann lacht er schallend los.
„Oh!“, antworte ich darauf.
„Du klingst ein wenig enttäuscht. Haben deine Freunde Telefon zu Hause? Meine nicht!“
„Darum geht es gar nicht. Mit Telefon wären wir etwas Besonderes.“
„Genug davon“, meldet sich nun meine Mutter zu Wort, „wenn du etwas Besonderes sein willst, dann sitz gerade am Tisch und iss dein Brot ordentlich auf.“
Wie eine giftige Wolke, die einem den Atem nimmt, hängt mein Lieblingswort ordentlich in der Luft. Früher oder später musste eine Zurechtweisung meiner Mutter die Stimmung ruinieren. Sie sitzt, wie immer ein gutes Beispiel gebend, aufrecht am Tisch und bemerkt es nicht einmal.
Könnte ich Distanziertheit mit einem Geruch gleichsetzen, wäre es der meiner Mutter. Ich wünschte, meine Erinnerung daran würde mich täuschen. Was sie zum Lachen bringen konnte, hatte ich noch nicht herausgefunden und mein Vater wahrscheinlich schon wieder vergessen.
Doch heute gibt er sich noch nicht geschlagen. Da er am Tisch mehr lümmelt als sitzt, bezieht er die Zurechtweisung auch auf sich. Wie auf Kommando strecken wir beide gleichzeitig unseren Rücken durch. Die Komik der Szene entgeht selbst meiner Mutter nicht.
„Der Junge wird nie Respekt lernen, wenn du alles ins Lächerliche ziehst!“
Worte und Tonfall ergänzen sich wunderbar. Obwohl sie an meinen Vater gerichtet sind, hinterlassen sie bei mir einen faden Beigeschmack. Ich bewege mich unruhig auf meinem Stuhl hin und her. Die Situation ähnelt der im Kino, wenn ich merke, dass ich im falschen Saal sitze und den falschen Film sehe. Dieser Familienfilm gefällt mir nicht. Ich will den Saal verlassen, ohne die Aufmerksamkeit aller zu erregen. Wie stelle ich das an?
Die Haustür geht auf und bietet mir die Gelegenheit dem Geschehen zu entkommen. Ich springe vom Stuhl hoch und schieße wie ein Pfeil ins Freie. Die Erklärung für mein plötzliches Verschwinden überlasse ich dem Eintretenden. Er wird es ausbaden müssen. Tat er ja immer.
*
„Die Indianer gehören in den Pappkarton und nicht auf den Kipper.“
„Die liegen doch schon seit gestern da“, versuchte ich mich zu rechtfertigen.
„Dann hast du gestern nicht ordentlich aufgeräumt“, entgegnete meine Mutter. Ende der Durchsage! Mit der Ordnung in meinem Zimmer hatte ich einen schweren Stand. Glaubte ich, mein Werk getan zu haben, fand sie immer etwas, dass ihr nicht gefiel. Die mütterliche Fürsorge, die sie meinem Zimmer angedeihen ließ, übertrug sie selbstverständlich auf das ganze Haus. Doch das Haus war widerspenstiger als ich.
Es war ein altes Fachwerkgemäuer mit kleinen Fenstern und niedriger Decke. Bevor meine Eltern das Haus bezogen, wohnten dort bereits über Generationen hinweg Spinnen. Spinnen, die fleißig ihre Netze webten und sich nicht von der Reinigungswut meiner Mutter beeindrucken ließen. Jeden Tag entstanden neue Netze. Ich wäre daran verzweifelt, doch meine Mutter hatte noch Zeit, sich um den Garten zu kümmern. Ihre ordnende Hand griff nach Obstbäumen, Blumen und Rasenfläche. Ohne Übertreibung konnte ich behaupten, dass in dieser Hinsicht keiner im Dorf an sie heranreichte.
„Den Indianern gefällt es, auf dem Kipper zu sitzen! Heute wollen sie nicht in den dunklen Karton zurück.“
Meine Gegenrede war eins mit einer plötzlichen Bewegung in Richtung Zimmertür. Doch meine Mutter war schneller und vereitelte die Flucht.
„Halt, mein Sohn, setz dich hin und hör zu.“
Jetzt musste ich wieder eine alte Geschichte aus ihrer Kindheit über mich ergehen lassen. Alle diese Erinnerungen begannen immer gleich, Wir waren arm, aber trotz allem sauber und ordentlich. Dieser Anfang schläferte mich sofort ein, sodass ich selten etwas mitbekam, doch heute war ich zu munter.
„Im Sommer liefen meine Brüder und ich den ganzen Tag barfuß herum. Abends vor dem Schlafengehen mussten wir dem Vater unsere Füße vorzeigen. Waren sie ihm nicht sauber genug, half er mit einem Ziegelstein nach. Meine Brüder mussten diese Prozedur regelmäßig über sich ergehen lassen, während sie mir in meiner Kindheit erspart blieb. Rate mal, warum?“
Ich zuckte mit den Schultern.
„Weil ich immer saubere Füße hatte!“ Jetzt leuchteten ihre Augen voller Stolz, doch ich war nur froh, dass wir uns Seife leisten konnten. Was hatte das alles mit den Indianern auf dem Kipper zu tun?
*
Der nächste Tag war ein wunderschöner Sonnabend. Seit dem frühen Morgen fuhren die Erntefahrzeuge mit ihren Hängern die Dorfstraße immer wieder entlang. Ich machte mir darüber keine Gedanken, bis ich die Straße sah, die ich zu kehren hatte. Stroh lag überall auf den Wegen und hing in den Bäumen. Mit meinem Rechen erledigte ich die ungeliebte Arbeit auf die schnelle Art. Doch kaum war ich mit dem Harken fertig, lag alles erneut voller Stroh.
Da meine Mutter meine häuslichen Arbeiten kontrollierte, begutachtete sie auch das Straßenreinigen. Als sie nun die Straße in besagtem Zustand vorfand, schickte sie mich sofort wieder hinaus.
„Das nennst du sauber? Stell dich bloß nicht so an. Auf ein neues, ab marsch!“
Nach dem dritten Versuch an diesem Tag, die Straße vom Stroh zu befreien, meuterte ich. Das rief sogleich meinen Vater auf den Plan. Für Meuterei war er zuständig. Doch diesmal hatte ich Glück. Nachdem sich mein Vater ein Bild von der Lage gemacht hatte, erkannte er, in welcher Klemme ich steckte.
„Jetzt ist aber Schluss mit dem Unsinn!“, rief er und nahm mir den Rechen weg. Ja, mein Vater sah die Dinge lockerer. Doch um des lieben Friedens Willen widersprach er meiner Mutter nur selten. Während andere Väter Samstagabend mit ihren Kumpanen in der Dorfkneipe zechten, war meiner zu Hause im Kreis seiner Familie.
Steffen erzählte davon, wie es war, wenn sein Alter nachts sternhagelvoll nach Hause kam. War er schlecht gelaunt, bezogen Steffen und sein älterer Bruder schon mal Prügel nur für ihre bloße Anwesenheit. Das blieb mir alles erspart. Bei mir verhielt es sich eher umgekehrt, ich bekam den Hintern versohlt für meine Abwesenheit.
Es gab viele Dinge, die mich ablenkten und die Zeit vergessen ließen. Meistens merkte ich am Dunkelwerden, dass ich spät dran war. Dann rannte ich sofort nach Hause, um zu retten, was noch zu retten war. Langsames Gehen hätte völlig genügt, denn der Ärger war nur selten aufzuhalten. Alles, was ich zu meiner Entschuldigung sagte, konnte meinen Vater nicht umstimmen, meine Strafe fallen zu lassen. Nun gut, ich hatte das Abendessen um eine Stunde oder etwas mehr verpasst. Doch jetzt war ich schließlich wieder bei ihnen. Wussten meine Eltern denn nicht, dass mir beim Spielen nichts passieren konnte?
Offensichtlich stand ich mit dieser Ansicht allein da. Meine Eltern waren der Meinung, ich hätte absichtlich gegen die Regel der Pünktlichkeit verstoßen. Vater packte mich am Kragen und seine Sorgen, die er sich meinetwegen gemacht hatte, strömten in seine rechte Hand, die daraufhin kräftig mein Hinterteil gerbte.
„Junge, was soll nur aus dir werden?!“, skandierte meine Mutter im Rhythmus der Schläge. Es gehörte zur Tradition, das jedes Mal, wenn ich eine Tracht Prügel bezog, meine Zukunft beschworen wurde. Im Gegensatz zu meiner Mutter machte ich mir darüber keine Sorgen, wenn nur die Schläge bald aufhörten. Die Zukunft war so weit weg wie der Mond. Für mich zählte einzig die Gegenwart (ohne dass ich mir dessen bewusst war). Das Abenteuer lag vor der Haustür und ich packte es entschlossen beim Schopfe. Die Folgen bekam ich später zu spüren. Doch bekanntlich bereut man nur verpasste Gelegenheiten.
*
Waren die Sonntage für andere auch so unerfreulich wie für mich? Diese Frage stellte ich mir immer wieder. Reichte es nicht schon, am nächsten Tag wieder zur Schule gehen zu müssen? Nein! Sonntags gehörte ich der Familie und das hatte Konsequenzen. Ich musste mit meinen Eltern spazieren gehen. Dafür wurde ich fein angezogen. Im allgemeinen hatte ich nichts gegen die Sachen einzuwenden, die meine Mutter für mich herauslegte, doch seit ich eine Hose mit Gürtel besaß, wollte ich keine mehr mit Hosenträgern anziehen. Hosenträger waren etwas für kleine Jungen. Männer trugen Gürtel. Das besagte jedenfalls meine Philosophie. Ich rebellierte offen gegen die Entscheidung meiner Mutter.
„Heute ist Sonntag und da musst du doch ordentlich aussehen“, kam es von ihr zurück. Gegen diese Art der Argumentation konnte ich nichts ausrichten. Ordentlich! Wenn ich dieses Wort aus dem Mund meiner Mutter hörte, überkam mich ein unwiderstehlicher Brechreiz. Ordentlich zu sein, war zu einer Art Ersatzreligion für sie geworden. Trotzig verschränkte ich meine Arme vor der Brust. Meinem Vater riss wie üblich der Geduldsfaden.
„Gut, du sollst deinen Gürtel haben“, rief er, während er ihn aus den Bundschlaufen der Hose herauszog. Unbeherrscht schlug er damit auf mich ein. Jetzt hatte ich die Gelegenheit zu zeigen, ob ich den Gürtel wirklich verdiente. Ich unterdrückte meine Tränen und schluckte den Schmerz hinunter. Obwohl ich das ganz gut hinbekam, blieb die Belohnung aus. Ich zog also die Hose mit den Hosenträgern an.
Nicht, dass ich durch Schläge formbar gewesen wäre, nein, ich folgte nur dem Lieblingsspruch meines Vaters, Der Klügere gibt nach. Seinerseits leider nur ein Lippenbekenntnis.
Sonntage wie dieser boten sich immer wieder an, über meine Eltern nachzudenken. Die beiden Menschen, die mir am nächsten standen, waren die, welche ich am wenigsten verstand. Außerirdische mögen fremdartiger aussehen, doch konnten sie unmöglich eigenartiger sein als meine Eltern.
Doch will ich mich nicht beschweren. Wahrscheinlich wunderten sie sich im gleichen Maße über mich und fragten sich, warum mir das Tragen von Hosenträgern auf einmal nicht mehr genehm war. Als ordentlicher Sohn hatte ich doch nur zu gehorchen und damit basta!
Nicht immer verliefen die Vorbereitungen zum Sonntagsspaziergang so drastisch. Manchmal wurde nur darauf bestanden, dass ich meine Schuhe noch einmal putzen musste oder mir die Hände gründlicher waschen sollte oder meine Haare richtig zu kämmen hätte oder alles zusammen.
Doch ich hatte auch meinen Spaß. Mein Vater rasierte sich immer vor dem Spaziergang und fluchte laut, wenn er sich schnitt. Da er sich regelmäßig schnitt, fluchte er immer. Wegen dieser Flüche hätte mein Vater eigentlich exkommuniziert werden müssen, doch bekam er nur die Zurechtweisung meiner Mutter zu hören.
“Vater! Ich bitte dich, hör mit dem Fluchen auf!“
Ich wünschte mir, ich hätte jedes Mal einen Pfennig bekommen, wenn ich sie diesen Satz sagen hörte. Mein Glück wäre gemacht. Vater hingegen schien überhaupt nichts zu hören. Bei nächstbester Gelegenheit würde er erneut fluchen. So war es immer.
Meine Hand lag auf der Türklinke, bereit sie hinunterzudrücken, als meine Mutter plötzlich feststellte, dass ihre Strumpfhose eine Laufmasche hatte. Ich wartete förmlich auf die verbale Attacke meines Vaters. Sie fiel so drastisch aus, dass es meiner Mutter die Sprache verschlug. Das war neu für mich. Bis dahin hatte ich nicht geglaubt, dass es möglich wäre, ihre nervtötenden Zurechtweisungen abzustellen.
Nach den vielen Verzögerungen traten wir endlich geschlossen auf die Straße, um die harmonische Familie schlechthin zu verkörpern. Meine Mutter, elegant gekleidet (für jemanden aus unserem Dorf), hakte sich bei meinem Vater unter. Was für ein schönes Paar. Und dann erst meine Wenigkeit. Meinem Benehmen sah man die im Vorfeld ausgetragenen Unstimmigkeiten nicht an. Ich tat so, als könne ich kein Wässerchen trüben. Kommt herbei, ihr Leute und schaut auf dieses Glück (und werdet grün vor Neid)!
*
Wie vom Blitz gerührt schnellte ich hoch. Mit weitaufgerissenen Augen stierte ich ins Dunkel. Mein Puls raste. Endlich begann mein Gehirn zu arbeiten und gab Entwarnung. Ich befand mich zu Hause in meinem Bett. Wo auch sonst hätte ich mich zu nachtschlafender Zeit aufhalten sollen? Ein scheußlicher Traum hatte mich gequält. Nichts von Bedeutung. Nur mein Schlafanzug war völlig verschwitzt. Ich stand auf und zog mir einen trockenen an. Dann drehte ich die Decke mit der nassen Seite nach oben und ging wieder ins Bett. Doch der Schlaf wollte nicht kommen. Ich wälzte mich von einer Seite zur anderen.
Meine Mutter sagte immer, Wenn du nicht einschlafen kannst, zähle einfach Schäfchen. In abgewandelter Form folgte ich ihrem Rat und rechnete statt zu zählen. Quadratzahlen hatten es mir angetan. Ich bildete sie nach folgender Methode: Die Differenz zweier aufeinanderfolgender Quadratzahlen um zwei erhöht und auf die größere der beiden addiert, ergibt die nächste und immer so fort. Das funktionierte. Wirklich.
Ein fanfarenartiges Aufstehen weckte mich. Meine Mutter hatte die Angewohnheit, die Tür meines Zimmers zu öffnen und den Raum mit ihrer Stimme zu füllen. Da gab es kein Entkommen. Ihre Stimme war wie der Klingelton eines Weckers, den ich nur durch schnelles Aufstehen abstellen konnte. Heute wollte ich mir weitere Fanfarenrufe ersparen. Außerdem musste ich zur Schule gehen. Und der Schulbus wartete nicht auf Trödelfritzen.
Beim Anziehen ging mir die Zahl 69 durch den Kopf. Beim Zähneputzen und Waschen ebenso.
„Kann jemand von euch etwas mit der Zahl 69 anfangen?“, rief ich meinen Eltern entgegen, als ich mich zu ihnen an den Frühstückstisch setzte.
Ich erntete verständnislose Blicke. Überzog sich das Gesicht meiner Mutter mit einer leichten Röte? Was hatte ich nun schon wieder angestellt? Meine Mutter, so nahm ich an, würde nur bei dem Thema rot werden, das in meinem Beisein nie zur Sprache kam. So unwahrscheinlich es auch klingen mochte, die Zahl 69 musste etwas mit Sex zu tun haben.
„Du hast nur schlecht geschlafen. Trink erst mal einen Schluck Milch“, sagte mein Vater und unterbrach meine Gedanken. Ich durchschaute sein Ablenkungsmanöver, aber an seiner Bemerkung, schlecht geschlafen zu haben, war etwas Wahres dran. Mit der Schnelligkeit eines Faultiers, das sich an einem Ast entlang hangelt, fügten sich die Erinnerungsstücke der vergangenen Nacht wie ein Puzzle zusammen. Warum um alles in der Welt hatte ich so grässliches Zeug geträumt, dass ich davon klatschnass aufwachen musste? Und wo zum Teufel war nur der verschwitzte Schlafanzug abgeblieben? Egal, er würde sich schon wieder anfinden.
Auf einmal wusste ich, warum mir die Zahl 69 andauernd im Kopf herumspukte. Bei dem Versuch, 69 auf die letzte Quadratzahl zu addieren, bin ich gescheitert. Gescheitert wie ein Hochspringer, der sich die Latte für seine Tagesform zu hoch aufgelegt hat. Und das wieder und immer wieder. Darüber musste ich eingeschlafen sein. Schon verrückt, was einen in den Schlaf lullt. Wenn ich die Aufgabe zu Ende gerechnet hätte, wäre ich auf 1225 gekommen. Dies ist 35 zum Quadrat und hat mit Sex bestimmt nichts zu tun. Das wäre fürs Erste geklärt. Aber wo befand sich mein Schlafanzug?
*
In unserem Nest passierte nicht viel, was einen Jungen wie mich interessierte. Geschah etwas, ereiferten sich immer die Erwachsenen und zerrissen sich die Mäuler über die Betroffenen. Meine Eltern bildeten da keine Ausnahme. Doch bekam ich nie Klatschgeschichten zu hören, weil ihre Unterhaltung sofort verebbte, wenn ich mich ihnen näherte. Da immer nur den anderen etwas widerfuhr, blieb meine Welt davon unberührt. In unserer Familie verlief alles in geregelten Bahnen. Mit anderen Worten, es war langweilig.
Doch dann besuchte uns Tante Anna. Das war nicht gerade ungewöhnlich, denn sie schaute häufig vorbei, sagte Hallo und verschwand wieder. Sie war die jüngere Schwester meines Vaters und wohnte in der Stadt. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie kam nur, um mich in ihre Arme zu nehmen und mir nasse Küsse aufzudrücken. Ich ließ es gleichmütig über mich ergehen.
Doch diesmal hatte sie einen besonderen Grund, uns zu besuchen. Sie wollte ihr Kätzchen abholen. Die Mausi hatte wieder einmal Nachwuchs bekommen.