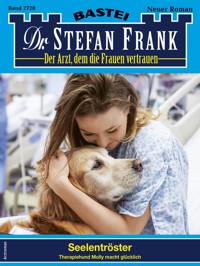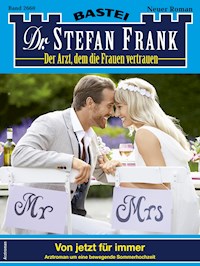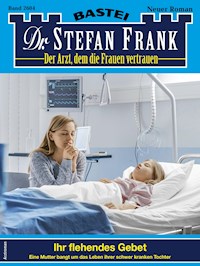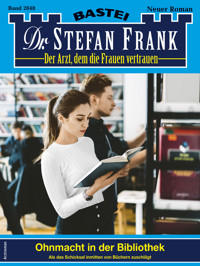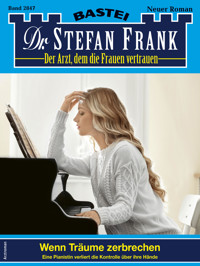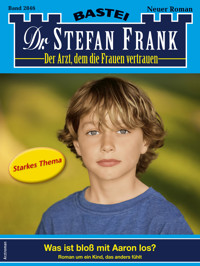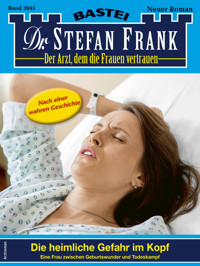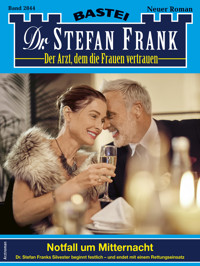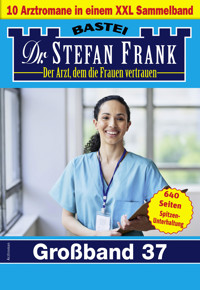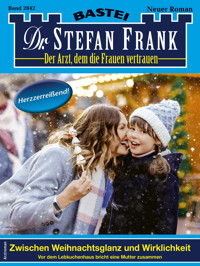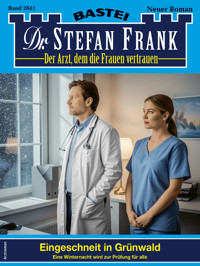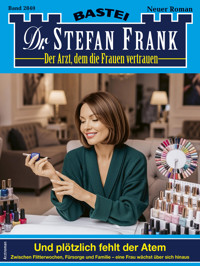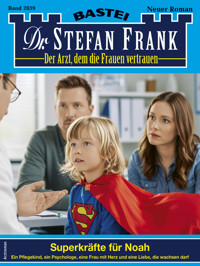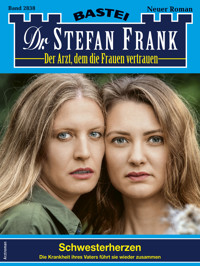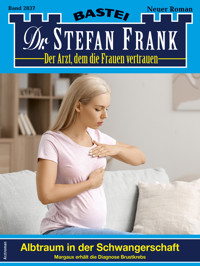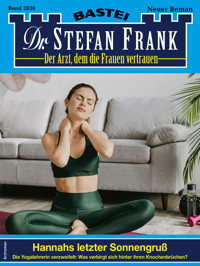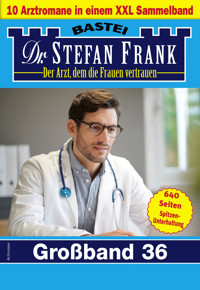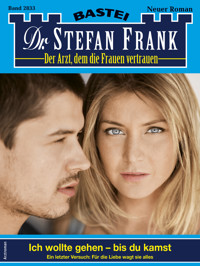Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas Zett kennt sich auf vielen Schlachtfeldern aus. Sein Ruf als Leibwächter war legendär, bevor er seinen letzten Boss verriet, um einen Anschlag in Israel zu vereiteln. Seitdem jagt ihn Hisbollah. Zett lebt mit falschem Namen und kunsthistorischem Doktortitel in Köln. Das neue Gesicht stammt aus der plastischen Chirurgie, die Ersparnisse schrumpfen, und vierzig Jahre auf dem Buckel machen einen Neuanfang als Söldner schwierig. Außerdem randaliert der tote Freund und Mentor Willem Cloerkes in seinem Kopf. Zetts Traumata haben ihn fest im Griff. Da erreicht ihn im November 2003, Bushs Irakkrieg ist wenige Monate alt, das Angebot eines europäischen Thinktanks. Der richtet gerade eine internationale Konferenz aus und bietet Zett einen Kontrakt als Personenschützer. Zum Einstand jedoch soll der "Doktor" eine spleenige kleine Recherche über Vittore Carpaccios Ursula-Gemäldezyklus in Venedig unterstützen. Zett stolpert in eine kontrafaktische Welt, wo nicht einmal mehr die Legenden vertraute Muster bedienen. Im Kreuzfeuer aus Kunst, Verrat und großer Diplomatie versucht er zu überleben – und zu verstehen, welche Rolle die schöne Susanne spielt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Frank
Der Kontrakt des Söldners
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Kölner Archiv. Samstag, 6.12.2003, 15:00 Uhr
2. Köln und Venedig. 17. bis 18.11.2003
3. Torcello. Dienstag, 18.11.2003
4. Venedig. Mittwoch, 19.11.2003 bis Freitag, 21.11.2003
5. Venedig. Freitag, 21.11.2003, nachts
6. Venedig. Samstag, 22.11.2003 bis Samstag, 29.11.2003
7. Kölner Archiv. Samstag, 29.11.2003
8. Köln, Wallraf-Richartz-Museum. Samstag, 29.11.2003
9. Köln. Samstag, 29.11.03, abends
10. WRM. Sonntag, 30.11.03, nachmittags
11. Köln. Sonntag, 30.11.2003 bis Montag, 1.12.2003
12. Köln, St. Ursula. Montag, 1.12.2003
13. Köln – Wien – Köln. Dienstag, 2.12.2003
14. Kölner Archiv. Dienstag, 2.12.2003
15. Köln, WRM. Mittwoch, 3.12.2003
16. Kölner Archiv. Mittwoch, 3.12.2003
17. Köln. Donnerstag, 4.12.2003
18. Köln, Hotel Kiesel Palace. Donnerstag, 4.12.2003
19. Kölner Archiv. Donnerstag, 4.12.2003
20. Hotel Kiesel Palace. 4.12.2003 bis 5.12.2003
21. WRM. Freitag, 5.12.2003
22. Köln. Freitag, 5.12.03, nachmittags
23. Kölner Archiv. Freitag, 5.12.2003
24. WRM. Samstag, 6.12.2003
25. Köln, Taxi. Samstag, 6.12.2003
26. Kölner Archiv. Samstag, 6.12.2003
27. Kölner Archiv. Samstag, 6.12.2003
28. Kölner Archiv. Samstag, 6.12.2003, nach 15.00 Uhr
29. Kölner Archiv. Samstag, 6.12.2003
30. Kölner Archiv. Samstag, 6.12.2003
31. Kölner Archiv. Sonntag, 7.12.2003, 1:00 Uhr
32. Torcello. Dienstag, 6.01.2004
Dank:
Impressum neobooks
1. Kölner Archiv. Samstag, 6.12.2003, 15:00 Uhr
Sogar beim Training mit den Navy Seals, etwa nach sechsunddreißig Stunden ohne Schlaf, äußerlich übersät mit Prellungen und Schürfwunden, inwendig verknotet von Muskelkrämpfen, hatte Thomas Zett auf seinem Feldbett immer noch eine Seite John Ruskin gelesen, »Die Steine von Venedig«, ehe er vor der Müdigkeit kapitulierte. Insofern war es unfair, was hier abging.
Doch nicht der Mangel an Fairness erschreckte ihn zutiefst, sondern die Art und Weise, wie diese Frau im businessmäßigen Hosenanzug, die Hose weit geschnitten über ihren dünnen Beinen, sich zusehends im Gestrüpp ihrer Loyalitäten verhedderte. Wie sie mit der Pistole herumfuchtelte, die Legende zerfetzte, seinen fiktiven Lebenslauf, den doch Karl Bucholtz höchstpersönlich abgesegnet hatte.
„Von wegen Kunsthistoriker“, legte sie nach, „du Ursulalegenden-Hochstapler, du überreifer Doktor Sixpack!“
Ihre Stimme überschlug sich in schriller Körperfeindlichkeit, die schlecht zu ihrem eigenen austrainierten Körper passte. Fast selber eine Kampfmaschine, dachte Zett, der Körper einer Läuferin. Das schmale Gesicht melancholisch mit Ringen unter den Augen, wie von einer zu strammen Schwimmbrille.
„Deinen Bonus kannst du jetzt abschreiben. Sei froh, wenn du hier lebend rauskommst!“
„Achten Sie nicht auf das Geschwätz“, nuschelte der Mann im Rollstuhl. „Und Sie halten die Schnauze, Peeters!“
„Sonst was, Herr Lank?“ Sie trat zu Lank, hielt die Waffe allerdings zunächst auf Zett gerichtet, trat zwischen die Vorderreifen des Rollstuhls, und weil klar war, dass Lank den Kopf nicht in den Nacken legen konnte, beugte Peeters sich vornüber und stützte ihre freie Faust auf den Oberschenkel. So gebückt und auf Augenhöhe herrschte sie Lank erneut an: „Sonst was…!“
Zett konnte ihre feuchte Aussprache gut sehen. Lank musste sie wohl spüren.
Das Büro im Erdgeschoss war gediegen eingerichtet, sozusagen Bonner Republik, wobei die irritierende Parksituation in der Auffahrt der großbürgerlichen Fassade jede Menge Risse zufügte. Die gepanzerten Bentleys und Mercedes’ vor den Fenstern mochten ja noch angehen, aber dazwischen parkten auch Hummer mit verchromten Kuhfängern, die neuste Zivilversion des militärischen Humvee der US-Armee. Zett hatte nicht viel Ahnung von Autos, aber dass es – trotz der aktuellen Werbebilder aus dem Irakkrieg – fast unmöglich war, solche Schlachtschiffe nach Deutschland zu importieren, das wusste er genau.
Rings um die neun Fahrzeuge patrouillierten Dreiergrüppchen finster blickender Chauffeure. Männer aus aller Herren Länder. Breitschultrig. Steifbeinig. Bürstenhaarschnitt. Drei Gruppen zu drei Mann, strikt auf Distanz bedacht.
Was Zett anfangs für eine traditionsbesoffene Briefkastenfirma in Sachen internationaler Diplomatie gehalten hatte, entpuppte sich mehr und mehr als paramilitärischer Thinktank, in dem es beißend nach Gefahr stank. Sogar eine Frau Peeters im Büro kickboxte gut genug, um einem Profi wie Zett die Waffe aus der Faust zu treten. Nun pochte und schwoll die eh schon übel verletzte Hand, während Zett versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
Vor einer Stunde, als sie ihn begrüßte, hatte Peeters sich noch durchaus zivilisiert betragen. Ruppig aber zivilisiert. Umso bestürzender wirkte jetzt das Gefuchtel, das sie mit der Waffe, die einmal Zett gehört hatte, im Gesicht des wehrlosen Rollstuhlfahrers aufführte. Sie stippte Richard Lank den Lauf der Makarow gegen die Nase und bohrte das Metall abwechselnd in seine Mundwinkel.
„Sonst was, Herr Lank?“, flüsterte sie dramatisch.
Lank nutzte seinen Spielraum von ein oder zwei Zentimetern, um den Joystick zwischen die Lippen zu bekommen, mit dem er den Rollstuhl lenkte. Da Peeters den Druck ihrer Pistole eher noch verstärkte, schrammte die Mündung einen rosa Streifen über Lanks Wange, als das Gefährt plötzlich losruckelte.
Zett schaute zu und suhlte sich in seiner Schmach. Es gab keine Entschuldigung. Natürlich war er todmüde, angeschossen und zugedröhnt mit Dexamethason. Trotzdem war es unprofessionell gewesen, dieser Frau auch nur eine Sekunde lang mit gesenkter Pistole zu begegnen. Peinlich leicht hatte er es ihr gemacht, die Schuhspitze – diese schicke Metallapplikation ihres Pumps – an seine Rechte mit der Makarow zu bringen. Dabei hatte Bucholtz ihn gewarnt: „Sie ist ein raffiniertes Biest!“ Nun musste Zett den Bonus wohl tatsächlich abschreiben, obwohl ... Lank zumindest schien ihm nichts nachzutragen, sondern stoppte den Rollstuhl kameradschaftlich an seiner Seite, offenbar um ein zusätzliches Hindernis zwischen Peeters und die Tür zu stellen.
„Sie kommt hier nicht raus“, schniefte er. „Man kann die Fenster nicht öffnen. Schalldichte Scheiben, schussfest und vom Park her blind. Da nicht mal Peeters so verantwortungslos wäre, hier ein Handy zu benutzen, führt ihr Weg hinaus nur über unsere Leichen oder das Festnetz.“
Gut fünf mal fünf Meter Büro. Eine Wand mit den Fenstern zur Auffahrt. Gegenüber, hinter Zett und Lank die Schiebetür aus Bleiglas mit floralem Dekor, dessen Rot, Blau und Türkis bei Zett Erinnerungen an die kolumbianischen Aras wachrief. Da war die Hand noch heil und er konnte noch klettern.
An zwei Wänden halbhohe Regale mit Aktenordnern und einem grauen Koffer. In der Mitte der Schreibtisch, um dessen Kanten ein Band aus Perlmuttintarsien lief, abgestimmt auf das Dekor der Borde und Stuhllehnen. Alles sehr aufgeräumt. Zu aufgeräumt für echte Arbeit, offenbar, weil der Raum dem Hausherrn nur als offizielle Fassade diente – am Parktor hatte Zett ein Import-Export-Schild gesehen.
Dem kunsthistorischen Hochstapler Zett summte die Stimme seines toten Mentors Willem Cloerkes im Ohr: „Hübsche Jugendstilmöbel haben die hier! Schätz das ruhig mal, mein Junge, nur so zum Üben, der Schreibtisch tausend -, die Regale je vierhundert Dollar, sagen wir lieber dreihundertfünfzig, die Stühle achtzig pro Stück ...“ Schon trudelten Erinnerungen noch weiter zurück, zu kostspieligen Bildbänden in der elterlichen Buchhandlung, Jahrzehnte, bevor man anfing, so etwas im deutschsprachigen Raum Coffee Table Books zu nennen ... mach keine Eselsohren, hörst du!
Die übliche Büroelektronik und farblich dazu passend perlgraue Seidenpolster auf den Stühlen. Ein achteckiger Aschenbecher aus fast durchsichtigem Porzellan, in dem jemand einen halb gerauchten Zigarillo ausgedrückt hatte, einen unten zerfaserten Stumpen, der oben fast senkrecht stehen geblieben war. Komisch, dachte Zett, er hatte Bucholtz niemals rauchen sehen. Dann fiel ihm ein, dass Bucholtz hier gar nicht der Hausherr war, auch wenn er dieser internationalen Konferenz vorsaß, um die sich gerade alles drehte.
„Lank, ich rufe jetzt den Chef an und bitte ihn, Karl Bucholtz abzulösen. Kommen Sie oder Ihr bestusster Söldner mir quer, dann schieße ich. Ist das verstanden?“
„Klar doch, Herzchen“, blaffte der Schmerzensmann im Rollstuhl. Der Gegensatz zwischen seiner Figur und dem Machospruch verblüffte alle drei – Lank selbst vielleicht am allermeisten. Er flüchtete aus der Peinlichkeit in heiseres Kichern, das zum Röcheln wurde, so brustzerreißend, dass Zett sich besorgt zu ihm hinab beugte, um in dieser Position, zwischen zwei Atemzügen, den gekeuchten Befehl aufzuschnappen: „Schieß!“, bevor das Röcheln doppelt so laut weiterging.
Dann musste das jetzt wohl so sein. Ein Showdown war ein Showdown. Zett stand ohnehin mit gebeugtem Oberkörper da – ein Anblick, der bei Peeters keine Reflexe mehr auslöste. Höchstens weitere fünfzig Zentimeter trennten seine Hand von der kleinen Smith & Wesson am Knöchel. Also ging er mit geheuchelter Fürsorglichkeit neben Lank in die Hocke, wobei der gestrige Streifschuss am Oberschenkel wieder aufplatzte. Dafür allerdings rutschte das Hosenbein ein Stück höher und gab den Klettverschluss über dem Strumpf frei. Er zog die Smith & Wesson und schoss das Telefon samt Ladestation vom Schreibtisch, bevor er sich aufrichtete, um den Anblick der entgeisterten Peeters zu genießen. Draußen hatte niemand was gehört. Ein hemdsärmeliger Mann mit Headset servierte den Fahrern Espresso.
„Das Telefon ist wohl im Arsch ... Herzchen!“, stichelte Lank. „Und Sie, mein lieber Doktor Zett, sorgen sich bitte nicht um Ihren Bonus!“ Das Röcheln war Lank mit Zetts Treffer vergangen. „Dieses Theater strengt mich doch ziemlich an ...“
„Herr Czartoryski verdoppelt Ihr Honorar, wenn Sie mich mit ihm sprechen lassen“, verkündete die Peeters.
„Wollen Sie trommeln?“, fragte Zett. „Rauchzeichen geben?“
Lank begann erneut zu röcheln, als Peeters’ freie Hand blind die Tastatur des Notebooks fand. Das Telefon war zwar geschrottet, aber der Kabelanschluss funktionierte wohl noch. Typisch, dass sie kein W-LAN benutzen, dachte Zett, gesundes Misstrauen gegenüber drahtlosen Netzen! Er schoss. Die Steckdose qualmte. Irgendwo im Haus schrillte ein Alarm, verstummte aber gleich wieder, da man die Konferenzteilnehmer offenbar nicht beunruhigen wollte.
Peeters richtete Zetts Makarow nun auf das große Fenster. „Lasst mich raus, oder ich schieße“, drohte sie.
„Tsss ...“, machte Lank. „So ein Eklat bei der Konferenz amüsiert weder Bucholtz noch Czartoryski. Außerdem schießen Sie auf Panzerglas. Wahrscheinlich hört man draußen gerade mal ein Knistern. Ich schlage vor, Sie lassen den Quatsch!“
„Sie schäbiger Verräter! Der Chef hat Ihnen nie etwas getan!“
„Ich ihm doch auch nicht“, erwiderte Lank. „Tatsache ist aber nun mal, dass Czartoryski ein großer Visionär ist und im Kampf ein mächtiger Anführer, jedoch als Moderator eine glatte Null. Er würde die Konferenz in fünf Minuten an die Wand fahren. Viel zu schnell gekränkt, viel zu großes Ego und dabei nicht halb so gerissen wie Bucholtz. Nur unter Karls Vorsitz haben wir eine Chance.“
„Aber wie soll denn ausgerechnet Bucholtz noch vermitteln?“, rief sie, nun fast mit Tränen in der Stimme. „Er ist doch inzwischen selber Partei – erpresste, von draußen manipulierte Partei!“
„Und wer bitte weiß in diesem Augenblick, dass er erpresst wird?“, fragte Lank. „Außer ihm selbst, Ihnen, mir und unserem Doktor Zett hier? Wer bitteschön weiß unten am Konferenztisch, dass man Karl erpresst?“
„Der Erpresser, falls er mit am Tisch sitzt“, sagte Zett.
Peeters dankte ihm mit enthusiastischem Nicken.
„Allenfalls der“, brummte Lank widerwillig. „Aber weder der, noch die anderen, noch ihr zwei habt die geringste Ahnung, wozu Karl fähig ist, wenn man ihn in die Enge treibt.“ Lank zögerte, bevor er schloss: „Zielen Sie auf Frau Peeters’ Kopf, Doktor Zett, und sobald die Dame ihre Waffe wieder auf das Fenster richtet, drücken Sie ab.“
„Sonst können Sie Ihren Bonus vergessen, Doktor ehedem Sixpack“, ätzte die Peeters. Zett trat auf sie zu, mit kurzen, vorsichtigen Schritten. Nur keine Eile, keine Bedrängnis! „Angst, Sie schießen auf zwei Meter daneben?“, spottete sie.
Näher. Noch näher.
Er starrte in das neun Millimeter kleine Loch, das im Normalfall die Mündung seiner vertrauten SIG Sauer 229 gewesen wäre. Die ungewohnte Makarow hatte er nur genommen, um notfalls den perfekten Schalldämpfer des Fabrikats zu nutzen. Der steckte jetzt in der Innentasche seines Sakkos. Wenn sonst nichts mehr half, konnte er damit immer noch werfen oder zuschlagen. Bestimmt ein Ehrenplatz in der Hall of Fame seiner Einsätze: Sich erst von der Frau die Knarre aus der Hand treten lassen und die Gegnerin dann mit dem Schalldämpfer ausknocken!
„Sie schießen nicht auf mich“, sagte er. „Vielleicht aufs Fenster, aber nicht in meinen Kopf. Geben Sie mir jetzt die Waffe!“
„Passen Sie auf, die legt Sie wieder rein!“, schimpfte Lank, doch Peeters zuckte nur die Achseln.
„Das ist es nicht wert“, sagte sie.
„Meine Pistole“, beharrte Zett.
Peeters rührte sich nicht. Sie zielte immer noch auf ihn, so wie er auf sie. Behutsam hob Zett seine Linke und hatte fast die Waffe gegriffen, da öffnete sich Peeters’ Faust und die Neunmillimeter polterte zu Boden. Peeters nutzte die Schrecksekunde, den Zwiespalt ihres Gegners ... Waffe sichern oder Feind stellen? ... nutzte den winzigen Vorsprung, den sie sich verschafft hatte, um Lanks Rollstuhl am Rad zu packen und von der Schiebetür weg zu kippen, sodass Lank ausgerechnet mit seinem lahmen Kreuz übers Parkett schlitterte, schweigend, ohne Wehlaut, still auch noch, als Zett mit schmerzverzerrtem Gesicht über ihn hinweg sprang und Peeters zu Boden warf.
Auf dem blanken Fischgrätparkett drei lädierte Körper und der umgekippte, wild piepende, Hightech-Rollstuhl. Jetzt allerdings macht Zett Ernst. Ein Schlag an den Hals raubt Peeters den Atem. Noch während sie japst, trifft der Kolben seiner Waffe sie über der Nasenwurzel. Niemand ist so leicht zu kontrollieren wie ein Gegner, dessen Tränendrüsen gerade den Impuls für maximalen Ausstoß bekommen. Allerdings tut der Hieb auch Zett nicht gut. Anfangs wallt der Schmerz noch scheinheilig langsam aus der Hand über Arm und Schulter in den Brustkorb, beschleunigt dort aber und bohrt sich zuletzt hochtourig in den Solarplexus.
Nun übernimmt vollends der Berserker das Kommando, der Berserker in Zett, dem Scham, Furcht, rotglühender Schmerz und das nie mehr abwaschbare Gefühl von Cloerkes’ Gehirnklümpchen durch die Synapsen rasen. Dieser Berserker schließt die Faust um Peeters’ Kehlkopf und drückt ihr die Mündung seiner Smith & Wesson in den Augenwinkel, dort, wo es schön weich ist. Das tut der Hand nicht weh.
2. Köln und Venedig. 17. bis 18.11.2003
Mit Autobomben bei den Istanbuler Synagogen Newe Schalom und Beit Israel hatte der antisemitische Terror, in der Türkei völlig neu, auf einen Schlag vierundzwanzig Tote und zweihundertfünfzig Verletzte gekostet. Während die Fernsehbilder von der Straße zum Galataturm liefen, die Zett selbst oft genug mit bandagiertem Gesicht hinauf gestapft war zur postoperativen Nachsorge, hatte er den Gestank von Betaisodona nicht aus der Nase gekriegt.
Nur allmählich fand er zur gewohnten Form zurück, dank abgeschaltetem Fernseher und leeren Mailboxen – und auch nur so lange, bis er im Flur den Umschlag entdeckte, der unter der Tür seiner Altbauwohnung durchgeschoben war. Unfrankiert. Ohne Adresse oder Absender. Fünf Fünfhunderteuroscheine für Spesen und ein Brief, der begann:
„Verehrter Doktor Zett! Wir sind weder Hisbollah noch Al Quaida, was Sie unschwer daran erkennen, dass Sie bei bester Gesundheit Staub wischen, während zwei Fenster zum Lüften offen stehen und uns perfektes Schussfeld bieten ...“
Dann ging der anonyme Absender bestürzend genau auf Zetts windige Doktorarbeit über den Ursulalegendenzyklus im Wallraf-Richartz-Museum ein, blieb ansonsten aber ziemlich vage und schloss:
„Falls unser Angebot Sie kalt lässt, was immerhin sein könnte, denn weltweit führt kein Broker Ihren neuen Namen in seiner Kartei, machen Sie sich mit den Spesen einen schönen Abend. Bei Interesse jedoch suchen Sie uns bitte morgen in Venedig auf.“
Angebot? Welches Angebot?
An die so genannte Promotion mochte Zett gar nicht mehr denken. Er hatte, während er auf diverse Ziele schoss, eine Menge kunsthistorisches Zeugs geschrieben, hauptsächlich als Co-Autor von Willem Cloerkes. Und dass das Thema seiner Turbo-Dissertation, dieses überlebenswichtigen Mosaiksteinchens der neuen Identität, damals mehrfach willkürlich geändert worden war ... Schwamm drüber! Wer wusste schon, was in Professor Sturgesons korruptem Gehirn vorging? Nun schien es aber plötzlich so, als wäre damals eine dritte Partei beteiligt gewesen. Oder zumindest informiert. An sich schon beunruhigend genug. Partei? Vielleicht Allahs Partei? Hisbollah ...?
Schon die Erwähnung der Hisbollah machte Zett paranoid, zumal ihm tags darauf vor dem Reiterdenkmal Colleonis einfiel, dass hier ein betrogener Söldner in Bronze gegossen stand. Als man Zett aus dem Frühstücksraum zum Telefon in der Lobby gerufen hatte, um diesen Bronzereiter als Treffpunkt zu bestimmen, hatte er die Fakten nicht präsent gehabt, doch jetzt war ihm qualvoll bewusst, dass Colleoni, um der Gier der Serenissima ein Schnippchen zu schlagen, die Republik zur Alleinerbin bestimmt hatte, mit der einzigen testamentarischen Auflage, ihm vor San Marco ein Denkmal zu setzen. Leichtsinnigerweise schrieb er nicht ausdrücklich: vor der „Kirche“ San Marco. Die Republik wartete also den natürlichen Tod ihres Condottiere ab, kassierte die Barschaft, beackerte geerbte Ländereien und errichtete sein Standbild vor San Marco, allerdings nicht vor der Kirche, sondern vor der Scuola Grande di San Marco – dem zugegebenermaßen prächtigsten Gildenhaus der Stadt.
Das sähe Hisbollah ähnlich, dachte Zett, ihn mit perfidem Humor in die Falle zu locken! Da würden sie sich auf Taqīya berufen, die koranische Erlaubnis, im Kampf gegen Ungläubige zu lügen.
Es war eine rauchige Frauenstimme gewesen, morgens am Telefon im Hotel. Sie wussten also, dass er kein Handy benutzte, nicht geortet und nicht permanent abgehört werden wollte. Die Stimme aus dem vorsintflutlichen Bakelit-Hörer hatte ihm aufgetragen, er möge ein Tagesbillett für die Vaporetti kaufen und zum Colleonidenkmal kommen. Dort klebe am Gerüst der Restauratoren ein roter Zettel, Kanalseite, unterste Querstange.
Ein arabischer Straßenmusikant spielte eine Art Dudelsack. Kopfschüttelnd eilte eine Gruppe Venezianerinnen an ihm vorbei, die solche Töne in den Tagen Istanbuler Terrors wohl unangebracht fanden. Nur die jüngste der Frauen blieb stehen und hörte zu. Zett bückte sich routiniert, wie um die Schnürsenkel fester zu binden. Zwanzig Schritte weiter, hinter der Kirchenwand von Zanipolo, befanden sich das Epitaph und die abgezogene Haut Marc’Antonio Bragadins, den die Türken bei Famagusta so grausam getäuscht hatten. Dieses ausgeklügelte Arrangement betrogener Kämpfer war doch kein Zufall, verdammt!
Er las: „Fahren Sie zum Supermercato am Zattere und kaufen Sie dort die oberste Tube Zahnpasta Hyperdental. Hinter der Kasse öffnen Sie die Schachtel und lesen den Beipackzettel. Vernichten Sie jetzt diese Nachricht!“
Mit trübem Blick auf Colleoni, den posthum übervorteilten Bronzereiter, zerknüllte Zett das Papier und schnippte es in den Rio dei Mendicanti. Er war nicht mehr jung und brauchte das Geld – Hisbollah hin, Paranoia her.
Machte ihm jemand Zeitvorgaben? Nein! Also fuhr Zett den denkbar umständlichsten Weg, um herauszufinden, wer ihm durch mehr als zwei Wasserbusse folgte. Und bald hatte er den osteuropäischen Lockenkopf entdeckt. Ihre Hand trommelte mit langen, unlackierten Fingernägeln auf dem Holz der Gepäckablage. Peinlich achtete sie darauf, dass ihr Haar nicht die fettige Scheibe der Bootsbrücke berührte. Ganze fünf Mal musste sie mit ihm umsteigen, bevor Zett ihr den Gefallen tat, den Supermarkt anzusteuern.
Dort folgte er eine Weile der Putzmaschine, trödelte durch die frisch gewienerten Gänge und zog sogar die vorgeschriebenen Plastikhandschuhe über, um die Qualität unverpackter Birnen zu prüfen. Schließlich verlor sein eleganter Schatten die Nerven und rauschte an ihm vorbei zur Kasse, wohl um ihn draußen vor dem Eingang abzupassen. Was sie aufs Band legte, war ausgerechnet eine Zahnbürste – vielleicht ein Gag zu viel für Hisbollah. Vielleicht gehörte sie ja zu den neuen Auftraggebern. Jedenfalls merkte Zett, wie sich ein Teil seiner Verkrampfung löste, während er las: „Nehmen Sie beim Anleger Accademia die nächste Verbindung zur Fondamenta Nuove. Von dort fahren Sie nach Torcello und kommen zum Bootsanleger hinter Santa Maria Assunta. Behalten Sie die Zahnpastatube in der Hand. Wenn Sie auf dem Weg telefonieren oder ein Wort mit jemand wechseln, dann laufen Sie ins Leere. Verschlucken Sie jetzt das Papier!“
Draußen vor dem Markt schaute Zett sich um und entdeckte sie ein ganzes Stück weiter Richtung Salute, vertieft in einen Plan der Wasserbusse. Um sie zu provozieren, schlug er die Gegenrichtung ein, aber sie dachte gar nicht daran, ihm zu folgen, sondern schlenderte weiter bis zur Brücke über den Rio San Trovaso. Zett kehrte um. Der Rio war mit Eisenschotten abgedichtet und auf hundert Meter leer gepumpt, weil Fundamente ausgebessert werden mussten. Man sah die Baumstämme, auf denen Venedigs Steine ruhten. Auch Miss Lockenkopf besichtigte den entblößten Schlamm der Jahrhunderte und den Salzfraß am Mauerwerk des Squero di San Trovaso. Zett schmunzelte. Er ging nun zügig in Führung, hörte sie hinter sich stöckeln und fuhr auf dem Absatz herum.
Ertappt!
Aus dem Schwung heraus machte sie noch zwei, drei Schritte, bevor sie wie angewurzelt stand und erneut den Linienplan entfaltete. Nun stützte Zett seine Ellbogen auf die Balustrade der nächsten Brücke. Jetzt hatte er Zeit, und zwar im Überfluss. Miss Locke hielt das allerdings nur fünf Minuten aus. Dann stöckelte sie resigniert an ihm vorbei, stadteinwärts Richtung Accademia.
Ihre Wangenknochen traten spitz aus dem Gesicht hervor, in sonderbarem Kontrast zum weichen Mund und dem runden Kinn. Zu gerne hätte Zett gewusst, ob ihr die rauchige Frauenstimme gehörte, die ihm frühmorgens erste telefonische Weisungen erteilt hatte, doch ansprechen durfte er sie ja nicht.
Einsteigen. Umsteigen, in eins der großen Boote. Gleichmäßig klatschte das Wasser am Rumpf. Der Rücken Venedigs, die abgelegene Uferpromenade Fondamenta Nuove, lag bald weit hinter ihnen und geradeaus die Friedhofsinsel San Michele – was durchaus wieder als Hisbollahhumor durchging. Da es auf der Fähre nirgends Gepäckablagen gab, auf denen sie mit nervösen Fingern trommeln konnte, hatten Zett und seine Miss es sich auf dem Panoramadeck bequem gemacht, immer fest die nächsten Pali im Blick. Später dann, über der offenen Lagune, klarte der Novembermorgen auf, und Zett ahnte am Horizont verschneite Dolomitengipfel. Trotzdem blieb die leidige Frage nach der Stimme. Nur – wie brachte man jemand zum Reden, ohne selbst den Mund aufzutun? Vielleicht hundert Milligramm Zahnpasta in die Locken? Zett wartete, bis jeder Anflug Paranoia abgeklungen war, dann setzte er sich – in einem Karree von dreißig freien Plätzen – auf den Platz neben sie. Sie lächelte ihn an. Er lächelte zurück, allerdings sollte das Lächeln ihr sagen: Hey Locke, hör doch bitte auf mit dem Quatsch, lass uns den Rest der Strecke wie Profis abreißen! Dabei packte er wohl ein bisschen viel wortlosen Inhalt in sein Lächeln, jedenfalls verunglückte es, und sie wandte sich ab. Starrte geradeaus über die Salzwiesen.
Vielleicht eine halbe Seemeile weiter wurde ihm unbehaglich. Er stand auf und setzte sich auf seinen ursprünglichen Platz zurück, riskierte einen Blick – sie sah ihm direkt in die Augen. Was für ein unhaltbarer Zustand! Wieder stand er auf und schlenderte zur Heckreling, um das Kielwasser zu vermessen. Sollte sie ihm doch in den Rücken schießen mit ihrer schallgedämpften Waffe und anschließend die Treppe runter stöckeln in die überfüllte, miefige Kabine, um dort vielleicht noch mit rauchiger Stimme zu flüstern: „Allahu akbar!“
Er wartete. So wie am Bug das Wasser gleichmäßig klatschte, rauschte und schäumte es hinten monoton, wobei leider der Wind schlecht stand, und Zett reichlich Dieselabgase schluckte. Offenbar war sie nicht die Vollstreckerin. Ein Lockvogel, der seine Entschlossenheit zu schweigen testen sollte und ihn deshalb anflirtete? Hatte sie ihn eigentlich angeflirtet? Hielt sie die Zahnbürste in der Hand, bevor oder nachdem er seine Tube Zahnpasta gekauft hatte?
Cloerkes hatte ihm gepredigt, mein Junge, hatte er gepredigt, wir Männer bereiten die meisten unserer Niederlagen durch Selbsttäuschung vor. Der weise alte Großkotz … Gott, wie Zett ihn vermisste! Manchmal bedauerte er geradezu, nicht ein Fitzelchen Cloerkes konserviert zu haben. In den Jahren seitdem war er einer Frau begegnet, die trug die Kohlenstoffe ihres jung verunglückten Gatten, verdichtet zum winzigen blauen Kunstdiamanten, am Trauring. Lustige Spiele hatten sie gespielt mit dem Diamanten.
Mittlerweile war der Campanile von Santa Maria Assunta in Sicht. Zett stutzte, als die Fähre nicht direkt Kurs auf den Torcello-Anleger nahm, sondern nach Burano einschwenkte, aber gut, von dort ging ein Traghetto. Unten drängelten schon Lagunenbewohner mit Touristen um die Wette. Seine Miss machte keinerlei Anstalten, sich einzureihen. Auch Zett wartete – er wollte nicht im Dunst der überheizten Kabine anstehen. Allmählich wurde es dann aber doch Zeit, denn erfahrungsgemäß löste die Mannschaft unmittelbar nach dem Gedrängel das Hanftau vom Poller und stieß wieder ab, ohne Rücksicht auf Nachzügler.
Zett glich auf der Stahltreppe das Schwanken des Bootes aus, als er plötzlich ihr Parfüm roch, sehr nah, eine, höchstens zwei Stufen hinter ihm. Die Kleinfamilie vor ihm, Vater, Mutter, Sohn, letzterer fußballverrückt und überaus mitteilsam, hatte auf dem Festland einen Plasmafernseher gekauft, der sich im Karton ziemlich sperrig machte „Signore, do you speak English? ... for the European Championship, you know, next year.“
Und der Vater ergänzte: „And for 2006 as well!“ Wohl um einen Pflock einzuschlagen, damit nicht zur Weltmeisterschaft in drei Jahren das Gerät der nächsten Generation fällig würde.
Hinter Zett erklang ein warmes Lachen. Er selbst musste wie der letzte Stoffel das Maul halten und kratzte sich mit der Zahnpastatube die Wange. Blieb stehen. Wartete den Landgang der glücklichen Konsumfamilie ab. Mutter und Sohn stürmten voran, alberten rum, nur der Vater tappte vorsichtig Schritt für Schritt, weil der sperrige Karton ihm die Sicht nahm. Von der Reling winkte ungeduldig die blaue Uniformbluse. Zett nahm eine Stufe, die zweite ... man hatte ihm verboten „mit“ jemand zu sprechen. Die dritte Stufe ... nirgends war die Rede davon gewesen, ohne Ansprechpartner einfach rumzubrüllen. Die vierte Stufe, dann rief er theatralisch: „Merda, un ratto!“ und stolperte rückwärts hinauf, wobei er gegen Miss Locke stieß. Noch mehr Parfüm! Nichts, was er kannte. Ein kühler, auf Lavendel basierender Duft, wie ihn vielleicht eine Wüstenbewohnerin aussuchen würde.
„Ach, spinn doch nicht rum“, sagte die Stimme hinter ihm, die eindeutig nicht rauchig klang, sondern erstens schwäbisch und zweitens verärgert. Nachdem solchermaßen die Stimmenfrage geklärt war, nahm Zett verlegen die restlichen Stufen und eilte über das Hauptdeck an Land, von wo es weiterging zum Anleger Richtung Torcello. Dabei vermied er jeden Blick zurück.
3. Torcello. Dienstag, 18.11.2003
Rita Monego war gestorben, nur einen Tag vor ihrem Bruder Giancarlo, der sie laut Todesanzeige aufopfernd gepflegt hatte. Das komplette Schutzhäuschen des Anlegers klebte voll mit solchen Traueranzeigen. Wie die Sterbequote drüben auf Torcello aussah, am anderen Ufer, konnte Zett nicht erkennen. Das dortige Häuschen war nicht aus Plexiglas gebaut, sondern aus massiven Bohlen. Eine Art Blockhütte, die auf ihrem Ponton träge und mit lauten Klatschern in der Lagune schaukelte, sonst aber jedem US-Nationalpark Ehre gemacht hätte. Vielleicht eine Hommage an Ernest Hemingway, der in seinen goldenen Tagen auf Torcello Enten gejagt hatte, bevor er sich im allerschwärzesten Moment die doppelläufige Jagdflinte in den Mund schob? Eindeutig Hisbollahhumor, dachte Zett, die Tour mit solchen Hinweisen zu pflastern!
Und deprimierend ging es weiter: Dingo ließ sich nicht blicken. Normalerweise begrüßte Torcellos Inselhund die Fährpassagiere schon beim Anleger. Heute jedoch vernachlässigte er seine Pflichten. Zett rechnete herum, den ganzen Weg am Hauptkanal entlang. Er hatte den stolzen Mischling zuletzt vor einem dreiviertel Jahr gekrault – dem Volksmund nach gut viereinhalb Hundejahre. Vielleicht liegt er ja inzwischen mit Rheuma am Ofen, dachte Zett, atmete dann aber doch auf, als er die Hütte mit dem Namensschild wiederfand, zwischen dem Lorbeergestrüpp und der Souvenirbude, die weltberühmte Buranospitze verkaufte, made in Taiwan.
Daneben der Steinklotz, den sie Attilas Thron nannten. Wenn Heimatkundler von der Lega Nord sehr viel Grappa intus hatten, delirierten sie, die Hunnen hätten während der Belagerung Aquilejas auch Torcello angegriffen. König Attila habe sich zur Siegesfeier dieses massive Steintrumm meißeln lassen. Was für ein Unfug! Wenn Attilas viereinhalb Bötchen überhaupt zu einer solchen Seeoperation fähig gewesen wären, warum hatten sie dann nicht gleich die Festlandsflüchtlinge auf Venedigs Hauptinseln ausgeräuchert? Warum meißelten Hunnen, die sonst alles aus Holz, Gras, Leder und Wolle fertigten, für ihre Stippvisite den klotzigen Steinthron? Fehlten bloß noch ein paar Räder unten dran, dann hätte man den Hunnenkönig durch die Gegend rollen können, jedenfalls bis zur ersten sumpfigen Stelle.
Egal: Auf Torcellos erstem Bischofsthron, vulgo „Sede di Attila“, auf diesem unkippbaren Stuhl hockten einträchtig beisammen der Inselhund Dingo und – eine getigerte Katze. Das Alter, dachte Zett kopfschüttelnd mit jäh aufsteigender und diesmal ganz ziviler Furcht, so muss das Alter sein!
Hinter Santa Maria Assunta umfingen ihn wattige Stille und ein Haufen Müll, rings um den Hinterreifen eines Traktors. Der Unterschied betrug nur wenige Meter, doch fast nie verirrten sich Touristen in diese verwunschene Lagunenlandschaft, deren einzelne Bestandteile nichts hermachten, in ihrer Komposition jedoch überwältigend wirkten. Matschige Wiese. Eine menschenleere öffentliche Fondamenta, frisch gepflastert mit istrischem Bruchstein. Der private Anleger aus Holz mit einer Gittertür, die beim ersten Schubs gut geölt aufschwang. Fünf, sechs hohl klingende Schritte. Zett bedauerte, kein Maler zu sein. Vor ihm lag die völlig unbewegte Wasserfläche eines breiten Kanals. Obwohl, ganz still war sie auch wieder nicht, denn am anderen Ufer ragte ein Strommast kerzengerade empor, während das Wasser ihn gekräuselt spiegelte. Je weiter der Blick aber nach rechts schweifte, spätestens beim ersten Reusengestänge, war das Wasser einfach nur noch glatt und zeichnete ein perfektes Abbild der schiefen, krummen Holzstangen und der herbstlichen Baumgruppe, die jeden ferneren Blick versperrte. Mitten im Kanal spielte sich ein Ölfilm als Regenbogen auf, doch wenn man wie Zett nach rechts blickte, stur nach rechts, dann wurde dieses Eiland magisch, denn was an Land vergilbt und rostbraun an den Bäumen hing, das Herbstlaub vor dem Blätterfall, spiegelte sich im überdüngten Kanalwasser saftig grün, wie der junge Frühling, gerahmt vom knorrigen Totholz der Reusenstangen.
Das Wummern eines starken Bootsmotors, der sehr gedrosselt fuhr, näherte sich, und als Zett das Gefährt sah, bekam die Paranoia sofort wieder Futter: Viel zu kleines Boot für den mächtigen Motor! Der Motor fünfmal so viel wert, wie das Boot. Im Bug ovale Vertiefungen: Schächte! Zett hatte sowas auf dem Rio Magdalena in Kolumbien gesehen oder später am Mittellauf des Kongo, bei der Flussvilla eines lokalen Warlords, der das Edelholz ganzer Urwälder verschob. Mit dem hatte Zetts Libanese einen Deal gehabt. Pro Holzfrachter wurde in Monrovia ein Beutel Diamanten abgezweigt, persönlich für den Libanesen, ohne Hisbollah zu beteiligen.
Die sahen nach nichts aus, solche Boote, rammten sich aber problemlos den Weg durch schwimmende Baumstämme. Oder sie überstanden einen Sturm drei Seemeilen vor der Küste. Und die zerkratzten Ovale im Rumpf, das waren Klappen, die bei Bedarf aufplatzten um Schnellfeuerläufe zu entblößen. Manchmal auch schlanke Raketen.
Dieses Teil hier auf Torcello hatte man heruntergeschminkt bis auf den Charme eines verbeulten Fischkutters. Trotzdem musste man schon Eier haben, um so etwas durch die Adria zu steuern. Während der Balkankriege hatten Schnellboote der Zigarettenmafia, die im albanischen Durres die Marken Kent und Winston fälschte, unter der Persenning am Bug vielleicht ein MG aufgebockt, aber das war auch schon alles. Mehr hatte sich nie jemand getraut. Ein Boot, wie es hier sanft herabglitt, im Mittelmeer zu fahren, deutete entweder auf einen kompletten Schwachkopf hin oder auf einen Eigner, den jede NATO-Marine kannte, ohne ihn je in die Zieloptik zu nehmen.
Im Cockpit saß eine Frau. Zett war sicher, er würde höchstens einen Quadratzentimeter milchweißes Panzerglas produzieren, wenn er auf sie schoss. Sie stoppte präzis am Anleger, ohne die Lupa Cinque zu vertäuen. Hinter ihr wuchtete sich ein sonderbarer Mensch aus dem Ledersessel, dessen Fuß im Kabinenboden verschraubt war. Der Mann warf der Bootsführerin den Schnellhefter hin, in dem er gelesen hatte:
„Neue Konten für die gemarkerten Stellen, Frau Peeters!“ Sie nickte, machte Anstalten, ihre Uzi unter der Lederjacke zu verstauen, doch der Merkwürdige sagte barsch: „Danke, Frau Peeters, die neuen Konten bitte gleich“, womit er an Deck stieg und überraschend leichtfüßig auf den Anleger sprang. „Ich brauche hier keinen Bodyguard, oder was meinen Sie, Herr Doktor Zett?“
Zett, auf Deutsch angesprochen, verneinte auf Deutsch.
„Das ist aber lieb, dass Sie an meine Zahnpasta gedacht haben!“ Der Merkwürdige warf die Tube ins Cockpit. Peeters fing sie auf. „Unseren Privatdruck mit dem Ursulazyklus bitte, Frau Peeters!“ Sie reichte ihrem Chef einen Prachtband – goldgeprägte Lettern auf rotem Leinen, den der Merkwürdige sogleich an Zett weitergab. »Der Ursulalegendenzyklus des Vittore Carpaccio in der Accademia zu Venedig«. „Besten Dank Frau Peeters! Und passen Sie auf, dass niemand unser Bötchen klaut!“
Zett war nicht ganz sicher, doch er glaubte, von ihren Lippen ein „Arschloch!“ zu lesen, bevor die Tür der Kanzel zuschlug – oder eben nicht, weil die Frau das mit einem Vorschnellen ihres Fußes verhinderte. Ein Spalt blieb offen, was dem Chef scheinbar entging.
Trotz des ruppigen Umgangstons glaubte Zett, dass die Frau sich für diesen Mann notfalls in Fetzen schießen lassen würde. Offenbar wusste das Arschloch ihre Loyalität gar nicht zu schätzen. Zett fand ihn ekelhaft. Ein breitschultriger Mann, der an der Brust früher wahrscheinlich Muskeln gehabt hatte, inzwischen aber Brüste. Bauch, mächtig viel Bauch und Arme, die ein bisschen Hanteltraining verrieten ... nichts, was man nicht mit einem Schlag an den Kehlkopf erledigen konnte. Und doch – dieses Gesicht: Zett wusste aus eigener Erfahrung, wie sich Operationsnarben im Gesicht entwickelten. Entweder hatte auch dieser Mann einmal sein Aussehen chirurgisch verändern müssen und war dabei einem Metzger in die Hände gefallen oder ihn hatte etwas Böses, ungemein Feindseliges im Gesicht getroffen. Und so etwas zu überleben – das wiederum nötigte Zett Respekt ab.
„Herr Doktor Zett, nachdem Frau Peeters uns nicht länger stört und nachdem Sie nun freier Publizist sind und ... Kunsthistoriker ... und außerdem ein Junge vom Kölner Eigelstein ...“, er lachte leise und dreckig. Das Hängebauchschwein kicherte. Zett hätte ihm ohne weiteres einen Finger zwischen den Rippen ins Herz bohren können, aber das Schwein gluckste unverschämt, wohl wissend, dass Zett weder Doktor war, noch vom Eigelstein stammte, auch wenn er inzwischen dort wohnte. Dort hatten sie ihm schließlich die zweieinhalbtausend Euro unter der Wohnungstüre durchgeschoben. Der mutmaßliche Geldgeber spielte Theater. Aber für wen? Wohl kaum für Zett, der alles besser wusste, angefangen beim Eigelstein. Von der Doktorarbeit ganz zu schweigen. Also spielte der Merkwürdige Theater für die Frau hinter der spaltweit offenen Kabinentür. Er hatte folglich durchaus mitgekriegt, dass die Tür nicht ins Schloss gefallen war und wartete jetzt ebenso wie Zett auf die Reaktion der Lauscherin. „Mein Name ist Bucholtz“, fuhr er fort, „und Sie, mein lieber Doktor Zett, als Kind vom Kölner Eigelstein, kennen natürlich die Ursulalegende in- und auswendig.“ Offenbar war er hochmütig weit jenseits aller Selbstkritik. „Diese Legende wird Ihr erster Einsatz. Sie setzen den Schlussstein in die Arbeit meines armen Freundes Richard Lank. Keine ganz ungefährliche Aufgabe übrigens, aber dafür engagiert man schließlich Söldner. Vor einem Jahr lief Richard noch den Halbmarathon. Dann hat man schlecht auf ihn gezielt. Heute sitzt er im Rollstuhl. So kann’s gehen. Oder rollen, wie man’s nimmt. Also passen Sie gut auf sich auf!“
Dingo und seine Katze waren ihnen entgegengekommen und spielten Verstecken in dem mächtig profilierten Hinterreifen des Traktors.
„Das Leben bringt merkwürdige Paarungen hervor, nicht wahr?“, fragte Bucholtz. Er reckte sich und wirkte nun, als liefe er normalerweise gestaucht umher. Mit begradigtem Rücken gewann er einen knappen Viertelmeter Körpergröße hinzu. Das Hängebauchschwein bekam plötzlich die Konturen eines ziemlich bulligen Kerls.
Zett nickte erlöst – definitiv nicht Hisbollah! Aber diesem Arschloch den Gefallen tun, ihm zuzustimmen, um sich dann hochnäsig abkanzeln zu lassen – ausgeschlossen! Da fragte er doch lieber: „Was sollte das Theater gerade an der offenen Kabinentür?“
„Ach, das!“, sagte Bucholtz wegwerfend. „Das war für Peeters. Sie ist ein raffiniertes Biest. Jetzt sind wir erstmal wieder quitt.“
„Trotzdem lassen Sie sich von ihr bewachen.“
„Stimmt!“
...
Stimmt? ... Hallo? ... Kam da noch was?
Kein Wort kam da.
Der Mann erklärte nur, was er erklären wollte.
Bucholtz schmunzelte. „Nicht böse sein! Aber Willem Cloerkes hatte recht. Man kann sehen, was Sie denken.“
Zett musste schlucken ... woher kannte der Mensch Cloerkes? „Ja, woher wohl?“, fragte Bucholtz. „Er hat Sie mir empfohlen. Es ist ja nicht gerade so, dass zurzeit Mangel herrschte an über vierzigjährigen Sicherheitskräften. Ich lege meine Karten dann mal auf den Tisch. Der Eigelstein und Ihr kunsthistorischer Doktor sind Ihre neue Identität für ein aussichtsloses Leben auf der Flucht, nachdem Sie Ihren Hisbollah-Chef verraten und bestohlen haben – zum Besten Israels übrigens, was in meinen Augen eine sehr gute Empfehlung darstellt, Herr Zottnow, Thomas, geboren in Überlingen am Bodensee als Sohn des Buchhändlers Gerd Zottnow und der Schweizer Bankierstochter Caroline Zottnow, geborene Ruffy. Interessieren Sie sich überhaupt für Kunst? Wenigstens ein bisschen?“
„Woher kennen Sie Cloerkes?“, ächzte Zett.
„Die Welt ist klein“, sagte Bucholtz.
„Herr Bucholtz!“, brachte Zett mühsam heraus, denn sein Kloß im Hals wuchs von Sekunde zu Sekunde.
„Was soll ich sagen“, meinte Bucholtz. „Willem Cloerkes war mein Freund! Als die bosnischen Serben Banja Luka hielten und die Muslime Zenica, da gab es trotz allem diesen schwungvollen Handel mit Konserven und Medikamenten über Mount Vlasic. Außerdem haben die Kriegsparteien sich natürlich gegenseitig Panzer vermietet. Aber Cloerkes hat für beide Seiten den Medikamentennachschub organisiert. Waren Sie da schon bei ihm?“
„Natürlich!“ sagte Zett.
„Auch, als er starb?“
Zett zögerte. Das ging ihm alles viel zu weit. War auch viel zu gefährlich. Er wollte gerade ansetzen zu einer gestammelten Erklärung, die einer Bitte um Entschuldigung sehr nahe gekommen wäre, da sagte Bucholtz leichthin:
„Das müssen Sie mir bei Gelegenheit erzählen. Offenbar teilen wir das Trauma verlorener Freunde. Tot oder im Rollstuhl ... was Cloerkes angeht, so nahm ich manchmal seine Dienste in Anspruch im hollandweit berühmten Welthafen Rotterdam. Da haben wir zur Tarnung Rinderhack durch den Wolf gedreht und eine Klitsche betrieben, die Schiffsklos desinfizierte. Logistik halt! Beim Genever danach hat er Sie eines Tages gelobt über den grünen Klee. Ich kenne also Ihre dalmatische Geiselbefreiung aus erster Hand. Beeindruckend.
Dann ließ ich recherchieren: Kolumbien, als Sie noch für die amerikanische Drug Enforcement Agency tätig waren. Und nach dieser Blaupause ein paar Kilometer nordwestlich von Zadar Cloerkes’ Befreiung, nicht wahr? Vorwiegend eine schauspielerische Leistung. Sie spielen so lange den Clown, bis Sie ein paar Treffer absetzen können und Ihren Schutzbefohlenen rausholen. Vielleicht sechzig Prozent Chance. Nie an einen Partner gedacht?“
Zett schüttelte den Kopf.
„Und warum nicht?“
„Er ist vielleicht der bessere Soldat. Aber mein Partner weiß nie, wann er drohen muss, schimpfen, lächeln oder sich besser vor gespielter Angst in die Hose pisst. Jedenfalls bin ich meinem Partner nie begegnet.“
Bucholtz nickte. „Und Ihre Angst war immer nur gespielt?“
„Sie sind ein ahnungsloser Hirnwichser“, sagte Zett.
Wiederum nickte Bucholtz. Dann deutete er auf sein Gesicht und sagte: „Kosovokrieg. Sprengfalle“, bevor er eine lange Pause machte. Zwischen seinen Narben arbeiteten die unzerstörten Muskelreste. Schließlich hatte er sich wieder im Griff. „Mittelfristig setzen wir Ihre Erfahrungen aus Kolumbien und der dalmatischen Geiselbefreiung ein. Sie beschützen Leute – manche von uns brauchen Schutz. Sie können jemand raushauen, notfalls mit nicht mehr als einem Riesentheater – manchmal muss einer von uns rausgehauen werden. Das ergänzt sich also. Das werden Ihre Aufgaben, mittelfristig, in ein paar Monaten. Vorderhand gedenke ich persönlich die Erfahrungen zu nutzen, die Sie in Cloerkes’ weniger respektablen Jahren erworben haben. während seiner Tätigkeit als ... sagen wir mal Kunsthändler?“
Zett mochte überhaupt nicht, wie milde abfällig Bucholtz über Cloerkes sprach. „Was wollen Sie?“, fragte er barsch und wedelte mit dem edlen, goldgeprägten Leinenband. „Vorderhand!“
„Sie sind ziemlich unverschämt, Zottnow. Betrachten Sie sich als engagiert!“
„Für welchen Auftrag? Vorderhand? Wie lange? Wo? Wie viel?“
„Immer direkt auf den Punkt“, sagte Bucholtz, „was ja bei Kunsthistorikern eher selten ist, mein lieber ... da stoßen wir übrigens auf ein Problem: Soll ich Sie unter vier Augen Zett nennen oder Zottnow? Wir könnten es konspirativ auch so halten, dass die Anrede mit Ihrem richtigen Namen für die Korrektheit meiner Anweisungen bürgt, wohingegen ...“
„Herr Bucholtz“, unterbrach Zett ihn mühsam beherrscht. „Wie Sie wissen, ist für mich der Name Zottnow lebensgefährlich. Thomas Zottnow ist tot. Sonst bin ich tot.“
„Tja, der iranische Auslandsgeheimdienst ist ganz schön pfiffig“, nickte Bucholtz, „und teilt sein Wissen ärgerlich oft mit Hisbollah ...“ Zett hätte ihn gern geohrfeigt. „Und eben, weil Sie es sich nicht leisten können und fast Ihr letztes Geld in die neue Identität gesteckt haben ... so sind Sie das doch vom Broker gewöhnt, oder? ... dass Sie runterverhandelt werden? Ich meinerseits habe gar keine Lust, mit Ihnen zu verhandeln. Sie unterschreiben mir den üblichen Vertrag, in dem Sie das Risiko akzeptieren, beschossen, verstümmelt oder getötet zu werden, sei es durch Schusswaffen, Landminen, Bomben, den Absturz von Flugzeugen, chemische oder biologische Kampfstoffe, Hieb- und Stichwaffen et cetera, et cetera, pe, pe. Und ich biete Ihnen den Sold eines Eins-A Gruppenführers, dreißigtausend im Monat plus Spesen. Plus Bonus im Erfolgsfall. Keine Verhandlungen! Ja oder nein?“
„Euro? Aber ich kenne immer noch nicht meinen ersten Auftrag“, sagte Zett. „Den mit Ursula. Wenn ich das Buch hier richtig deute.“
„Euro! Aber für einen akzeptablen Auftrag finden Sie das Geld okay?“ Zett nickte, ärgerte sich aber sofort, weil ihm sein Nicken zu beflissen vorkam. „Dann sind Sie engagiert – vorausgesetzt, Sie fühlen sich der Aufgabe gewachsen. Über jedes weitere Detail herrscht ab sofort absolutes Stillschweigen!“
„Einverstanden“, sagte Zett, „vorausgesetzt, Sie vergessen den Namen Zottnow!“
Bucholtz reichte ihm die Hand und Zett schlug ein, gerade, als sie den Steinthron passierten.
„Das passt doch alles ganz hervorragend!“ deklamierte Bucholtz. „Nehmen Sie Attilas Sitz hier zu unserer Rechten! Diesen getürkten Hunnenthron. Totaler Blödsinn, wie Sie wissen! Venedig selbst hat seine mächtige Handelskonkurrenz Torcello in Schutt und Asche gelegt – bis auf die Kirche Santa Maria Assunta. Anschließend hat Venedig seine Mordbrennerei dem Attila in die Schuhe geschoben, was nur funktionierte, weil in der Lagune niemand noch verhasster war als Attila. Dass dieser Steinsessel hier Attilas Thron heißt, ist ein grandioser Propagandatrick. Alter Stein eignet sich eben hervorragend für Propagandazwecke, das weiß niemand besser als Sie, Sie haben es ja in Dubrovnik miterlebt nicht wahr? Oder bleiben wir bei der Hunnenpropaganda und dem Clematiusstein mit seinen elftausend Jungfrauen in Köln. Ursula hin oder her, ich brauche einen Neugierigen, der kunsthistorisch denken kann und auch ein bisschen schreiben und der außerdem damit klarkommt, wenn hinter der nächsten Ecke fünf Penner lauern, die auf seine Unterlagen scharf sind. Jemand, der schießt, bevor er sich erschießen lässt. Eine Art wehrhaften Ursulareferenten. Immerhin Ihre Doktorarbeit. Sie wissen doch, wovon ich rede?“
Zett fand das Examen lästig, lästiger noch als Bucholtz’ Kenntnis seiner Tage im belagerten Dubrovnik, doch Bucholtz musste wohl prüfen, wie fest seine kunsthistorische Tarnkappe saß.
„Ursula und ihre elftausend Jungfrauen, die angeblich von den Hunnen gemeuchelt wurden. In Köln wie in Venedig präsent durch Ursulalegendenzyklen, von allerdings sehr unterschiedlicher Qualität, wobei ich Carpaccios Märtyrerinnen vorziehe“, schloss er, als ihm Bucholtz’ ironisch hochgezogene Braue auffiel.
„Woran Sie gut tun. Sehr löblich!“, sagte Bucholtz. „Aber Märtyrerinnen? Ziemlicher Kokolores!“ Er zog Zett mit sich auf die Teufelsbrücke, die ohne Geländer den Hauptkanal überspannte. „Natürlich sind sie umgebracht worden, aber nicht als christliche Märtyrerinnen! Haben Sie überhaupt eine Vorstellung, wie das Pfeilmotiv in die Legende kam?“
„Hunnische Standardwaffe?“, riet Zett.
„Jaha“, lachte Bucholtz, „sollte man meinen, wäre plausibel! Aber ich zeige Ihnen mal was!“ Er griff in den Kragen seines Pullovers und zog am fadendünnen Kettchen einen klobigen, Siegelring heraus.
„Was für ein Klotz von Diamant!“, staunte Zett, der sich aus Westafrika den Blick für die Karatzahl bewahrt hatte.
„Diamant, Beryll oder Muranoperle – wer will mit letzter Gewissheit sagen, welcher Stein den Ring des Successors schmückt“, wiegelte Bucholtz ab.
„So, das reicht“, sagte Zett, der langsam wütend wurde. „Successor! Heißt Nachfolger! Heißt also: Sie sind nicht der Boss, sondern bloß der Nachfolger des Chefs. Und was wollen Sie von mir? Können Sie überhaupt zahlen?“
Bucholtz seufzte: „Die Konzentrationsspanne in unserer westlichen Zivilisation sinkt Jahr für Jahr!“ Er zerrte an der Gesäßtasche seiner abgewetzten schwarzen Jeans, bis er endlich einen Umschlag zutage förderte, ihn Zett aufdrängte, der hineinsah, dreißigtausend Euro in Fünfhundertern zählte und von Bucholtz zu hören bekam: „Ihr Sold für den Rest November. Habe ich jetzt ein Stündchen ungeteilter Aufmerksamkeit?“ Zett nickte, und nun rieb Bucholtz ihm den Ring regelrecht unter die Nase. Ein Pfeil war in den Stein geschliffen, von rechts unten nach links oben – das genaue Gegenteil eines optimistischen Umsatzdiagramms.
Entweder hatte er es mit einem Irren zu tun, für den Geld keine Rolle spielte – oder mit einer tief wurzelnden und weit verzweigten Geschichte. Vorläufig wahrte Zett in dieser Frage Neutralität und sagte nur: „Der Pfeil meint also doch nicht die Standardwaffe der Hunnen!“
„Ebenso wenig das Symbol für Ursulas Martyrium. Der Pfeil meint uns, solche wie mich, weshalb mein armer Freund Richard Lank auf Malta über die Ursulalegende recherchierte, als man ihn zum ... anschoss. Sie kennen die Kirche Sankt Ursula in Köln und ihre Goldene Kammer? ... bestens! Den Ursulalegendenzyklus im Wallraf-Richartz-Museum selbstverständlich auch?“
„Haben Sie etwa persönlich damals das Thema meiner Doktorarbeit manipuliert?“
„Pffff“, machte Bucholtz. „Doktorarbeit? Ja sicher! Aber kommen Sie, ich zeige Ihnen was!“
Die Spiegelung des Campanile von Santa Maria Assunta in jenem abseitigen Rinnsal übertraf sogar die Magie der Reusen hinter der Kirche. Allerdings spielte hier jemand mit dem Licht, so wie es eigentlich nur im Film möglich war. Die Bäume hinten sahen im grünen Wasser grün aus. Hier färbte dasselbe Brackwassergemisch aus Adria und Brenta die Blätter azurblau, obwohl der Sonnenstand sich mittlerweile kaum verändert haben konnte, und nach wie vor kein Wölkchen am Himmel stand.
Eins, zwei, drei ... zwischendurch verlor Zett den Überblick ...
„Sieben Stockwerke bis unterm Helm“, assistierte Bucholtz. „Und aus jedem Fenster wächst in der Spiegelung ein Ast dieses Busches hervor, als wäre der Kirchturm ein Baumstamm und triebe im Wasser Äste. Apropos Spiegel: Sie kennen doch die Firma Blackwater ... fast dreißig Millionen Dollar für Paul Bremers Personenschutz im Irak! Aber wissen Sie auch, wie Familie Prince, die Eigentümer von Blackwater, ursprünglich zu Geld kam?“ Zett empfand das dringende Bedürfnis, dem Mann weh zu tun. „Nein? Dann verrate ich es Ihnen – mit der Produktion beleuchteter Schminkspiegel für die Sonnenblenden, die man im Auto runterklappt. Kein Witz. Sehr katholische Leute übrigens. Fühlen sich den Malteserrittern verbunden. Aber die Bodenfresken von Santa Maria Assunta kennen Sie doch?“
„Hör auf mit dem Scheiß!“, knurrte Zett.
„Entschuldigung“, Bucholtz war höchst angetan, „Sie haben ja Recht, es sind natürlich Mosaiken, keine Fresken!“
„Ihnen ist wohl kein Versuch zu billig?“
„Ich würde dreißigtausend pro Monat nicht billig nennen.“
„Darf ich jetzt bitte ...?“
„Nein, Sie dürfen nicht! Vorläufig hören Sie zu! Ich fange mal mit der Ursulalegende an, nach Jacobus de Voragine, der zwar viel verschweigt, aber zumindest ein brisantes Detail preisgibt. In der Bretagne herrscht ein stockkatholischer König namens Nothus oder Maurus ...“, er hat ein bisschen was von Cloerkes, wenn er so doziert, dachte Zett, nicht in Körperbau oder Mimik, doch Cloerkes hätte die Geschichte genau so angefangen. „... wann genau verrät uns die Legende nicht. Der König nun ist mit einer überaus tugendsamen Tochter gesegnet, die auf den Namen Ursula hört und viel träumt, manchmal sogar prophetisch. So träumt sie eines Nachts, der König von England, ein sehr mächtiger Herrscher und böser Heide, wolle im Namen seines Sohnes um ihre Hand anhalten. Und sie, die tugendsame Ursel, werde die Gelegenheit beim Schopfe packen, um das heidnische England zum Christentum zu bekehren. Doch in ihrem Traum erfährt sie noch mehr. Ihr wird eine Wallfahrt nach Rom prophezeit – schöne Reise, kann man nicht meckern. Um es kurz zu machen: Die heidnischen Engländer gehen auf die Bedingung ein. Der Kronprinz lässt sich taufen. Man bereitet die Wallfahrt nach Rom vor, zu der aus allen Himmelsrichtungen Königinnen und ihre Töchter, Bischöfe und wer nicht noch alles sich versammelt. Und jetzt kommt die verräterische Passage. Schauen Sie in Ihren Umschlag, ich hatte keine Lust, das auswendig zu lernen.“
Hinter den Banknoten steckte tatsächlich ein gefaltetes DIN-A5 Blatt. Zett hatte es im Eifer des Geldzählens übersehen. Nun las er vor: „Als dann – wie verabredet – die Jungfrauen da waren und Dreiruderer und die notwendigen Nahrungsmittel bereitstanden, enthüllte die Königin den Jungfrauen, die mit ihr ziehen sollten, ihr Geheimnis, und alle schworen den Eid auf diese neue Art von Kriegsdienst.“
„Kriegsdienst“, betonte Bucholtz. „Plötzlich kein Wort mehr von Pilgerfahrt!“
Zett las weiter: „Nun begannen sie mit Kriegsübungen: Sie fuhren zusammen und trennten sich wieder, sie bekriegten sich oder täuschten Flucht vor, übten sich in jeder Art von Spielen und ließen nichts weg, was ihnen einfiel, bald kehrten sie mittags, bald auch spät abends zurück ... schon merkwürdig“, sagte Zett. „Die Märtyrerinnen ziehen erst ins Manöver, bevor sie sich dann ohne Gegenwehr abschlachten lassen!“
„Nicht wahr!“, rief Bucholtz. „Aber es geht ja noch weiter. Zuerst reist man zu Schiff nach Köln, wo Ursula erneut der Engel erscheint, um zu weissagen, sie werde zwar sicher von Rom nach Köln zurück gelangen, dort aber mitsamt ihren Gefährtinnen das Martyrium erleiden. So eine Aufklärung wünscht sich jeder General, oder? Die Mädels reisen trotzdem weiter, ganz bewusst ihrem Tod entgegen, über Basel nach Rom, wo sich ein legendärer Papst Cyriacus, den es nie gegeben hat, ihrer Wallfahrt anschließt. Ein Jahr und elf Wochen soll der gute Cyriacus die Tiara getragen haben. Viele Einsen, wenn auch nicht elftausend. Seine Abdankung erbost die Führer des römischen Heeres, Maximus und Africanus, dermaßen, dass sie ihrem Verwandten Julius, dem Fürsten des Hunnenvolks, einen Tipp geben: Elftausend Jungfrauen nähern sich Köln. Sie könnten sich übrigens ruhig ein bisschen engagieren und anmerken, dass wir es hier an diesem Punkt der Legende mit Spuren der historischen Beziehungen von Aetius und Attila zu tun haben. Sie sind doch sonst so ein schlaues Kerlchen“, sagte Bucholtz, worauf hin Zett ihm wieder gern eine aufs Maul verpasst hätte, was er aber schön bleiben ließ, weil ihnen seit geraumer Zeit auf zwei- bis dreihundert Meter Entfernung eine Gestalt folgte, die zwar einen unförmigen Kapuzenmantel trug, doch am Schultergurt auch eine Waffe, die ebenso gut eine Jagdflinte wie ein Präzisionsgewehr sein konnte. Wobei zwischen amerikanischen Modellen die Grenzen durchaus fließend waren. Von wegen – wir brauchen keine Bodyguards!
„Woher kommt das bloß, dass ihr alle immer so kleinkariert seid?“, fragte Bucholtz.
„Wer – wir?“
„Söldner. Oder mögen Sie den Begriff nicht? Alle Männer und Frauen, die für Geld tödliche oder todbringende Aufträge annehmen, sind von Skepsis zerfressen.“
„Wer ist das da hinten“, fragte Zett und war verblüfft, was für ein freundliches Lächeln sich plötzlich in Bucholtz’ zerstörtem Gesicht breitmachte.
„Meine Versicherung“, sagte Bucholtz. „Stellen Sie sich vor, Sie bekämen Lust auf meinen ... wie sagten Sie so schön ... klotzigen Diamant? – und ich schlappes Hemd wäre Ihnen ausgeliefert, ganz allein … das geht doch nicht, das müssen Sie schon einsehen!“
„Ich dachte, wir bräuchten keine Leibwächter!“
„Dachte ich auch. Denk ich noch. Trotzdem ist man ja immer ganz gerührt, zu merken, wenn sich jemand kümmert.“
„Peeters?“
„Iwo! Frau Peeters schaukelt das Bötchen und erfindet Kontobewegungen. Hören Sie lieber den Schluss der Legende: Stellen Sie sich vor, das Hunnenheer belagert Köln. Und nun werden diesem barbarischen Hunnenheer elftausend Jungfrauen avisiert, durch Vertraute in Rom. Was denkt das Heer?“
„Ich fürchte: Massenvergewaltigung!“, sagte Zett.
„Das ist wohl leider so in der realen Welt. Doch nicht in der Legende. Da sorgen sich die Verbündeten in Rom und die Hunnen in Köln um die Ausbreitung des Christentums. Huuh, da kommen unbewaffnete Jungfrauen und wollen uns Kriegern die rauen Sitten abgewöhnen! Schreckliche Bedrohung! Und darum hält sich niemand mit Vergewaltigung auf, sondern man schreitet direkt zum Mord ...“
„Mit einer Ausnahme“, fiel ihm Zett ins Wort. „Ursula selbst kriegt den Antrag vom Sohn des Hunnenchefs ...“
„In den »Legenda Aurea« vom Hunnenchef persönlich“, korrigierte Bucholtz.
„Jedenfalls lehnt sie ab und teilt das Schicksal ihrer Jungfrauen und des Papstes und ihres Verlobten, der ihr entgegen gereist ist.“
„Genau“, sagte Bucholtz. „Übrigens – Chapeau!“
Hinter ihnen gellte ein Pfiff. Als sie sich umblickten, zeigte die Wache auf einen Butler im schwarzen Frack, der sich durch das kniehohe Gras der Salzwiese kämpfte, die zwischen ihnen und der imposanten Villa lag, einen halben Kilometer meerwärts. Der Diener balancierte ein Tablett.
„Oh weh“, seufzte Bucholtz. „Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich.“
„Wieso?“
„Wir haben diesen Leuten mal einen Gefallen getan, vor etlichen hundert Jahren. Seitdem huldigen sie uns als ihren Lehensherren.“
In Zetts Gehirn brannten ein paar Sicherungen durch, aber bevor es knallte, war der Butler mit dem Silbertablett bei ihnen. „Zur Stunde der Ombra vielleicht einen kleinen Weißen für Sie Successore und Ihren Freund?“
„Vielen Dank, aber das ist doch nicht nötig.“ Bucholtz wirkte tatsächlich verlegen. „Bügeln Sie nur gleich die Hosenbeine wieder trocken, Pietro, sonst erkälten Sie sich noch. Die Salzwiesen sind feucht, so spät im Jahr.“
„So Gott will, bald nicht mehr“, strahlte der Butler. „In elf Jahren machen die Schotte zwischen den Lidi dicht.“
„Zu viel Berlusconi-TV“, seufzte Bucholtz. „Dabei hatte ich Ihnen zum Geburtstag ein Buch über das Mosesprojekt geschenkt.“
„Zwei Bücher, Successore!“
„Richtig, ist doch gar nicht so schwer zu verstehen: Wenn Moses kommt, gibt es keine Überschwemmung mehr – aber die Frage ist, mein Lieber, ob Ebbe und Flut dann noch genügend Wasser durch unsere tausend Kanäle schieben. Wir brauchen den Wasseraustausch. Und den garantiert uns kein Professor vom MIT. Prost!“, sagte er.
Zett schnupperte an seinem Wein. Er roch feuchtes Gras und Salz und Meer und Fisch, Schießpulver, uralten Stein, Gummi, Brackwasser unter Ölschlieren und stechende Sonne, woraufhin er das winzige Gläschen, das so betörend ehrlich duftete, schlürfend mit drei Schlucken leerte. Pietro nickte anerkennend.
Bucholtz schwenkte sein Glas und musterte die Kirchenfenster aus alkoholischen Schlieren. „Was macht Neapel?“ fragte er.
„Viel Müll. Wenig Deponie. Die Banden im Aufwind“, erwiderte Pietro.
„Tja“, meinte Bucholtz, indem er nun auch sein kostbares Glas leerte und vorsichtig auf das Tablett zurück stellte. „Und die Familie?“
„Hält aus“, sagte Pietro lakonisch.
„Dann grüßen Sie mir einstweilen den Skipper! Er soll mich nächstens nicht bemerken, wenn ich über sein Land stromere. Oder besser noch, Sie verstecken ihm den Feldstecher.“
„Mit Vergnügen. Und meine Komplimente an die Signora“, erwiderte Pietro.
„Die richte ich nun wieder mit Vergnügen aus“, sagte Bucholtz, wieder mit diesem glückselig blöden Lächeln im Gesicht. Eigentlich ist es nur glücklich, analysierte Zett dieses Lächeln, wie er so manches Porträt analysiert hatte. Die Verzerrung ins Blöde kommt von den Narben. Tief wurzelnd. Weit verzweigt.
„Elftausend tote Jungfrauen!“ resümierte Zett, der seinen Auftrag immer noch nicht ganz verstand, als sie wieder über den Hauptweg schlenderten. „Jungfrauen mit paramilitärischer Ausbildung!“
„Komisch, oder?“, sagte Bucholtz. „Aber jetzt kommen wir mal zu Carpaccio und seinem Ursulalegendenzyklus. Schon lange war es ein Running Gag unserer Bibliothekare, Vittore Carpaccio sei einer der Unsrigen gewesen. Ein Hobby von mir und von Richard Lank. Doch als wir bereits schöne Zwischenergebnisse vorweisen konnten, zerstörte im Oktober 2001 ein Wasserschaden in unserem Zentralarchiv das gesamte Recherchematerial. Letztes Jahr dann war Lank zu einer Konferenz auf Malta. Nach deren Ende blieb er noch zwei Tage in La Valletta. Wir wollten im Nationalmuseum einen Detailentwurf Carpaccios sichten. Außerdem besitzt das Bistum Gozo Ursulareliquien. Und dort hat man Richard dann in Klump geschossen. Nicht aus erkennbaren beruflichen Motiven – da nehmen wir hohe Risiken durchaus in Kauf. Sondern quasi in Ausübung unseres gemeinsamen Hobbys. Verstehen Sie, dass ich ihm die Fortsetzung der Arbeit schuldig bin?“
„Also nach Malta?“, fragte Zett.
„Nein, die malteser Spur führte ins Leere. Venedig ist Ihr Einsatzort. Und Köln. Dort beginnt in den nächsten Tagen eine Konferenz, die ich leite – und bei der ich garantiert nicht erschossen werde. Unter den Teilnehmern sind allerdings ein paar, die auch auf Malta waren. Und denen möchte ich auf den ursulinischen Zahn fühlen, um es mal so auszudrücken. Deshalb brauche ich jemand im Team, der sich zwar leider nicht ganz so gut auskennt wie Lank, der aber, anders als Richard in seinem Rollstuhl, notfalls täglich zwischen Köln und Venedig pendeln kann. Sichten Sie zunächst einfach noch mal Carpaccio.“
„Warum kein Profikunsthistoriker?“
„Damit der dann mit sensationellen Entdeckungen an die Weltpresse geht? Sie Idiot! Außerdem sollte mein Kunsthistoriker, der für mich den Zyklus sichtet, ganz nebenbei auch schießen können und keine Skrupel haben, zu treffen.
Schauen Sie sich also in der Accademia noch mal sehr genau Carpaccios Zyklus an. Vergleichen Sie alles mit meinen Randnotizen im Buch – Entschuldigung für die Handschrift! Sie werden dort zum Beispiel Marcus Vipsanius Agrippa finden, unseren Allerersten. Analysieren Sie Brücken, Türme, Spiegelungen, Pfeile – denken Sie an meinen Siegelring. Vielleicht interessiert es ja auch den Söldner, dass neben dem Colleonidenkmal einst die Scuola di Sant’Orsola stand, wo der Zyklus ursprünglich hing!“
„Aber ...!“
„Kein aber! Tun Sie einfach, was man Ihnen sagt. Randnotizen gibt es reichlich. Was unserem Privatdruck fehlt, ist eine Knallereinleitung. Vielleicht dreißig Seiten. Sie werden, jede Wette, bei der Recherche observiert ... nehmen Sie inzwischen Befehle von mir entgegen?“ Zett nickte. „Dann befehle ich, dass Ihnen alles wurscht ist! Sie sind Kunsthistoriker. Seien Sie naiv und leichtsinnig. Niemand observiert Kunsthistoriker. Sie merken nichts, schreiben nur in Ihr Notizbuch, immer schön emsig, mit gerunzelter Stirn. Spiegelungen. Brücken. Türme. Pfeile. Agrippas ...! Im Grunde müssen Sie nur meine Randnotizen zum Text verdichten. Will jemand Sie aushorchen, stellen Sie sich dumm. Stoßen Sie auf Gewalt, dann weichen Sie aus, wenn möglich. Wenn nicht, dann töten Sie.
Flanieren Sie einfach durch die Welt dieser Bilder, so wie Cloerkes es seinen Lesern vermittelt hat. Wenn Sie was finden, was wir noch nicht entdeckt haben – wunderbar. Wenn nicht, erwartet Sie demnächst solide Leibwächterarbeit.“
Zett konnte sich nicht verkneifen, leise aber zackig „Yes Sir, Successor Sir“, zu brummen, was Bucholtz zunächst wieder seine dreckige Lache entlockte, dann jedoch die Bemerkung: „Sie lernen schon noch die lateinischen Codes unserer Schwarzen Hände!“
Schwarze Hände, dachte Zett, klingt verteufelt nach Balkan.
„Und denken Sie, wann immer Sie aus meinem Mund von Schwarzen Händen hören, bloß nicht an faschistische Terrorbanden!“, warnte Bucholtz. „Unsere Schwarzen Hände gibt es seit zweitausend Jahren!“
Da gab es zwar keine Faschisten, aber sehr wohl schon die Fasces genannten Rutenbündel der Liktoren – spann Zett den Faden stillschweigend fort. Er begann zu denken wie sein Auftraggeber, stellte er mit Entsetzen fest. „Klar. Sicher. Zweitausend Jahre“, sagte er. „Seit wann auch sonst?“ Das letzte Stück Weges absolvierten sie schweigend. Als Peeters sie kommen sah, sprang sie auf, öffnete die Tür der Bootskanzel und bezog draußen auf dem Steg Position. Bucholtz nickte ihr zu. Zett riskierte ein freundliches „Hallo!“, das sie eisig überhörte.
„Schön“, sagte Bucholtz, bereits aus der Kanzel heraus, „ich denke, wir haben uns verstanden, Doktor Zett. Sie setzen Richard Lanks Arbeit an Carpaccios Ursulalegendenzyklus fort und schreiben mir für den Anfang ... etwa dreißig Normseiten. Übrigens liegt in Ihrem Hotelzimmer der Vertrag auf dem Tisch. Unterschreiben Sie und lassen Sie ihn liegen. Um den Rest kümmern wir uns. Alsdann!“
Ein Nicken, die Tür schnappte zu, und die Schraube des donnernden Bootsmotors, der jetzt bei der Abfahrt schamlos seine ganze Kraft ausspielte, zerwirbelte den Kanal zu einer Schaumlandschaft, in der sich nichts, aber auch gar nichts mehr spiegelte.
4. Venedig. Mittwoch, 19.11.2003 bis Freitag, 21.11.2003
Zett spielte noch am nächsten Morgen mit dem Gedanken, den Job abzulehnen, während er sich erfolglos bemühte, eine Randbemerkung in Bucholtz’ krakeliger Handschrift zu entziffern. Nachts hatte er sich in der allerödesten Discothek von Mestre die Kante gegeben. Jetzt wirkte das Aspirin nicht, weshalb er eisgekühlten Orangensaft kippte, den das Hotelpersonal mit nervtötender Langsamkeit immer erst vom Tetrapack in Glaskaraffen umfüllte. Die abgearbeiteten Sizilianer hielten bei der Plackerei streng ihre Routine ein – und wirkten dennoch fröhlich. Bei Zett lief das gerade umgekehrt: Er blies Trübsal im großen Durcheinander seines Lebens, angefangen bei den alkoholischen Exzessen, die ihn ganz ohne Spaßgewinn von Mal zu Mal heftiger ausknockten.
Außerdem war es auf Dauer bestimmt nicht gesund, mit dem toten Cloerkes zu quatschen, als wären sie ein altes Ehepaar.
Zumal der die entscheidenden Auskünfte für sich behielt. Wann hatte er mit Bucholtz über Zett gesprochen? Falls er ihn tatsächlich dem Merkwürdigen empfohlen hatte, musste das vor seinem Tod gewesen sein. Und der lag fast zehn Jahre zurück. Warum trat Bucholtz dann erst jetzt an Zett heran? Womit die Frage nach der Seriosität des neuen Auftraggebers auf den Tisch kam ... das alles drehte sich im Kreise und im Kopf herum.
Taktische Analyse: dumpfer Schmerz hinter der Stirn, kein Schluck O-Saft mehr im Glas und wenig Vertrauen zu Bucholtz, geschweige denn Sympathie. Andererseits gab es gutes Geld und den klaren Befehl: Geh zur Akademie, sieh dir schöne Bilder an – was ja nun keine arge Zumutung war für dreißigtausend Euro.
Zuletzt gab es da noch das DIN-A5-Blatt. Gestern Abend hatte Zett die digitalen Bibliotheken im Web nach Ausgaben der »Legenda Aurea« durchstöbert und tatsächlich die Passage über Kriegsübungen der Elftausend Jungfrauen gefunden. Bucholtz war also kein Banause. Nach Wegfall dieser Ausrede war Zett mit dem Wassertaxi zur Piazzale Roma gefahren und dort ins Autotaxi umgestiegen. In einer ehemaligen Chemiefabrik, die mit Theke, Riesenboxen und Flackerlicht hochgerüstet worden war, hatte er sich an das Teufelsgebräu aus süßem Prosecco und Grappa gehalten, das die Kids hier tranken. Zwischendurch hatte er ein wenig auf der Tanzfläche herumgestampft und einen Hänfling zusammengeschlagen, der einfach nicht aufhören wollte, ihm bunte Pillen zu verkaufen. Zett hatte mit der Faust geschlagen, obwohl eine Ohrfeige gereicht hätte, und wusste dabei ganz genau, dass er auf ein Problem mit unmotivierter Gewalt zusteuerte. Immerhin hatte ihn der Türsteher trotz seiner Überreaktion in Frieden gelassen, als er den Hänfling zwang, das Plastiktütchen mit den Drops herauszurücken. An seinem Ecktisch mit Blick auf die Schwingtür hatte Zett dann verworrene Zwiesprache mit Cloerkes gehalten, der ihn bedrängte, lieber ins Hotel zu fahren, bevor er auf dem Parkplatz sturztrunken dem rachsüchtigen Hänfling und seinen Kumpels in die Hände fiel. Auch eine Art von Risikomanagement!