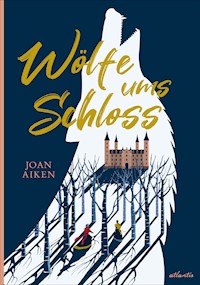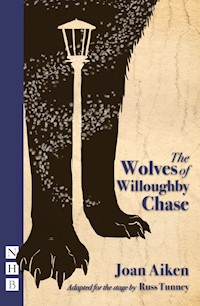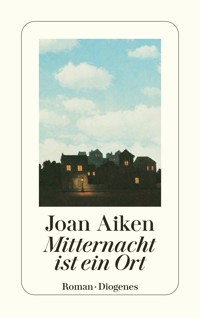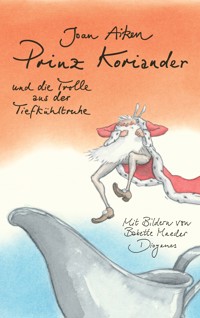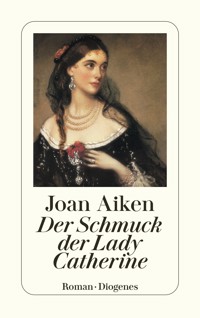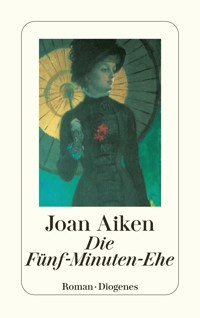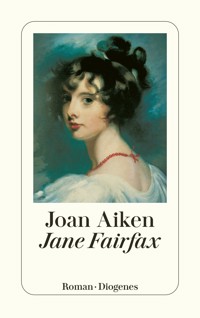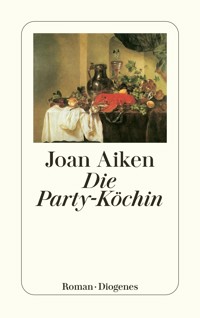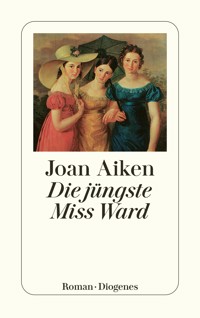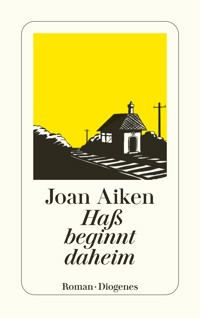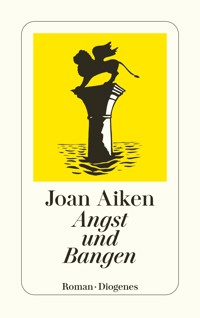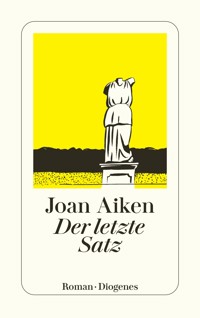
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Kind hielt Priscilla die griechische Insel Dendros für das Paradies auf Erden. Nun kehrt sie mit ihrer verwitweten Mutter, die sich von einem schweren Unfall erholen muß, dorthin zurück. Auch Lady Julia Saint weilt mit ihrem Mann in der Exklusivklinik Helikon, nachdem dieser auf ihrer Hochzeitsreise einen beunruhigenden Sonnenstich erlitten hat. Was von außen wie eine himmlische Idylle wirkt, entwickelt sich bald zum Schauplatz geheimnisvoller und gefährlicher Verstrickungen, die in unerklärliche Gewalt münden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Joan Aiken
Der letzte Satz
Roman
Aus dem Englischen von Edith Walter
Diogenes
Prélude
Als ich nach Hause ging, hörte ich im Crowbridge Park von weitem das leise, dumpfe Plopp-klack-plopp von Tennisbällen, untermalt von Stimmen, die den Spielstand ausriefen. Die Abendsonne wärmte mir angenehm die Schultern. Die Vögel sangen aus voller Kehle, denn es war April; die Apfelbäume hatten Knospen angesetzt, im Freien duftete es neu, kühl, würzig, und über allem lag ein prickelndes Versprechen. Am liebsten hätte ich, wie die Vögel, selbst aus voller Kehle gesungen. Seit fünf Uhr morgens auf den Beinen, wollte ich endlich nach Hause, um zu baden und mich ein bißchen aufs Ohr zu legen. Dann mußte ich ins Crowbridge Theatre Royal zurück, weil ich noch gut zwei Stunden mit der Bühnenausstattung und den Kostümen für Der Kirschgarten zu tun hatte, bevor der Vorhang sich zur Premiere hob. Es würde ein wunderbarer Abend werden, das fühlte ich. Endlich einmal hatten wir die Rollen mit den Ensemblemitgliedern des Crowbridge Repertoiretheaters wirklich perfekt besetzen können. Alle hatten, von Begeisterung mitgerissen, vorübergehend ihre Fehden und Eifersüchteleien vergessen und in Harmonie zusammengearbeitet, und das Ergebnis war eine wirklich runde Sache, flüssig, lebendig und herzzerreißend. Außerdem war ich zum erstenmal allein für Ausstattung und Kostüme zuständig. Von Stolz beflügelt, hatte ich mich halbtot geschuftet. Geschlafen hatte ich im letzten Monat im Durchschnitt drei Stunden pro Nacht, fühlte mich aber trotzdem phantastisch. Zum erstenmal im Leben war ich vollkommen ausgefüllt, hatte ich das Gefühl, wirklich zum Ensemble zu gehören, und war, was für mich noch mehr zählte, mit meiner Arbeit fast zufrieden. Nicht ganz zufrieden natürlich, denn die finanziellen Mittel unseres Repertoiretheaters waren beschränkt. Doch wenn man bedachte, daß die Kostüme aus den billigsten Stoffen geschneidert werden mußten, die wir auftreiben konnten, Kunstfasern und Juteleinwand, und die Kulissen auf Hartfaserplatten- und Holzresten gemalt waren, die im einheimischen Heimwerker-Möbelmarkt abfielen, schien mir das Ergebnis ein wahrer Triumph. Die anderen Ensemblemitglieder waren übrigens derselben Meinung. Sogar während meines kurzen Dreistundenschlafs war ich immer wieder aufgewacht und hatte bewundernd an den gemalten Kirschgarten mit seinen Grau- und Grüntönen und den zahlreichen Schattierungen von Weiß gedacht, von denen sich das Schwarz, Taubenblau und Mahagoni der Kostüme so vorteilhaft abhob. (Zum Glück hatten wir in Crowbridge auch eine große Färberei, und Rose Drew, die Tochter des Direktors, war unsere Varya.) Ich befürchtete, daß ich es, nachdem das Stück vom Spielplan abgesetzt worden war, nicht fertigbringen würde, diese schönen Kulissen hinauszuwerfen, und sah sie schon jetzt während der nächsten fünf Jahre als Dekoration in meiner Wohnung herumstehen.
Auch diese Wohnung war ein Glücksfall für mich. Ein Zimmer im Tiefparterre freilich nur, aber mit Ausblick auf den Park und die Kuppel des Theatre Royal, deren Vergoldung allmählich abblätterte. Ich konnte mir diese Wohnung erst leisten, seit ich zur Inspizientin und Requisiteurin befördert worden war und vier Pfund pro Woche mehr verdiente; seit einem Monat, um genau zu sein. Vorher hatte ich zusammen mit Rose Drew ein Zimmer mit Küchenbenützung bewohnt. Jetzt hatte ich meine eigene Küche und sogar ein Badezimmer mit einem Messingboiler und Schimmel an den Wänden. Aber egal, es war meine Wohnung; so nach und nach würde ich die gräßlichen Möbel meines Vermieters durch andere ersetzen, in Trödelläden entdeckt und nach meinem Geschmack gestrichen. Ich freute mich schon diebisch darauf. Inzwischen konnte ich die Abendsonne genießen, die durch mein Vorderfenster schien, den Ausblick auf den Park und den Luxus meines feuchten Badezimmers.
Ich durchquerte den kleinen Vorgarten, in dem ungestört bunte Hortensien vor sich hinwucherten. Sie gehörten meinem Vermieter, der sie wahrscheinlich nur deshalb gepflanzt hatte, weil sie am wenigsten Arbeit machten – nach diesem Motto richtete er sich auch auf allen anderen Gebieten –, ging über den zementierten Weg seitlich vom Haus zu meiner Tür, schloß auf und betrat meine Wohnung.
Auf den roten Fliesen des kleinen Flurs lag ein Telegramm.
Eine Spur des Lichts, das sich in der offenen zur Hälfte verglasten Wohnzimmertür spiegelte, fing sich in dem groben gelben Umschlag.
Er war an Priscilla Graffin adressiert. Das ist zwar mein Name, aber ich war dennoch verblüfft, denn nach meines Vaters Tod vor dreizehn Jahren hatte meine Mutter ihren Mädchennamen Meiklejohn wieder angenommen, und ich hatte meinen Namen mit einer notariell beglaubigten einseitigen Erklärung ebenfalls in Meiklejohn geändert. Und weder in der Schule noch im Crowbridge Theatre hatte man mich je mit meinem Vornamen gerufen, der sich höchstens auf einem Grabstein gut ausnimmt. Alle nannten mich Mike. Daher jagten mir die förmlichen Worte auf dem Umschlag einen richtigen Schreck ein, und meine Hände waren, als ich ihn aufhob, kalt und feucht von Schweiß. Und zugleich wurde mir bewußt, daß die Abendsonne nur ein Vorbote des Frühlings war und in meiner Wohnung arktische Kälte herrschte wie in einem Tiefkühlschrank.
Kommen Sie bitte sofort Stretford Hospital Ihre Mutter schwer verletzt lautete der unpersönliche mit dem Computer ausgedruckte Text auf dem bräunlichen Telegrammformular.
Es war eine Nachricht, mit der wir, das ist uns allen im tiefsten Innern bewußt, irgendwann im Lauf unseres Lebens rechnen müssen, von der niemand verschont bleibt; denn die Welt ist – so sehr wir auch mit Licht und Versatzstücken und Worten von machtvoller dramatischer Bedeutung herumspielen mögen – häßlich und gemein und nicht darauf ausgerichtet, daß es dem Menschen wohl ergehe.
Ich legte das Telegramm auf die scheußliche, unpraktische polierte Anrichte und fing an, umherzuwandern und mechanisch ein paar Sachen in eine kleine Reisetasche zu stopfen – Hausschuhe, Zahnbürste, Geld, Pullover. Wenn ich nur ein Telefon hätte! Zwar sollte ich demnächst eins bekommen, doch wie ich unser General Post Office kannte, mußten bestimmt noch ungefähr sechzehn Wochen verstreichen, bevor es soweit war.
Sechzehn Wochen – was würde bis dahin nicht alles passiert sein?
Zum Glück fiel mir in dem Moment ein, daß mein Hauswirt ein Telefon hatte und ich bei ihm oben telefonieren konnte. Seine Frau war normalerweise zwar nicht sehr entgegenkommend, doch das war schließlich ein Notfall. Ich ging also hinaus, um das Haus herum und die Stufen zu ihrer Wohnung hinauf. Außerdem mußte ich ihr wohl sagen, daß ich verreiste, damit sie dem Mann von der Wäscherei, dem Gasableser und dem Fensterputzer Bescheid geben konnte … Während ich im Kopf automatisch die entsprechenden Punkte abhakte, sah ich hinter der Tür mit dem Riffelglas die große, sargförmige Gestalt von Mrs. Charm auftauchen.
Charm: ein höchst unpassender Name für jemand, der nicht ein Fünkchen Charme besaß. Ihr blaßrosa Gesicht sah wie ein mißlungener Kuchen mit Zuckerguß aus. Ihre feuchten Augen tränten ständig hinter der goldfarbig gefaßten Brille, und ihr strohfarbenes Haar war ungeschickt zu einem kissenähnlichen Aufbau getürmt.
»Eh, Miss Meiklejohn«, begann sie in ihrem zum Schneiden dicken Belfaster Akzent, »was warr’n das fürn Telegramm? Derr Junge war zuerrst hierr, aberr ich hab ihm gesagt, Sie wohnen unten …«
»Ja, darum geht es«, unterbrach ich sie schnell, denn sie hätte so schnell kein Ende gefunden. »Meine Mutter hat einen Unfall gehabt. Sie liegt im Stretford Hospital, und ich muß zu ihr. Dürfte ich Ihr Telefon benutzen?«
»Oh, wie schrrecklich!« sagte sie, plötzlich mit ganz glukkenhaft übertriebener Fürsorge und kam sich ungeheuer wichtig vor. Sie führte mich zum Telefon, das in dem mit Möbeln vollgestopften Raum auf einem fürchterlichen gläsernen Beistelltischchen stand. »Warr’s ein Autounfall?«
Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. »Wissen Sie, wo Stretford ist?« fragte ich, während ich darauf wartete, daß die Auskunft sich meldete. Mrs. Charm wußte nicht einmal, daß es einen Ort dieses Namens gab. »Hoffentlich isses nicht zu weit weg«, erklärte sie salbungsvoll.
Da meine Mutter Direktorin einer großen Gesamtschule in den Midlands war und der Unfall sich wahrscheinlich dort ereignet hatte, Crowbridge aber an der Südküste liegt, war diese Hoffnung bestimmt vergeblich.
Die Auskunft meldete sich und gab mir die Nummer des Krankenhauses. Nach den üblichen Endlospausen, in denen es immer wieder klickte, rauschte und krachte und undefinierbares Gemurmel, unterbrochen von langen Perioden absoluter Stille, meine Geduld auf eine harte Probe stellte, bekam ich die Verbindung.
»Ist dort das Stretford Hospital? Können Sie mich zur Intensivstation durchstellen?«
Nachdem ich noch einmal längere Zeit warten mußte, meldete sich endlich die Intensivstation.
»Oberschwester Crouch.« Eine klare, intelligent klingende Stimme. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»M-mein Name ist Meiklejohn. Ich habe ein Telegramm bekommen, es geht um meine Mutter, Mrs. Barbara Meiklejohn …«
»Meiklejohn? Ich dachte, Sie heißen Graffin. Entschuldigen Sie den Irrtum. Ich bin sehr froh, daß Sie anrufen.« Die Stimme bekam einen leicht vorwurfsvollen Unterton. »Wir haben versucht, uns mit Ihnen in Verbindung zu setzen, aber Sie haben anscheinend kein Telefon.«
»Nein, leider nein. Ist sie – was ist … Wie geht es meiner Mutter?«
»Es ist noch zu früh, um etwas Endgültiges zu sagen. Sie wurde heute nachmittag um halb fünf operiert.«
»Operiert? Was ist denn geschehen?«
»Ein Dach ist über ihr zusammengestürzt.«
»Wie bitte?«
»Das Dach der Turnhalle ihrer Schule, wenn ich richtig verstanden habe. Sie hat eine Kopfverletzung … Woher rufen Sie an, Miss Meiklejohn?«
»Ich bin in Kent, und da ich nicht daheim war, habe ich Ihr Telegramm erst jetzt vorgefunden …«
»Sie sollten so schnell wie möglich herkommen«, sagte Oberschwester Crouch.
Ihre Stimme klang freundlich, verständnisvoll, mitfühlend, doch sie erschreckte mich bis ins Mark. Die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir war nicht besonders eng, aber wir hatten keine anderen Verwandten, und die Vorstellung, in einer Welt zu leben, in der es sie nicht mehr gab, kam mir unerträglich trostlos vor.
Ich wagte nicht, nach näheren Einzelheiten zu fragen. Es gelang mir nur schwer, meine Stimme unter Kontrolle zu halten – und ich fühlte die schweigende Allgegenwart von Mrs. Charm, die neugierig wie eine Elster fast lauernd hinter mir stand.
»W-wo ist das Stretford Hospital?« fragte ich. »Wie komme ich dorthin?«
Die Oberschwester schien erstaunt, weil ich es nicht wußte, sagte aber: »Sie nehmen einen Zug von King’s Cross. Mit dem Schnellzug sind Sie in zwei Stunden hier.«
»Danke. Aber da ich zuerst nach London muß, werde ich es bestenfalls in vier bis fünf Stunden schaffen. Sagen Sie – ist meine Mutter bei Bewußtsein?«
»Im Moment nicht. Aber sobald sie zu sich kommt, sage ich ihr, daß Sie unterwegs sind.«
»Vielen Dank, Oberschwester«, sagte ich bedrückt, doch sie hatte schon aufgelegt.
»Eh, Sie müssen über London fahrren, dasis schrrecklich«, sagte Mrs. Charm. »Rrufen Sie doch gleich auch ein Taxi, das Sie zum Bahnhof brringt.«
Das war ein guter, nützlicher und ungewöhnlich freundlicher Vorschlag, den ich natürlich sofort befolgte.
Doch dann verdarb Mrs. Charm den guten Eindruck wieder, den ich von ihr gewonnen hatte. »Sie müssen die Gesprräche nicht gleich bezahlen, ich schlage sie Ihnen auf die nächste Wochenmiete auf. Warr’s denn nun ein Autounfall?«
»Nein, ein Dach ist ihr auf den Kopf gefallen«, sagte ich und ließ sie mit weit aufgerissenen Augen stehen.
Die Taxizentrale hatte mir gesagt, der Wagen brauche wenigstens zwölf Minuten bis in die Parkside Villas; Zeit genug, um fertigzupacken. Dann wurde mir plötzlich ganz komisch, Schwäche überkam mich, ich trank eine Tasse Wasser und fiel kraftlos in einen der beiden widerwärtigen Lehnsessel, die aus der Art-deco-Periode der dreißiger Jahre stammten – schmutziggraue Sessel mit geschwungenen Formen, die mit einer leichten Schaukelbewegung nach hinten kippten, wenn man sich setzte. Daß der Sessel unter mir nicht stillhielt, verstärkte noch das quälende Gefühl in mir, die ganze Welt breche unter mir zusammen. Ich sah mich in dem häßlichen, düsteren Zimmer mit den orangefarbenen Wandsockel, den grünlichgelben Vorhängen und der senfgelben Tapete um und fragte mich, ob ich ihm noch einmal dieselben Empfindungen entgegenbringen konnte wie bisher – bis zu dem Augenblick, in dem ich das Telegramm gelesen hatte; meine Hoffnungen und Pläne, es eines Tages nach meinem Geschmack umzugestalten, waren offenbar dahin. Die Abendsonne war weitergewandert und schien nicht mehr herein. Das Zimmer wirkte jetzt unglaublich trostlos.
Auf der Straße bremste ein Wagen. Das Taxi? Ich sprang auf, warf noch ein paar Sachen in die Tasche und ging, ohne einen einzigen Blick zurück. Mrs. Charm hatte einen Schlüssel. Mochte sie, wenn ich weg war, ruhig zum Schnüffeln kommen und feststellen, daß die Wohnung unordentlich war. Mir war’s egal.
»Halten Sie bitte kurz am Royal Theatre«, sagte ich zum Taxifahrer.
Rickie würde da sein. Er wohnte außerhalb von Crowbridge, eine Stunde mit dem Motorrad, und er hatte gesagt, er wolle im Theater bleiben und sich im Künstlerzimmer ein bißchen hinlegen. Ihm würde ich Bescheid sagen, und er konnte es dann den anderen ausrichten.
Ich weckte ihn nur ungern. Er schlief fest, hatte sich auf einem Haufen übriggebliebener Jutesäcke zusammengerollt und sah im Schlaf sehr wehrlos aus. Als ich ihn schüttelte, fuhr er in die Höhe, rieb sich die Augen, fuhr sich durch den zerzausten Schopf. Er sah wie ungefähr vierzehn aus, war aber zweiundzwanzig, sechs Monate jünger als ich und schon sehr berufserfahren. Er war mit sechzehn zur Bühne gegangen und hatte an verschiedenen Repertoiretheatern gearbeitet.
»Was soll das?« fragte er gähnend. »Is was passiert?«
»Ich bin heute abend nicht hier, Rickie, ich muß weg. Meine Mutter hatte einen Unfall. Sie ist schwer verletzt, und ich muß zu ihr, quer durch halb England. Sag bitte den anderen, daß es mir sehr leid tut.«
»O mein Gott!« Er sah mich sprachlos an, begriff nur langsam.
»Oh, wie schrecklich, Mike!« Die gleichen Worte, die Mrs. Charm benutzt hatte, aber was für ein Unterschied! »Du könntest nicht bis nach der … Nein, natürlich nicht. Du wärst nicht bei der Sache, würdest dir nur furchtbare Sorgen machen. Aber wie sollen wir ohne dich fertig werden?«
»Du schaffst das schon, und bestimmt sehr gut.« Rickie war mein Assistent. Das meiste konnte er genausogut wie ich, in einigen Dingen war er mir sogar überlegen. Jetzt jedoch rührte mich der Ausdruck von Ergebenheit, mit dem er sagte: »Aber ohne dich wird es nicht dasselbe sein, Mike. Es kommt mir so unfair vor … Natürlich sehe ich ein, daß du fahren mußt.« Er umarmte mich und setzte hinzu: »Armer Liebling, wie entsetzlich für dich! Wohin mußt du?«
»Nach Stretford. Und ich weiß nicht mal, wo das ist.«
»Aber ich weiß es. Meine Großmutter hat dort gewohnt. Es liegt in der Nähe von Northampton. Fährst du jetzt gleich?«
»Ja, ich muß los. Ich hab das Taxi warten lassen.«
»Ich ertrag’s einfach nicht, daß du diesen Abend versäumen mußt«, sagte er unglücklich.
Ich ertrug es selbst kaum, deshalb sagte ich noch einmal:
»Ich muß wirklich los.«
»Warte – hast du was gegessen?«
»Nein, aber ich kauf mir was auf dem King’s Cross-Bahnhof. Sag den anderen, wie leid es mir tut, und richte Eve aus …«
»Hier, nimm das.« Er schob mir ein fettiges Päckchen in die Hand. »Und ein Taschenbuch – ich wette, du hast keins mitgenommen, und die Fahrt nach Stretford dauert ewig, davon weiß ich ein Lied zu singen.«
Ich versuchte abzulehnen, doch er überrannte meinen halbherzigen Widerstand und begleitete mich zum Taxi. »Hast du genug Geld bei dir?« fragte er. Wie wär’s mit fünf Pfund?«
»Danke, aber Geld hab ich genug.« Zum Glück hatte ich gerade meine Gage bekommen.
Rickie sah nicht besonders eindrucksvoll aus – klein, schwächlich, schwindsüchtig, mit kurzsichtigen Augen hinter dicken Brillengläsern aus Bergkristall –, aber ich bin nie einem netteren und verläßlicheren Menschen begegnet. Plötzlich wünschte ich mir, er könnte mich auf meiner Reise begleiten, wollte ihn bei mir haben. »Ich hoffe sehr, daß dich dort eine gute Nachricht erwartet«, sagte er ernst und griff nach der Klinke, um die Tür des Taxis hinter mir zu schließen.
Ich nickte, biß mir auf die Unterlippe, schluckte und sagte: »Morgen ruf ich dich an.«
»Bitte vergiß es nicht!«
Die Tür klappte zu, und er ging ins Haus zurück. Hoffentlich konnte er wieder einschlafen.
Die Fahrt dauerte genauso lange und war genauso gräßlich, wie ich erwartet hatte. Von Crowbridge nach Charing Cross verkehren hauptsächlich Bummelzüge, und der, mit dem ich fuhr, schien besonders langsam zu sein. Gedränge und Gewimmel in London widerten mich an wie immer. So schnell wie möglich kämpfte ich mich von einem Hauptbahnhof zum anderen durch, aber es war inzwischen halb zehn Uhr abends, und die U-Bahnen fuhren nur noch unregelmäßig. Auf dem King’s Cross-Bahnhof stellte ich fest, daß der nächste Zug nach Stretford in fünf Minuten ging, was mir zuerst ein reiner Glücksfall zu sein schien. Ich stieg rasch ein – natürlich war der Zug voll und kein einziger Platz mehr frei –, und er fuhr auch pünktlich los, hielt aber ungefähr zweihundert Meter hinter dem Bahnhof wieder an und setzte sich erst nach einer guten halben Stunde mit einem Ruck endgültig nordwärts in Bewegung. Es war wieder ein Bummelzug, der an jeder winzigen Station hielt; die Nester trugen Namen, die ich im Leben noch nie gehört hatte – zum Beispiel Scroop und Priddy’s End und Moleham und Gazeby-on-the-Wold. Daß es Menschen gab, die freiwillig hier wohnten, überstieg meine Vorstellungskraft.
Unendlich dankbar war ich für Rickies großes, fettes Stück Speck zwischen zwei altbackenen Brotscheiben. Die Stunden verstrichen, und ich stand schwankend zwischen zwei Fremden in dem engen, staubigen Gang mit unzähligen Zigarettenkippen und klebrigen Resten von verschüttetem Cola auf dem Boden. Das Taschenbuch, das Rickie mir mitgegeben hatte, war Candide; ich kannte es nur allzugut und fand es zu deprimierend, also überließ ich mich meinen eigenen Gedanken.
Und zu denken gab es genug …
Wie würde mir zumute sein, wenn Mutter starb?
Unsere Beziehung war seit Jahren nicht mehr sehr eng, und ich hatte deshalb ein permanent schlechtes Gewissen; oft aber bereitete es mir auch Kummer, daß wir uns, seit ich erwachsen war und selbst verdiente, so selten sahen. Ich hatte sie schon ein paarmal zu neuen Produktionen im Theatre Royal eingeladen, aber ihr Leben als Direktorin der riesigen Market Broughton Gesamtschule füllte sie ganz aus; das bißchen Freizeit, das ihr blieb, schien sie bei Tagungen und Konferenzen über das Erziehungswesen zu verbringen und hatte daher nie Zeit gehabt, nach Crowbridge zu kommen. Ich wiederum erledigte zwei- oder dreimal im Jahr meine Pflichtbesuche bei ihr, die nie länger dauerten als ein Wochenende. Es waren immer ziemlich unerfreuliche Tage und die Stimmung zwischen uns gezwungen, denn unsere Interessen waren so verschieden, daß wir uns praktisch nichts zu sagen hatten. Nicht einmal ihr Haus war noch das Haus meiner Kindheit, das Haus, in dem ich aufgewachsen war. Als sie nach Vaters Tod wieder angefangen hatte zu unterrichten, hatte ihr mühsamer, aber schließlich doch sehr erfolgreicher beruflicher Werdegang sie gezwungen, häufig den Wohnort zu wechseln, da sie immer wieder versetzt wurde. Mich hatte sie in ein Internat gesteckt, da sie der Meinung war, es wäre nicht gut für mich, die Schule zu besuchen, an der sie unterrichtete. Später entschloß ich mich, nach Frankreich an eine Schauspielschule zu gehen. Die Ferien verbrachten wir auch nur selten zusammen; Mutter entdeckte immer irgendwelche Kurse oder Seminare, die ich absolvieren mußte, oder nahm selbst an irgendwelchen Kursen teil. Und obwohl ich unglücklich war, stand für mich fest, daß sie das nur tat, um mich – vielleicht aber auch sich selbst? – darüber hinwegzutäuschen, daß sie mich nicht liebte, sondern ganz einfach langweilig fand. Die einzigen echten Gefühle, deren sie fähig war, hatte sie – davon war ich überzeugt – mit meinem Vater und meiner älteren Schwester begraben, die zwar nicht zur gleichen Zeit, jedoch im selben Jahr gestorben war wie er. Das war schon lange her, ich war damals neun gewesen.
Die Tatsache, daß Mutter den Schmerz über ihren Tod allein tragen mußte, weil ich zu dieser Zeit in Griechenland war, hatte uns nur noch weiter voneinander entfernt. Wäre ich nur bei ihr gewesen, dachte ich oft, wir stünden uns heute bestimmt viel näher.
Vor Vaters plötzlichem Tod hatten mich meine Eltern auf die Insel Dendros zu einer griechischen Familie geschickt. Die Idee kam von meinem Vater. Er hatte während des Zweiten Weltkriegs einige Zeit auf Dendros verbracht, sich in die Insel verliebt, Freunde gefunden und wollte, daß seine Kinder Land und Leute ebenfalls kennenlernten. Meine Schwester Drusilla war ein paar Jahre vor mir dagewesen, aber es hatte ihr nicht gefallen. Sie war zart, verabscheute die Hitze, schrieb kreuzunglückliche Briefe und bettelte, nach Hause kommen zu dürfen. Ich hingegen war hellauf begeistert; ich liebte die Freunde meines Vaters, die Aghnides, und besonders eng schloß ich mich an die gleichaltrige Kalliope Aghnides an. Nach Vaters Tod verkaufte Mutter unser Haus und zog in ein kleineres. Vater war Sänger gewesen und hatte Gesangsunterricht gegeben, was ihm ein gutes, aber beileibe kein üppiges Einkommen eingebracht hatte. Mutter schrieb den Aghnides, daß der Umzug noch anstrengender wäre, wenn ich ihr dauernd im Weg stünde, und fragte an, ob ich noch ein paar Monate länger auf Dendros bleiben könnte. Selbstverständlich schrieben die gastfreundlichen Aghnides zurück, ich könne bleiben, solange Mutter es wünsche.
Und so fand der Umzug aus dem Haus, in dem ich geboren war und mein ganzes bisheriges Leben verbracht hatte, ohne mich statt. Ich betrat es nie wieder. Es war ein großes, freundliches Farmhaus am Stadtrand von Oxford. Der Verlust meines liebevollen, fröhlichen und sanften Vaters, der Gärten, Vögel und Music-Hall-Songs aus viktorianischer Zeit geliebt hatte, war – zusammen mit dem Verlust der vertrauten Landschaft meiner Kindheit (sogar mein Kater Othello war während des Umzugs verschwunden) – ein Schock für mich, der mich auf seltsame Weise lähmte. Nachts träumte ich von meinem Zimmer mit den schiefen Deckenbalken und dem Blick auf den Obstgarten; ich war todunglücklich und konnte einfach nicht glauben, daß ich nie wieder dort schlafen sollte. Jahre später ging ich einmal an ›unserem‹ Haus vorbei, hätte gern angeklopft und gefragt, ob ich mich ein bißchen darin umsehen dürfe, aber mir fehlte der Mut; es wäre zu schmerzlich für mich gewesen. Merkwürdigerweise träumte ich nie von meinem Vater, es war, als habe er sich mir völlig entzogen, sei tief in mein Unterbewußtsein eingesunken.
Die Aghnides waren in dieser Zeit sehr lieb und herzlich zu mir, und ich war auf Dendros glücklich. Ich liebte ihr kühles, altes Haus mit dem gekiesten Hof und den Orangenbäumen drumherum. Ich liebte Kalliope und ging begeistert mit ihr in die griechische Schule. Der Schmerz wurde allmählich schwächer, lebte dann aber wieder auf. Meine Schwester Drusilla verunglückte an ihrem siebzehnten Geburtstag in der Schule tödlich. Mutter teilte den Aghnides die furchtbare Nachricht mit und fragte abermals an, ob ich noch bleiben dürfe. Mir schrieb sie nicht. Man sagte es mir damals auch noch nicht, und ich hatte es bis heute nicht fertiggebracht, Mutter zu fragen, was das für ein Unfall gewesen war, der Dru das Leben gekostet hatte.
Diese Unfähigkeit, mit ihr zu sprechen, mag als Maßstab für die Kluft gelten, die sich zwischen Mutter und mir aufgetan hatte. Ich wußte, daß Dru ihr Liebling gewesen war. Dru war freundlich, zurückhaltend, ernst, unglaublich fleißig und hatte Geologin werden wollen. Dru war meiner Mutter nachgeraten. Sie hatte in Cambridge studieren wollen. Ich hingegen? Aus mir wäre nie eine Wissenschaftlerin geworden, und wenn man mich zwanzig Jahre in Schulen und ähnliche Zuchtanstalten gepreßt hätte. Meine Intelligenz war nicht von dieser Art. Außerdem, davon war ich überzeugt, war Dru ein Wunschkind gewesen, ich jedoch ein unerwarteter Nachzügler, der nur im Weg war. Mit zehn Jahren trauerte ich tief und aufrichtig um Dru, die mich immer freundlich und liebevoll behandelt hatte, aber wegen der sieben Jahre Altersunterschied zwischen uns mehr wie ein dritter Elternteil, nicht wie eine Schwester. Ich wünschte mir jedoch nicht, wie nach Vaters Tod, nach Hause zu fahren. Der Gedanke, daß nichts mehr so war wie vorher, die Vorstellung, mit Mutter allein zu sein, war zu erschreckend für mich.
Ich fügte mich nur allzugern, als beschlossen wurde, daß ich wenigstens bis zum nächsten Jahr bei den Aghnides bleiben sollte. Am Ende wurden es fast drei Jahre, die ich auf Dendros verbrachte, und ich kehrte nur nach England zurück, weil die Aghnides ein großes Familientreffen in den USA planten. Sie schlugen mir sogar vor, sie zu begleiten, aber Mutter konnte den Flug nicht bezahlen, und obwohl sie sich bereiterklärten, die Reisekosten für mich zu übernehmen, lehnte Mutter ab; sie wollte sich ihnen nicht in einem solchen Ausmaß verpflichtet fühlen. Eine ihrer hervorstechendsten Eigenschaften war ein leidenschaftlicher Unabhängigkeitsdrang. Also kehrte ich endlich mit fast zwölf Jahren nach England zurück. Die Trennung von den Aghnides, die inzwischen ›meine‹ Familie geworden waren, fiel mir sehr schwer, und es tat mir weh, die warme glückliche Insel verlassen zu müssen.
Es war eine seltsame, eine traurige Rückkehr. Mutter unterrichtete damals Geschichte an einer großen Schule in Birmingham, also fuhr ich dorthin. Sie hatte eine möblierte Wohnung gemietet und unsere Möbel eingelagert, und daher gab es in keinem der drei Zimmer etwas, das mich an zu Hause erinnerte, außer einer Kiste mit meinen Spielsachen und Büchern, die Mutter aufgehoben hatte, für die ich aber inzwischen zu alt geworden war. Am schlimmsten jedoch war, daß wir Fremde zu sein schienen und es auch blieben. Sie hatte mich in einer ländlichen Internatsschule angemeldet, in die sie mich schon eine Woche später verfrachtete, denn, so sagte sie, eine Wohnung in Birmingham sei nicht der richtige Platz für ein Kind. Auf diese Weise machte sie es uns praktisch unmöglich, einander wiederzuentdecken.
Und die Möglichkeit schien sich auch während der nächsten elf Jahre nie zu ergeben. Mutter tat ihre Pflicht, soweit es um mich ging, aber ihr Herz gehörte ihrer Karriere, die sie mit stoischer Zielstrebigkeit und Energie verfolgte. Ich bewunderte sie, sah zu ihr auf, aber es fiel mir schwer, sie zu lieben, außer auf eine zurückhaltende und vorsichtige Art und ohne je Liebe von ihr zu erwarten. Sie war so verschlossen, so kalt. Ich wußte, daß sie zu einer engen Beziehung kaum fähig war, weil es ihr schwerfiel, sich ungezwungen zu geben und Zuneigung zu zeigen, sie war durch und durch Schottin, und seit die beiden Schicksalsschläge sie getroffen hatten, kehrte sie die Schottin noch mehr heraus und wurde noch verschlossener. Ich hatte das Gefühl, es sei meine Pflicht, die Kluft zwischen uns zu überbrücken, denn mir fiel es leichter als ihr, Kontakte zu knüpfen, vor allem seit ich in der Welt draußen Umgang mit mir geistig verwandten Kollegen hatte. Aber sobald ich versuchte, meiner Mutter näherzukommen, verließ mich der Mut, auch heute noch. Jeder zaghafte Versuch, mich ihr zu nähern, scheiterte an ihrem abweisenden Wesen, das mich lähmte. Daher schob ich jedes ernsthafte Bemühen immer wieder auf, bis ich mich ihr eines Tages gewachsen fühlen würde.
Hoffentlich hatte ich nicht zu lange gewartet.
Endlich lief der Zug in Stretford ein – einer dunklen, reizlosen, schmutzigen Industriestadt, in der es in der Kühle der Nacht nach Brauereien, Gerbereien und heißem Metall roch. Der Widerschein aus den verschiedenen Fabriken sprenkelte den Himmel mit trüb orangefarbenen Flecken. Es schien eine wohlhabende Stadt zu sein – wenigstens warteten auch noch jetzt, nach Mitternacht, mehrere Taxis auf dem kopfsteingepflasterten Bahnhofsvorplatz. Ich bat einen Fahrer, mich zum Krankenhaus zu bringen, und war sehr froh, daß ich’s getan hatte, denn die Fahrt in die Vorstadt dauerte eine Viertelstunde. Stretford, mitten in der Ebene der Midlands gelegen, und Market Broughton, wo die Schule meiner Mutter war, schienen fast ineinander überzugehen. Ich hätte genausogut einen Zug nach Market Broughton nehmen können und wäre schneller am Ziel gewesen.
Oberschwester Crouch hatte noch Dienst auf der Intensivstation. Sie war eine kleine Frau mit scharfen Gesichtszügen, Sommersprossen und semmelblondem Haar, die nur einen einzigen Blick auf mich warf und sagte: »O Gott, Sie Ärmste! Sind Sie etwa schon unterwegs, seit wir miteinander telefoniert haben? Gehen wir in mein Dienstzimmer, dort können Sie eine Tasse Tee trinken und sich ein bißchen aufwärmen. Ihre Mutter ist noch bewußtlos, es hat also keinen Sinn, sofort zu ihr reinzustürzen. Ich bin trotzdem froh, daß Sie hier sind. Sobald sie zu sich kommt, werden wir Sie brauchen.«
»Was ist ihr passiert?« fragte ich noch einmal und schlürfte den kochend heißen, geschmacklosen Krankenhaustee.
»Sie ist am Kopf verletzt. Ein Balken ist auf sie gefallen. Sie hat einen Schädelbruch, und außerdem mußte ein Blutgerinnsel entfernt werden.«
»War es – wird sie …« Ich schluckte und begann noch einmal. »Wie stehen ihre Chancen?«
Oberschwester Crouch warf mir einen harten, abschätzenden Blick zu. »Hat Ihre Mutter keine anderen Verwandten – keine Brüder, Schwestern? Keine anderen Kinder? Keine Eltern – Großeltern? Nur Sie?«
Ich nickte verängstigt.
»Sie sind sehr jung«, sagte sie. »Aber Sie sehen vernünftig aus, das muß ich sagen. Gut, Sie sollen es wissen: Der Chirurg, der Ihre Mutter operiert hat, denkt, ihre Chancen stehen eins zu zehn.«
»Ihre Chancen zu überleben?«
»Zu überleben – oder wieder ein normales Leben führen zu können. Aber« – sie hob die Hand, obwohl ich nichts gesagt hatte und sie nur benommen anstarrte – »aber ich bin nicht seiner Meinung. Da ich eine Frau bin, begreife ich besser, was für eine Frau Ihre Mutter ist. Ich glaube, sie ist zäh und hat eine sehr große natürliche Widerstandskraft. Ich denke, ihre Chancen sind besser, als er meint. Aber es kann eine langwierige, langsame Sache werden. Und vielleicht habe ich unrecht. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Dr. Wintersmain ist ein sehr erfahrener Chirurg. Alles hängt davon ab, wie sie die nächsten sechsunddreißig Stunden übersteht.«
»O ja, ich verstehe«, sagte ich. Doch eigentlich verstand ich gar nichts.
Oberschwester Crouch sah mich freundlich an und entgegnete: »Sie können Sie jetzt sehen, kommen Sie. Und dann gehen Sie ruhig nach Hause und ruhen sich ein bißchen aus.«
Nach Hause? dachte ich verwirrt, während ich hinter der Oberschwester durch den breiten, blankpolierten Korridor hertrottete, in dem es nach Medikamenten roch. Wo ist zu Hause?
Dank ihrer Stellung als Direktorin der Market Broughton Gesamtschule hatte man Mutter in ein Privatzimmer gelegt, und da lag sie, flach unter einem weißen Laken, den Kopf dick bandagiert, durch mehrere Schläuche mit Flaschen verbunden, die an einem dreibeinigen Gestell hingen. Ihr Gesicht, das, wie ich feststellte, zum Glück unverletzt geblieben war – ich hatte große Angst gehabt, daß sie entstellt sein könnte –, sah unverändert aus: blaß, streng, die Lippen zu einer festen Linie zusammengepreßt, die Stirn leicht gerunzelt, als ließen die Gedanken sie nicht einmal im Zustand tiefer Bewußtlosigkeit los. Ihre Stirn unterhalb des Verbandes wirkte sehr hoch, und dann fiel mir ein, daß man ihr natürlich vor der Operation den Kopf rasiert haben mußte. Arme Mutter – nicht, daß sie besonders großen Wert auf ihr Äußeres legte, aber sie hatte hübsches Haar gehabt, ein helles schottisches Strohblond, in dem sich auch jetzt noch keine Spur von Grau zeigte; und Mutter war immerhin Anfang Fünfzig. Sie hatte immer große Würde ausgestrahlt, doch die schien, so traurig das war, mit ihrem Haar dahin zu sein. Nun ja, da lag sie also – abweisend, streng, ein helmtragender Kreuzfahrer auf seinem Sarg, das Gesicht wie aus grauem Marmor gemeißelt. Mich überkam plötzlich das Verlangen, niederzuknien, das Gesicht auf die Bettkante zu pressen und zu rufen: »Mutter! Mutter, sag etwas zu mir! Sag mir, daß du mich liebst! Sag mir, daß du wieder gesund wirst!«
Doch ich beugte mich nur über sie und küßte sie auf die Wange.
Oberschwester Crouch machte ein Gesicht, als finde sie mein Verhalten zwar unvernünftig, aber menschlich verständlich.
»Jetzt gehen Sie wohl am besten nach Hause und schlafen ein paar Stunden«, sagte sie.
Wo ist zu Hause? dachte ich wieder.
»Ich würde Sie ja von einem Wagen des Krankenhauses heimbringen lassen«, fuhr die Schwester fort, »aber zum Haus Ihrer Mutter sind es höchstens zehn Minuten, und ein kleiner Spaziergang wird Ihnen guttun. Dann können Sie bestimmt besser schlafen.«
»Ich – ich habe keinen Schlüssel zu Mutters Haus«, sagte ich verwirrt, aber Oberschwester Crouch meinte beruhigend: »Wir haben ihre Handtasche hier, da ist der Schlüssel bestimmt drin. Wenn Sie morgen früh wiederkommen, bringen Sie bitte einen kleinen Koffer mit – für ihre Kleider. Ich schreibe Ihnen auch noch ein paar andere Sachen auf, die sie brauchen wird. Selbstverständlich rufen wir Sie sofort an, wenn eine Veränderung eintritt und wir denken, daß Sie hier sein sollten. Die Nummer haben wir. Wie gut, daß Sie ganz in der Nähe sind. Und Sie können uns selbstverständlich auch jederzeit anrufen.«
Sehr freundlich, diese Oberschwester Crouch; sie wollte wirklich ihr Bestes für mich tun.
Sie reichte mir eine schlichte schwarze Diplomatenmappe, in der natürlich mustergültige Ordnung herrschte; außer den Schlüsseln enthielt sie unter anderem Mutters Terminkalender, Führerschein und mehrere Karteikarten, die mit ihrem Beruf zu tun hatten.
Mutter wohnte am Rand des riesigen Schulkomplexes, der zufällig an den Park des Krankenhauses grenzte, im Haus der Direktorin. Nicht unbedingt ideal für die Patienten, die sicherlich unter dem Lärm litten, den ein paar hundert Kinder auf Schulhof, Spiel- und Sportplätzen machten, aber Industriestädte des 19. Jahrhunderts mußten sich eben da ausdehnen, wo Platz war.
Ich kam durch eine solide viktorianische Vorstadt mit breiten Straßen und den mit gotischen Türmchen bestückten Villen der Fabrikbesitzer. Die Gärten prunkten mit Zedern, Araukarien und Rhododendren. Irgendwie war mir nicht ganz wohl dabei, daß ich mich um drei Uhr morgens wie ein Einbrecher in Mutters Haus schleichen mußte; ich war bisher nur einmal dagewesen, vor sechs Monaten etwa. Freunde vom Repertoiretheater in Birmingham hatten mich hergefahren. Mutter war auch erst seit einem knappen Jahr hier.
Das Haus war wie die anderen Schulgebäude nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut worden, ein kleiner, schmuckloser Würfel, nicht viel besser als ein größeres Reihenhaus, aber wenigstens praktisch.
In der engen Diele lagen mehrere Briefe auf der Türmatte. Berufliche Post, hauptsächlich, wie ich feststellte, als ich sie aufhob und auf ein Beistelltischchen legte. Wohnzimmer rechts, dahinter ein Eßzimmer, das Mutter als Arbeitszimmer benutzte, und die Küche direkt geradeaus. Das Haus war völlig geruchlos, ordentlich und makellos sauber. Ich ging in die Küche, nahm mir ein Glas Milch, überlegte, ob ich mir ein Käsebrot machen sollte, ließ es dann aber sein und stieg, nachdem ich das Licht ausgeknipst hatte, in den ersten Stock hinauf.
Der Grundriß der oberen Räume entsprach dem der unteren: Mutters Zimmer über dem Wohnzimmer, Gästezimmer über dem Arbeitsraum, Bad über der Küche. Ich stellte Mutters Tasche in ihrem Schlafzimmer ab, das wie alle anderen Räume asketisch kahl und ordentlich war, mit Möbeln ausgestattet, die in Mutters Jugend modern gewesen sein mochten: helle Schwedenhölzer, geschwungene Formen, Teppiche und Vorhänge blaßbraun und grau. Keine Nippes, keine Souvenirs, keine Schätze, keine sinnlosen Kleinigkeiten. Auch keine Fotografien. Nichts, das verriet, daß die Frau, die hier lebte, Mann und Kinder gehabt hatte. Entmutigt stellte ich die Tasche auf das ordentlich gemachte Bett, suchte den Wäscheschrank, holte Bettwäsche heraus und machte mir das Bett im Gästezimmer zurecht. Es wäre praktischer gewesen, in Mutters Zimmer zu schlafen, wo ein Telefon stand, doch der Gedanke widerstrebte mir.
Das Haus war so still und verlassen, daß es mir fast nicht möglich war, einzuschlafen. Ich schien auf der ganzen weiten Welt der einzige Mensch zu sein. Nachtgeräusche der Stadt hielten mich wach, aber sie waren irgendwie unwirklich, mechanisch: Züge, die verschoben wurden, Fabriken, die stampften und wimmerten; sie halfen mir nicht über meine Verlassenheit hinweg.
Ungefähr zehn vor sechs fiel ich endlich in einen schweren Schlaf, wurde aber – wie mir schien – vom Klingeln des Telefons fast sofort wieder herausgerissen. Erschrocken, völlig durcheinander stolperte ich in Mutters Zimmer, griff nach dem Telefonhörer und erwartete, Oberschwester Crouch sagen zu hören: »Kommen Sie sofort!« Aber die Stimme, die sich dann meldete, kannte ich nicht.
»Hier spricht Gina Signorelli«, verkündete sie sofort. »Ich habe eben im Krankenhaus angerufen, und man hat mir gesagt, der Zustand Ihrer Mutter sei unverändert.«
»Was – wer …«
»Sie sind doch Miss Meiklejohn, nicht wahr? Im Krankenhaus hat man mir gesagt, daß Sie im Haus Ihrer Mutter sind.«
»Ja – ja, das stimmt. Tut mir leid, ich bin gerade erst aufgewacht.« Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Es war halb acht. »Würden Sie mir bitte noch einmal sagen, wer Sie sind?«
»Gina Signorelli. Ich würde gern in einer halben Stunde rüberkommen und Mrs. Meiklejohns Post abholen – wenn Sie nichts dagegen haben. Es sind bestimmt eine Menge Briefe zu beantworten. Geht das in Ordnung?«
»Aber ja, selbstverständlich«, sagte ich, da ich mich von meinem bisher einzigen Besuch her vage daran erinnerte, daß Gina Signorelli Mutters Sekretärin und persönliche Assistentin war.
»Soll ich Ihnen irgendwas mitbringen?« fragte sie, und es klang nicht mehr so schroff und abgehackt, sondern menschlicher und freundlich. »Eier? Speck? Bis zu den Läden ist es weit. Oder sind Sie Vegetarierin wie Ihre Mutter?«
»Nein, das bin ich nicht, aber machen Sie sich bitte keine Mühe. Ich besorge mir später, was ich brauche.«
»Sind Sie sicher? Na denn, auf Wiedersehen.« Sie legte unvermittelt auf.
Nach meinem kurzen, gewaltsam unterbrochenen Schlaf noch immer wie benommen, trat ich fröstelnd ans Fenster und schaute hinaus. Hier, in der nördlicheren Hälfte Englands, hatte der Winter die Landschaft noch fest in der Hand; eisiger, grauer Nebel hüllte die Stadt fast ganz ein, aber der Pulsschlag der Industrie wurde allmählich schneller und lauter: Busse und Züge rumpelten über Kopfsteinpflaster und Gleise, Fabriksirenen kreischten, der Verkehr stockte, wurde zum Chaos. Ich badete – kalt, weil ich nachts den Heizungsschalter nicht gefunden hatte –, aber ich wurde wenigstens richtig wach. Dann zog ich mich an und brühte mir eben eine Kanne Kaffee auf, als Miss Signorelli erschien und sich durch ein langes Klingeln an der Haustür bemerkbar machte.
»Ich habe beschlossen, nicht auf Sie zu hören«, sagte sie und stellte einen Karton mit Lebensmitteln auf den Küchentisch. »Wahrscheinlich sind Sie wie Ihre Mutter, wollen niemandem zur Last fallen. Aber in diesem Haus finden Sie nur Kaninchenfutter, und Sie müssen richtig essen, um bei Kräften zu bleiben. Käse und Obst mögen für Ihre Mutter gut sein – und der Himmel allein weiß, wie sie bei dieser Kost so viel leisten kann –, aber ich bin sicher, daß es für Sie nicht taugt. Es wird wahrscheinlich ein langer Tag für Sie werden.«
Sie sah mich streng an. Sie war klein, energisch, ungefähr so alt wie Mutter, hatte lebhafte Farben, zupackende schwarze Augen und schwarz gefärbte Locken. Ich erinnerte mich jetzt an sie. Sie hatte in Bath, wo Mutter als für die Wohngebäude des Internats zuständige Lehrerin tätig gewesen war, Stenografie und Wirtschaftslehre unterrichtet. Von Miss Signorellis einschüchternder Tüchtigkeit tief beeindruckt und von ihrer robusten, stets gutgelaunten Art angetan, hatte ihr Mutter, nachdem sie die Leitung der hiesigen Schule übernommen hatte, geschrieben und sie gefragt, ob sie Lust hätte, Schulsekretärin zu werden. Gina hatte akzeptiert und war mit ihrem invaliden Vater nach Market Broughton gezogen. In Mutters doch recht beziehungslosem nomadischem Leben war Gina Signorelli, wie ich so halb und halb vermutete, ein schwaches Bindeglied zu einem früheren Lebensabschnitt, eine ihrer wenigen Beinahe-Freundinnen und ihre Vertraute – aber nur soweit Mutter sich selbst eine Vertraute gestattete. Sie nannten sich sogar beim Vornamen, wie mir jetzt einfiel.
Miss Signorelli schien entschlossen, freundlich zu mir zu sein, und da sie sich im Haus offenbar gut auskannte, konnte ich sie fragen, wo verschiedene Dinge waren, die ich bisher nicht gefunden hatte.
Während ich uns Kaffee einschenkte, ging sie in Mutters Arbeitszimmer und holte sich einen Riesenberg Arbeit.
»Solange Ihre Mutter nicht da ist, werde ich dreimal soviel zu tun haben wie gewöhnlich«, sagte sie. »Rufen Sie mich in der Schule an, wenn Sie etwas wissen wollen oder brauchen. Ich bin bestimmt von früh bis abends da. Und versuchen Sie, sich ihretwegen keine allzu großen Sorgen zu machen«, setzte sie wenig überzeugend hinzu. »Ich bin sicher, sie kämpft wie eine Löwin.«
Ich merkte jedoch, daß sie selbst traurig und besorgt war.
»Können Sie mir genau erzählen, was passiert ist?« fragte ich. »Im Krankenhaus habe ich keine Einzelheiten erfahren.«
»Es war das neue Dach der Turnhalle.« Miss Signorelli verstummte für einen Moment und preßte die Lippen zusammen. Dann stieß sie heftig hervor: »Ihre Mutter hat ihnen gesagt und immer wieder gesagt, daß der Bauplan nichts taugte. Aber der Schulvorstand gab natürlich der Firma den Auftrag, die den niedrigsten Kostenvoranschlag eingereicht hatte. Trau, schau, wem! Diese Geizhälse! Ihre Mutter hat gestern nachmittag bei den Hallensportwettkämpfen zugesehen, die wir am Ende eines Semesters regelmäßig veranstalten, und plötzlich begann es im Dach fürchterlich zu krachen, und es sackte in der Mitte durch. Ich selbst war nicht da, aber die Sportlehrerin Emily Johns, mit der ich befreundet bin, hat mir erzählt, was passiert ist. Es waren ungefähr sechzig Menschen in der Halle, hauptsächlich Kinder und ein paar Eltern – und vier Ausgänge. Emily und Ihre Mutter riefen ihnen zu, ganz ruhig zu bleiben und ordentlich zu den Ausgängen zu gehen, aber das Dach stürzte ein, bevor sie alle draußen waren, und natürlich war Ihre Mutter bis zuletzt geblieben. Ich nehme an, ihr steht irgendeine Tapferkeitsmedaille zu. Die Royal Human Society Medal oder irgendwas Ähnliches. Verdammte knickerige Pfennigfuchser! Einer der Betonträger ist in der Mitte durchgebrochen, und ein Teil hat Ihre Mutter am Kopf getroffen. Die Ambulanz war nach zehn Minuten da, die Leute sind wirklich Klasse, und eine halbe Stunde später lag Ihre Mutter schon auf dem Operationstisch. Man hat alles getan, was man tun konnte, aber so etwas hätte einfach nie passieren dürfen. Sie war die einzige Schwerverletzte, sonst gab es nur ein paar Platzwunden und blaue Flecke.«
Sie unterbrach sich und blinzelte mich wütend an, doch ihre Lippen zitterten. »Aber ich will Sie mit dem ganzen Drum und Dran nicht belasten. Sie haben es auch so schon schwer genug, ohne daß Sie darüber nachgrübeln, ob dieses Unglück vermeidbar gewesen wäre. Oh, wenn Sie ins Krankenhaus gehen – und wahrscheinlich wird das ziemlich bald sein –, nehmen Sie doch bitte die Sozialversicherungskarte Ihrer Mutter mit. Sie brauchen die Versicherungsnummer für ihren Papierkram, weil Ihre Mutter in einem Privatzimmer liegt. Sie finden die Karte in ihrem Schreibtisch, in dem Fach ganz außen rechts. Es steht Persönlich drauf. Geht das in Ordnung?«
»Aber ja, selbstverständlich.«
»Frühstücken Sie ordentlich, bevor Sie gehen«, sagte sie mürrisch und fügte hinzu: »Hoffentlich bekommen Sie jetzt schon etwas Ermutigenderes zu hören.« Sie klemmte ihre Papiere unter den Arm und marschierte ab.
Zwar hatte ich überhaupt keinen Hunger, aber Miss Signorelli hatte recht gehabt: Vor mir lag ein langer Tag. Ich machte mir Rühreier und aß sie hastig. Ebenso hastig spülte ich das Geschirr, von dem geradezu neurotischen Verlangen getrieben, die Küche so fleckenlos sauber zurückzulassen, als könnte Mutter jeden Moment hereinkommen.
Als ich fertig war, las ich die Liste durch, die Schwester Crouch mir gegeben hatte – Nachtwäsche, Taschentücher, Talkumpuder, Eau de Cologne, Hausschuhe, Morgenrock, Bettjäckchen –, wobei ich allerdings fürchtete, daß Mutter das meiste noch länger nicht brauchen würde. Dann erinnerte ich mich an die Sozialversicherungskarte, die Miss Signorelli erwähnt hatte. Mit dem kleinen Wochenendkoffer in der Hand betrat ich Mutters schattiges, ungeheiztes Arbeitszimmer und öffnete den Schreibtisch mit Rolladenaufsatz.
Auch hier die für meine Mutter charakteristische Ordnung – exakt gestapeltes Schreibpapier, Tabletts voller Füller, Kugelschreiber, Bleistifte, kleine Fächer, sauber etikettiert: Konten, Steuern, Bank, Haus, unbezahlte Rechnungen, Sozialversicherung, Schule. Und dann, ganz rechts, das Fach, das Gina Signorelli erwähnt hatte; mit Persönlich beschriftet. Ich zog ein Bündel Papiere heraus, das von einem Gummiband zusammengehalten wurde. Einen braunen Umschlag mit der Aufschrift: Geburtsund Heiratsurkunden; einen noch gültigen Paß, der häufig benutzt worden war, da Mutter oft an Konferenzen und Tagungen im Ausland teilnahm; ein paar Versicherungspolicen und ein Plastikordner mit einigen Fotografien.
Hier also bewahrte sie sie auf. Neugierig schlug ich den Ordner auf und legte das halbe Dutzend Schnappschüsse nebeneinander, die er enthielt: zwei oder drei von Vater und Dru, einen von mir. Ich war ungefähr sieben und hielt Othello auf dem Schoß. Vater hatte die Aufnahme gemacht, fiel mir ein. Ich glaube, Mutter besaß nicht einmal einen Fotoapparat, und für Schnappschüsse hatte sie bestimmt nichts übrig. Das Foto, auf dem ich sieben Jahre alt war, war – von Paßbildern und Klassenfotos abgesehen – meines Wissens das letzte, das von mir gemacht wurde.
Ich betrachtete die Bilder von Vater und Dru. Er hatte ein schmales, lächelndes Gesicht, einen buschigen Schnurrbart und so schwarzes Haar wie ich. Die Fotos waren nicht sehr deutlich und nicht besonders gut – sie vermittelten den Eindruck eines jungen, fröhlichen, ziemlich unbekümmerten Menschen; das war ungefähr alles. Auf einem Foto beugte er sich lachend zurück; auf einem zweiten hielt er einen Tennisschläger in der Hand und blinzelte in die Sonne; das dritte zeigte ihn in der Badehose mit einem Handtuch um den Hals. Er sah jung, glücklich und sorglos aus – vielleicht nicht unbedingt wie eine starke Persönlichkeit, aber gewiß auch kein Mann, dessen Bild man ansah und sagte: »Er wird mit einundvierzig Jahren sterben.«
Und Drusilla? Ein ernstes Mädchen – gradlinige Züge, direkter Blick, energischer Mund – wie der von Mutter –, Pagenkopf, ziemlich breite Nase, weit auseinanderstehende Augen, irgendwie wehrlos und bekümmert. Ich versuchte angestrengt, mich an ihre Farbe zu erinnern – grau wie Mutters Augen? Blau wie die meinen? Es war ein Paßfoto, das Dru mit sechzehn Jahren zeigte, so wie ich sie zuletzt in Erinnerung hatte; das heißt, eigentlich waren es drei Abzüge desselben Fotos. Meine Schwester Drusilla: Warum hatte sie sterben müssen, ehe sie auch nur einen Zipfel ihres eigentlichen Lebens packen konnte? Welche Flut hatte sie mitgerissen? Warum hatte es ihr und meinem Vater an Widerstandskraft gefehlt? Verglichen mit ihnen, hielt ich mich mit geradezu vulgärer Zähigkeit am Leben fest, strotzend vor Gesundheit und Vitalität. Ob Mutter genauso war? Oder würde sie das Leben loslassen, wie die beiden es getan hatten? In dem kalten grauen Zimmer von einem leichten Frösteln überrieselt, legte ich die Fotos zurück und schob das Gummiband über das Bündel. Ein Briefumschlag, den ich bisher übersehen hatte, rutschte heraus. Ich drehte ihn um. Auf der Vorderseite zwei getippte Zeilen:
Meiner Tochter Priscilla Meiklejohn im Falle meines Todes auszuhändigen.
Wie betäubt starrte ich den Umschlag an. Ich habe schon einmal erwähnt, daß ich immer aus dem Gleichgewicht gerate, wenn auf irgendeinem Papier so förmlich mein Name steht. Und dieser gewohnte kleine Schock, gekoppelt mit den so unwiderruflich endgültigen Worten »im Falle meines Todes« – reicht wohl aus, um einem den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
Plötzlich ertrug ich weder den Anblick des Umschlags noch den der Aufschrift auch nur eine Sekunde länger, schob ihn unter das Gummiband zu den anderen Papieren, nahm die Versicherungskarte, steckte sie zu Mutters Toilettensachen in den Koffer und ließ den Rolladen des Schreibtischs heruntersausen. Dann stürmte ich aus dem Haus und rannte ins Krankenhaus, als ob der Teufel hinter mir her wäre.
Oberschwester Crouch war natürlich nicht mehr im Dienst. Die Tagschwester war eine kummervoll aussehende Frau namens McCloy, die große Ähnlichkeit mit einer Kuh hatte. Oberschwester McCloy war auf ihre Weise ebenfalls sehr freundlich und zweifellos eine ausgezeichnete Krankenschwester, aber ich vermißte Oberschwester Crouchs Direktheit und ihren gesunden Menschenverstand. Oberschwester McCloy schien sich von Unheil und Verhängnis unwiderstehlich angezogen zu fühlen, und stets das Schlimmste anzunehmen, war für sie eine Selbstverständlichkeit.
»Ah, nicht einer von hundert solcher Fälle erholt sich wieder«, sagte sie seufzend und begleitete mich an Mutters Bett. Es war alles beim alten, ihr Zustand unverändert. Oberschwester McCloy rückte mir einen Armsessel zurecht und ließ mich in dem melancholischen kleinen Krankenzimmer allein, das wie das Innere eines Würfels aussah und das ich in den nächsten Tagen gewissermaßen auswendig lernte. Ungefähr alle Stunden kam eine Schwester herein, um nachzusehen, ob der Tropf noch funktionierte, durch den Mutter künstlich ernährt wurde, und um zu prüfen, ob ihre Temperatur und ihr Puls sich nicht geändert hatten. Abgesehen von diesen Kurzbesuchen, hatten Mutter und ich das Zimmer für uns allein, und ich saß da, betrachtete ihr Marmorprofil und fragte mich, was der versiegelte Briefumschlag enthalten mochte, was für eine wichtige Mitteilung, was für schreckliche Fakten? Was war für uns beide so wichtig, daß es mir vorenthalten werden mußte, solange Mutter noch lebte, das ich aber nach ihrem Tod auf jeden Fall erfahren sollte?
Um halb zwölf kam Dr. Wintersmain, der Chirurg, der Mutter operiert hatte, zur Visite. Er war ein großer, raumeinnehmender Mann, der einem grauen Seehund glich, sehr gut angezogen, freundlich, rücksichtsvoll und mir von Herzen unsympathisch. Alle hatten mir versichert, er sei ein erstklassiger Chirurg, einer der besten des Landes, und Mutter habe ungewöhnliches Glück gehabt, daß er nach ihrem Unfall bei der Hand gewesen sei, aber ich fand seine Art, mich »junge Dame« zu titulieren und mir zu versichern, »alles Menschenmögliche werde getan«, ganz einfach unerträglich. Das floß ihm alles so leicht über die Lippen wie Sahne über den Rand eines silbernen Milchkrugs, war nichts als ärztliche Routine. Wie Oberschwester McCloy, hatte auch er Mutter schon abgeschrieben und im Geist dem Beerdigungsunternehmer zugeteilt. Für ihn war sie ein interessanter Fall, der ihm nur noch als Anschauungsmaterial für spätere gleiche oder ähnliche Fälle diente.
Er gab mir deutlich zu verstehen, daß Mutter seiner Meinung nach aus dem Koma nicht mehr erwachen werde und es daher auch keinen Sinn habe, wenn ich bei ihr blieb. »Es ist nicht gut für Sie, den ganzen Tag eingesperrt zu sein«, sagte er herablassend wie zu einer Sechzehnjährigen. »Warum gehen Sie nicht ein bißchen im Park spazieren, essen eine Kleinigkeit in einem Café und sehen sich hinterher einen hübschen Film an? Zur Teezeit könnten Sie wieder herkommen, aber ich erwarte in den nächsten Stunden keine Veränderung im Zustand der Patientin.«
Brav sagte ich ja und amen zu seinen Vorschlägen, hatte jedoch nicht die Absicht, sie zu befolgen. Ich blieb, wo ich war. Mittags ging ich in die Krankenhauskantine hinunter und aß ein scheußliches Brötchen mit Wurst und eine geschmacklose Orange. Dann kehrte ich zu meiner Mutter zurück.
Ich stellte mir vor, wie es wäre, in meinem Einzimmerapartment in Crowbridge zu leben, Mutter einmal täglich im Rollstuhl auf der Promenade spazierenzufahren und sie darüber hinaus gegen Bezahlung Mrs. Charms Obhut zu überlassen …