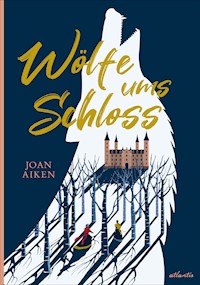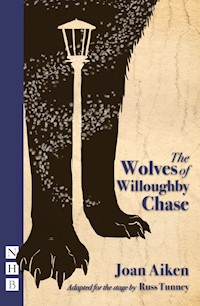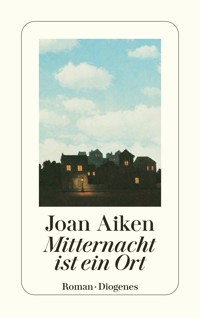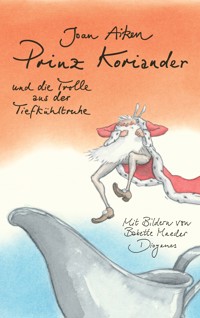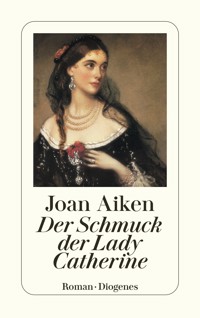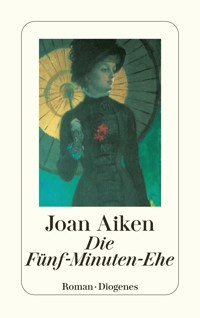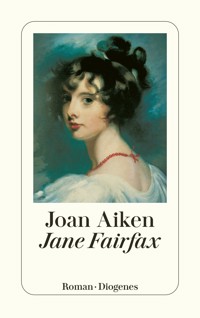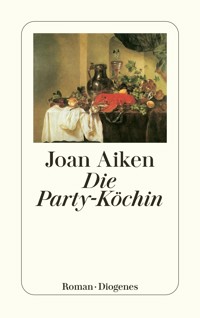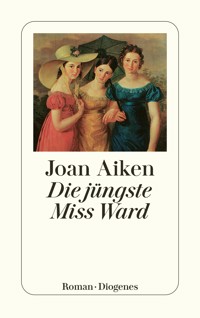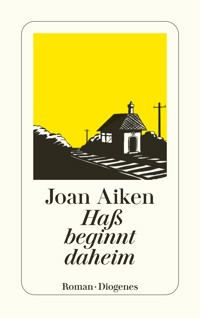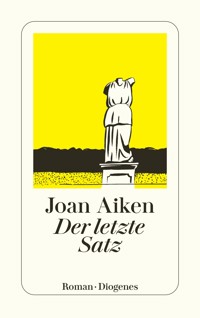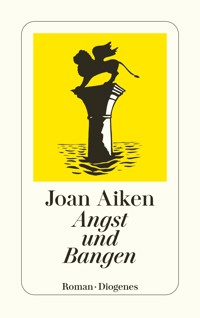7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kleine alltägliche Schrecknisse steigern sich in der ›Kristallkrähe‹ über große Verwirrungen zu einem finsteren Ende. Da ist die junge Schriftstellerin, die mit ihrer entsetzlich eifersüchtigen Freundin zusammenlebt, die Ärztin und ihr Bruder, dem sie eine tödliche Krankheit bescheinigt, dazu kommen diverse Schizophrene und Depressive und - ein entlaufener Leopard.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Joan Aiken
Die Kristallkrähe
Roman
Aus dem Englischen von Helmut Degner
Diogenes
1
Der Zug rumpelte zwei Abende vor Weihnachten durch die kalte Nacht, und ich saß darin und blickte aus dem schwarzen Fenster und weinte unauffällig und leise, bedrückt und traurig, daß ich von fröhlichen Freunden wieder zurück nach Hause mußte, zu den Kümmernissen einer Liebe, die am Verwelken war. Ich war zu Besuch bei einer großen Familie gewesen – alles sehr glückliche, sehr musikalische Menschen, deren ganzes Leben heiter und beschwingt schien wie eine komische Oper. Es hatte nur einen Moment der Mißstimmung gegeben – als Paul, der älteste Bruder – der hübsche –, einen Augenblick die Beherrschung verlor und den Pfau auf der Terrasse erschoß, weil er ein Kreischen in As von sich gab, während er eine Violinsonate in cis-Moll spielte, doch der Pfau war ohnedies lahm, und einige meinten, es sei eine barmherzige Erlösung. Es waren Menschen, von denen jeder für sich sein Leben lebte, ungezwungen und in bester Harmonie miteinander, wie man es sich im Paradies vorstellt, und es war mir gar nicht recht, in mein eigenes Leben zurückzukehren, das mir bis jetzt ganz gut gepaßt hatte, doch jetzt war mir, als sollte ich in einen nassen Badeanzug schlüpfen, und am liebsten hätte ich das Ganze hinausgeschoben.
Die Tallents neigten nicht zum Grübeln; ihre Begeisterung, ihre Sorgen, falls sie welche hatten, was sie voneinander dachten und hielten – all das ergoß sich in einem ständigen Redeschwall; wie erholsam war das nach dem brütenden Schweigen daheim! Und was sie redeten, war intelligent, doch nicht bedeutungsschwer; es war auf kein bestimmtes Ziel gerichtet; sie redeten, weil sie es gern taten, das war alles. Ich hatte mit Paul und seinem Cousin Finn eine zwanzig Kilometer weite Wanderung gemacht; sie sahen gut aus, sie waren fröhlich, sie alberten die ganze Zeit herum; ich hätte mich leicht in jeden von ihnen verlieben können, doch irgendwie schienen in diesem Haus gefühlsmäßige Bindungen nicht nötig, war gar keine Zeit dafür; der Strom freundlicher Zuneigung schoß über dieses Wehr hinweg. Ich hatte mich diesem Strom überlassen, war in ihm untergetaucht und hätte mit Freuden immer auf diese Weise gelebt, und jetzt, als ich wieder an trockenes Land gestiegen war, überkam mich plötzlich ein trostloses Gefühl, verlassen zu sein, Gelegenheiten versäumt zu haben. Ich hatte nie zuvor über den freien Willen nachgedacht, doch als mich der Zug immer weiter nach Süden trug, wurde mir plötzlich klar, daß sich mir die Chance geboten hatte, Neues und Unbekanntes zu erleben, und daß ich sie nicht genützt hatte. »Schreib uns, schreib uns bald«, sagten sie alle, auch Paul, und ich sagte ja, doch ich wußte, ich würde es nie tun. Schottland war zu weit weg. In acht Stunden würde mein altes zweidimensionales Leben mich wieder umschließen wie eine Falle.
Wir hatten Teile des Weihnachtsoratoriums gesungen, und aus dem Rattern des Zuges hörte ich plötzlich das Thema der Pastorale heraus, tum-ti-ti, tum-ti-ti, tum-ti-ti, tum-ti-ti, und das war so traurig, daß ich es nicht ertrug. Das Leben und meine Weiblichkeit und diese mir neu aufgegangene Last meiner Jungfräulichkeit drückten mich schwer wie ein schlecht gepackter Rucksack. Ich nahm meinen Mantel aus dem Gepäcknetz, hüllte mich hinein und legte mich der Länge nach auf den Sitz. Rasch war ich eingeschlafen, und bald bemühte ich mich verzweifelt, die Wohnung am Guilford Square aufzuräumen, sammelte ich die Zigarettenasche und die Haarnadeln auf, die Maggie verstreut hatte, und sah mich vergeblich nach einem Papierkorb um. Als der Zug in Newcastle hielt, wachte ich auf, denn jemand polterte in meinen Waggon und schlug die Tür zu, doch ich kuschelte mich zusammen und schloß die Augen und hoffte, er würde sich hinsetzen und mich wieder meiner unangenehmen Aufgabe überlassen, doch ich bekam einen Stoß zwischen die Rippen und dann noch einen; dieser Mensch ließ sich nicht ignorieren, und so richtete ich mich auf, steif und frierend und ziemlich hungrig (wir hatten bis zum letzten Moment gesungen und so hatte ich vergessen, die Tallents um ein paar belegte Brote zu bitten), und sah den Eindringling an.
Er trug eine amerikanische Luftwaffenuniform, war sehr groß und lächelte freundlich, so daß ich sah, er hatte eine Zahnlücke, und er hielt zwei Becher Tee. Das ist alles, was ich noch von seinem Aussehen weiß. Er hielt die zwei Becher Tee in der einen Hand; mit der andern hatte er mich zwischen die Rippen gestoßen.
»Möchten Sie einen Schuß Scotch?« fragte er.
»Nein, danke«, sagte ich geziert.
»Ach, gehn Sie, in drei Tagen ist Weihnachten.« Und ohne zu warten, zog er eine Flasche aus seiner Tasche, schüttete reichlich Scotch in den Tee und reichte mir den einen Becher. Er war heiß und erquickend, und so war mir dieser Mensch, der mich aus meinem Traum gerissen hatte, gleich sympathischer, und ich hatte ohnedies den Verdacht, daß ich im Schlaf um Hilfe gerufen hatte; wieso hätte er mich sonst durchs Fenster gesehen, und war zurück zu dem Wagen auf dem Bahnsteig gegangen, um einen Becher Tee für mich zu holen? Es gab keinen Grund, Hilfe abzulehnen, wenn sie sich bot.
Wir lächelten uns über den Durchgang weg an, und unsere Knie berührten sich. Er sagte mir seinen Namen – er hieß Wallace, oder Wal –, und ich sagte ihm meinen, und er fand, es sei der verrückteste Name, den er je gehört hätte, und als der Zug wieder losfuhr, holte er ein Päckchen belegte Brote herunter und bot mir eins nach dem andern an, und ich verschlang sie gierig. Wir sprachen wenig, nicht viel, und tranken noch etwas Whisky, als wir mit dem Tee fertig waren. Ich hatte das verzweifelte Gefühl, daß ich nicht wieder zum Schlafen kommen würde; mein kurzer Schlummer hatte mich erfrischt, und blitzartig durchzuckte mich der Gedanke: Hilfe, Hilfe!
Wal faltete das Papier zusammen, steckte die flache Flasche wieder ein und sah sich nachdenklich in dem leeren Waggon um. Wir rollten durch eine endlos öde Gegend Nordenglands, ein schwarzer unbewohnter Berg nach dem andern. Wal machte die Lampe über den Sitzen aus und stand auf und setzte sich neben mich. Seine Umarmung erfüllte mich mit einem ganz wundervollen Gefühl des Vertrauens und der Erleichterung, besser, als wenn einem ein Dorn rausgezogen wird, besser, als wenn man einen einsamen Platz findet, wo man sich übergeben kann. Ich kannte mal eine alte Frau, die Tag für Tag in ihrem Sessel saß und die Daumen drehte. »Wenn ich sie so herum drehe, kann ich mich an die Vergangenheit erinnern«, sagte sie. »Wenn ich sie so herum drehe, kann ich die Zukunft voraussehen.«
»Warum halten Sie sie nicht mal eine Weile still?« fragte ich. Sie hörte auf, die Daumen zu drehen, und sofort breitete sich ein zutiefst seliges, leeres Lächeln über ihr Gesicht. Genauso fielen meine Vergangenheit und meine Zukunft von mir ab. Lange Zeit saßen wir regungslos, Mund an Mund, Kinn an unrasiertem Kinn, und seine Knöpfe drückten Kuhlen in meinen Angorapullover, bis ich mir vorkam wie eine Reliefkarte. Sicher täusche ich mich, wenn ich mich zu entsinnen glaube, daß er die ganze Zeit seinen Tornister um hatte, doch ich kann mich ganz deutlich daran erinnern, daß ich dickes, kantiges Segeltuch an meinem Handgelenk spürte.
Nach einer Weile – es kann eine Stunde gewesen sein, oder vielleicht waren es nur zehn Minuten – legten wir uns langsam auf den Sitz, der zum Glück breit war, denn dies war in seiner Blütezeit ein Erster-Klasse-Waggon gewesen.
Wal stopfte sorgsam meinen Mantel unter meinen Kopf und begann systematisch meine Knöpfe zu öffnen.
»He, laß das!« protestierte ich.
»Wieso, was hast du?« sagte er gekränkt.
»Das wollte ich nicht …«
»Ach, nun hab dich nicht so, Kleines, das ist nicht fair. Sei nicht herzlos. Du kannst einem doch nicht mittendrin einen Korb geben!« Er schien so aufgeregt und empört, daß mich die Angst überkam, ich könnte es wirklich nicht.
»Wirklich, Wal, das ist nicht …«
»Ach, bitte, Kleines. Du bist ein süßes Mädchen. Ich liebe dich.« Ich war jung und kaltherzig genug, um darauf »Quatsch« zu erwidern.
»Warum sagst du das?« flüsterte Wal beleidigt.
»Du brauchst dich nicht verpflichtet zu fühlen, mir solche Dinge zu sagen. Schließlich haben wir uns eben erst kennengelernt.«
»Ich möchte aber gern mehr von dir sehen«, sagte er entschieden und knöpfte weiter auf. Mein Herz klopfte so sehr, daß ich fürchtete, es könnte sich an seinen Knöpfen wundschlagen. Seine letzte Bemerkung kam mir komisch vor, und ich lächelte ihn im Halbdunkel an, doch er war so versunken, daß er es nicht merkte, und plötzlich verkündete sein befriedigtes Seufzen, daß seine Bemühungen um unser beider Wohlbefinden erfolgreich beendet waren. Über seiner Schulter sah ich undeutlich die Lampe in der Mitte der Decke mit den kleinen Rosetten auf beiden Seiten und das dunkle Geflecht des Gepäcknetzes.
»Was denkst du?« fragte er schließlich.
»Ich weiß nicht.«
»Hör mal – du mußt doch irgendwas denken?«
Ich biß ihn zärtlich ins Ohr, um ihm zu zeigen, daß meine Gefühle freundlich waren, und dann sagte ich, daß ich es schön fände, meinen Erfahrungsschatz erweitert zu haben.
»Es war bei dir das erstemal, hm?«
»Ja.«
»Wie alt bist du, Kleines?«
Als ich es ihm sagte, war er ziemlich entsetzt.
»Im allgemeinen steh ich nicht auf so junges Gemüse. Aber irgendwas ist an dir, weshalb ich dich für älter gehalten hab. Was würde deine Mutter dazu sagen?«
Der Gedanke belustigte mich, doch ich beruhigte ihn schnell. »Sie ist tot – sie ist gestorben, als ich fünf war.« Was genaugenommen stimmte.
»Hm, das ist aber schlimm. Das arme kleine Mädchen hat nie eine Mammi gehabt.«
»Genau«, sagte ich in fröhlichem Ton, doch er bestand darauf, mich gefühlvoll an sich zu drücken, weil ich ein armes Waisenmädchen war, und mir noch einen Schluck Whisky zu geben, was er mit großer Geschicklichkeit tat, indem er die Flasche zwischen uns aus seiner Tasche zog und an meine Zähne drückte. Er trank ebenfalls, seinen Hals verrenkend, und dann begannen wir, uns wieder zu küssen. Bisher hatte mir Küssen nicht viel Spaß gemacht, doch jetzt begriff ich zum erstenmal, was daran war, und kam auf den Geschmack.
Später murmelte Wal: »Glaub mir, ich liebe dich wirklich.«
»Bitte, sag das nicht dauernd, Wal. Es ist nicht wahr, und es verdirbt alles.«
»Doch, es ist wahr«, antwortete er. »Ich würde dich gern heiraten. Wir müssen uns nur einen andern Namen für dich ausdenken. Der, den du hast, ist ja schrecklich. Aulis – wie kann ein Mädchen bloß Aulis heißen?«
»Oh, du könntest mich gar nicht heiraten«, sagte ich rasch. »Ich bin schon verheiratet.«
»Was?«
»Mit einem Cousin von mir«, schwindelte ich.
»Aber wieso …«
»Er bekam an unserem Hochzeitstag Kinderlähmung und liegt seither im Krankenhaus in einer Eisernen Lunge.«
»Du mußt aber sehr jung geheiratet haben.«
»Da hast du recht. Ich brauchte eine Erlaubnis vom Lordkanzler.« Es machte mir nicht die geringsten Gewissensbisse, ihm all diese Lügen zu erzählen, und ich flunkerte lustig weiter. Ich tat es eigentlich nicht, um ihm etwas vorzumachen, sondern um mich mit der Illusion eines anderen Lebens zu erfüllen, eines Lebens voller Möglichkeiten, die meinem wirklichen fehlten, das so schrecklich durch die Wohnung am Guilford Square begrenzt war. Ich kam mir vor wie ein Kind, das in einen Spiegel schaut und sagt: »Tun wir so, als ob wir in diesem Zimmer leben.«
Ich erzählte Wal allerlei über meinen Cousin Nicholas, mit dem ich nur auf dem Papier verheiratet war, und der merkwürdige Bursche wurde so von Eifersucht gepeinigt, daß er schließlich sagte, ich solle den Mund halten. Dann tat es ihm leid, und er gab mir noch etwas Whisky und meinte, er würde mich schon dazu bringen, Nicky zu vergessen, der sich wahrscheinlich ohnedies mit den Krankenschwestern amüsiere.
»Was ist, willst du mir nicht sagen, daß du mich liebst?«
»Ich finde dich sehr nett, Wal. Ich mag dich sehr gern.« Und ich konnte nicht widerstehen, hinzuzufügen: »Wo du mir soviel Whisky gegeben hast, muß ich dich ja wohl mögen, oder?«
Da lachte er plötzlich laut auf, und unsere Beziehung wurde wieder freundlicher. Nach etwa einer Stunde schlief Wal ein, und da ich mich allmählich beengt fühlte, schlüpfte ich von dem Sitz und legte mich auf die andere Seite. Während der Zug durch die endlose Nacht rumpelte, begann ich mich zu fragen, was ich von all dem der Freundin erzählen sollte, die ich liebte und mit der ich zusammenlebte, in einem so hoffnungslos unentwirrbaren Verhältnis. Sie hieß Maggie und war Ärztin. Trotz meiner jugendlichen Roheit und Naivität fürchtete ich, sie würde es mir übelnehmen, doch konnte ich ein so wichtiges Ereignis in meinem Leben verbergen? Ich bezweifelte es. Der Gedanke an Maggie quälte mich schrecklich – sie schien plötzlich im Waggon neben mir aufzuragen. Es ist seltsam, daß man jemanden lieben und zugleich seine körperlichen Eigenschaften widerlich finden, ja verabscheuen kann. Wütend und voll Groll dachte ich an Maggies Größe, ihr volles schwarzes Haar, das sie oben auf dem Kopf geflochten trug, an die schwarzen Hosen, die sie zu Hause meistens anhatte und die ihre breiten Hüften betonten, an ihre gar nicht zu ihr passende und peinliche Gewohnheit, kleine Tänze aufzuführen, an ihre Schlampigkeit, die unbekümmerte Weise, auf die sie mit anderer Leute Sachen umging, die Wolke von Zigarettenqualm, die sie umgab. Ich begann mir ein Gespräch auszudenken:
»Soll das heißen, du hast mit diesem Mann geschlafen?« Mit bohrendem Blick sah sie mich an, erbarmungslos und intelligent.
»Hm – ja.«
»Warum?«
»Ach, Maggie, du weißt doch, wie schwer ich anderen Leuten widerstehen kann.«
Nein, ich mußte mir etwas ausdenken, um diesen Vorfall zu verheimlichen. Wieder befiel mich ein Gefühl der Bedrückung. Der Zug hielt an irgendeiner einsamen Station, und jemand stieg in unseren Waggon, eine alte Frau; ich sah sie undeutlich im Licht der Bahnsteiglampe, bevor sie ihr Gepäck über sich verstaute und sich seufzend in einer Ecke niederließ. Fast sofort begann sie zu schnarchen, laut, rasselnd, langgezogen. Mir war klar, daß ich mich damit abfinden mußte, von nun an wach zu bleiben; nach etwa einer Stunde knipste ich vorsichtig die kleine Lampe über meinem Kopf an und vertrieb mir die Zeit damit, Wal zu betrachten. Er wirkte nicht besonders eindrucksvoll, wie er so schlafend und mit etwas derangierter Kleidung dalag, doch seine Zahnlücke war nicht zu sehen, was von Vorteil war, und er erfüllte mich mit einem freundlichen und angenehmen Gefühl, ganz anders als die lähmende Liebe und Verpflichtung, die mich an Maggie band, weil ich wußte, sie brauchte jemanden, den sie umhegen konnte. Ach, diese verzweifelte Angst, andere Menschen zu verletzen; sie hat mich in mehr Mißlichkeiten gebracht als all meine andern Schwächen zusammen.
Ich beugte mich vor und zog Wals Mantel hoch, der heruntergerutscht war, und damit weckte ich ihn auf.
»Hallo, Engelchen«, sagte er grinsend und packte mich am Handgelenk, als ich mich wieder zurücklehnen wollte.
»Schlaf weiter. Ich wollte dich nicht wecken.«
»Mag nicht schlafen. Zeitvergeudung. Komm, setz dich wieder neben mich.«
Dieses Gespräch hatte die alte Frau in der Ecke gegenüber gestört; sie regte sich und murmelte, und plötzlich starrte sie uns ausdruckslos mit kleinen, runden Vogelaugen an. Wir rührten uns nicht und hofften, sie würde wieder einduseln, doch nach einer Weile wachte sie ganz auf und nahm ihren Verstand zusammen.
»Ich fahr gern in einem Waggon, wo man Gesellschaft hat«, sagte sie. »So vergeht die Zeit schneller, nicht?«
Sie zog eine Tüte Karamelbonbons hervor und bot uns beiden eins an. Ich schaute auf meine Uhr. Zehn vor vier.
Die alte Frau hatte eine ungewöhnlich heisere Stimme, vielleicht weil sie Gin trank oder zuviel rauchte, oder möglicherweise war sie bloß stark erkältet. Außerdem bemerkten wir, daß sie fast stocktaub war, und man mußte sie laut anbrüllen, damit sie einen verstand. Wal bot ihr einen Schluck Whisky an, und sie nickte eifrig und trank zu seiner Bestürzung die ganze Flasche aus. »Na ja – vielleicht schläft sie darauf wieder ein«, sagte er und legte hoffnungsvoll seinen Arm um mich. Doch ich machte mich steif und sträubte mich, denn sie saß hellwach da, ihre glänzenden Augen starr auf mich gerichtet, was mich mit Unbehagen erfüllte. »Ich hab meine Tochter und meinen Schwiegersohn zum Flugplatz gebracht«, flüsterte sie nach einer Weile heiser. »Sie sind nach Grönland geflogen – stellen Sie sich das vor! Vor zwei Tagen haben sie geheiratet. Das erstemal, daß sie von mir weg ist, sie ist erst siebzehn. Wir haben den ganzen Tag geheult.« Eine furchtbare Wehmut stieg in mir auf; ich glaube, es war das erstemal, daß ich für jemanden wirklich Mitleid empfand. Wal sagte freundlich: »Es wird ihr schon nichts passieren, Madam; er wird auf sie aufpassen.«
Dann begannen wir ein langes und unerträglich stumpfsinniges Gespräch über das Leben, das wir daheim führten. Ich entsinne mich noch des lebendigen Bildes von Wals Zuhause in Iowa, das in mir Gestalt annahm, von seiner verheirateten Schwester, bei der er seine Urlaube verbrachte, den Hühnern auf dem Hof, den Nichten und Neffen, und von den verschiedenen verheirateten Kindern der alten Frau, bei denen sie abwechselnd das Jahr über wohnte, alle drei Monate zum nächsten reisend. Wal schrieb mir den Namen und die Adresse seiner Schwester auf ein Stück Papier und sagte, ich müsse sie besuchen, falls ich mal in die Staaten käme; seine Schwester würde mich sicher reizend finden. Der Zug hielt irgendwo, ich glaube, in Doncester, und die alte Frau rannte plötzlich hinaus.
»He, glaubst du, sie ist ausgestiegen und hat ihre Sachen vergessen?« sagte Wal hoffnungsvoll. »Ich möchte dich noch mal küssen.«
»Das kannst du doch auch so.«
»Nein – du weißt schon, was ich meine, Kleines.«
»Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich holt sie nur einen Becher Tee«, sagte ich abweisend, doch seine Umarmung erwidernd.
»Tee!« rief Wal und sprang auf. »Mein Gott, davon könnte ich einen Schluck vertragen!« Doch im gleichen Moment fuhr der Zug los, die alte Frau kam triumphierend mit drei Bechern zurück, und uns blieb nichts anderes übrig, als die Unterhaltung fortzusetzen. Das Midland ist mir nie so scheußlich flach und öde erschienen wie an diesem feuchten Dezembertag, der allmählich heraufdämmerte. Tiefe Trostlosigkeit erfüllte mich bei dem Gedanken an King’s Cross, den 77er Bus und den kurzen Weg zum Guilford Square.
Wal fuhr nicht bis King’s Cross. Seine Einheit war auf einem Gutshof bei Bishop’s Langley stationiert, und er mußte dort aussteigen.
»Hör mal! Warum kommst du nicht mit?« rief er plötzlich.
»Die Jungens werden von dir begeistert sein, und du kriegst ein gutes Weihnachtsessen. Wir veranstalten eine Feier. Du mußt unbedingt mitkommen! Das wäre eine Wucht!«
»Aber das meinst du doch nicht im Ernst?«
»Na klar, die Jungens laden alle ihre Freundinnen ein. Du wirst dich mit meinem Colonel prima verstehen – ihr habt beide so eine ernste Art.«
Wal schien mit seinem Colonel auf sehr vertrautem Fuß zu stehen, wenn man bedachte, daß er nur Second Lieutenant war. Ich hatte den Eindruck, die ganze Einheit war reichlich unkonventionell, und schließlich stimmte ich zu, teils aus Neugier, teils, um noch nicht nach Hause zu müssen. Maggie haßte die Feiertage sowieso und hatte wahrscheinlich im Krankenhaus für die nächsten zwei Tage, bis Weihnachten vorbei war, freiwillig Dienst übernommen.
Wir verabschiedeten uns von der alten Frau und stiegen an einem häßlichen, kleinen modernen Bahnhof aus. Mich fröstelte, während wir an einer breiten Ausfallstraße auf den Bus warteten. Der Tag war naßkalt und neblig und keine Menschenseele zu sehen. Morgen war Heiliger Abend, doch hier war nichts davon zu merken; keine Spur Geheimnisvolles oder Festliches. Ich fror und fühlte mich steif, kein Wunder; als ich herzhaft gähnte, sah Wal mich schuldbewußt an.
»Du bist ziemlich fertig, hm, Kleines? Weißt du was – wenn wir da sind, haust du dich in meine Falle und schläfst ein bißchen, während ich mich melde. Dann bist du zum Dinner wieder auf dem Damm.«
Wir stiegen an einem Parktor aus und gingen eine endlose Zufahrt zwischen Buchen und Kastanien hinunter. Als wir uns dem Gutshaus näherten, tauchten zwischen den Bäumen Baracken auf, und gleich darauf bog Wal zu einer davon ab.
»So, da sind wir. Mal sehen, ob jemand da ist.«
Es war niemand da. Ich legte mich auf eins der unteren Betten, und er wickelte mich in eine Decke, gab mir einen freundlichen Klaps, sagte, er würde bald wieder da sein, und ging. Ich sank in Schlaf wie in Watte und merkte lange Zeit nichts, bis mich eine Stimme weckte. Dicht über meinem Kopf sagte sie: »Mensch, sieh dir das an. Was steckt denn da in Wals Weihnachtsstrumpf?«
»Nicht übel«, sagte eine andere Stimme. »Wirklich nicht übel.« Ich kam zu dem Schluß, daß es am besten war, weiterzuschlafen, und döste wieder ein. Es dauerte nicht lange, bis die Tür wieder aufging und Wals Stimme sagte: »Hallo, Jungens. Hat alles geklappt, während ich weg war?«
»Bei dir scheint’s ja bestens geklappt zu haben.«
»Moment, ich stell sie euch gleich vor. Wach auf, Schatz. Es ist bald Dinnerzeit. Hast du gut geschlafen? Fein. Das ist Mike und das ist Richard.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagten beide grinsend. Sie gaben mir Seife und ein Handtuch und einen Spiegel, und ich rollte mich aus meinem Kokon und machte mich zurecht. Dann schlenderten wir alle zu einer anderen Baracke, in der die Kantine war. Das Weihnachtsessen, das an einer Theke ausgegeben und auf zerbeulten Blechtabletts serviert wurde, war nicht gerade umwerfend.
»Beeil dich«, flüsterte Wal mir zu, »der Colonel hat uns danach zu einem Drink eingeladen.« Wir schlangen unsere Truthahnstücke hinunter, während Mike und Richard, die hinter Wals Eile andere Motive vermuteten, freundlich-spöttische Bemerkungen machten, und dann führte er mich feierlich hinauf zum Gutshaus. Wir gingen jedoch zu einer Hintertür hinein und durch einen Korridor, der breit wie ein Kanal und mit einem grünen Läufer ausgelegt war, zu einem Raum, der vermutlich einmal die Gesindestube gewesen war.
»Das ist mein Colonel«, sagte Wal und stellte mich stolz vor. »Colonel Fisher, mein Prinzeßchen.« Wie er auf die Idee kam, mich so zu nennen, weiß der Himmel.
Colonel Fisher hatte eine Glatze und strahlte übers ganze Gesicht. Ich habe nie etwas so Prächtiges gesehen wie seine Uniform und seine Ordensspangen, und außer ihm waren etwa ein Dutzend andere Colonels und mehrere Kisten Whisky in dem Raum. Wieso Wal auf so vertrautem Fuß mit den Colonels stand, war mir schleierhaft.
»Geben Sie der kleinen Dame einen Drink, Wal – ich hoffe, sie wird sich bei uns wohl fühlen«, sagte Colonel Fisher und drückte etwa drei Minuten meine Hand. »Können Sie singen?« fragte er mich.
Eine Platte wurde aufgelegt, auf der Bing Crosby von weißen Weihnachten träumte, und alle fielen mit ein. Einigen der Colonels rannen Tränen die Wangen herunter. Es schien viel länger als vierundzwanzig Stunden her, seit ich mit den Tallents gesungen hatte.
Draußen dämmerte es, und das Grau wurde blau, und schließlich sagte ich zu Wal, ich müßte gehen, sonst würde ich nie nach Hause finden. Er hatte während des Singens wesentlich mehr Whisky als ich vertilgt, und der Gedanke, hinaus in die Kälte zu gehen, schien ihm gar nicht recht. Er bat mich, noch ein bißchen zu bleiben.
»Geh noch nicht, Süße. Es gibt doch noch Tee.«
»Tee! Ich werde tagelang keinen Bissen essen können. Nein, ich muß wirklich gehen. Meine Freundin macht sich bestimmt Sorgen, wo ich stecke.« Im Lauf des Tages hatte ich meine Lebensgeschichte etwas revidiert, da es mir zu kompliziert war, bei der Story von meinem impotenten Mann zu bleiben.
»Diese Freundin paßt mir nicht. Paßt mir gar nicht«, sagte Wal und sah mich finster an. »Also schön, dann komm. Wo sind deine Klamotten?«
»Wir haben sie in der Baracke gelassen.«
Er versuchte mich zu überreden, mit hineinzukommen, doch ich hatte plötzlich genug von Wal und wollte schnellstens nach London.
»Ich besuch dich irgendwann mal«, versprach ich.
»Ich will dich nicht irgendwann. Ich will dich jetzt.«
»Ach, komm, Wal, ich versäum den letzten Bus, wenn wir uns nicht beeilen.« Er hatte mir gesagt, daß er um fünf fuhr. Ärgerlich holte er meinen Koffer, und wir gingen die Zufahrt hinunter. Die kalte Luft machte ihn noch beschwipster, und es kam zu ein paar unschönen Ringkämpfen, als er mich in das Gebüsch zwischen den Buchen zu zerren versuchte. Es war, als ob ich einen großen Hund an einer Stelle spazierenführte, wo es von Kaninchen wimmelte. Doch das Gesträuch lockte mich kein bißchen; das Wetter war plötzlich umgeschlagen, von milder Wärme zu beißender Kälte.
»Ich versteh nicht, wie du gegenüber einem armen Kerl so kaltherzig sein kannst«, sagte Wal traurig.
»Weil ich meinen Bus kriegen will.«
»Diese Weiber«, murmelte Wal. »Immer denken sie bloß an ihren eigenen Vorteil.«
»Ist doch klar, wenn’s darum geht, einen letzten Bus zu kriegen. Du kannst ruhig zurückgehen – ich find von hier allein zur Busstation.«
»Hältst du mich für so ungalant?« fragte Wal würdevoll.
Ich erwischte den Bus gerade noch, indem wir die letzten hundert Meter rannten, und Wal drückte mich fest an sich, als ich mich hinaufschwang, und riß mich fast wieder herunter; ich sei ein ganz süßes Mädchen, sagte er, aber mit einem Herz aus Stein, und ich müßte ihn bald besuchen, oder er würde mich anrufen und wir könnten uns vor Swan and Edgar’s treffen. Der Bus brauste ins Dunkel davon, und mir fiel ein, daß ich gar nicht wußte, wie er mit Nachnamen hieß.
2
»Ein Jahr?« sagte Charles. »Nur ein Jahr?«
Er und Eleanor starrten einander über ihren Schreibtisch weg an; beide waren sehr blaß.
»Ich fürchte, ja. Es ist zwar Cardews Diagnose, nicht meine, aber er ist – er war immer sehr zuverlässig.« Sie fingerte nervös an ihrer Füllfeder herum; dann blickte sie auf ihre Hände, als gehörten sie ihr nicht, und legte sie nebeneinander auf den Schoß. Charles stand auf und begann im Zimmer herumzugehen. Eine Minute blieb er am Fenster stehen und schaute hinaus auf die Themse, die sich draußen wie eine große silberne Fläche ausbreitete und alles Licht des Winterhimmels auffing.
Wie viele andere Patienten in einer ähnlichen Lage hatten wohl schon auf den Fluß hinuntergestarrt und um Beherrschung und Gelassenheit gerungen, als sei eine solche Mitteilung eine alltägliche Sache?
»Wenn mein Arzt mir nur noch ein Jahr gibt, dann werde ich im März meinen Urlaub nehmen … meine Wohnung kündigen … keinen Portwein mehr bestellen – was im Keller ist, wird so lange reichen …«
Wirre Gedanken gingen ihm durch den Kopf, während er sich an den neuen engen Horizont zu gewöhnen suchte. Dezember. Also noch ein Herbst, nasse Äpfel in verfilztem Gras, die nervösen Reisevorbereitungen der Schwalben vor ihrem Flug nach Süden. Noch einmal Weihnachten; vielleicht; Eleanor hatte »bestenfalls ein Jahr« gesagt. Bestimmt noch ein Frühling. Wenn er im nächsten Winter starb, mußte er den kommenden Frühling und Sommer so gut wie möglich nützen.
Manche Menschen machen unter solchen Umständen Reisen, geben ihr ganzes Geld für Reisen nach Angkor Wat, Samarkand, zum Popocatepetl aus. Charles hatte keine Lust dazu. Er bemerkte Eleanors ruhigen, prüfenden Blick und wußte, sie würde ihm helfen, jedes übertriebene, unbeherrschte, kopflose Benehmen zu vermeiden.
Er holte eine Zigarette hervor und zündete sie an, Tante Julias kleines whiskyflaschenförmiges Feuerzeug mit ruhiger Hand haltend. Eleanor lächelte ihn an, unterbrach ihn jedoch nicht in seinen Gedanken; sie kritzelte ein paar hieroglyphenartige Zeichen auf ein kariertes Blatt Papier, legte ihre Hände daneben und blickte nachdenklich darauf nieder. Es waren wohlgeformte, ziemlich männliche Hände; weiß, gepflegt, ringlos. Von ihren Händen wanderte Charles’ Blick über ihren weißen Ärmel hinauf zu dem glatten blonden, über das Blatt Papier gebeugten Kopf; irgendwie sah sie aus wie ein weißes Fragezeichen in diesem stillen Raum.
Charles selbst verspürte keine Neugier. Er würde bald sterben; schön, dann war es eben so. Das Rätsel, welchen Sinn dies alles hatte, bemühte er sich nicht zu lösen. Als er wieder zum Fenster schlenderte, dachte er: ich muß diesen Anzug abbestellen – und ein Testament machen, Eleanor kriegt alles; die Arme, es hat sie sicher auch hart getroffen.
Sie sieht müde aus, dachte er, abgespannt; kein Wunder. Außerdem arbeitete sie seit Jahren zuviel, vor allem seit ihr Partner bei einem Autounfall umgekommen war und ihr eine doppelte Menge Patienten und die Stellung im Krankenhaus hinterlassen hatte.
Nur gut, daß ich keine Kinder habe. Er spürte einen kalten Schauer bei dem Gedanken. Um ihn abzuschütteln, sagte er: »Gott sei Dank, daß die arme Zita das nicht mitmachen muß.« Eleanor sah ihn fragend an.
»Sie würde jetzt wahrscheinlich gerade ihr erstes Kind erwarten.« Nach ihrer Miene zu schließen, fand seine Schwester diese Bemerkung geschmacklos. Sie sagte: »Wenn Zita noch leben würde, wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen. Ich glaube, diese ganze Sache hat dazu beigetragen, dein Herzleiden zu verschlimmern. Der Schock, der Umstand, daß du immer wieder getaucht bist, als es bereits ziemlich aussichtslos schien, sie zu retten, die seelische Belastung durch die Frage, warum sie es getan hat – und ganz abgesehen von deiner körperlichen Krankheit warst du selbst am Rand eines Nervenzusammenbruchs.« Charles schien sich zu ärgern; er wollte etwas sagen, doch dann nahm er sich zusammen.
»Lasse ich jemanden warten – einen andern Patienten?« fragte er abrupt. »Ich hab vergessen, im Speisezimmer nachzusehen.«
»Nein, ich hab dich absichtlich als letzten bestellt, damit wir Zeit haben, miteinander zu reden.«
»Sehr aufmerksam von dir«, brummte er, und dann: »Entschuldige meine Gereiztheit, Nell. Es ist nicht ganz einfach, damit fertigzuwerden.«
»Selbstverständlich«, sagte sie ruhig. »Setz dich und laß uns überlegen, was wir am besten tun. Ich stehe ganz zu deiner Verfügung, Charles, das weißt du. Die Praxis ist völlig unwichtig – ich kann sie jederzeit aufgeben – ich tät’s sogar sehr gern; seit Cardews Tod ist das Ganze ein bißchen zuviel für mich. Ich hab auch schon daran gedacht, meine Stellung im Ogham aufzugeben.«
Er nickte und sank in einen Sessel am Kamin.
Langsam wurde es dunkel, das kalte, fahle Licht der Straßenlaternen am Themsedamm schimmerte durch die Zweige, und der Himmel war blaugrün und voller schieferfarbener Wolken. Nells Zimmer, das kühl und unpersönlich wirkte, wurde in dem Dämmerlicht ein wenig freundlicher; der rote Teppich glühte, die kastenartigen Konturen der Wände wurden weicher. Ein Holzklotz zischte leise im Kamin, und der Kater, der davor lag, streckte sich wohlig in der Wärme und wälzte sich auf den Rücken.
Aus Gewohnheit kratzte ihn Charles mit der Spitze seines Schuhs zwischen den Rippen, und wie immer rollte sich der Kater blitzschnell herum und grub seine Zähne und Klauen in den Schuh. Ein wenig feindselig blickte Charles auf ihn nieder und dachte: Er wird länger leben als ich – wird er’s wohl merken, wenn ich nicht mehr da bin?
»Ich glaube, es ist am besten, wenn ich meine Stellung gleich aufgebe«, sagte er. »Ich möchte in meinen letzten Monaten etwas machen, was ich wirklich gern tu – solange ich noch was tun kann. Die Frage ist – was? Was tu ich gern, Nell?«
Sie hob die Augenbrauen.
»Gartenarbeit? Mit einem Boot herumschippern? Beides nicht das Ideale für einen Menschen in deinem Gesundheitszustand, aber du hast recht; Hauptsache, du tust es gern. Letzten Endes kann es nicht viel ausmachen.«
Die gedankenlose Roheit ihrer Worte ließ Charles leicht zusammenzucken. Aber schließlich war sie Ärztin; begreiflich, daß sie diese Dinge nüchtern betrachtete.
»Die Stellung solltest du auf jeden Fall aufgeben«, fügte sie hinzu. »Die Reise nach Amerika wäre bestimmt schön gewesen«, sagte er ein wenig wehmütig.
Sie sah ihn rasch an. »Trotzdem – es wäre nicht ratsam, wenn du mitfahren würdest. So eine Geschäftsreise ist sicher sehr anstrengend; vergiß nicht, was für Scherereien du den anderen bereiten würdest, wenn du plötzlich tot umfällst – der Ärger mit den Behörden und die Einäscherung, und dann müßten sie dich in einer Urne auf der Queen Elizabeth wieder zurückschaffen.«
Er lachte laut auf. »Gute alte Nell!«
Leicht verblüfft schaute sie ihn an.
»Was schlägst du dann vor?« fragte er.
»Hm –« Sie schien etwas verlegen. »Du hattest doch immer die Absicht, einmal nach Cornwall zurückzugehen, nicht? Vielleicht würde ich dort irgendwo eine Praxis finden? Du könntest von deinem Kapital ein Haus kaufen – es hat ja keinen Sinn. wenn du’s zusammenhältst –, und ein bißchen könnte ich natürlich auch beisteuern. Dann könntest du tun, wozu du Lust hast, vielleicht ein bißchen segeln, und ich könnte mich um dich kümmern und Nin den Haushalt führen.«
»Das wär für mich nicht übel, aber ob es für dich das Richtige ist?« fragte er zweifelnd. »Was willst du tun, wenn ich nicht mehr da bin?«
»Es ist ja nur eine Idee«, sagte sie. »Aber überleg dir’s mal.«
Dann fügte sie hinzu: »Vielleicht könnten wir irgendwo in der Nähe von Tante Julia leben. Du weißt ja, sie ist sehr unterhaltsam.«
Charles gab keine Antwort. Er starrte ins Feuer und sah darin ein graues Landhaus zwischen Bäumen, zu dem schmale Wege führten, die sich durch Farnkraut und Feuernelken und Fingerhut schlängelten. Jedenfalls sympathischer als der Gedanke an eine Krankenhausstation, an Leichenschau, Begräbnis, dunkle Kleider und kurze Notizen in der Lokalpresse. »Mr. Charles Foley, der sich kürzlich aus gesundheitlichen Gründen aus der Stadt zurückzog – plötzlich an einem Herzanfall –«
Eleanor legte ihre Hand leicht auf seine Schulter.
»Du weißt, was ich fühle«, sagte sie. »Das brauche ich dir nicht zu sagen. Ich muß jetzt ins Krankenhaus. Bleib hier, solange du willst – wenn du möchtest, über Nacht. Man wird dir ein Bett herrichten. Ich würde bald zu Bett gehen, so eine Nachricht ist natürlich ein Schock. Es wird dir guttun, dich richtig auszuschlafen. Du solltest ein paar Schlaftabletten nehmen. Im Badezimmerschrank ist eine Flasche Somnil.«
»Ach, vielen Dank, Nell, aber mach dir um mich keine Sorgen«, sagte er. »Ich denke, ich werde nach Hause gehen. Ich muß ein bißchen über alles nachdenken und mich mit dem Büro in Verbindung setzen. Ich schau morgen bei dir vorbei.«
»Tu das«, sagte sie. »Und lieg nicht wach und grüble … Übrigens, ich fürchte, der arme Cardew hatte mit seiner Diagnose recht, aber wenn du eine zweite Meinung hören möchtest, was natürlich dein gutes Recht wäre, könnte ich dir einige sehr gute …«
»Nein, nein, vielen Dank«, sagte er. »Was hätte das für einen Sinn?«
»Schön.« Sie nickte ihm freundlich zu. »Dann bis morgen.«
Mit einem leisen, entschiedenen Klicken schloß sich die Tür hinter ihr.
Charles starrte weiter ins Feuer, an seinen Füßen den schlafenden Kater.
Mein Gott, dachte er plötzlich aufgeregt, hoffentlich erzählt Nell niemandem davon. Ich hätte es ihr sagen müssen.
Er sah die Gesichter von Freunden und Bekannten vor sich, mitleidsvoll, neugierig, forschend. Schon von dem armen Foley gehört? Kein Jahr mehr zu leben. Anscheinend das Herz; schrecklich, was? Lohnt sich kaum, das Jahr am Leben zu bleiben. »Lohnt sich kaum«, murmelte er.
Die Tür ging auf, und eine magere ältere Frau in einem schwarzen Kleid und einer weißen Schürze kam herein.
»Oh, ich wußte nicht, daß Sie noch da sind, Master Charles«, sagte sie. »Ich wollte nur nach dem Feuer sehen. Miss Nell hat nicht gesagt, ob Sie zum Abendessen bleiben. Ich hätte eine gute Fleischbrühe und könnte Ihnen ein Omelett machen.«
»Nein, vielen Dank, Nin, ich gehe gleich«, sagte er zu der alten Frau und suchte in ihrem Gesicht zu lesen, ob sie Mitgefühl empfand oder von dem Schrecklichen wußte; doch nein, sie sah aus wie immer und blickte kopfschüttelnd auf etwas Staub auf dem Teppich und eine abgescheuerte Stelle an seinem Ärmelrand.
»Dieser Kater! Dauernd macht er den Teppich voller Haare. Hoffentlich kommen Sie bald wieder mal, Master Charles, man sieht Sie in letzter Zeit so selten. Sie sehen ein bißchen schmal aus; wahrscheinlich arbeiten Sie zuviel.«
Er lächelte mühsam, als sie ging, und versank wieder in Gedanken. Ich hab’s ja kommen sehen, würden die Leute sagen, seit dieser Tragödie war er nicht mehr der Alte. Ach, Sie wissen gar nichts davon? Eine furchtbare Sache; er hatte sich eben verlobt, er war mit dem Mädchen und seiner Schwester in Italien auf Urlaub. Zita hieß sie, ein hübsches Ding, alles war wie im Paradies, und dann hinterließ sie ganz plötzlich einen Brief bei der Padrona, in dem stand, sie wolle nicht mehr leben, und ging und ertränkte sich. Ohne jeden Grund, völlig unerklärlich. Der arme Charles war fischen; zur Teezeit kam er zurück und fand den Brief.
Die Frau sagte, sie sei zur Bucht gegangen, und so rannte er hinunter wie ein Irrer und fragte alle Leute; ja, sagten sie, sie wäre mit einem Boot rausgefahren und nicht zurückgekommen; da fuhr er hinaus, fand das leere Boot, sprang ins Wasser und tauchte, fast wäre er selbst ertrunken. Er bekam eine Lungenentzündung. Nell hatte alle Mühe, ihn durchzubringen – ein Glück, daß sie da war. Merkwürdige Sache, angeblich hatte sich das Mädchen vorher bei ihr über Schmerzen beklagt, und Nell diagnostizierte eine Verdauungsstörung von zuviel Antipasto; das Mädchen war körperlich kerngesund, doch bei der gerichtlichen Untersuchung kam man zu dem Schluß, daß sie eine Hysterikerin war, die sich einbildete, sie hätte irgendeine entsetzliche Krankheit. Furchtbare Sache für den armen alten Charles – es wäre naheliegend, sich zu fragen, ob er irgendwie dran schuld war, oder?
Charles umklammerte die Armstützen des Sessels, er schwitzte, sein Herz pochte. Ganz ruhig, ermahnte er sich, doch er spürte wieder den heißen, salzigen Geruch des sandigen Klippenwegs und sah die zum Trocknen ausgebreiteten Netze vor sich, das blasse, glatte Meer in der Bucht und die widerlich ausdruckslosen Gesichter der Leute, die er fragte.
»La Signorina Newman? No, Signor« – sie streckten die Hände aus, als bemitleideten sie ihn wegen seiner Torheit – »schaun Sie nach, wenn Sie wollen, sie ist nicht da.«
Dann hatte er sie gesucht, endlos und außer sich vor Aufregung, zuerst im Boot; dann war er hinausgeschwommen, hatte verzweifelt und nutzlos getaucht, »Zita! Zita!« schreiend, hatte den Haufen Kleider gefunden, war in Bewußtlosigkeit versunken. Einige heimkehrende Fischer retteten ihn und brachten ihn zu Nell, die eben von einem Abstecher zum örtlichen Kloster zurückgekommen war.
Die Wochen danach waren ein Alptraum gewesen: Injektionen, Schwitzen und Frösteln in dem harten Bett, denn man konnte ihn nicht ins Krankenhaus bringen, die scheußlichen Kräutertees, die ihm die Padrona kochte, Nells gequälter Blick, wenn er sie immer und immer wieder nach Zita fragte. Warum, warum nur hatte sie es getan? Sie würden es nie erfahren. Er würde sich nie verzeihen, daß er woanders gewesen war, als sie in ihre Krise geriet, was immer der Grund gewesen sein mochte. Bestimmt hätte er ihr helfen, ihr klarmachen können, daß das Leben lebenswert war. Es mußte eine momentane Panik gewesen sein, aus der sie ein vernünftiges Wort herausgeholt hätte; als er am Morgen hinausfuhr, war sie guter Laune gewesen, voll Albernheit und Fröhlichkeit. Ihr schwarzes Haar wehte im Wind, als sie am Kai auf einer Taurolle saß und ihm nachwinkte. »Ich hoffe, du wirst genug Fische für ein üppiges Abendessen mitbringen!« rief sie spöttisch; dann winkte sie ein letztes Mal sorglos und ging zu den Marktfrauen an den Blumenständen, um mit ihnen zu plaudern.
Die Leute sagten, sie sei unausgeglichen und zu impulsiv gewesen, und vielleicht stimmte das. Jedenfalls war ihre Liebe zueinander mit seelenversengender Schnelligkeit aufgeflammt, vom ersten atemberaubenden, zaghaften Kuß zu der tiefen Verzückung und Vertrautheit, die sie so rasch erreichten. Oder die sie nur seiner Meinung nach erreicht hatten; das war das Schreckliche daran. Er glaubte, daß er sie durch und durch kannte, daß sie sich ihm mit völliger Rückhaltlosigkeit geschenkt hatte, mit jener Hingabe, die so charakteristisch für sie schien. Doch welcher dunkle Drang, welcher unbekannte grauenhafte Umstand hatte sie so schnell von ihm wegzerren können?
Er würde die Antwort nicht finden, wenn er noch hundert Jahre lebte – geschweige denn in dieser kläglich kurzen Zeit, die er nun noch leben würde.
Die Frage, die die ganze Zeit versteckt in ihm gelauert hatte, kam jetzt hervor.
»Lohnt es sich überhaupt, weiterzumachen? Über ein Jahr lang hast du krampfhaft versucht, dich in Arbeit zu vergraben. Lohnt es sich, auf diese jämmerliche Weise noch zwölf Monate weiterzuexistieren, wenn nun noch hinzukommt, daß du jeden Moment sterben kannst, daß du Freunden und Fremden zur Last fällst und Nell mit Qual und Sorge erfüllst? Warum nicht dem natürlichen Lauf der Ereignisse ein rasches – wenn möglich sehr rasches Ende bereiten?«
Nells Worte fielen ihm plötzlich ein: Nimm ein paar Schlaftabletten. Lieg nicht wach und grüble. Im Badezimmerschrank ist eine Flasche.
Mechanisch ging er zur Tür hinaus, über den Korridor in Nells hübsches Badezimmer und nahm die Flasche aus dem Schrank. Wie viele? Sie waren nicht groß; es würde nicht schwer sein, alle, die in der Flasche waren, zu schlucken. Das sollte reichen.
Nein, nicht hier. Es wäre unverzeihlich, der armen alten Nin das anzutun; sie war mit ihm bei der Lanrith-Regatta gewesen, seine erste klare Erinnerung. Weiße Segel und grünes Wasser. Wenn du alt genug bist, wirst du selbst mit einem Boot segeln, Charles.
Nun, jetzt war er alt genug, doch zum Segeln war er nicht viel gekommen. Was hatte ihn nicht alles davon abgehalten – der Dienst bei der Marine, die Berufsausbildung, die Arbeit, die mit dem Erfolg der Firma immer mehr wurde, dann noch härtere Arbeit, um Zita zu vergessen.
»Verdammt noch mal«, sagte er wütend. »Was für ein erbärmliches Ende.«
Er steckte die Flasche ein und ging in die Küche zu Nin.
»Wiedersehen, Nin, alles Gute.« Er umarmte die alte Frau und blickte sich in dem warmen Raum um. »Hübsch hast du’s hier.« Die Küche war groß für ein Apartment, und Nin hatte von ihr Besitz ergriffen und sie in einen behaglichen Teil einer anderen Welt verwandelt. Eine große Kuckucksuhr tickte laut über einem Kaminsims mit einer fransengesäumten Decke, auf der Weihnachtskarten aufgebaut waren; auf einem Flickenteppich vor dem Kamin stand ein Messingvorsatz. Auf der größten Schale einer Muschelkassette auf der Anrichte stand ›Ein Geschenk aus Lanrith‹. Er erkannte darin ein altes Stück aus dem Familienhaus, das längst verkauft war; er hatte es Nin zu Weihnachten geschenkt, als er zehn war.
»Ja, ganz hübsch«, sagte sie, »aber ich finde, in einer Etagenwohnung gibt’s keine richtige Küche. Passen Sie auf, daß Sie keine nassen Füße kriegen, Master Charles, draußen nieselt’s scheußlich.« Sie hielt ihm die Wange hin, als er sie küßte, und beugte sich dann wieder über ihre Strickerei; als er die Tür zumachte, hörte er, wie die Nadeln zu klappern begannen.
Draußen nieselte es, wie sie gesagt hatte, ein feiner, mit Schnee vermischter Regen, und er blieb unentschlossen stehen und blickte auf den schwarzen, gesprenkelten Fluß, auf dessen Oberfläche sich die Lichter spiegelten.
Eine dumpfe Müdigkeit und Depression befiel ihn. Er war entschlossen, doch wo sollte er es tun? Irgendwie graute ihm vor seiner trostlosen, kalten, dunklen Wohnung. Er sprang in irgendeinen Bus, stieg aus und ging über den Piccadilly Circus, ohne auf das Quietschen und Hupen der Taxis auf dem nassen Asphalt zu achten. Beleuchtete, mit Regentropfen übersäte Busse schaukelten vorbei und schleuderten Schmutz hoch.
Er ging in die Kneipe an der St. Martin’s Lane, ein vertrautes, behagliches Lokal voll rotem Samt, Blattgold und Kandelabern; genau das Richtige gegen seine desolate Stimmung.
»Keine harten Drinks«, hatte Nell ihm geraten, und er hatte es ihr versprochen, doch jetzt – was machte es schließlich aus? – bestellte er einen doppelten Rum und trug ihn zu einer gemütlichen Nische mit plüschbezogenen Bänken.
»Nanu, ist das nicht Charles!« rief eine Stimme erfreut.
Oh, mein Gott, dachte er, wer ist das? Jemand Bekannten zu treffen, war das letzte, was er sich wünschte – doch dann erkannte er die Tiefe und den Tonfall der Stimme; es gab nur einen Menschen, der so sprach; und als er sich umdrehte, sah er, daß er recht hatte und sagte aufrichtig:
»Claire! Es gibt niemanden, den ich lieber sehen würde als dich.«
»Das hört sich aber schlimm an. Komm, rutsch dort in die Ecke – ich hol mir nur schnell einen neuen Drink, und dann müssen wir ordentlich miteinander tratschen. Ich bin eben aus Moskau zurückgekommen«, sagte sie. »Hab über den Turnerinnenwettkampf berichtet.«
Claire Dean war, wie selbst ihre besten Freunde zugeben würden, keine Schönheit, doch es war etwas an ihr – eine Wärme und Ungezwungenheit, ein schrankenloser Eifer, Freunde zu gewinnen –, das sie bei einer ungeheuren Zahl von Menschen beliebt machte. Sie war groß, mager, schlampig gekleidet; ihr Haar war kraus und struppig; ihre tiefliegenden Augen blickten aus einem unebenen, doch sympathischen Gesicht, das oft mit Tinte beschmiert war. Sie war immer heiter und gelassen, ob sie Kinder bei einem lokalen Tennisturnier ermutigte oder Mitgliedern der königlichen Familie über einen schwierigen Moment bei einem Pferderennen hinweghalf. Jahrelang hatte sie Großbritannien bei verschiedenen Turnerinnenmeisterschaften vertreten, und seit sie den aktiven Sport aufgegeben hatte, schrieb sie eine Sportkolumne für eine Zeitung. Sie pflegte zahllose lahme Hunde gesund und hatte meistens irgendeinen Hilfsbedürftigen in ihrer von Zeitungen übersäten Wohnung – einen Alkoholiker, den sie ins normale Leben zurückführte, eine schwangere Flüchtlingsfrau, die einen Job suchte, einen heruntergekommenen Schauspieler oder geldlosen Schriftsteller.
Charles holte ihr den üblichen Whisky (kein Drink hatte je die mindeste Wirkung auf Claire), und sie sagte: »Du bist also deprimiert? Kann ich gut verstehen – ich auch. Widerlich, diese baumstammwerfenden Moskauer Trampel; am liebsten würde ich meinen Job aufgeben und mich zur Ruhe setzen. Wird sowieso allmählich Zeit.« Nur wenige Leute kannten Claires Alter, doch angeblich ging sie auf die sechzig zu.
Während sie sprach, hatte sie Charles nachdenklich angesehen, und jetzt legte sie mitfühlend ihre große Hand auf seine. »Ich muß sagen, du siehst wirklich schlecht aus«, sagte sie in völlig anderem Ton. »Willst du nicht drüber reden?«
Zu seiner Überraschung stellte Charles fest, daß er wollte.
Die ganze Zeit, während er erzählte, hielt Claire seine Hand zwischen ihren warmen Händen und blickte ihn aufmerksam an, und der Rauch ihrer Zigarette schwebte zwischen ihnen. Sie unterbrach ihn nicht, und allein der Umstand, daß sie sich unter Ausschluß alles anderen auf sein Problem konzentrierte, beruhigte und tröstete ihn.
»So, jetzt weißt du, was los ist«, schloß er.
»Begreiflich, daß du völlig zu Klump geschlagen bist«, sagte sie langsam, »– so was ist kein Spaß, wie?«, und Erleichterung erfüllte ihn.
»Aber weißt du was!« rief sie, und ihre Augen leuchteten auf, »das ist doch eine wundervolle Chance!«
»Botschaften aus dem Jenseits zu schicken?« sagte er bissig. Doch er fühlte sich bereits besser.
»Nein, natürlich nicht, du Kamel.« Sie stieß ihn zwischen die Rippen. »Gott, du wirst mir natürlich schrecklich fehlen – falls du Botschaften schicken kannst, würde ich mich sehr darüber freuen. Nein, ich meine, du hast jetzt die Chance, zu tun, was du auch willst, ohne Angst vor den Folgen haben zu müssen. Hast du daran gedacht? Publicity, Kosten, Gefahr – das alles spielt keine Rolle mehr. Du könntest die riskantesten Aufträge übernehmen – dich freiwillig für ein Raumfahrtunternehmen melden …«
»Dazu muß man gesundheitlich völlig in Ordnung sein. Und außerdem habe ich zu so was keine Lust«, sagte Charles schroff. Er kam sich vor wie ein Kind, das zum erstenmal in ein Internat geschickt und von seinen Angehörigen heuchlerisch ermuntert wird – »Was für ein Glück für dich, daß du auf die Schule darfst« –, obwohl er und sie wissen, daß ihm die reine Hölle bevorsteht.
Doch Claire meinte es ehrlich. Ihre Augen funkelten vor Neid.
»Du wolltest dir doch schon immer ein Boot zulegen und segeln, nicht? Und du kannst deine Memoiren schreiben, ohne Verleumdungsprozesse fürchten zu müssen.«
»Die wären wohl nicht sehr interessant.« Er lächelte zögernd.
»Das solltest du tun, Claire.«
»Ach, dazu hätte ich nie die Ausdauer. Noch etwas – du kannst dein ganzes Geld verjubeln.«
»Da hast du recht«, sagte er ohne Begeisterung. Er stand auf und ging mit ihren Gläsern zur Theke. Als er zurückkam, dachte er zum erstenmal: Claire wird alt. Würde sie es wohl je zu dem kleinen Bauernhof bringen, nach dem sie sich immer gesehnt hatte? Und wenn, würde sie dann wirklich glücklich sein oder vor Einsamkeit durchdrehen und sich zu Tode trinken? Er stellte sich vor, wie sie in Sandalen durch Schlamm stapfte und, eine Zigarette im Mundwinkel, Eimer mit Maische zum Stall trug. Die Leute würden sie die komische alte Miss Dean nennen, und sie würde sehr nett zu den Kindern sein und sie in ihr Haus holen, wenn sie von der Schule heimgingen, und ihnen die frisch ausgeschlüpften Küken im Backofen zeigen.
»Du schaust so nachdenklich drein«, sagte er. »Was denkst du?«
»Ich hab versucht, mir das Ganze zusammenzureimen – ob wohl Zitas Tod an deiner Krankheit schuld ist. Ich dachte nämlich, du hast dich von dem Schock darüber ganz gut erholt.« Auf dem Tisch lagen ein paar abgebrannte Streichhölzer, und Charles schwieg eine oder zwei Minuten und legte sie zu einem Kreuz zusammen.
Schließlich sagte er: »Ich glaube, ich würde zu niemand anderem so ehrlich sein, nicht mal zu Eleanor, aber dir hab ich nie was vorgemacht, und es ist zu spät, jetzt damit anzufangen. Ein paar Monate nach Zitas Tod mußte ich mich bemühen, ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung zu unterdrücken – ein schreckliches Gefühl, das mich mit Gewissensbissen und Entsetzen erfüllte. Denn mir wurde klar, daß es ein großer Fehler gewesen wäre, wenn Zita und ich geheiratet hätten. Wir paßten nicht richtig zusammen; wahrscheinlich hätten wir uns in zwei oder drei Jahren hoffnungslos auseinandergelebt. Nicht, daß wir uns nicht geliebt haben; wir haben uns geliebt, und heute noch spüre ich einen Klumpen in der Kehle, wenn ich daran denke – aber ich war zu ernst für sie; sie war für mich zu sorglos und leichtsinnig. Wir hätten uns gegenseitig verrückt gemacht.
Manchmal frage ich mich, und es ist ein qualvoller Gedanke, ob Zita das wohl gemerkt hat. Denn mir wurde bereits klar, daß ich sie nicht so sehr brauchte wie sie mich. Diesen ganzen Tag damals hab ich kein einziges Mal an sie gedacht – ich war mit meinen Gedanken völlig beim Fischen. Manchmal peinigt mich die Frage, ob sie’s wohl deshalb getan hat.«
Er brach ab und sah Claire, die regungslos dasaß, fragend an.
»Hm«, sagte sie ernst, »das ist eins der albernsten Geständnisse, das ich je gehört hab. Und ich hab viele gehört. Nur gut, daß du dir das von der Seele geredet hast – wenn du gesund bist, kannst du’s dir leisten, dich auf so puritanische Weise zu quälen, aber nicht, wenn du nur noch ein paar Monate zu leben hast. Du kannst ganz sicher sein – aus so einem lächerlichen Grund hätte Zita sich nie umgebracht. Vergiß nicht, ich hab sie gekannt. Wahrscheinlich hätte sie sich aufgeregt, eine Szene gemacht – aber hinzugehen und sich zu ertränken! Einfach absurd. Sie war ein bißchen unbesonnen und impulsiv, doch nicht auf diese Weise, nicht im mindesten.«
»Aber«, erwiderte Charles, »es war einfach furchtbar, so deutlich und plötzlich zu erkennen, daß wir nicht zueinander gepaßt hätten. Es war, als ob man durch die Nacht geht und sich verirrt; man sieht im Finstern etwas, das wie ein Baum und ein Tor ausschaut; dann kommt plötzlich der Mond vor, und man merkt, der Baum ist in Wirklichkeit ein Hochsitz und das Tor sind drei schwache Lichtstreifen, und es wird einem klar, daß man kilometerweit von der Stelle, wo man zu sein glaubte, entfernt ist.«
»Ich frage mich, ob du wohl je wirklich verliebt warst?« sagte Claire.
»Ich hatte immer die komische Idee« – es klang, als wolle er sich entschuldigen – »ich glaube, jeder hat sie – daß ich irgendwann mal dem Menschen begegnen werde, der wirklich für mich bestimmt ist. Zita hatte alle äußerlichen Eigenschaften, die ich mir bei meinem Traummädchen immer vorstellte – klein, schwarzes Haar und blaue Augen und dieses herrliche glucksende Lachen – aber irgend etwas fehlte ihr. Allmählich bemerkte ich eine merkwürdige Leere, einen Mangel an Empfindsamkeit – mein Gott, es ist furchtbar, so über sie zu sprechen. Sie war süß, zärtlich, fröhlich, aber irgend etwas fehlte ihr …«
»Ja, das stimmt«, sagte Claire leise. »Die arme Zita.«
»Die arme Zita«, wiederholte er, doch er fühlte sich seltsam erleichtert. Zum erstenmal waren sein Kummer und sein Mitleid nicht mit dieser erdrückenden Reue gemischt.
»Zigarette?« Claire sah ihn an wie ein Chirurg, der eine Operation mit Erfolg beendet und die Wunde zugenäht hat.
»Rauch eine von meinen.« Als er in seine Tasche griff, berührte er etwas Unvertrautes und zog es erstaunt hervor. »Was, zum Teufel – oh.« Ihre Blicke trafen sich über der Flasche, und einen Moment herrschte Schweigen.
»Du überraschst mich, Charles«, sagte sie schließlich in ruhigem Ton. »Ich habe dich höher eingeschätzt.«