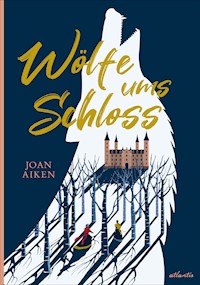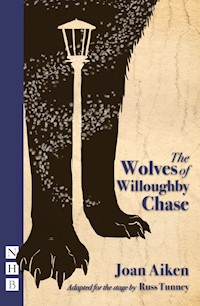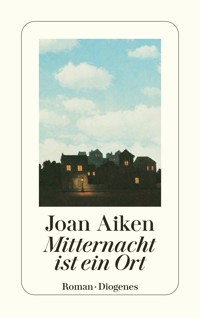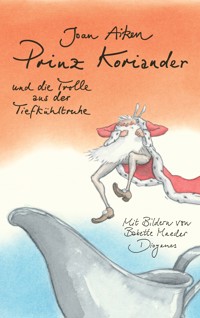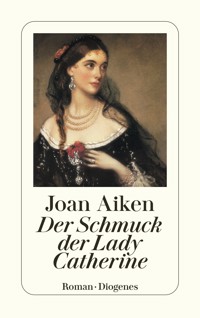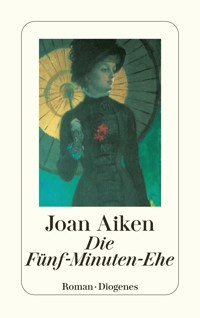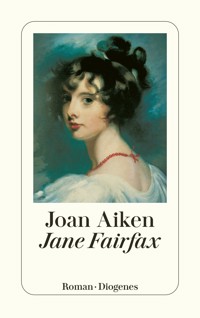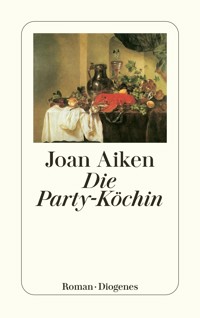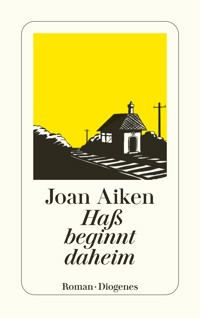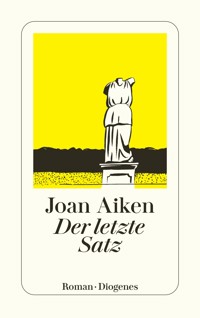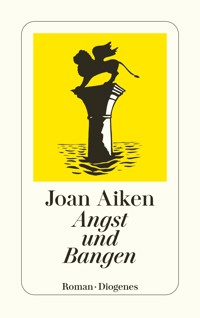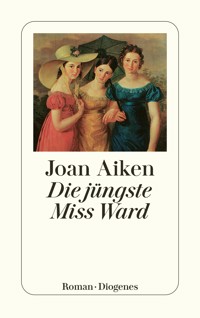
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf herrschaftlichen Anwesen wie Mansfield Park ließen sich Gefühl und Verstand nicht so leicht vereinbaren. Erst Hatty Ward, die Joan Aiken hinzuerfunden hat, durchbricht die Konventionen. Sie verfügt zwar über keine große Mitgift, doch dank ihrer Einfühlungsgabe meistert sie die schwierigsten Situationen. Vermag sie selbst das Herz von Lord Camber zu gewinnen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Joan Aiken
Die jüngste Miss Ward
Roman
Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann
Diogenes
Erster Teil
1
Henry Ward, Herr über das Anwesen Bythorn Lodge in der Grafschaft Huntingdon, empfand es als äußerst bitter, daß er angesichts seiner prekären Vermögensverhältnisse nur eine Mitgift von siebentausend Pfund aufbringen konnte, als seine Tochter Maria das Glück hatte, die Zuneigung von Sir Thomas Bertram zu gewinnen, der als Baronet einen stattlichen Besitz in der Grafschaft Northamptonshire sein eigen nannte. Mr. Wards anderen Töchtern sollte es später noch schlechter ergehen. Da sich bis dahin das Vermögen ihres Vaters weiter dezimiert hatte, sollte Agnes, die älteste Miss Ward, nur zweitausend Pfund erhalten, als sie sechs Jahre nach der Hochzeit ihrer Schwester eine achtbare, wenn auch keineswegs blendende Verbindung mit Mr. Norris einging, einem von ihrem Schwager protegierten Geistlichen in mittleren Jahren. Frances, die dritte Schwester, brannte dann in einer für die Familie besonders aufreibenden und kummervollen Zeit mit einem Marineleutnant aus Portsmouth durch und hieß von da an bei den Schwestern – insbesondere bei Mrs. Norris – halb herablassend, halb mißbilligend nur noch die »arme Fanny«. Harriet aber, die jüngste Miss Ward, setzte allem die Krone auf: Ihr Leben nahm einen so unerhörten, ja geradezu empörenden Verlauf, daß die Familie (natürlich bis auf Mrs. Norris) nicht einmal mehr ihren Namen in den Mund nahm.
Ihr Schicksal mit all seinen Widrigkeiten ist es, das hier geschildert wird, wobei mit falschen Anschuldigungen und Verleumdungen ein für allemal aufgeräumt werden soll.
Der jüngsten Miss Ward, Harriet – oder Hatty, wie sie meist gerufen wurde – hätte im Alter von zwölf Jahren, zu dem Zeitpunkt, da dieser Bericht beginnt, niemand ein Leben in Unehre vorausgesagt. Sie war von jeher der Liebling ihrer Mutter, die drei Jahre nach Hattys Geburt bettlägerig geworden war, und verbrachte viel Zeit in Mrs. Wards Zimmer, las mit ihr Bibeltexte, Erzählungen und Gedichte oder sang ihr mit zarter, aber reiner Stimme etwas vor.
Was das Äußere betraf, hatte das Schicksal die Ward-Schwestern sehr ungleichmäßig bedacht. Zwei von ihnen, Maria und Frances, sahen ihrem gutaussehenden Vater ähnlich. Sie konnten sich über einen strahlend klaren Teint, große blaue Augen, einen hohen schlanken Wuchs und gefällige Formen freuen, und man war sich darüber einig, daß sie zu den hübschesten jungen Frauen der Grafschaft zählten.
Die anderen beiden Schwestern, Agnes und Hatty, schlugen ihrer Mutter nach, die in die Familie Lebensart, aber weder Geld noch Schönheit eingebracht hatte. Die geborene Isabel Wisbech, entfernt mit dem Herzog von Dungeness verwandt, war eine gescheite, gutherzige und vornehme Frau, aber klein von Wuchs, schmal und unauffällig. Sie hatte dunkle Augen, einen blassen Teint und ein wenig ausgeprägtes Selbstbewußtsein. Da sie zudem sehr still und in sich gekehrt war, nährte das in der Grafschaft Gerüchte, ihre Ehe sei nicht eben glücklich.
Agnes und Hatty hatten beide den kleinen Wuchs und die dunklen Haare und Augen ihrer Mutter geerbt, nicht aber ihr passives Wesen. Hatty besaß Mrs. Wards Anmut und einen Liebreiz der Züge, durch den sie sich Fremden, die genauer hinzusehen verstanden, sofort empfahl. Agnes, die Älteste, war ein scharfzüngiges, übereifriges und herrisches Geschöpf, während Hatty Witz und Schlagfertigkeit und die Fähigkeit zu eigenständigem Denken besaß. Da zwei ihrer älteren Schwestern zu schwerfällig waren, um ihre Scherze und Einfälle zu würdigen, die dritte hingegen zu hitzig, hatte Hatty sich schon immer auf eigene Faust vergnügen müssen.
Mr. Ward war in diesem Weiberhaushalt zu einem vergrämten Mann geworden. Zeitlebens war es sein größter Wunsch, Master of Foxhounds, also oberster Jagdleiter, zu werden, denn er war ein leidenschaftlicher Waidmann, der am liebsten tagtäglich auf die Jagd gegangen wäre und den größten Teil seines Vermögens auf edle Reitpferde verwendet hatte. Zum Zeitpunkt seiner Eheschließung hatte er gehofft, verwandtschaftliche Bande mit Oberst Frederick Wisbech, einem Vetter zweiten Grades seiner Frau und jüngerem Sohn des Herzogs von Dungeness, welcher zudem in dem Ruf stand, sein Geld überaus geschickt in der City von London anzulegen, könnten ihm gesellschaftliche und finanzielle Vorteile bringen, doch war er weder in der einen noch in der anderen Hinsicht in den Genuß der ersehnten Wohltaten gekommen. Oberst Wisbech betrachtete Mr. Ward als einen Langweiler erster Güte und hielt sich tunlichst von ihm fern, während der Herzog seine Jagdmeute weiter in der recht nachlässigen Obhut seines Schwagers beließ.
Die Enttäuschung aber, die am heftigsten an Henry Ward nagte, betraf seinen Besitz, der nur in männlicher Linie vererbt werden konnte und in Ermangelung eines Erben an einen der Söhne seines Bruders fallen würde. Philip Ward war Advokat in Portsmouth und in den Augen von Henry Ward gesellschaftlich ohne jede Bedeutung. Die beiden Brüder schrieben sich nur selten und waren im Lauf von achtzehn Jahren nur einmal zusammengekommen. Für Mr. Ward war es ein ständiges Ärgernis, daß diese unerhebliche Familie aufgrund lächerlicher juristischer Federfuchsereien das Recht haben sollte, seinen Besitz zu übernehmen. Das Leben war für einen Mann wie ihn, der zwar in eine vornehme Verwandtschaft eingeheiratet hatte, aber aufgrund seiner ungenügenden Mittel niemals mit ihr von gleich zu gleich verkehren konnte, nicht eben einfach.
Vier Töchter hatte die unglückliche Mrs. Ward bis zu ihrem einunddreißigsten Lebensjahr zur Welt gebracht, und nach der Geburt der vierten erklärte ihr Hausarzt, daß ein fünftes Kind ihr sicherer Tod wäre, was Mr. Ward in helle Empörung versetzte. Von den ersten drei Töchtern hatte er kaum Notiz genommen, die vierte ignorierte er völlig. Nach Hattys Geburt hatte Mrs. Ward ein schweres Kindbettfieber bekommen, danach ging es mit ihrer Gesundheit stetig bergab, und als Miss Marias Hochzeit näher rückte, war sie schon seit acht oder neun Jahren ans Bett gefesselt.
Daß die Vorbereitungen für die einer künftigen Lady Bertram angemessenen Feierlichkeiten ihre Kräfte bei weitem übersteigen würden, war allen Beteiligten bewußt.
»Könnten wir nicht meine Base Ursula Fowldes um Hilfe bitten?« fragte sie eines Tages zaudernd ihren Mann. »Ich denke, daß sie zu bewegen wäre, ein paar Tage vor der Hochzeit zu kommen und sich um alle Einzelheiten zu kümmern. In diesen Dingen dürfte niemand kenntnisreicher und tauglicher sein als sie. Du weißt, daß zwei ihrer Schwestern bereits verheiratet sind, so daß sie reichlich Erfahrungen sammeln konnte. Und bei der Hochzeit unserer lieben Maria mit Sir Thomas Bertram wollen wir uns doch keine Fehler oder Nachlässigkeiten leisten.«
Mr. Ward nahm diesen Vorschlag sehr wohlwollend auf. Lady Ursula Fowldes, die älteste Tochter des fuchsjagdbesessenen Grafen von Elstow, des Herzogs Schwager, hatte mitgeholfen, zwei ihrer jüngeren Schwestern, Lady Mary und Lady Anne, durchaus angemessen unter die Haube zu bringen, weshalb zu vermuten stand, daß sie mit Prozedur und Etikette bis ins kleinste vertraut war. (Über die Frage, warum Lady Ursula nicht geheiratet hatte, wurde in der Nachbarschaft viel getuschelt und gerätselt, man sprach von einer romantischen Liebe, die vor einigen Jahren zerbrochen war.) Mittlerweile war sie siebenundzwanzig Jahre alt, und mit der Möglichkeit, sie könne doch noch in den Stand der Ehe treten, rechnete aus allerlei Gründen inzwischen längst niemand mehr.
»Ich glaube, daß Base Ursula bereit wäre, herzukommen und uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen«, wiederholte Mrs. Ward, »auch wenn ich sie lange nicht mehr gesehen habe. In jüngeren Jahren waren wir einander sehr zugetan. Wenn du mir Papier und Feder bringst, Hatty, will ich gleich an sie schreiben.«
Hatty gehorchte; allerdings konnte sie, als sie der Mutter die Schreibutensilien brachte, einen leisen Seufzer nicht unterdrücken. Bei den Töchtern der Wards war Lady Ursula recht unbeliebt, denn sie bildete sich auf ihre gesellschaftliche Stellung nicht wenig ein und gab sich (vielleicht als Folge jener legendären Romanze) stets säuerlich-formell und überheblich. Ihre stocksteife Haltung versetzte jedem geselligen Beisammensein, an dem sie teilnahm, einen betrüblichen Dämpfer. Nase, Kinn und Augenbrauen strebten ständig in verwunderter Mißbilligung nach oben. Niemand verstand es so gut wie Lady Ursula, gemeine Anmaßung niederzuhalten oder kurzen Prozeß mit parvenühafter Unverfrorenheit zu machen.
»Ja gewiß, deine Cousine Ursula ist bestimmt die geeignetste Person, um die Vorbereitungen für Marias großen Tag zu beaufsichtigen«, bestätigte Mr. Ward in ausnahmsweise hochzufriedenem Ton.
Zu jener Zeit sah Mr. Ward, nachdem Maria eine so überaus willkommene Verbindung mit Sir Thomas Bertram eingegangen war, seine Aussichten für die Zukunft noch in leidlich rosigem Licht. Es stand zu hoffen, daß Maria dank ihrer künftigen angeheirateten Verwandten auch den jüngeren Töchtern akzeptable Partien würde vermitteln können. Der Plan, Lady Ursula zu einem Besuch in seinem bescheidenen Heim zu überreden, kam ihm sehr entgegen, denn bislang hatten sich trotz der verwandtschaftlichen Verbindungen kaum Kontakte zwischen den Wards und der Familie von Lord Elstow in Underwood Priors ergeben. »Unsere Verwandten, die Fowldes … unsere Cousine, Lady Ursula …«, hörte Mr. Ward sich im Geiste bereits sagen. Bei den bevorstehenden Hochzeitsfeierlichkeiten würde das ein sehr erwünschtes Gegengewicht zu den adligen Verwandten des Bräutigams sein.
Mr. Ward war bereit und willens, für die Dauer der Hochzeitsfeierlichkeiten den abschätzigen, um nicht zu sagen rüden Ton abzulegen, den er gewöhnlich der Weiblichkeit gegenüber anschlug, und Lady Ursula mit Ehrerbietung, Liebenswürdigkeit, ja nachgerade Galanterie zu begegnen, worüber sich seine Töchter später nicht genug wundern konnten.
Doch galt es vor dem Eintreffen der Hochzeitsgäste noch verschiedene häusliche Hürden zu überwinden. Auch eine alte Tante von Mr. Ward, Mrs. Winchilsea aus Somerset, war eingeladen, und Bythorn Lodge verfügte nur über ein Gästezimmer. Eine der vier Töchter würde deshalb ihr Zimmer an Lady Ursula abtreten müssen. Daß Maria, die Braut, nicht aus ihrem Zimmer vertrieben werden konnte, lag auf der Hand. Naheliegend wäre es gewesen, eines der beiden jüngeren Mädchen, Hatty oder Frances, auszuquartieren, deren Räume aber nicht so ansprechend waren.
»Agnes muß ein Opfer bringen«, entschied Mr. Ward, als ihm die Sache zur Beurteilung vorgelegt wurde. »Sie hat das größte Zimmer mit einer schönen Aussicht auf die Trift. Es ist die am besten geeignete und einzig angemessene Unterkunft für Lady Ursula, die ja schließlich Zeit und Mühe auf unsere Angelegenheiten verwendet. Was für ihre Bequemlichkeit getan werden kann, soll geschehen. Agnes muß dann eben zu Frances ziehen.«
Der ältesten Miss Ward mißfiel diese Entscheidung sehr. Sie war ohnedies gekränkt, weil Maria als Begleiterin für die Hochzeitsreise nach Bath und Wells nicht die ältere Schwester ausersehen hatte. Nicht Agnes, sondern Frances sollte ihre Reisegefährtin sein. Der Familie kam die Wahl nicht unerwartet, denn Frances und Maria, die sich vom Wesen und vom Aussehen her so ähnlich waren, standen sich seit jeher sehr nah, während Agnes, die Älteste, und Hatty, die Jüngste, getrennt durch dreizehn Jahre und in jeder Beziehung denkbar gegensätzlich, mehr schlecht als recht miteinander zurechtkamen.
Die Zurücksetzung hatte Agnes tief getroffen. Es lag in ihrer Natur, sich über jeden Tort, den man ihr antat, auch wenn er nur in ihrer Einbildung bestand, heftig zu kränken, und die Sache wurde nicht besser dadurch, daß die künftige Lady Bertram in ihrem ruhig-schleppenden Ton bemerkte: »Es ist eindeutig deine Pflicht, daheim zu bleiben und dich um Mama zu kümmern, während Frances und ich mit Sir Thomas auf Reisen sind. Wie oft habe ich dich sagen hören, daß allein du dich auf die Pflege unserer Mutter verstehst, daß man Fanny mit ihrem Spatzenhirn unmöglich den Haushalt anvertrauen kann und Hatty natürlich noch zu jung ist. Wenn wir es so regeln, ist allen geholfen. Ich denke, du wirst gut daran tun, in Hattys Zimmer zu ziehen, denn bei Fanny wird es durch das Kofferpacken und die übrigen Reisevorbereitungen ein großes Durcheinander geben. Fanny ist so fahrig. Wenn wir fort sind, hast du dann, falls Lady Ursula länger bleibt, die Wahl zwischen meinem und Fannys Zimmer, denn ich denke doch, daß Fanny, wenn wir uns in Mansfield Park, dem Besitz von Sir Thomas, eingerichtet haben, noch etliche Monate bei uns bleiben wird.«
Agnes mit ihrem reizbaren Temperament schmeckten diese Ausführungen gallebitter, zumal ihnen durchaus vernünftige Argumente und unwiderlegbare Fakten zugrunde lagen. Das Ende vom Lied war, daß Agnes sich zu Hattys großem Kummer tatsächlich dafür entschied, zu der jüngeren Schwester zu ziehen. Zwei Gründe gaben den Ausschlag. Erstens war das Zimmer näher an ihrem eigenen, und zweitens konnte sie Hatty, als die Jüngste, am besten herumkommandieren und mit Kleiderbündeln und anderen Dingen von einem Raum zum anderen schicken.
Dieser kleine häusliche Umzug war der Anlaß für ein Mißgeschick, dessen Auswirkungen noch über viele Jahre spürbar bleiben sollten.
Marias Hochzeit sollte im Juni gefeiert werden. Der Frühsommer jenes Jahres war ausnehmend schwül und gewittrig, und die Sonne ließ sich nur selten blicken. Die kränkelnde Mrs. Ward, die unter der stickigen Wärme besonders litt, hatte gebeten, möglichst viele Türen und Fenster zu öffnen. Und deshalb stand die Haustür von Bythorn Lodge sperrangelweit offen, als der Vierspänner aus Underwood Priors mit Lady Ursula eintraf, was mehrere Stunden früher als vorgesehen geschah. Es war bekannt, daß diese bei ihren Reisen sich nicht um die Bequemlichkeit ihrer Mitmenschen scherte, und da sie ihren Besuch als außerordentlichen Gunstbeweis betrachtete, hatte sie nicht die mindesten Bedenken gehabt, ihre Ankunft um einen halben Tag vorzuverlegen.
Durch die Hochzeitsvorbereitungen und die Zurichtungen für einen weiteren Gast befand sich der Haushalt bereits in einiger Unordnung, und deshalb war kein Diener zur Stelle, als die hochgewachsene Lady Ursula mit düster-mißbilligender Miene durch die offenstehende Haustür die Eingangshalle betrat. Sie stieß kräftig mit ihrem Stock auf die Steinplatten, sah sich um und rief mit ihrer hohen, gebieterischen Stimme: »Heda! Ist hier niemand?«
Fanny Ward, die gerade mit einem Bündel Bettwäsche die Treppe herunterkam, war beim Anblick der furchterregenden Erscheinung wie vom Donner gerührt.
»O Himmel! Tante Ursula! Ich … Ich w-wußte ja nicht, daß man dich schon so früh erwartet. Papa ist drüben bei den Ställen …«
Mr. Ward war tagsüber unweigerlich in den Ställen zu finden, sofern er sich nicht seinem geliebten Waidwerk widmen konnte.
»Besten Dank, aber mit ihm habe ich im Augenblick nichts zu schaffen«, sagte Lady Ursula frostig. »Frances, wenn ich nicht irre? Du wirst mich zu deiner Mutter führen, wenn ich bitten darf.«
»Ja … ja, natürlich.« In ihrer Verzweiflung zog Fanny an der Klingelschnur und gab, als die sichtlich nervöse Haushälterin erschien, ebenso nervös ihre Anweisungen.
»Sag Jenny und meiner Schwester Hatty, sie sollen unverzüglich Lady Ursulas Zimmer richten.«
»Führe mich zu deiner Mutter, wenn ich bitten darf«, wiederholte Lady Ursula merklich lauter. Sie war es offenbar nicht gewohnt, eine Aufforderung wiederholen zu müssen.
»Gewiß doch, Tante Ursula. Bitte hier entlang … Ich weiß nicht recht, ob Mama … aber wenn du mir folgen würdest … und wenn du nur eben …«
Lady Ursulas Miene machte deutlich, daß sie nicht gewillt war, wartend in einem Gang herumzustehen. Auf der kleinen Galerie im Obergeschoß führte eine Glastür zu einem Balkon, aber Fannys hoffnungsvolle Geste in Richtung des dort plazierten Sessels verfehlte ihre Wirkung auf Lady Ursula, die der verstörten Nichte ungerührt folgte.
Die Tür zu Mrs. Wards Schlafzimmer war ebenso weit geöffnet wie die Haustür und bot ein Bild, das die meisten Betrachter anrührend, ja bewegend gefunden hätten.
Um sich in der drückenden Schwüle möglichst viel Erleichterung zu verschaffen, hatte die Kranke im Bett, durch einen Berg von Kissen gestützt, eine halb liegende, halb sitzende Stellung eingenommen und war in leichteste Gaze- und Batiststoffe gehüllt. Schon in gesunden Tagen schmal und dünn, wirkte sie jetzt spinnwebleicht, fast körperlos. Das dunkle Haar war der Hitze wegen hochgesteckt und mit einem Spitzentüchlein bedeckt. Das schmale, heute nur ausnahmsweise nicht von Schmerz gezeichnete Antlitz, das Lady Ursula jetzt einigermaßen bestürzt betrachtete, schien sich in den letzten zwölf Jahren kaum verändert zu haben. Das kleine Mädchen, das es sich mit einem Buch in der Hand auf einem kleinen Polstersessel neben dem Bett bequem gemacht hatte, wies eine frappierende Ähnlichkeit mit der Mutter auf, aber im Ausdruck unterschieden sich die beiden Gesichter erheblich. Das des Kindes verriet Erschrecken, die Miene der Frau erhellte sich in freudigem Erkennen.
»Ursie! Liebste Ursie! Welche Freude! Wir hatten dich erst gegen Abend erwartet.«
»Ja, das habe ich an den unzulänglichen Vorbereitungen gemerkt«, gab die Besucherin bissig zurück, nahm aber der Kritik die Spitze, indem sie näher trat und ihre Wange kurz an die der Kranken legte. Das Kind hatte sich indessen wie ein scheues kleines Tier ängstlich vom Bett entfernt.
Lady Ursula gönnte der Kleinen kaum einen Blick, aber Mrs. Ward sagte leise, indem sie eine abgezehrte Hand ausstreckte: »Wir lesen unseren Shakespeare später weiter, Liebes. Bald, das verspreche ich dir. Wir waren gerade an einer so spannenden Stelle angekommen. Du kannst dir vorstellen, daß Cousine Ursula und ich im Gespräch viel nachzuholen haben. Sei ein liebes Mädchen und hilf Fanny, die Zimmer für Ursula und Tante Winchilsea herzurichten. Pflücke beiden ein Wickensträußchen im Garten. Hattys Sträuße sind die schönsten«, fügte Mrs. Ward, zu der Freundin gewandt, hinzu und deutete mit einem matten, hoffnungsvollen Lächeln auf das zierliche Gebinde aus Lavendel, Eberraute und Storchenschnabel, während die Kleine wieder näher kam und mit der Wange die ausgestreckte Hand streifte.
Doch Lady Ursula sah auch jetzt die jüngere Nichte kaum an. »Lauf, Kind«, sagte sie schroff. »Du wirst hier nicht gebraucht. Deine Mutter und ich haben vertrauliche Dinge zu bereden. Jetzt geh schon, spute dich. Und mach die Tür hinter dir zu.«
Mrs. Ward öffnete den Mund zu einem Protest und schloß ihn wieder. Dann sagte sie sanft: »Setz dich, meine liebe Ursie. Such dir einen bequemen Sessel. Es tut gut, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Du mußt mir ausführlich von der Hochzeit deiner Schwestern erzählen. Und von deiner Mutter. Und wie geht es deinem Papa, meinem Onkel Owen?«
»Schlecht«, erwiderte Lady Ursula kurz angebunden. »Zu Hause ist er öfter betrunken als nüchtern. Und wenn er sich in London aufhält – was meist der Fall ist –, zieht es meine Mutter vor, sich nicht allzu genau nach seinem Tun und Treiben zu erkundigen. Sie selbst lebt meist in ihrer eigenen Welt. Sprechen wir nicht von ihnen. Es wäre Zeitverschwendung.«
Angewidert schob sie den kleinen Polstersessel vom Bett weg, sah sich suchend um und wählte eine Sitzgelegenheit, die ihrer geraden Haltung mehr entgegenkam. Als sie Platz genommen hatte, musterte sie ihre Gastgeberin mit gerunzelter Stirn. »Du dürftest nicht zulassen, daß dieses Kind dich derart ermüdet. Soll doch eine ihrer Schwestern sie beim Lernen beaufsichtigen.«
»Aber wir haben es so schön miteinander, liebste Ursie. Hatty ist jetzt meine einzige – ist eine meiner größten Freuden. Bitte schilt nicht mit mir. Ich hoffe, du bist nicht zum Schelten gekommen. Ich habe mich so nach dir gesehnt.«
Mrs. Ward griff liebevoll nach der Hand der Freundin.
»Komm, laß uns so tun, als säßen wir wieder in der Schulstube von Underwood. Wie geht es Barbara und Drusilla? Und meinem Vetter Fred Wisbech? Und meinem Onkel, dem Herzog? Und – und meinem Vetter Harry?«
»Ich habe keine Ahnung«, erwiderte Lady Ursula kalt und abweisend. »Unsere Wege kreuzen sich nie. Zum Glück, möchte ich sagen.«
»Ach Ursie …« In Mrs. Wards Stimme, die kaum lauter als ein Seufzer war, lag alle Betrübnis, alles Mitgefühl dieser Welt. Jetzt hatte sie die Hand der Freundin mit beiden Händen umfaßt und streichelte sie sanft und tröstend. »Meine liebe, liebe Ursie. Warum hast du mich nie besucht?«
»Zu welchem Anlaß?« fragte Lady Ursula kalt, aber sie ließ ihre Hand, wo sie war. Unbeweglich saß sie da, einer gewaltigen Fregatte gleich, die nur noch eine schwache Verankerung im Hafen hält.
Es wurde früh Nacht an diesem drückend heißen Tag. Die Zubereitung eines ungewohnt anspruchsvollen Dinners zu Ehren von Lady Ursula und Mrs. Winchilsea hatte die Kräfte der schlecht geschulten Dienerschaft überfordert, und als es dunkelte, liefen Hatty und eins der Hausmädchen noch immer mit Kleidern, Mänteln, Unterröcken und Toilettenartikeln von einem Zimmer zum anderen. Der kürzeste Weg für sie war quer über den obersten Absatz der Haupttreppe, die zur Eingangshalle hinunterführte.
Bis plötzlich – wie so oft vor dem Ausbruch eines Gewitters – ein gewaltiger Windstoß durch den Garten fegte und der stickigen Schwüle ein Ende machte. Die Haustür fiel mit einem lauten Knall zu, und der Luftzug löschte sämtliche Kerzen in der Halle. Hatty, die just in diesem Moment mit einem schweren Tablett voller Toilettenartikel von der Kommode ihrer ältesten Schwester über den Absatz im Obergeschoß kam, war so erschrocken, daß sie in der jähen Finsternis stolperte und unter dem Klirren von Porzellan und umweht von kräftigem Lavendelwasserduft kopfüber die Treppe hinunterfiel.
»Himmel hilf, Miss Hatty!« kreischte Jenny, das Hausmädchen, das nur wenige Schritte hinter ihr gewesen war. »Herrjemine, sind Sie tot? Was ist mit Ihnen?«
Mr. Ward, der das Zuschlagen der Haustür, Hattys lärmenden Sturz und Jennys Aufschrei gehört hatte, trat mit der Kerze in der Hand aus seiner Studierstube. »Was zum Kuckuck geht hier vor?« polterte er. »Was soll der Lärm? Denkt an die arme Herrin oben in ihrem Krankenzimmer.«
Tatsächlich hörte man von oben Mrs. Wards matte Stimme, die um Aufklärung bat. In diesem Moment trafen auch Agnes, Maria und Frances am Unfallort ein, Agnes in größter Eile, die anderen gemächlicher.
»Abscheuliches, unbedachtes Ding!« rief Agnes empört. »Seht nur, was sie mit meinen Sachen angestellt hat.«
Die Steinplatten der Eingangshalle waren in weitem Umkreis mit Glas- und Tonscherben, mit Elfenbein- und Lacksplittern bedeckt.
»Aber Miss Hatty, Miss Hatty«, wehklagte Jenny. »Bestimmt ist sie tot. Mausetot!«
»Laß den törichten Wirbel«, fuhr Mr. Ward sie an. »Du ängstigst Mrs. Ward um nichts und wieder nichts. Natürlich ist sie nicht tot, sie hat bei dem Sturz nur das Bewußtsein verloren.«
Inzwischen war auch Mrs. Ayling, die Haushälterin, eine besonnene, verständige Frau, auf der Bildfläche erschienen.
»Aber wenn sie sich nun etwas gebrochen hat, Sir?« wandte sie ein. »Soll nicht Mr. Jones nach ihr sehen?«
Mr. Jones war Mrs. Wards Hausarzt, der in der Nähe wohnte und häufig im Haus war. Eilends herbeigerufen, befand er, daß Miss Hatty sich nichts gebrochen, aber eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hatte und einige Tage das Bett würde hüten müssen.
Dieser Unfall brachte Hatty um die Hochzeit, um ihren Auftritt als Brautjungfer und alle Feierlichkeiten. Da sie in den ersten Tagen noch recht benommen war, trauerte sie dem unfreiwilligen Verzicht nicht weiter nach.
Später sollte ihr aus dieser Zeit hauptsächlich der Besuch im Gedächtnis bleiben, den Lady Ursula ihr am Krankenbett abgestattet hatte. Eine ungeheuer große düstere Gestalt betrat lautlos ihr Zimmer und sah aus erschreckender Höhe auf die Kranke herab. Das Gesicht mit der gekrümmten Nase, den verächtlich nach unten gezogenen Lippen und den verhangenen Augen kam der armen Hatty vor wie das eines Raubvogels. Durch die straff unter einer schwarzen Spitzenhaube zurückgekämmten Haare zogen sich schon graue Strähnen. Die Hände waren lang, knochig und eindringlich behende, als sie jetzt Hatty mit dem Finger drohte. »Du hast deiner Schwester Agnes großen Verdruß bereitet, du unnützes Kind, und ihr einen schweren Verlust zugefügt. Was für ein albernes, überflüssiges Mißgeschick. Dein Verhalten war kindisch und einer jungen Dame nicht würdig.«
»Ich kann aber wirklich nichts dafür, Tante Ursula. Als es plötzlich dunkel wurde, bin ich gestolpert«, sagte Hatty leise und bittend, den Blick auf das strenge, langgezogene Gesicht gerichtet. Sie hatte noch immer leichtes Fieber und meinte fast, eine Marmorstatue habe sich aus dem Garten zu ihr verirrt.
»Unsinn! Eine Dame sollte in allen Lebenslagen ihren Körper beherrschen können. Wäre dir diese Regel bereits in Fleisch und Blut übergegangen, wärst du stehengeblieben, als das Licht erlosch, statt auf diese tölpelhaft-ungeschliffene Art und Weise die Stufen hinunterzupurzeln. Deine arme Schwester Agnes hat einige ihrer kostbarsten Habseligkeiten eingebüßt.«
»Ich weiß, ich weiß«, flüsterte Hatty bedrückt. »Wie kann ich das je wieder gutmachen? Ihr Elfenbeinfächer … ihre silberne Brosche …«
Eine Aufzählung der von Agnes erlittenen Verluste war das erste, was die unglückliche Hatty zu hören bekam, als sie wieder bei Bewußtsein war. Die älteste Ward-Tochter war unbändig stolz auf die Schätze, die sie auf ihrem Ankleidetisch aufgebaut hatte. Das Prunkstück ihrer Sammlung war eine elfenbeinerne Haarbürste samt Kamm und Handspiegel aus der Hinterlassenschaft der alten Mrs. Wisbech, ihrer Großmutter mütterlicherseits. Auf der Rückseite aller drei Stücke war ein großes W eingraviert, das natürlich für Ward genausogut stehen konnte wie für Wisbech. Jetzt war das Spiegelglas in Scherben, der Kamm zerbrochen, die Haarbürste beschädigt. Ein heißgeliebtes Lackkästchen war in tausend Stücke gegangen, ein Flakon aus venezianischem Glas hatte einen Sprung, so daß der aromatische Essig auslief, und noch manch anderes war krumm und schief und nicht mehr zu reparieren. Da es in ihrem Leben weder Freundschaften noch Liebhaber gab, hatte Agnes ihr ganzes Herz an diese Schätze gehängt, und der Verlust war ein schwerer Kummer, den sie weder zu bemänteln noch mit einem Scherz zu überspielen bereit war. Hatty war genötigt, sich den peinlich genauen Katalog mehrmals am Tag anzuhören.
Der Vorfall trübte dauerhaft das Verhältnis zwischen Hatty und ihrer älteren Schwester, das nie ausgesprochen innig oder herzlich gewesen war, und führte bald dazu, daß ein Plan geschmiedet wurde, der Hattys weiteren Lebensweg entscheidend beeinflussen sollte. Bisher war Hatty in allen Fächern von Mrs. Ward unterrichtet worden, obgleich diese bettlägerig war, denn Mr. Ward hatte sich geweigert, Miss Tomkyns, die Gouvernante von Agnes, Maria und Fanny, für Hatty weiterzubezahlen. Mutter und Tochter hatten eifrig und stillvergnügt miteinander Geschichte, Französisch, Latein, Griechisch und Italienisch betrieben und Theaterstücke, Abhandlungen und Gedichte gelesen. Einmal in der Woche kam für die beiden jüngsten Töchter ein Musiklehrer ins Haus, da nach Mr. Wards Meinung für ein Frauenzimmer, das sich einen Ehemann angeln wollte, musikalische Fertigkeiten unerläßlich waren.
Allen aber war klar, daß es so nicht mehr lange gehen konnte, denn Mrs. Ward wurde von Tag zu Tag schwächer. Lady Ursula, mit der Mr. Ward sich in dieser Sache beriet, plädierte mit Nachdruck dafür, Hatty aus dem Elternhaus fort zu einer anderen Familie zu schicken. Agnes unterstützte den Plan nach Kräften. Sie hatte die Jüngere noch nie gemocht und nannte tausend gute Gründe für ihre Entfernung aus Bythorn Lodge.
»Der Lärm, den sie macht, ist zuviel für meine arme Mutter. Sie bekommt nicht die Ausbildung, die sie braucht, denn da sie die Jüngste von uns ist, hat sie nicht viel zu erwarten und muß sich darauf einstellen, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, sehr wahrscheinlich als Gouvernante. Ich habe den ganzen Haushalt am Hals und Mamas Pflege obendrein, da bleibt mir keine Zeit, mich um Hatty zu kümmern. Man sieht ja, wie wild und unbedacht sie geworden ist. Das Leben in einer anderen Familie wird sie lehren, sich anständig zu betragen und Älteren den nötigen Respekt zu erweisen.«
Die andere Familie war die des Philip Ward, seines Zeichens Rechtsanwalt in Portsmouth.
Henry Ward hatte zwei weitere Gründe, den Plan zu favorisieren, die er seiner Familie nicht verriet. Vor fünfzehn Jahren hatte er, als es um seine Vermögensverhältnisse noch besser bestellt war und Philip Ward am Anfang seiner Anwaltslaufbahn stand, seinem Bruder 500 Pfund geliehen. Inzwischen hatten sich die Verhältnisse umgekehrt, und Mr. Ward konnte mit Fug und Recht annehmen, daß sein Bruder ihm diese Summe ohne weiteres hätte zurückzahlen können, aber aus dem einen oder anderen Grund geschah das nie. »Muß warten, bis der Mietzins für meine Häuser eingegangen ist … Habe sehr säumige Zahler unter meinen Mandanten … unerhört hohe Kosten für das Haus und nach der Geburt der Zwillinge hohe Arztrechnungen für Mrs. Pauline Ward.« Könnte er Hatty bei ihren Verwandten in Portsmouth unterbringen, kalkulierte Henry Ward, ließen sich, wenn er den Betrag für Kost, Logis und Nadelgeld mit seinem Guthaben verrechnete, im Lauf von fünf Jahren ebenjene 500 Pfund einsparen. Und war es nicht außerdem zumindest denkbar, daß die Kleine, auch wenn ihr liebender Vater im Augenblick keinerlei Reize an ihr zu entdecken vermochte, im Lauf der Zeit und durch das ständige Beisammensein mit den Vettern die Zuneigung eines der Jungen gewann und dadurch Bythorn Lodge wieder in seine, Henry Wards, Hände gelangte? Zur Zeit erschien das zwar sehr unwahrscheinlich, aber Zeichen und Wunder geschehen bekanntlich immer wieder, und schaden konnte es zumindest nicht, sie in die Familie ihres Onkels zu geben. So gingen denn Briefe in dieser Sache hin und her, und man wurde sich einig.
Ein halbes Jahr später betrat Mr. Ward eines schönen Vormittags das Zimmer seiner Frau, wo sie und Hatty friedlich beisammensaßen und »Was ihr wollt« lasen, und verkündete: »Es ist alles abgemacht. Am Donnerstag verläßt Harriet das Haus und zieht zu meinem Bruder und seiner Familie nach Portsmouth. Es trifft sich gut, daß Mr. und Mrs. Laxton, Verwandte des Pfarrers, an dem Tag mit der Postkutsche nach Portsmouth fahren und bereit sind, unsere Tochter in ihre Obhut zu nehmen.«
Zwei leichenblasse Gesichter wandten sich ihm zu, zwei Münder öffneten sich weit – dann fiel Mrs. Ward in Ohnmacht. Da das in den letzten Wochen schon öfter geschehen war, machte man nicht allzuviel Aufhebens darum.
»Wann – wann werde ich von meinem Besuch bei Onkel Philip zurückkommen?« flüsterte Hatty mit zitternden Lippen, nachdem ihre Mutter mit Hilfe von Riechsalz und aromatischem Essig wiederbelebt worden war.
»Frühestens dann, wenn du erwachsen bist, Kind«, war die väterliche Antwort, »wenn überhaupt. Doch das braucht dich nicht zu bekümmern, du bist hier wie dort gleich gut aufgehoben. Und in Portsmouth leisten dir deine Vettern Gesellschaft.«
Die Familie Ward hatte drei Söhne, Sydney, Thomas und Edward, sowie zwei Töchter, die Zwillinge Eliza und Sophy, die sehr viel jünger waren.
Die Frage, ob ihre Mutter mit diesem Plan einverstanden sei, kam Hatty nicht über die Lippen. Sie merkte, daß es Mrs. Ward in ihrem geschwächten Zustand zu sehr angegriffen hätte, auch nur darüber zu sprechen. Außerdem nützte ja alles Reden nichts. Mr. Ward, Lady Ursula und Agnes hatten die Sache fest im Griff. Widerstand war zwecklos. Mit einer für ihr Alter erstaunlichen Reife akzeptierte Hatty die Entscheidung ohne Protest.
»Falls es Mama schlechtergehen sollte, Papa, falls sie den Wunsch äußern sollte, mich zu sehen – wirst du dann nach mir schicken? Wirst du mir dann erlauben, nach Hause zu kommen?« fragte sie flehend und mit Tränen in den Augen.
»Ich möchte wohl wissen, was wir von dir hätten, wenn der Zustand meiner Mutter sich verschlechtern sollte«, empörte Agnes sich lautstark. »Lange genug hat sie sich mit dir geplagt, da ist es gewiß eine Erholung für sie, wenn sie sich nicht mehr mit deinem Unterricht zu belasten braucht, ja ihr Zustand dürfte sich merklich bessern, wenn du erst aus dem Haus bist. Und bilde dir nur nicht ein, daß Papa es sich leisten könnte, das teure Geld für die Postkutsche aufzubringen, damit du unter irgendeinem fadenscheinigen Vorwand heimkommen kannst. Ist es nicht so, Vater?«
»Ja, natürlich«, gab Henry Ward ungehalten zurück. »Stell keine törichten Fragen, Kind.«
»Darf ich Simcox – darf ich meinen Kater mitnehmen?« erkundigte Hatty sich schüchtern. Doch gehörte auch das wohl in die Kategorie der törichten Fragen, denn ihr Vater verließ ohne ein weiteres Wort das Zimmer, und Agnes sagte scharf: »Ganz gewiß nicht. Bei deinen Vettern kämst du mit einem Haustier schön an! Außerdem kann man Katzen nicht umsiedeln, sie kommen immer wieder in ihr ursprüngliches Heim zurück. Und jetzt fängst du am besten gleich an zu packen. Du kannst Tante Polly ein Glas von meinen eingelegten Damaszenerpflaumen mitnehmen. Ich habe noch ein paar Gläser vom letzten Jahr übrig, auf denen nur ganz wenig Schimmel ist. Bestimmt hat sie nichts, was nur halb so gut ist. Fanny und Maria kannst du einen Abschiedsbrief schreiben, wer weiß, wann du die wiedersiehst. Mr. Challis fährt in Kürze nach Bath und hat versprochen, Briefe an Sir Thomas und deine Schwester mitzunehmen.«
Hatty schlich sich auf ihr Zimmer, aber sie begann nicht gleich mit dem Packen. Regungslos saß sie auf dem Fußboden, den Kopf ans Bett gelehnt.
Worte der Trauer kamen ihr in den Sinn, aber Hatty schob sie zur Seite. Nicht jetzt. Später einmal.
2
Bythorn Lodge, das Haus, in dem Henry Ward mit seiner Familie wohnte, war nicht sehr groß, konnte aber durchaus als angenehmer Wohnsitz für einen Gentleman gelten. Es stand in einiger Entfernung vom Dorf Bythorn auf einem recht beachtlichen Grundstück mit Rasenflächen, Blumen und Büschen, einer Kutschenauffahrt und einem schönen Rundblick auf Wälder und Wiesen.
Das Heim seines Bruders Philip Ward in der Lombard Street von Portsmouth war als Stadtresidenz auch durchaus ansehnlich; es hatte zwei gerundete Erker rechts und links vom Portikus und war durch mächtige weiße Pfähle und Ketten gegen die Straße hin abgegrenzt. Drei breite Steinstufen führten zu einer stattlichen Haustür. Zu dem Besitz gehörten ein ziemlich großer Garten hinter dem Haus, der an einen aufgelassenen Friedhof angrenzte, sowie Stallungen, Nebengebäude und ein aufwendiges, aber recht baufälliges Gewächshaus.
Mr. Ward hatte seinen Wohnsitz vor einigen Jahren von London nach Portsmouth verlegt. Vorgeblich fand der Umzug im Interesse der Gesundheit seiner Frau statt, welche die Geburt der Zwillinge recht mitgenommen hatte. Mr. Wards Kollegen vertraten damals die Ansicht, er habe leichtfertig auf zahlreiche bedeutende Geschäftsverbindungen verzichtet. Da aber ein sehr wichtiger Mandant, der Herzog von Dungeness, und dessen ältester Sohn, Lord Camber, beträchtlichen Landbesitz in Hampshire hatten, lag es nah, daß die beiden jetzt Mr. Ward zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit ihren Ländereien übertrugen. Außerdem gewann er nun auch Mandanten unter den Verwandten und Bekannten des Herzogs, so daß der neue Wohnsitz seine Geschäfte begünstigte. In der frischen Seeluft besserte sich auch Mrs. Wards Gesundheitszustand, und die Söhne, die sich schon bald auf den Befestigungswällen und am Hafen vergnügten, fühlten sich in Portsmouth viel wohler als in High Holborn.
Für Hatty allerdings stellte sich der Abschied von den stillen grünen Wäldern und Wiesen in Huntingdonshire wesentlich anders dar. Die Lombard Street war eine belebte Durchgangsstraße. Statt ländlicher Stille hatte Hatty nun das ständige Rattern und Klappern von Lastkarren, Pferden, Rollwagen und Kutschen im Ohr, die über die Pflastersteine holperten, den Ruf der Marktschreier und Nachtwächter, das Geläut der Glocken aus der näheren und ferneren Umgebung und von weiter her das Kreischen der Möwen und das scharfe Knattern von Schießübungen. Obgleich das Haus für einen Wohnsitz in der Stadt recht geräumig war, empfand Hatty es als fast unerträglich eng und laut. Nachts ließen der Verkehrslärm und der Ruf der Wache sie nicht schlafen, tagsüber rannten die Jungen, wenn sie nicht gerade Unterricht hatten, ständig die Treppen aller vier Stockwerke hinauf und hinunter, knallten die Türen und verständigten sich lauthals von ganz oben nach ganz unten. (Mr. Ward, der diesem Treiben sehr schnell ein Ende gemacht hätte, war fast den ganzen Tag in seiner Kanzlei.) Die jüngsten Familienmitglieder, die Zwillinge Eliza und Sophy, waren kränklich und weinerlich, so daß ihre Stimmen Tag und Nacht klagend durchs Haus schallten. Daß eine fröhlich-füllige rotgesichtige Frau wie Tante Polly zwei so trübsinnige Kinder in die Welt gesetzt hatte, war Hatty unbegreiflich.
»Es war dieser trostlos verregnete Sommer im Jahre achtundsiebzig«, erzählte Mrs. Philip Ward munter, während sie zusammensaßen und Hemden säumten. »Oder war es neunundsiebzig? Lieber Himmel, ich weiß es noch wie heute: In ganz London waren keine anständigen Erdbeeren aufzutreiben, obgleich Mr. Ward, dein Onkel Philip, bis nach Blackheath und Barnet schickte, denn du kannst dir nicht vorstellen, Kind, wie es mich nach Erdbeeren gelüstet, wenn ich guter Hoffnung bin. Eigentlich dürfte ich darüber wohl gar nicht mit dir sprechen, aber ich habe gleich gemerkt, daß du ein aufgewecktes, verständiges kleines Ding bist, ganz anders als manche meiner früheren Schülerinnen. Wenn ich nur an Lady Susan und Lady Louisa Wisbech denke … Zwei naseweise Frauenzimmer waren das, den lieben langen Tag nichts als Flausen im Kopf. Bös gemeint war es aber nie, es sind liebe Mädchen, die sich sehr gut verheiratet haben. Was die Fowldes, ihre Verwandten, angeht – aber darüber schweige ich lieber. Dir, liebes Kind, sieht man an, daß du reif für dein Alter bist, das kommt wohl auch daher, daß du all die Jahre der Herzenstrost deiner lieben Mama warst. Nicht weinen, Kind. Für uns Frauenzimmer ist das Leben eine endlose Kette schwerer Prüfungen, und je früher wir uns damit abfinden, desto besser kommen wir damit zurecht. Du liebe Güte, was habe ich mit den Zwillingen nicht schon erlebt! Unsere Freunde staunen alle, daß ich sie bis heute durchgebracht habe, und ohne Burnaby und ihre Salben und Tränke hätte ich es wohl auch nicht geschafft. Wenn es dir gelänge, meine liebe Hatty, etwas gegen die Erregbarkeit der beiden Kleinen und ihr freudloses Wesen zu tun, wäre ich dir auf ewig dankbar.«
»Versuchen will ich es natürlich. Wenn nur Burnaby –«
»Ja, sicher, mit Burnaby ist kein leichtes Auskommen, und man darf sie nicht vor den Kopf stoßen, denn ich bin, was die Zwillinge angeht, ganz und gar auf sie angewiesen. Du mußt sehr behutsam vorgehen, Hatty, damit sie sich nicht kränkt. Aber das gelingt dir schon, denn ist nicht deine Schwester Agnes von der gleichen Art? Immer mit dem Kopf durch die Wand und gleich beleidigt, wenn sie meint, daß man ihr die Stellung streitig machen will?«
»Ja, das stimmt. Ich werde versuchen, mich mit den Zwillingen anzufreunden, vorausgesetzt, Burnaby läßt mich überhaupt ins Kinderzimmer.«
»Tu das, Hatty, denn ich sage dir ganz offen, daß mir die Zukunft der beiden große Sorgen bereitet. Ich schäme mich fast, es zuzugeben, aber ich komme mit ihnen partout nicht zurecht. Wie leicht hatte ich es dagegen mit meinen früheren Schülerinnen! So liebe sonnige Wesen! Kurzum, manchmal ist es mit den Zwillingen fast nicht zum Aushalten. Bin ich länger als zehn Minuten mit ihnen zusammen, bekomme ich so heftiges Sodbrennen und Herzrasen, von Zittern und Hitzewallungen gar nicht zu reden, daß dein Onkel mir inzwischen ausdrücklich verboten hat, mich dieser Anstrengung auszusetzen. Ich soll die Kleinen ganz Burnaby überlassen, meint er. Es ist schon eigentümlich: Die lieben Jungen haben mich nie so mitgenommen, und wenn sie noch so wilde Taugenichtse waren. Es ist schon gut so, liebes Kind, daß du jetzt bei uns bist. Dein Onkel und dein Vater sind sich so spinnefeind, wie Brüder es nur sein können, Philip hält Henry für einen aufgeblasenen Wicht und hätte ihm die fünfhundert Pfund nie freiwillig zurückgegeben, auch wenn er es heute mit Leichtigkeit tun könnte, denn seine Kanzlei blüht und gedeiht, und seine Mandantenliste liest sich schon wie ein halbes Adelsregister, während dein unglücklicher Pa nach allem, was man so hört, kaum noch einen Penny in der Tasche hat. Doch das nur nebenbei. Für dich ist es besser, wenn du die letzten Monate deiner lieben Mutter nicht miterlebst. Auch wenn du es jetzt vielleicht nicht wahrhaben willst – die schmerzlichen Eindrücke würden dich ein Leben lang verfolgen. Und da nun die Familie unter der Fuchtel deiner Schwester Agnes und ihrer Busenfreundin Lady Ursula lebt – zwei Zankteufel, wie man sie sich schlimmer nicht vorstellen kann – und Lady Ursula sich überdies in den Kopf gesetzt hat, sich deinen Papa zu krallen, sobald das Trauerjahr vorüber ist, wenn man das, was Base Letty Pentecost erzählt, glauben darf –«
Hatty überlief es eiskalt. »Was soll das heißen? Mama wird doch nicht sterben?«
»Ach, Kind, wozu die Augen vor etwas verschließen, was doch mit Händen zu greifen ist? Ein Wunder, daß die Ärmste es überhaupt so lange gemacht hat. Und was Lady Ursula angeht, die früher einmal die beste Freundin deiner lieben Mama war, wissen wir doch alle, daß dein Papa nichts unversucht lassen würde, damit Bythorn Lodge nicht an meinen armen Sydney fällt – dabei ist der Junge charmant und gescheit wie selten einer, es würde mich nicht wundern, wenn er es noch mal bis zum Lordkanzler brächte –, und da Lady Ursula ganz wild auf deinen Vater und außerdem schon seit mindestens fünf Jahren überständig ist, gehe ich jede Wette ein, daß sie die Bande knüpfen werden, sobald es der Anstand erlaubt. Dein Onkel ist fuchsteufelswild, und könnte er ihnen Knüppel zwischen die Beine werfen, täte er’s gewiß, aber ihm ist noch nichts eingefallen. Ist nicht dein Vater bei der Hochzeit deiner Schwester Maria um Lady Ursula herumscharwenzelt, daß es schon nicht mehr schön war? Base Letty hat mir erzählt, daß die Aufmerksamkeiten, die er ihr erwiesen hat, allen aufgefallen sind, zumal dein Pa sonst mit Komplimenten und Kratzfüßen den Damen gegenüber nicht eben freigebig ist. Ob ihm allerdings diese Verbindung etwas nützt, ist eine ganz andere Frage. Meine Sonntagshaube würde ich darauf verwetten, daß die beiden allenfalls noch ein Mädchen zustande bringen. Die Fowldes sind alle überzüchtet – fünf magere Töchter hat die arme Lady Elstow, Lady Ursulas Mutter, zur Welt gebracht, von denen eine – obgleich ich das vielleicht gar nicht sagen dürfte – wohl nicht ganz richtig im Kopf ist. Kein Wunder, wenn man in einem modrigen Verlies wie Underwood Priors aufwächst.«
Tante Polly war etliche Jahre Gouvernante und vielgeliebte Vertraute der Töchter des Herzogs von Dungeness gewesen, deren Mutter früh verstorben war. In dieser Stellung hatte sie natürlich auch vieles über deren Verwandtschaft, die Familie von Lord Elstow, erfahren, und als Philip Ward in Geschäften des Herzogs auf Bythorn Chase gewesen war, hatte er dort seine Polly kennengelernt, umworben und gewonnen.
Hatty machte große Augen. Nur mit Mühe gelang es ihr, diese Flut von Mitteilungen aufzunehmen. Es sollte Stunden, Tage und Wochen dauern, bis sie das, was sie von der Tante erfahren hatte, auch wirklich begriff.
»Gerade auch für meine Jungen freue ich mich, daß du zu uns gekommen bist. Dein Onkel hat gemeint, daß sich womöglich einer von ihnen in dich verliebt, daß es zu Tändeleien, wenn nicht gar zu Rivalitäten und Raufhändeln kommen könnte. Larifari, habe ich gesagt, da besteht nicht die mindeste Gefahr, sie wird meinen lieben Schlingeln wie eine Schwester sein und sie durch ihr Beispiel bessere Manieren und ein ruhiges, vornehmes Auftreten lehren. – Da ist ja dein Onkel! Endlich haben die Geschäfte ihn freigegeben.«
Philip Ward war ein hagerer Mann mit fahlem Stubenhockergesicht, da ihm die Kanzlei kaum Zeit für Spaziergänge an der frischen Luft ließ. Abends brachte er meist dicke Aktenstapel mit heim und zog sich damit in ein Zimmer im ersten Stock zurück, das er mit einem Schreibtisch, Regalen voll juristischer Werke und vielen Schränken möbliert hatte, in denen er wichtige Akten und Urkunden seiner vornehmen Mandanten verwahrte. Mit seinem schroffen, wortkargen Wesen unterschied er sich nicht wesentlich von seinem rotgesichtigen, jagdliebenden Bruder. Hatty, die sich in seinem Beisein immer ein wenig unbehaglich fühlte, da sie das Gefühl hatte, daß er sie nicht gern sah, erhob sich hastig, doch er hielt sie mit einer Frage zurück.
»Ähem … Hast du Nachrichten von der unlängst verheirateten Lady Bertram? Sie ist besser weggekommen als erwartet, sehr viel besser sogar. Zehntausend Pfund im Jahr! Ich hätte ihr nicht mal zwei zugetraut. Für ihre Schwestern ist’s ein Glücksfall, sie werden ihr vielleicht noch mal dankbar sein.«
»Nein«, stammelte Hatty, »das heißt, an mich hat Maria nicht geschrieben, aber das war wohl auch nicht zu erwarten. Ich nehme an, daß Mama und Papa einen Brief von ihr erhalten haben, aber – aber ich weiß davon nichts.«
»Na gut, Kind. Lauf jetzt.«
Nachdem die Tante ihr mit einem freundlichen Blick ebenfalls bedeutet hatte, sie möge gehen, verließ Hatty schleunigst das Zimmer. Sie machte einen Bogen um die Schulstube, wo sich die Vettern wie immer nach dem Unterricht lautstark vergnügten, und stieg in ihr Dachstübchen hinauf. Dort hatte gerade ein Stubenmädchen angefangen zu putzen und murrte, durch die neue Hausgenossin sei sie mit all ihren Obliegenheiten in Rückstand geraten. Ein wenig unschlüssig schlug Hatty den Weg zum sogenannten Bücherzimmer ein, der Studierstube des Onkels, der noch im Salon bei seiner Frau saß und ihr über die Ereignisse des vergangenen Tages Bericht erstattete. Sie war nicht sehr glücklich, dort ihren Vetter Ned vorzufinden, den jüngsten der drei Söhne des Hauses, der vor der gepolsterten Fensterbank auf und ab marschierte und vor sich hin murmelte:
A, ab, absque, coram, de
Palam, clam, cum, ex und e
Tenus sine …
»Pro, in, prae«, half Hatty nach.
Verdattert sah Ned sie an.
Sydney war zu jener Zeit sechzehn, Tom fünfzehn, Edward, kurz Ned genannt, elf, die Zwillinge Sophy und Eliza erst vier. Hattys Vater hatte häufig spitze Bemerkungen darüber gemacht, daß sein Bruder zu knickerig sei, die älteren Jungen nach Eton oder Westminster ins Internat zu schikken, wobei er zu vergessen schien, daß auch er für die Schulbildung seiner Töchter nicht eben tief in die Tasche gegriffen hatte. Philip Ward aber erklärte, die Jungen könnten, da sie in einer Privatschule nur lernen würden, das Geld zum Fenster hinauszuwerfen und sich Modegecken und Maulhelden als Freunde zuzulegen, ebensogut auf eine anständige öffentliche Schule in Portsmouth gehen und notfalls später an einer Universität noch den letzten Schliff erwerben. Sydney sollte die Kanzlei seines Vaters übernehmen, Tom und Ned waren für eine Laufbahn im Heer und in der Marine bestimmt.
Tom und Ned hatten heftig gemurrt, weil man ihnen zumutete, Latein zu lernen.
»Für Syd mag das gut und schön sein, der wird mal Advokatenlatein brauchen, aber was nützt einem beim Militär eine mausetote Sprache?« sagten sie. Tom, ein dicker Junge von schwerfälligem Verstand, hatte mit dem Lernen überhaupt große Mühe. Ned war zwar aufgeweckter, nahm sich aber seinen nächstälteren Bruder als Beispiel und plapperte ihm alles nach.
Hatty hatte bisher keinen günstigen Eindruck von ihren Vettern gewonnen. Die beiden älteren waren laut und ruppig und den Umgang mit Mädchen nicht gewohnt. Für all das, was ihr am Herzen lag, hatten sie nicht das mindeste Interesse. Ned unterschied sich zumindest äußerlich von seinen älteren Brüdern, er war eher klein und gedrungen, hatte dunkelbraunes Haar und strahlend braune Augen. Er war jünger als Hatty, aber ein Stück größer, und sie war zu der Überzeugung gekommen, daß er dank seiner natürlichen Begabung Tom im Unterricht bald überholen würde.
»Du kannst Latein, Base Hatty?« fragte er jetzt ganz fassungslos. »Wie kommt denn das?«
»Meine Mutter hat es mir beigebracht, ich lerne es schon seit Jahren.«
»Aber warum? Was will ein Mädchen damit anfangen? Und wieso konnte Tante Isabel Latein?«
»Ihr Vater – also mein Großvater – war Bischof. Er fand, daß Mädchen imstande sein sollten, die lateinische Bibel zu lesen.«
Ned fielen fast die Augen aus dem Kopf. »Oha! Bloß gut, daß er nicht mein Großvater war. Was hat deine Mama dir denn noch beigebracht?«
»Griechische Texte und die unregelmäßigen Verben und Woods Algebra, aber damit tue ich mich schwer.«
»Und ich erst!« gestand Ned verbittert. »Nur geht’s auf See eben nicht ohne Algebra, die brauchst du, um Positionen zu bestimmen und dergleichen. Am meisten aber ist mir die Geschichte zuwider. Was scheren mich all die Könige und Königinnen und Päpste?«
»Dabei ist Geschichte so aufregend«, wandte Hatty ein. »Denk nur an die vielen großen Helden: Richard Löwenherz und Roland und Karl der Große und Hereward und Bonnie Prince Charlie, der romantische Stuart-Prinz …«
Ned kriegte den Mund nicht mehr zu. Er starrte seine Base an, als zöge sie ein Kaninchen nach dem anderen aus einem Zylinder.
»Die kennst du alle?«
»Aber ja. Und die Griechen, Sparta, die Thermopylen, Odysseus … und Marathon und die Schlacht am Regillus … und Robin Hood … Früher habe ich manchmal so getan, als wenn ich Robin Hood wäre …« Sie unterbrach sich errötend und setzte verlegen hinzu: »Aber ich hab mir nie einen richtigen Bogen machen können, für den braucht man nämlich Eibenholz, und Eiben gab es im Garten von Bythorn Lodge nicht.«
»Ich weiß, wo es Eiben gibt, Base Hatty«, sagte Ned mit funkelnden Augen.
Hattys Stellung im Haus ihres Onkels Philip Ward sollte immer eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Handelsposten in einem von feindlich gesinnten Wilden bewohnten Territorium behalten. Einige der Bewohner – ihre Tante, ihr Vetter Ned – brachten ihr Wohlwollen entgegen, außerdem hatte sie Waren zum Tausch anzubieten, die für Kenner ein wertvolles Gut darstellten, doch blieb ihre Position ungefestigt und war nicht selten akut gefährdet.
Der Hauslehrer der Jungen, Mr. Haxworth, ein streng auf Disziplin bedachter, verdrießlicher Mensch, beäugte Hatty argwöhnisch und zeigte sich hellauf empört, als er erfuhr, daß er nun auch diese kleine, belanglose und unscheinbare Weibsperson unterrichten sollte.
Nach ein paar Wochen mußte er allerdings zugeben, daß die Anwesenheit der Base beim Unterricht sich auf die Jungen nicht ungünstig auswirkte – eher im Gegenteil. Hattys Wißbegier, ihre wache Aufmerksamkeit, der Fleiß, mit dem sie ihre Hausaufgaben erledigte, führten dazu, daß sich die Leistungen ihrer Vettern ganz erstaunlich verbesserten. Nur Tom beklagte sich über die höheren Anforderungen und die damit verbundene Mehrarbeit.
»Früher«, maulte er, »konnte ich Hackys Stunden halb verschlafen oder in Ruhe Kreisel schnitzen. Jetzt wird pausenlos geredet, und es hagelt Fragen. Man muß ständig hellwach sein, sonst brummt er einem Hausaufgaben noch und noch auf, und man muß das verwünschteste Zeugs aus dem Kopf hersagen.« Hatty, fanden die Jungen, hatte eine geradezu unfaire Befähigung zum Auswendiglernen, vermutlich dank der vielen Gedichte, die sie in ihrem Gedächtnis gespeichert hatte, um ihre Mutter damit zu erfreuen.
Nach einigen Wochen und Monaten konnte Mr. Haxworth nicht umhin, Mr. Wards Nichte – wenn auch unter Vorbehalt – zu akzeptieren.
Unerschütterlich in ihrer Feindseligkeit hingegen blieb Burnaby, die Kinderfrau der Zwillinge Eliza und Sophy. Die kleinen Mädchen waren, wie Hatty schon von ihrer Tante wußte, von klein auf kränklich und apathisch. Sie waren zu unzufriedenen, selbstbezogenen Menschlein herangewachsen, und diese Wesenszüge wurden durch die ständige Anwesenheit von Burnaby noch verstärkt, einer zugeknöpften, wortkargen Person mit harten Zügen, die begriffen hatte, daß sie durch ihr tyrannisches Regiment erhebliche Macht im Haus besaß. Nach der schweren Geburt hatte Mrs. Ward ihr die Kinder zunächst notgedrungen überlassen müssen, später tat sie es freiwillig, denn nach eigenem Eingeständnis kam sie mit den drei temperamentvollen Söhnen weit besser zurecht als mit den ständig nörgelnden und quäkenden kleinen Mädchen.
Nachdem Hatty ins Haus gekommen war, sagte Mrs. Ward zu der Pflegerin: »Ich weiß wohl, wieviel Arbeit du mit den armen kranken Kindern hast, Burnaby, und deshalb soll Miss Hatty dich ein wenig entlasten, den beiden Gesellschaft leisten und sie hüten. Miss Hatty hat lange ihre Mutter, meine arme Schwägerin, gepflegt und weiß, wie schwierig Kranke sein können. Sobald du sie eingewiesen hast, kannst du dir endlich hin und wieder ein paar Mußestunden gönnen.«
Burnaby stimmte zwar der Form halber zu, nahm sich aber fest vor, ihre beiden freudlosen Pfleglinge um keinen Preis einer naseweisen Neuen zu überlassen, die noch dazu gerade erst dreizehn Jahre alt geworden war.
»Danke, Miss, aber im Augenblick brauche ich Sie nicht«, lautete unweigerlich ihre Antwort, wenn Hatty an die Tür des Kinderzimmers klopfte, um einen Blick auf die beiden Jammergestalten zu tun, die – in ihren Hochstühlen festgezurrt – entweder an Korallenbeißringen nuckelten oder kläglich wimmerten. Mit ihren vier Jahren hatten sie vermutlich schon mehr Medizin geschluckt als so mancher Erwachsene in seinem ganzen Leben.
Hatty mochte keine Zwietracht zwischen Tante Polly und jener Frau säen, die ihr Onkel zur Pflege der beklagenswerten Basen eingestellt hatte, aber sie wurde den Eindruck nicht los, daß Burnaby absichtlich alles unterließ, was dazu angetan war, die unglückseligen Zwillinge weiterzubringen.
Wenn sich nicht bald jemand um sie kümmert, dachte sie mitleidig, sterben sie eines Tages aus schierer Verzweiflung.
Hatty schrieb ihrer Mutter häufig, bekam aber nur selten eine Antwort, wahrscheinlich, wie sie sich sagte, weil Mrs. Ward immer schwächer wurde. In einem der wenigen Briefe, die Mrs. Ward mit zittriger Schrift an die Tochter richtete, hieß es:
Liebste Hatty!
Wie habe ich mich gefreut, von Dir zu hören. Ich glaube fest daran, daß Du diesen Kindern helfen kannst. Nur wenn wir anderen helfen, kommen wir selbst voran. Versuch es mit SSP. Ich sehne mich nach Dir mit jedem Atemzug, von denen mir vielleicht nicht mehr viele vergönnt sind. In einer besseren Welt sehen wir uns wieder.
Deine Dich liebende M.
Wochenlang rätselte Hatty unter Tränen an diesem Brief herum. Gewiß, sie hätte bei Mrs. Ward anfragen können, was SSP bedeutete, aber ihre Mutter war so krank und hinfällig, daß sie sich fast herzlos schalt, sie wegen so einer Kleinigkeit zu belästigen.
Statt dessen fragte sie ihren Vetter Ned um Rat.
Zum Dank für ihre unauffällig-taktvolle Unterstützung bei der lateinischen Grammatik hatte er seine Cousine in ein Geheimnis eingeweiht, das er nicht einmal den älteren Brüdern anvertraut hatte. Zu dem Grundstück der Wards gehörten Stallungen, Nebengebäude, ein Blumengarten, Gemüsebeete und ein ummauerter Obstgarten. Von dem Blumengarten hielten die beiden Älteren nicht viel, weil man dort weder Bilboquet noch Schlagball spielen konnte. In ihrer Freizeit trieben sie sich meist am Strand, auf den Befestigungswällen oder am Hafen herum. Ned dagegen arbeitete gern im Garten, er hatte ein eigenes Beet, auf dem er Kresse, Rettiche und Mangold zog, und wenn seine Brüder sich auf den Weg zum Hafen oder zum Strand machten, erklärte er oft, er wolle lieber im Garten bleiben.
»Du bist mir schon ein komischer Kauz«, sagte seine Mutter, dessen Liebling er war. »Aber was wahr ist, muß wahr bleiben: Deine Rettiche sind doppelt so groß wie die vom Markt.«
Doch Ned hatte noch einen anderen Ort, an den er sich zurückziehen konnte und von dem seine Familie nichts ahnte.
»Komm, Hatty, ich zeig dir was«, sagte er an einem Samstagnachmittag, als er sicher sein konnte, daß die Brüder aus dem Haus waren.
Er führte seine Cousine quer durch den Blumengarten hinter dem Haus und durch das Törchen in der Mauer in den Küchen- und Obstgarten. Hinter den Obstbäumen sah man eine weitere Mauer, an der Spalierobst – Pflaumen und Birnen – stand. Die Bäume waren ziemlich ungepflegt, denn der Garten machte mehr Mühe, als Philip Ward zu bezahlen bereit war, und ihm lag vor allem an frischem Gemüse für die Mahlzeiten der Familie. Mehr Arbeit konnte Deakin, der einzige Gärtner, nicht bewältigen. Unbeschnittene Johannis- und Stachelbeerbüsche waren am Ende des Grundstücks zu einem Dschungel zusammengewachsen und umgaben einen großen Wasserbehälter aus Blei, der auf Stelzen unter den tief herabhängenden Zweigen eines mächtigen Birnbaums stand.
Ned führte sie über einen schmalen Pfad zwischen den Johannisbeerbüschen zu einem von Efeu überrankten Türchen in der Mauer. »Das ist mein Geheimzugang«, sagte Ned. Mit einiger Mühe – denn die Scharniere waren rostig, und der Boden war knöcheltief mit dürrem Laub und Zweigen bedeckt – stieß er die Tür einen Spaltbreit auf. »Es langt gerade, um sich durchzuzwängen. Gut, daß du nicht molliger bist, Base Hatty. Tom würde kläglich steckenbleiben.«
Auf der anderen Seite der Mauer lag ein kleiner, in Dreiecksform angelegter aufgelassener Friedhof. Sechs hohe Eiben und eine dicke Linde warfen ihre Schatten auf die umgestürzten, windschiefen, ungepflegten, mit Flechten bedeckten Grabsteine. Hüfthoch wucherten rechts und links der Schneisen, die Ned geschlagen hatte, Gras und Nesseln.
Hatty sah sich um. »Was für ein schöner, verschwiegener Ort«, sagte sie leise. Für kurze Zeit vergaß sie Kummer und Heimweh. »Es ist wie ein kleines Königreich, das ganz allein dir gehört.«
»Das will ich meinen«, erwiderte Ned stolz. »Ich zeig dir noch was.« Er führte sie zu seinem Baumhaus, einer aus morschen Brettern und Balken zusammengefügten Plattform, die in die Gabelung der Linde eingepaßt und über eine Strickleiter zu erreichen war.
Hatty war tief beeindruckt von seinem Reich, und daß er das Versteck vor seinen Brüdern geheimgehalten hatte, imponierte ihr noch mehr.
»Seit wann kommst du schon hierher, Ned?«
»Weiß ich nicht. Ganz lange jedenfalls«, gab er unbestimmt zurück.
Selbst der Verkehrslärm der Stadt schien weit weg.
Als sie dann hoch oben in dem Baumhaus saßen, wo ihnen der lieblich süße Duft der hellgrünen Lindenblüten in die Nase stieg, stellte Hatty nach langem Nachdenken zögernd eine Frage. »Was meinst du, Ned – ob Sterben weh tut?«
»Nein«, erklärte er sehr bestimmt. »Kein bißchen. Es ist, als wenn du einschläfst. Ich hatte mal einen Spaniel, Rust hieß er, der war schon alt und krank und ist letztes Jahr gestorben. Ich war bei ihm. Es ist im Schlaf geschehen. Er hat einfach aufgehört zu atmen.«
Danach saßen sie längere Zeit friedlich schweigend beieinander. Dann sagte Hatty: »Ich komme mit einer Stelle in Mamas letztem Brief nicht zurecht, Ned.«
Sie erzählte ihm, daß sie wegen der Zwillinge angefragt und ihre Mutter ihr geraten hatte, es mit SSP zu versuchen. »Was mag das heißen?«
»Bestimmt meint sie Schere-Stein-Papier«, kam es wie aus der Pistole geschossen.
Hatty fiel es wie Schuppen von den Augen. »Ja, natürlich. Wie dumm von mir, daß ich darauf nicht selber gekommen bin. Danke, Ned, vielen Dank. Sobald Burnaby, dieser Besen, mich mal ins Kinderzimmer läßt, probiere ich das aus.«
»Daß du dir so viel Mühe gibst, kann ich gar nicht verstehen«, sagte Ned. »Mit den Bälgern ist ja doch nichts anzufangen.«
»Du wärst auch nicht anders geworden«, wandte Hatty ein, »wenn sich kein Mensch um dich gekümmert hätte.«
»Mag sein. Höre, Hatty, von diesem Versteck darfst du keiner Menschenseele etwas verraten.«
»Natürlich nicht, Ned«, beteuerte Hatty. »Du kannst dich auf mich verlassen. Wenn es kein Friedhof wäre, könnten wir uns, wenn wir groß sind, hier ein kleines Haus bauen, nur für uns beide. Das wäre mein größter Wunsch: Ein Haus, das ganz allein mir gehört.«
»Wir müssen gehen«, sagte Ned. »Ich bleibe nie allzu lange aus, weil sich die anderen sonst vielleicht fragen, wo ich abgeblieben bin.«
Von jenem Tag an war Hatty als Gast im Lindenhaus stets willkommen.
In der folgenden Woche betrat Hatty, nachdem sie in Erfahrung gebracht hatte, an welchem Tag Burnaby frei hatte, entschlossen das Kinderzimmer, in dem Sue, das zweite Stubenmädchen, einen zerrissenen Vorhang flickte, ohne sich um die Zwillinge zu kümmern, die wie stets in ihren Hochstühlchen gefangen saßen und herumjammerten, ohne recht zu wissen warum.
»Ich spiele mal ein bißchen mit ihnen, Sue, vielleicht heitert sie das auf.«
»Ach Gottchen, Miss, wer die aufheitern wollte, müßte sich schon auf Wunder verstehen«, sagte Sue, verzog sich aber bereitwillig in die Küche.
Hatty setzte sich auf einen Hocker zwischen die beiden Hochstühle. Die kleinen Mädchen betrachteten sie mit weinerlich verzogener Miene. Ihre Haut war fahl wie die ihres Vaters, das Haar dünn und strohbleich über hohen Stirnen und wäßrig blauen Augen. Die sommersprossigen Gesichter waren immer voller Rotz- und Tränenspuren. Sie hatten beide an der gleichen Stelle ein Muttermal.
»Schaut her«, sagte Hatty. »Das ist ein Stein.« Sie ballte die Hand zur Faust. »Und das ist eine Schere.« Sie ließ die Finger auf- und zuschnappen. »Und das ist ein Blatt Papier.« Sie streckte die Hand aus. »Habt ihr das verstanden? Macht einen Stein, wie ich.« Wieder ballte sie die Faust.
Langsam schloß sich das schmuddelige Händchen von Sophy, gleich darauf folgte das von Eliza.
»Sehr schön. Jetzt macht die Schere. Schnipp-schnapp.«
Die kleinen Finger bewegten sich hurtig, angestrengte Falten erschienen auf den hohen Stirnen, der kummervollapathische Ausdruck war verschwunden.
»Gut. Jetzt macht das Papier. Es muß ganz flach sein, seht ihr?«
Die Händchen streckten sich flach aus, nur die kleinen Finger waren eingerollt wie schmuddelige Blütenblätter.
»Jetzt paßt gut auf. Schere schlägt Papier, weil sie schneiden kann.«
Die Stirnfalten vertieften sich bei dem Versuch, dieser Beweisführung zu folgen.
»Noch einmal: Schere schneidet Papier. Schnipp-schnapp. Versteht ihr?«
Die Zwillinge blickten sie aufmerksam, aber ohne eine sichtbare Regung an.
»Aber Papier schlägt Stein, weil Papier den Stein einwikkeln kann.«
Hatty legte zur Veranschaulichung eine Hand um die geballte Faust.
Vier weit aufgerissene Augen fixierten Hattys Hand.
»Jetzt spiele ich mit euch. Mit dir zuerst, Sophy. Du schüttelst dreimal die Faust, dann machen wir, jeder für sich, die Schere. Oder das Papier. Oder den Stein. Was uns gerade einfällt. Und dann sehen wir, wer wen geschlagen hat. Schütteln … schütteln … schütteln – jetzt!«
Sophy hatte die Schere, Hatty das Papier gemacht.
»Du hast gewonnen, Sophy. Schere schlägt Papier, weil die Schere das Papier schneiden kann.«
Sophy stieß einen lauten Freudenschrei aus. Eliza hatte das Geschehen mit vor Anspannung offenstehendem Mund verfolgt.
»Jetzt du, Eliza.«
Eliza machte die Schere, Hatty den Stein.
»Diesmal hab ich gewonnen. Jetzt spielt einmal gegeneinander.«
Eliza gewann. Sie lachte und juchzte. Gut möglich, dachte Hatty bei sich, daß es das erste richtige Lachen in ihrem jungen Leben ist. Sie spielten noch einmal, und diesmal siegte Sophy.
»Jetzt habt ihr einen schönen Zeitvertreib«, sagte Hatty, aber die Zwillinge hörten gar nicht hin. Sie waren ganz versunken in ihr Spiel. Hatty saß noch eine halbe Stunde bei ihnen und sah zu. Als Sue mit Suppe und Zwieback kam, hatten sie an die hundertsechzig Runden hinter sich, und Sieg und Niederlage waren ziemlich gleichmäßig verteilt. Manchmal kamen sie lange Zeit immer wieder zum gleichen Ergebnis – zwei Steine, zwei Scheren –, aber das störte sie nicht, sie lachten nur darüber.
»Meiner Seel, Miss Hatty«, sagte Sue, »ich hab die beiden noch nie so ruhig und fügsam erlebt. Da wird Miss Burnaby sich aber freuen.«
Natürlich sollte von Freuen bei Burnaby keine Rede sein.
Gleich nach dem Essen fingen die Zwillinge wieder an zu spielen, und Hatty verließ das Kinderzimmer und schrieb an ihre Mutter.
Ob diese aber ihre anschauliche Schilderung des so erfolgreich umgesetzten Vorschlags je zu lesen bekam, erfuhr Hatty nicht. Der Brief blieb unbeantwortet.
Und wenige Monate später erreichte sie in Portsmouth die Nachricht von Mrs. Wards Tod.