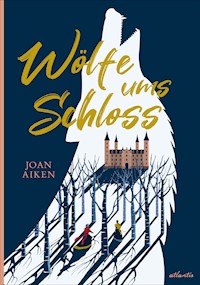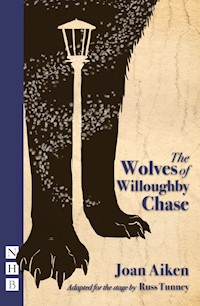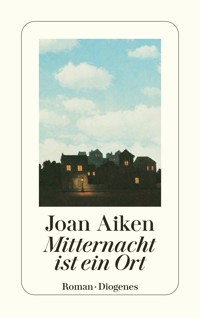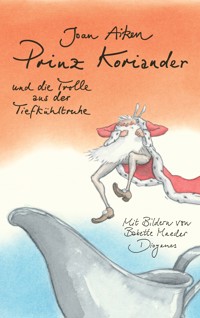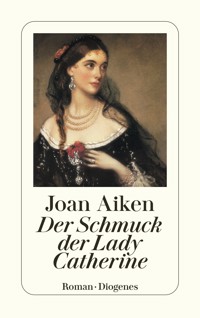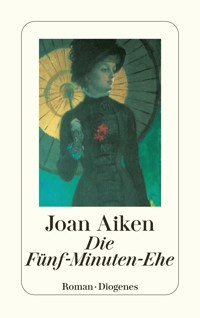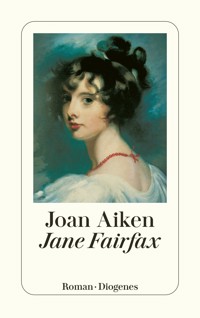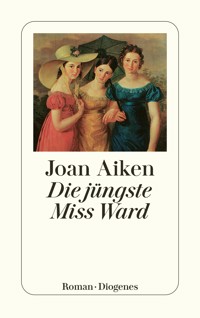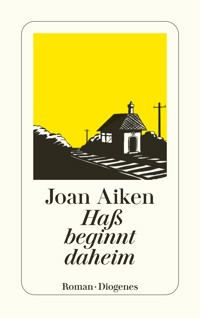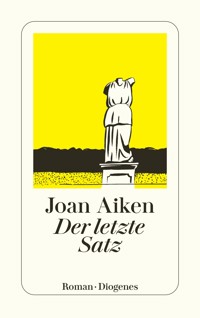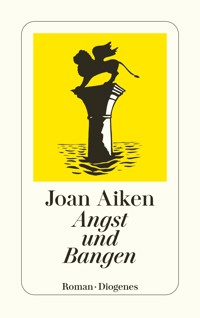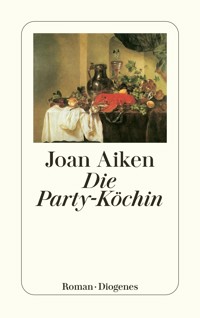
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach dreizehn Jahren quält die Chefin eines Party-Catering-Service, Clytie Churchill, immer noch die Frage, ob ihr Stiefsohn Finn bei einem Unglücksfall auf See wirklich mit ihrem Mann Daniel ums Leben kam oder ob die Briefe, die sie seit einiger Zeit bekommt, von ihm sein könnten. Nach einem Ärztekongress erzählt sie dem Arzt Dr. Rabuse in einer durchzechten Nacht ihre bewegte Lebensgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Joan Aiken
Die Party-Köchin
Roman
Aus dem Englischen von Edith Walter und Michaela Link
Diogenes
1
Beginnt, o Schwestern des geweihten Quells …
John Milton, Lycidas
Wie viele Zwiebeln muß ich wohl noch schneiden, bevor ich sterbe? ist ein Gedanke, der mich gelegentlich heimsucht, wenn ich wieder einmal darangehe, eines jener Gerichte aus den Resten von Lammfleisch zu zaubern, die mit einer gehackten und sautierten Zwiebel beginnen. Die Grundlage aller Kochkunst ist eine gehackte Zwiebel, hat meine Freundin Ellen einmal behauptet. Sie sagte auch, zur feinen Lebensart gehöre es anscheinend, daß man um sechs Uhr morgens aufstehen müsse. Beide Behauptungen sind zutreffend. Einer meiner Liebhaber hat einmal erklärt, meine Hände röchen immer nach rohen Zwiebeln (das war lange bevor ich lernte, sie sofort in kaltes Wasser zu tauchen). Ich entschuldigte mich, aber er sagte, er möge den Geruch; er erinnere ihn an Gärten und Gewächshäuser und Umtopfschuppen. Larry hieß er. Was wohl aus ihm geworden sein mag? Er hatte ein so rührendes, unschuldiges Profil – nur sanfte Rundungen. Einer Ente nicht unähnlich.
Ich sitze in einem neun Meter langen und knapp vier Meter breiten Zimmer der Campus Tavern. Die Innenausstattung ist spanische Gotik – massive, polierte hölzerne Spiegelrahmen, Lampensäulen aus Holz, Grabplatten ähnliche, geschnitzte hölzerne Kopfteile für zwei riesige Doppelbetten, jedes groß genug für eine Orgie von Flußpferden; Stehlampen so hoch wie die Freiheitsstatue; am entgegengesetzten Ende des Raums ein zusammenklappbarer Wandschirm aus Holz (braun wie Hundekot, karamelbraun, lackiert), hinter dem sich Dusche und Ausguß verschämt verbergen; gelb und rostbraun gestreifte Vorhänge (passend zu den Tagesdecken) bedecken die verglaste Vorderseite, die sich zu einem Dachgarten von der Größe eines Paradeplatzes öffnet.
Neben der Nachttischlampe, vorsorglich bereitgelegt, ein Merkblatt: Wie man einen Hotelbrand überlebt.
Weder Tageslicht noch frische Luft können je in diesen Raum gelangen; Soziologen einer späteren Epoche werden zu dem Schluß kommen, daß es sich um eine jener Kerkerzellen handelt, dazu bestimmt, den Gefangenen zu demoralisieren und seine Persönlichkeit schnell zu zerstören.
Ich wähle die Nummer des Zimmerservices und warte eine Weile.
Behalten Sie Ihren Zimmerschlüssel in der Hosentasche oder legen Sie ihn auf den Nachttisch.
»Oh, leider können wir Ihnen vor halb acht Uhr morgens nichts aufs Zimmer bringen«, teilte man mir mit und strafte vergnügt die Speisekarte Lügen, die Service rund um die Uhr versprach. Sinnlos mein Einwand, daß es für mich jetzt fünfzehn Uhr europäischer Zeit war.
Sollten Sie in Ihrem Zimmer Rauch spüren oder riechen, rollen Sie sich aus dem Bett, und kriechen Sie zur Tür.
Ich wartete bis halb acht und versuchte es dann wieder.
»Melone, Kaffee und ein Omelett.«
»Wir haben keine Melonen.«
»Aber auf der Speisekarte steht, Melone, je nach Saison. Wann ist denn die Saison für Melonen, wenn nicht im Sommer?«
»Bedaure, wir haben keine Melonen. Dürfen wir Ihnen statt dessen vielleicht einen Fruchtsaft servieren?«
Dieser Dialog erinnert mich an das, was George immer ›die Sprechblase‹ nannte.
Die Sprechblase ist das Ding aus den Comics, das über deinem Kopf schwebt und Perfektion verspricht; die Sprechblase ist das transzendente Gegenteil der Realität. Die Sprechblase hatte mir den Eindruck vermittelt, Mitchison, Nevada, sei ein kleines, malerisches Bergstädtchen, ungefähr so groß wie – sagen wir – Ronda; die Campus Tavern ein gemütliches, kompaktes Gebäude, im Stil eines Chalets vielleicht, und vom Campus der Universität Mitchison zu Fuß zu erreichen. Statt dessen scheint Mitchison sich über ungefähr hundert Quadratmeilen flachen Landes zu erstrecken, bestehend aus rechteckigen Betongebäuden, die durch ein kompliziertes System gebührenfreier Schnellstraßen und Autobahnen voneinander getrennt sind. Keines Menschen Fuß berührt je dieses Land, von einem Punkt zum anderen gelangt man nur mit dem Auto, dem Hubschrauber oder Heißluftballon. Und die Campus Tavern habe ich bereits geschildert. Ihre riesigen, stillen Räume sind durch kugelsichere Fensterscheiben und verschlossene Türen gegeneinander abgeschirmt.
Betasten Sie die Tür mit der Handfläche. Wenn die Klinke heiß ist, öffnen Sie nicht.
Als ich ein Kind war, gelang mir nie etwas. Meine Versuche, Anleitungen aus Büchern zu befolgen – wie man Papierfächer, indianischen Kopfschmuck, Möbel für ein Puppenhaus bastelt –, endeten stets als totales Fiasko. Schokoladeautomaten weigerten sich regelmäßig, meine Münzen zu behalten, oder erwiesen sich als leer; Sonderangebote waren ausverkauft, kurz bevor meine Bestellung eintraf; oder die bestellte Ware war, so sie mich doch erreichte, geradezu beleidigend klein und entsprach ganz und gar nicht der Abbildung im Katalog; außerdem hatte man die falsche Farbe geliefert. Nie erfüllte etwas meine Erwartungen. Mit zwölf Jahren hatte ich mich damit abgefunden, daß das Leben eine einzige Enttäuschung war. Als Jugendliche konnte mich keine Sprechblase mehr an der Nase herumführen.
Erst in den letzten Monaten habe ich, Gott weiß, warum, auf geheimnisvolle Weise wieder Hoffnung geschöpft und bin voller Erwartungen.
Angenommen, Daniels Kind wäre nicht ertrunken, sondern lebte noch; lebte noch – er wäre jetzt dreizehn –, wäre behütet, würde von Fremden aufgezogen, die über seine Herkunft nichts wüßten. Der kleine Finn, ein lächelnder blonder Junge. Wage ich, an diese Möglichkeit zu denken?
Ich ertappe mich dabei, daß ich es immer häufiger tue.
Dans Sohn, Ingrid Christs Sohn; was für eine Mischung wilder, aufmüpfiger und trauriger Gene müßte durch seinen kleinen Körper jagen – Poesie, Betrug, Ehrgeiz, Liebe, Genie und vor allem der Drang zur Selbstzerstörung. Beide Eltern haben Selbstmord verübt. Wenn ich den kleinen Finn je fände, wenn ich mich ganz seinem Wohlergehen widmete, wäre ich dann wohl imstande, diesen heftigen Drang in ihm umzupolen in Energie, Leben, Glück? Wer sollte besser wissen als ich, wie man das machte? Seit meinem neunzehnten Lebensjahr stehe ich mit dem Tod auf du und du. Für mich birgt er kaum noch ein Geheimnis. Seit sechzehn Jahren esse ich den Tod zum Frühstück, sauge ihn aus meinen Teppichen, grabe ihn aus meinen Blumenbeeten aus, mische ihn in meine Soßen, mähe ihn von meinem kleinen Rasen.
In diesen sechzehn Jahren habe ich eins ganz sicher gelernt: Diese Welt ist ein Ort des Schreckens, die Menschen sind ein Risiko, unzuverlässig, voller Meinungen, die auf Hörensagen beruhen; Tatsachen lassen sich nicht beweisen, denn jeder erzählt eine andere Geschichte. Doch wenigstens ist das Essen real. Wenn man den Leuten etwas zu essen gibt, tut man etwas Handfestes.
Feuer sind heiß, entwickeln Rauch und lösen Panik aus; halten Sie sich daher am Treppengeländer fest, damit Sie nicht von verängstigten Hausbewohnern umgerannt werden …
Zum Glück habe ich Feuer nie gefürchtet.
Die Konferenz beginnt nicht vor halb vier. Jeder Gang einer jeden Mahlzeit ist bis zur letzten Olive, bis zum letzten Butterbällchen exakt geplant; die Zutaten sind geliefert, aufgelistet, geprüft und noch einmal geprüft. Im Augenblick bin ich aller Pflichten ledig, brauche nur zu warten. Ich kann hier in diesem düsteren, stillen, kühlen Limbus liegen und Bestandsaufnahme machen. Kurz vor meiner Abreise aus England habe ich Anthony Roche aufgesucht. Die Unterredung war sehr, sehr unangenehm und schmerzlich.
Sein Haus abzuschließen muß immer ein trauriger Vorgang sein – auch wenn es nur für einen Monat ist. Die Gegenstände sind ein einziger stummer Vorwurf: Tassen an ihren Haken, aufgeräumte Schreibtischplatte, Kissenbezüge gewaschen und zum Trocknen aufgehängt, Bücher, ordentlich in den Regalen aufgereiht, Glyzinien und Rosen, die den Blick mit glühendem Rubinrot locken, Büschel wehmütigen Graublaus; am Tag der Rückkehr wird alles verblaßt, verwelkt, im Unkraut erstickt sein. Wenn dieser Tag je kommt. Jede Abreise ist ein Vorgeschmack des Todes.
Ich denke an Tante Thisbe, die jedes Toilettenpapier ganz aufrollt (sie kauft die steife, glänzende, Upper-class-Sorte, haltbar wie ägyptischer Papyrus, sehr geeignet für Mönchschroniken, ägyptische Hieroglyphen oder testamentarische Verfügungen) und mit rotem Kugelschreiber auf das letzte Stück schreibt: Fremdling, so ich tot bin, wenn dieses Blatt erreicht ist, gedenke meiner. Thisbe Angela Churchill.
»Warum schreibst du nicht ›Bete für die Seele von Thisbe Angela‹?« fragte ich einmal, als ich mit einer gewissen Scheu ihre Mahnung hinuntergespült hatte.
»Seele, Tuesday?« Thisbe ist noch die einzige, die mich Tuesday – Dienstag – nennt. »Du solltest mich besser kennen, hoffe ich doch«, sagte sie scharf. »Auf welche Weise, glaubst du, könnte das Gebet einer dritten Person meiner Seele dienen? Immer vorausgesetzt, daß ich eine habe. Wirkung zeigen nur die eigenen Anstrengungen.«
»Also, ich weiß nicht. Die Gebete anderer könnten helfen – eine Art Schmierfett – wie ein Zehntausend-Kilometer-Kundendienst.«
»Igitt!« Tante Thisbe gehört einer Generation an, die tatsächlich ›Igitt‹ sagt. »Wahrscheinlich hat dich dein katholischer Freund mit solchen Ideen angesteckt.«
Tante Thisbe weiß durch Osmose – denn ich pflege mich ihr nicht anzuvertrauen – eine Menge und mehr als alle anderen über meine Privatangelegenheiten. Aber sie hinkt immer mehrere Jahre hinterher. Sie muß über vieles nachdenken – die Sozialdemokratische Partei, Amnesty International, den Stadtrat von Pimlico.
Ich sagte: »Ich sehe ihn nicht mehr. Schon seit fünf Jahren nicht. Seit Hughs Tod.«
»Ich hätte gedacht, daß er – nach dem Tod seiner Frau – über deine Gesellschaft froh gewesen wäre.«
»Es ist anders gekommen.«
»Auch gut«, sagte sie grollend. »Du hättest dich zu sehr an ihn gewöhnen können – er war ein interessanter, kluger Mann. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, daß du einen Katholiken heiratest. Aber«, fügte sie unerwartet hinzu, »heiraten solltest du doch wieder.«
»Anthony heiraten? Genausogern würde er Madame Mao heiraten. Und ich sogar noch lieber.«
»Sei nicht albern, Tuesday. Wie könntest du Madame Mao heiraten?«
Ich schloß das Haus. Schüttete unverbrauchte Milch weg, hinterließ dem Milchmann eine Nachricht, füllte die ausgehöhlte Kokosnuß mit Fett für die Meisen, blickte aus meinem kleinen, von einer Mauer umfriedeten Garten hinauf zu dem dornigen Abhang unter der Brustwehr des Schlosses, deren Zinnen zahnlückig in den Himmel ragten, hoch über meinen Schornsteinkappen, auf denen wie immer Sperlinge scharrten und schwatzten. Trug meine Reisetasche hinaus, schloß leise die Haustür, als wolle ich die Lauscher im Haus nicht stören. Warum habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich Haus und Garten sich selbst überlasse? Vielleicht sind sie froh, wenn ich ihnen den Rücken kehre; wenn ich nicht da bin und sie aufeinander angewiesen sind, müssen andere Ordnungen existieren.
Tür zu, zählen, lauf hinaus,
Wo nun Stille ist im Haus:
Wer hält meinen Stuhl besetzt?
Wer schleicht auf der Treppe jetzt?
Wer ist in mein Bett gekrochen?
Und wessen Mund hat dies geprochen?
Eines von Ingrids frühen Gedichten. Kinderspiele hatte sie es genannt.
Liebes, kleines, uraltes Haus. Watch Cottage – das Wächterhaus. Ich drehe mich immer um, damit ich es noch einmal liebevoll betrachten kann. Weiß, kompakt, verschalt, winzig, steht es voller Würde unterhalb des von Dornengestrüpp bewachsenen Castle Mound am Ende einer kurzen, steilen, kopfsteingepflasterten Sackgasse, Watch Hill, die in die Bastion Street hinunterführt. Hier ist nicht Platz genug, um einen Wagen abzustellen, die Häuser stehen so dicht beieinander wie Zähne in einem zu kleinen Kiefer, daher habe ich meinen Citroën in der Bahnhofsgarage eingemietet, wo er manchmal wochenlang in kostspieliger Muße verharrt. Mit dem Zug ist man genauso schnell in London, und man kann lesen und sich mit den Leuten unterhalten.
Eine ehrwürdige Glyzinie überwuchert die Fassade von Watch Cottage. In den beiden winzigen Blumenbeeten im Vorgarten blühen, hinter eisernen Stäben eingesperrt, Glockenblumen und Geranien in Hülle und Fülle.
Drei abgetretene Steinstufen führen zu der ausgeblichenen, blauen Haustür mit dem Messingklopfer.
Zum erstenmal habe ich das Haus am Tag vor meiner Hochzeit gesehen.
»Verreisen Sie wieder?« Die alte Miss Crutchley, die in Nummer zwei ihre Milchflaschen herausstellt, sieht meine Reisetasche. Sie nuschelt stark, hat das Gebiß noch nicht im Mund.
»Für einen Monat. Nach Amerika.«
»Kochen Sie wieder bei einer Ihrer Konferenzen?«
»Genau. Diesmal sind es Ärzte. Ich glaube, sogar der Leibarzt von Breschnew ist dabei.«
Heutzutage koche ich eigentlich nicht mehr selbst, aber für Miss Crutchley kommt das auf dasselbe heraus. Außerdem bereite ich für eine besondere Mahlzeit im allgemeinen auch eigenhändig eine festliche Speise zu.
»Ärzte? Das sind große Esser, wette ich. Wenn Sie sie nur gut genug füttern, werden Sie Ihnen noch einen Orden verleihen. Ich werde Ihre Geranien gießen, meine Liebe, wenn es heiß wird.«
»Danke, Miss Crutchley, Sie sind wirklich reizend.«
»Sie bringen mir so oft Erdbeer- und Käsekuchen, meine Liebe. Ich sage immer, was hat das Leben denn für einen Sinn, wenn wir andern nichts Gutes tun können?«
Angetan mit Schürze und Pantoffeln, geht sie ins Haus zurück. Die alte Miss Crutchley. Wenn sie stirbt, wird sich irgendein junges Paar aus irgendeiner Chefetage das Haus schnappen.
Weiter, den steilen Hügel hinunter. Die Stadt Affton Wells breitet sich zu meinen Füßen wie ein Theaterprospekt aus hellgrauen, ziegelroten und geschindelten Giebeln aus. Tudor im Zentrum, 17. und 18. Jahrhundert an der Peripherie. Dahinter graue Salzmarsch, die in den Ärmelkanal zurückweicht.
Und nun, anstatt mich links zu halten, wie sonst immer, biege ich nach rechts in die Monmouth Street ab – in die Straße mit den hübschen Queen-Anne-Häusern und der Allee süß duftender Lindenbäume, die am Rand der breiten, gepflasterten Gehsteige stehen, dem würdevollen Monmouth Hotel mit seinen weißen Säulen und den Büros der einem Gentleman wohlanstehenden Berufe: Arztpraxen, Architekturbüros und Büros von Kirchenvertretern, Anwaltskanzleien.
Für mich ist es der kürzeste Weg zum Bahnhof. Seit fünf Jahren habe ich jedoch immer den längeren Weg genommen, durch Shadow Twitten und Quakers’ Row.
Wuchtig, vier Stockwerke hoch und eindrucksvoll die steinerne Fassade von Roche, Quimper and Durrenmatt, des Gebäudes, dem ich seit Jahren so sorgfältig aus dem Weg gegangen bin. Die großflächig paneelierte schwarze Eingangstür mit den dicken, sauberen Matten steht an diesem Sommertag offen. Ich stecke den Kopf durch das Schalterfenster des Empfangs, der von der Halle durch eine brusthohe, polierte Barriere aus Nußbaumholz abgetrennt ist, und nenne meinen Namen.
»Miss Churchill. Mr. Roche erwartet mich um halb zehn.«
»Aber Miss Churchill! Natürlich kenne ich Sie noch, das will ich doch hoffen.«
Miss Knowles, schon ältlich, mit Bärtchen und Brille, strahlt zur Begrüßung. »Obwohl es schon so lange her ist, seit wir Sie zu sehen bekommen haben. Mr. Roche erwartet Sie. Sie können sofort hinaufgehen, wenn Sie wollen.«
Einmal im Haus, sieht man, daß die Queen-Anne-Fassade rein äußerlich ist. Schräge Stufen, von Generationen abgetreten, Türen, für Zwerge geschaffen, verraten einen viel älteren Ursprung. Anthonys Büro liegt im dritten Stockwerk. Seinem Alter entsprechend wäre er berechtigt, in einer der unteren Etagen zu residieren, doch er liebt den dramatischen Ausblick über die Stadtmauern bis hin zu dem ebenen, grasbewachsenen, von Platanen gesäumten Park, the Severals, um den sich der Fluß Aff schlängelt.
Verglichen mit der Atmosphäre in Anthonys Zimmer, wäre die Antarktis eine warme Zone.
Ich hatte – merkwürdig genug – vergessen, wie groß er war. Ein ›prachtvoll gewachsener Mann‹, wie Tante Thisbe sagen würde, massig, aber gut proportioniert, mit starker Nase, kräftigem Kinn, muskulösem Hals, klangvoller Stimme, tiefliegenden Augen. In seinen dichten, buschigen Brauen und im widerspenstigen schwarzen Haar war jetzt mehr als nur eine Spur von Grau.
Als Kind teilte ich die Menschen, egal welchen Alters, in wir und sie auf, Kinder und Erwachsene. Anthony hätte immer zu den Erwachsenen gehört.
Aber Dans schwarze Brauen waren schöner gewesen: weich und glänzend, wie Haarpinsel; am liebsten hätte man immer darübergestrichen. Ich denke, sie waren es, in die ich mich zuallererst verliebt hatte.
»Guten Morgen. Willst du dich nicht setzen?«
Anthonys Stimme, seine ganze Haltung waren steif vor Empörung und Widerwillen über diese Verletzung seiner Privatsphäre, hinter der er sich vor fünf Jahren verschanzt hatte. Er zeigte auf den mit schwarzem Leder bezogenen Polstersessel vor seinem Schreibtisch. Und ich dachte: Diese Hand hat einmal so bewundernd meine Brust umfangen, diese Stimme – tief, mit leicht irischem Tonfall – hatte, sogar am Telefon, die Macht gehabt, mich zerfließen zu lassen wie eine Kerze.
Anthony kann seine Abstammung ganz klar bis zu einem Mann zurückverfolgen, der mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen ist. Seine Vorfahren hatten die Stammesfehden im County Cork siebenhundert Jahre lang unterdrückt. Und, wage ich zu behaupten, sich durch Generationen immer wieder mit den einheimischen Kelten verheiratet. Von ihnen hat er den Hang geerbt, über Jahre hinweg zu grollen und unversöhnlich zu sein.
Ich erinnerte mich deutlich an die letzten Worte, die er mir entgegengeschrien hatte, wie der Zufall es wollte, genau in diesem Raum: »Du bist nichts weiter als eine Hure!«
»Ach, komm schon, Anthony, wer bist du denn, daß du dir erlaubst zu urteilen, wenn ich fragen darf?«
Doch meine Worte verhallten ungehört, und was hätten sie auch geändert? Er war so leidenschaftlich erregt, und seine Hand zitterte so unbeherrscht, als er wieder eine Zigarette ausdrückte, daß ich mich fragte, ob er mir vielleicht den schweren gläsernen Aschenbecher an den Kopf werfen würde. Außerdem war unsere Unterredung (wenn man es so nennen konnte) ohnehin zu Ende. Es gab nichts mehr zu sagen, also verließ ich den Raum, in dem mir Anthony noch immer einen langatmigen Vortrag hielt, und seither hatte ich ihn nicht wiedergesehen.
Als ich mich jetzt höflich umsah, fiel mir in seinem sonst völlig unveränderten Büro ein einziger Unterschied zu früher auf: Der Aschenbecher war nicht mehr da.
»Du hast das Rauchen aufgegeben?« rief ich.
Er warf einen Blick auf seine Uhr.
»Ich habe nicht sehr viel Zeit. Wenn du nichts dagegen hast …« Mit übertriebener Geduld.
»O ja. Nun. Es ist so.« Der Anfang fiel mir schwer, besonders angesichts seines unverhohlenen Mißtrauens und feindseligen Verhaltens. Ich sagte: »Seit einiger Zeit frage ich mich – habe ich oft darüber nachgedacht –, ob – ob Daniels Sohn vielleicht noch am Leben sein könnte.«
»Daniels Sohn.«
»Der Sohn von Daniel Suter. Meinem Ehemann.«
Anthony sperrte sich absichtlich. Er wußte sehr gut, von wem ich sprach. Er war ursprünglich mit Dan befreundet gewesen, sie hatten einander gekannt, bevor ich einem von ihnen begegnet war; sie hatten sich irgendwo in einem Zug getroffen, ein paar Worte gewechselt und festgestellt, daß sie beide aus Affton Wells kamen, was zu einer lebhaften Unterhaltung über den South Eastern Arts Council geführt hatte, über seinen Geiz, seine Borniertheit und seine geradezu widerwärtige Art, die Cinque Ports University auszunutzen. Dan liebte es, sich im Zug mit Fremden zu unterhalten, und schloß auf diese Weise mehrere dauerhafte Freundschaften. Daher suchte er natürlich auch bei Anthony Hilfe, als er und Ingrid sich scheiden lassen wollten. Es war nicht zur Scheidung gekommen, aber Anthony hatte nach Ingrids Tod alle anfallenden rechtlichen Probleme geklärt. Und das gleiche auch nach Dans Tod getan. Ein paar Schulden, Schwierigkeiten aus seiner Vergangenheit, waren im Lauf der Zeit ans Licht gekommen, und Anthony hatte sie in der für ihn charakteristischen Manier für mich erledigt: schnell, energisch, sachkundig und mit rücksichtsloser Aufrichtigkeit.
»Muß ich diesen gräßlichen Menschen bezahlen, Anthony?«
»Dan war dein Mann, nicht wahr? Du hast ihn beerbt.«
»Tausend Pfund von der Lebensversicherung und neunhundert Pfund Schulden.«
»Du kannst die Schulden jetzt mühelos zahlen«, erklärte Anthony.
Und das stimmte auch. Inzwischen arbeitete ich wieder bei Daisy Dairy Products und war zum Marketing Director befördert worden. Auch hatte meine Mutter Vanessa mir, ihrem einzigen Kind, alle Rechte für ihre Übersetzungen griechischer Dramen übertragen, für die sie den Epidaurospreis bekommen hatte und die mir jährlich eine anständige Summe einbrachten. Also bezahlte ich die hinterlassenen Schulden des armen Dan und blutete innerlich jedesmal ein bißchen, wenn wieder neue auftauchten.
Wenn Seelen wie ein Narbengewebe aussehen können, muß meine einer Patchworkweste gleichen.
»Du erinnerst dich vielleicht«, sagte ich jetzt zu Anthony und richtete meine Geduld an der seinen aus, »daß Daniel und Ingrid ein Baby hatten, den kleinen Finn. Er war sechs Monate alt, als Daniel und ich heirateten.«
»Selbstverständlich weiß ich das«, antwortete er ziemlich scharf, als hätte ich ihn bezichtigt, senil zu sein. »Aber das Kind war in dem Boot, als es sank.«
»Dafür hat es nie einen Beweis gegeben. Seine Leiche wurde nie gefunden – als die beiden anderen …«
Ich schluckte und verstummte.
Anthony sah mich mit äußerstem Widerwillen an.
»Und was in aller Welt läßt dich vermuten, nach so langer Zeit – nach zwölf Jahren …«
»Dreizehn. Ich war zweiundzwanzig, als ich Dan heiratete.«
»… daß das Kind noch am Leben sein könnte? Warum – zum Beispiel – hätte man die Behörden nicht verständigt, wenn ein Kind an Land gespült worden wäre?«
»Vielleicht hat jemand es vorgezogen, es nicht zu tun.«
»Und ein unbekanntes Kind wurde einfach fraglos in eine Gemeinde aufgenommen? Was für eine Schauergeschichte spukt denn da in deinem Kopf herum?« erkundigte er sich bissig.
Ich zögerte mit der Antwort.
Tatsächlich hatte das Drum und Dran ein bißchen was von einer Schauergeschichte gehabt.
Als ich in Watch Cottage einzog, hatte es kein Telefon im Haus gegeben. (Es hatte vor mir einem neunundachtzigjährigen Exzentriker gehört, der sich nach seiner Rückkehr aus Trinidad dorthin zurückgezogen hatte und friedlich verhungert war.) Für meine Arbeit war ein Telefon zwar lebensnotwendig, doch damals war es nicht ungewöhnlich, daß man neun Monate auf einen Anschluß warten mußte, ehe das Postamt sich erweichen ließ, den leidenschaftlichen Bitten des künftigen Teilnehmers nachzukommen. Aber ich hatte in meinem Beruf gelernt, hartnäckig zu sein: Ich bombardierte das General Post Office mit Briefen, Karten und Anrufen aus Telefonzellen; stand Tag für Tag am Schalter der regionalen Anmeldestelle, fluchte, drohte und bettelte; das Ergebnis war, daß nach alle Rekorde brechenden drei Wochen mein Telefon von zwei Technikern nach Dienstschluß in Schwarzarbeit angeschlossen wurde. Zwei Drahtenden wurden in dem Glyziniendschungel vor dem Vorderfenster miteinander verknotet, durch die weiße Holzwand wurde hastig ein Loch gebohrt, und Watch Cottage war mit der Außenwelt verbunden. Angeblich eine provisorische Einrichtung, doch erschien nie wieder eine Menschenseele, um die ziemlich primitive Leitung zu überprüfen oder in Ordnung zu bringen. Daher mußte ich mich damit abfinden – zweifellos als Strafe für meine Penetranz gedacht –, daß meine Leitung bei windigem Wetter entweder tot war oder mit anderen Leitungen durcheinandergeriet. Auf diese Weise hörte ich alle möglichen Gespräche von mir völlig Fremden mit – über Krankheiten, die Unarten der Kinder, berufliche Probleme, die Gewohnheit, Schweizer Uhren zu schmuggeln, Fehden zwischen Nachbarn und Pläne für Weihnachten.
Ein- oder zweimal machte ich dem General Post Office den Vorschlag, etwas dagegen zu unternehmen, doch da der Service im großen und ganzen zufriedenstellend war, verfolgte ich die Angelegenheit nicht so energisch wie damals, als es mir darum ging, eine Telefonleitung zu bekommen; außerdem war ich zu der Zeit bitter allein, trotz – oder vielleicht wegen – meiner verschiedenen Liebhaber, und es wurde für mich zur Unterhaltung, bescherte mir eine Art geisterartiger Gesellschaft, als stumme Zeugin am Leben der mir unbekannten Menschen teilzuhaben. Ein Stückchen Zucker im leicht bitteren Gebräu des Lebens.
Bis zu jenem Tag im vergangenen Jahr, als ich den Hörer abnahm, um beim Gaswerk anzurufen, und zwei Frauen reden hörte.
Zuerst kamen ein paar schauerliche chirurgische Einzelheiten. Eine der beiden litt an den Nachwirkungen einer Zahnoperation; vielleicht waren ihr ein paar Weisheitszähne gezogen worden.
»Sie holen noch immer Knochensplitter aus meinem Kiefer. Ich werde noch eine ganze Woche nichts essen können. Schon mindestens neun Pfund habe ich abgenommen.«
»Gratuliere. So viel kann ich in einer Woche zunehmen«, antwortete Nummer zwei trocken, deren Mitgefühl man bestenfalls recht oberflächlich nennen konnte. »Zu viele Geschäftsessen, das ist der Jammer. Wann kommst du wieder zur Arbeit?«
»Oh, erst in ein paar Tagen.«
Beide sprachen unverkennbar mit dem Akzent der oberen Zehntausend, die das Glück der Erde auf dem Rücken ihrer Pferde fanden; es waren jene herzhaften, hallenden britischen Töne, die Einzelheiten über Ansichten und häusliche Sorgen ihrer Besitzerinnen klar und deutlich in jeden Winkel eines vollbesetzten Restaurants trugen. Der heilige Antonius selbst hätte der Versuchung, sie zu belauschen, nicht widerstanden. Und ich bin nicht der heilige Antonius.
»Und was ist mit Robert?«
»Meine Liebe! Er war am Boden zerstört, weil Neil ihm so zugesetzt und gedroht hat, sich umzubringen, in Roberts Badezimmer, vermute ich. Das hat Robert mir in einem Brief geschrieben.«
»Ach wirklich?« Die andere Stimme klang jetzt aufrichtig interessiert. »Das muß man sich mal vorstellen! Ich komme gelegentlich auf eine Tasse Kaffee vorbei, dann kannst du mir den Brief zu lesen geben.«
»Na schön, in Ordnung.« Mangel an Begeisterung jetzt auf dieser Seite. Nun ja, dem armen Ding tut der Kiefer weh, dachte ich, sie hat wohl kaum Nerven für gelegentlich vorbeikommende Besucher. »Wir haben diese Jungs hier, weißt du«, wandte sie zögernd ein.
In der Leitung knackte es – das passierte manchmal – ein paar Sekunden, doch dann waren die Stimmen wieder da, glasklar. Die lautere der beiden, die mit den Geschäftsessen, sagte jetzt: »Aber was ist mit Daniels zweiter Frau? Du meinst, sie hat wirklich nicht gewußt, daß sein Kind noch lebt?«
»Nein, woher sollte sie es wissen? Überleg doch, sie hatte einfach keine Möglichkeit, es herauszufinden.«
»Hatte sie es nicht versucht?«
»Warum sollte sie? Er ging sie schließlich nichts an. Sie hatte ihr eigenes Leben. Und überdies, woher sollte ihr der Gedanke kommen? Sie mußte schließlich annehmen, daß er tot war.«
»Aber wenn sie ihren Mann sehr geliebt hätte?«
»Hm. Darüber muß ich ein bißchen gründlicher nachdenken. Vielleicht kann ich es irgendwie benutzen.«
»Benutzen! Das will ich meinen! Es ist der Schlüssel! Das wäre durchaus ein Gesichtspunkt. Ich glaube, da ist jede Menge Geld drin.«
»Glaubst du das wirklich?« Hoffnungsvoll; gierig; eifrig fragend.
»Dessen bin ich sicher.«
Und dann, genau in diesem Moment, mußte ich husten – ich war zu Hause, weil ich die Grippe gehabt hatte –, und eine der beiden Frauen sagte scharf: »Ist da noch jemand in der Leitung?«
Ich blieb mäuschenstill, aber Schmerzender Kiefer sagte: »Egal, ich soll ohnehin jede Stunde gurgeln. Ich rufe dich bald wieder an, sobald ich Genaueres weiß.«
»Auf Wiedersehen. Und das sehr bald.«
Wartet! Wartet! wollte ich rufen. Was habt ihr da über Dans zweite Frau und das Kind gesagt? Aber sie waren zu meinem Leidwesen unwiderruflich im Äther verschwunden. Ich stand da, umklammerte den weißen Bakelithörer, als wär’s eine Hotline zu den Ufern des Flusses Styx, den gespenstischen Gefilden des Tartarus.
Monatelang brütete ich über dem Inhalt dieses Gesprächs. Ich handelte nicht voreilig. Ich war vorsichtig. Am Ende kam ich jedoch zu dem Schluß, daß es nicht schaden konnte, Dans Mutter zu schreiben und sie zu bitten, sich mit mir zu treffen. Mrs. Suter hatte mich stets genauso verabscheut wie ihre erste Schwiegertochter und verabscheute mich bestimmt auch noch jetzt, obwohl ich ihr die vierhundert längst zurückgegeben hatte, die Dan sich von ihr lieh, um das Boot, die ›Walküre‹, anzuzahlen. Plus Zinsen. Sie hat es mir nie bestätigt, obwohl ich wußte, daß der Betrag ihrem Konto auf der Postbank gutgeschrieben worden war. Auch als ich ihr mitteilte, daß ich mich im Watch Cottage niedergelassen hatte, beantwortete sie meinen Brief nicht; ich fuhr trotzdem zu ihr. Es war eine lange, trostlose Reise mit der Nordlinie, vorbei an einer Menge Vorstädte mit angelsächsischen Namen wie Thane Acre und Edwell’s Wood, aber von nicht besonders angelsächsischem Aussehen. Eine endlose Wildnis aus roten Ziegelhäusern.
Dann eine halbe Stunde Fußmarsch von der U-Bahn-Station Dodman’s End durch immer melancholischer wirkende Straßen mit kleinen, vernachlässigten Häusern. Und schließlich die Enttäuschung.
»Nein. Bedaure. Mrs. Suter wohnt nicht mehr hier.«
Eine dicke Frau mit einer Frisur, die wie ein Mop aussah; ihrem Leibesumfang entsprechend, hätte sie gutmütig und fröhlich sein sollen, hatte aber Augen, die wie gefrorene Erbsen aussahen.
»Sie war schon fort, als wir einzogen. Weiß nicht, wie lange. Nein, sie hat keine Nachsendeadresse hinterlassen; wenigstens nicht bei uns. Sie könnten auf der Post nachfragen. Aber wir wohnen schon fast zwei Jahre hier.«
Jetzt fiel mir auf, daß Haus und Garten viel ungepflegter aussahen als bei meinen früheren, unregelmäßigen Besuchen. Mager, desillusioniert und freudlos, fand Dans Mutter ihre einzige Befriedigung darin, das Haus peinlich sauberzuhalten, und ihr Garten prunkte mit gräßlich unnatürlichen Blumen, plexiglasfarbenen Dahlien, Gladiolen und Begonien. Ihre Gartenwicken wucherten wie billige Zuckerwatte, und ihre Rosen hatten die Farben von Vorhangmaterial aus Plastik. Doch jetzt war der Garten zertrampelt und überwuchert, mit kahlen Stellen dazwischen.
Ich erkundigte mich auf der Post, doch es war nur eine winzige Nebenstelle, wo man auch Süßigkeiten, Dosensuppen und Zeitungen kaufen konnte. An Mrs. Suter konnte man sich kaum noch erinnern und war auch sonst wenig hilfreich. Ich fragte beim Arzt nach und beim Bestattungsamt, fand jedoch keinen Hinweis darauf, daß Dans Mutter erkrankt oder gestorben war. Warum auch? Sie war erst fünfzig, als er ertrank. Er war ihr einziges Kind gewesen, und sie hatte ihn sehr jung, mit neunzehn Jahren, bekommen; sie hatten heiraten müssen. Ihr Mann, ein Alkoholiker, hatte es ihr überlassen, den größten Teil des Lebensunterhalts für die Familie zu verdienen. Als Dan dreizehn war, starb der Vater. Kein Wunder, daß sie so verbittert, so eifersüchtig und besitzergreifend war. Aber ihre Liebe zu Dan hatte bei ihm das Gegenteil bewirkt. Er konnte sie nicht ausstehen, und ich verstand ihn sehr gut.
Ingrids Zeilen Was für große falsche Zähne du hast, Großmütterchen. Willst du Rapunzel lehren, sich das Haar abzubrennen? war auf Mrs. Suter gemünzt gewesen.
Kein Nachbar wußte etwas über sie, doch das überraschte mich nicht; sie verachtete die Vorstadt, in der Dan sie untergebracht hatte; sie wollte keine Freunde.
Mrs. Suter war weggezogen, aus Doman’s End verschwunden, wozu sie natürlich das Recht hatte. Ich fragte mich, ob sie vielleicht nach Affton Wells zurückgegangen war, und sah im Telefonbuch nach; es gab mehr als dreißig Suters. Der Name kommt dort häufig vor, aber es gab weder eine Edith Agnes noch eine E.A. Und niemand wußte etwas von ihr, als ich ein paar Nummern anrief, um mich nach ihr zu erkundigen.
Ich konnte es ihr kaum übelnehmen, daß sie mich von ihrem Umzug nicht verständigt hatte; ich hatte mir keine große Mühe gegeben, mit ihr in Verbindung zu bleiben.
Nachdem ich gründlich nachgedacht hatte, beschloß ich zu inserieren.
Ich setzte kurze Annoncen in The Lady, The Times, Exchange & Mart und in ein paar Wochenblätter, die wegen ihrer persönlichen Kolumnen berühmt waren.
Ich interessiere mich für jede Information, die man mir – über den derzeitigen Aufenthaltsort des Kindes von Daniel und Ingrid Suter geben kann. Dazu meine Adresse: Mrs. Suter, c/o Barclay Bank, Victoria Station, London SW.
Ich benutzte diesen Namen, weil ich nicht zur Zielscheibe eines Haufens von Spinnern werden wollte.
Es hatten jedoch ein paar Artikel über mich in der Presse gestanden, als ich anläßlich der Geburtstagsfeierlichkeiten meinen Orden bekam, und in einem Fernsehinterview war erwähnt worden wo ich wohnte. Im Telefonbuch stehe ich unter Churchill, C., denn ich habe vor zwölf Jahren meinen Mädchennamen wieder angenommen. Wenn es jemand darauf anlegte, fiele es ihm vermutlich nicht schwer festzustellen, wo ich war.
Und offensichtlich hatte es jemand darauf angelegt. Nach ein paar Monaten – auf meine Inserate war keine einzige Antwort eingegangen – fingen die anonymen Briefe an.
Einen davon reichte ich jetzt Anthony Roche schweigend über den großen, glänzenden Schreibtisch. Er nahm ihn mit einem angeekelten Blick, als sehe er die Typhusbakterien förmlich, die sich auf der schmierigen Karte tummelten; sie war mit aus Zeitungen ausgeschnittenen Wörtern beklebt.
HA HA, DU KLEINES MISTSTÜCK, MÖCHTEST WOHL GERN WISSEN, WER DAS KIND HAT.
Wortlos betrachtete er die Karte eine Weile und fragte dann: »Was ist mit dem Umschlag? War er handgeschrieben? Gedruckt? Getippt?«
»Nein. Jemand hat sich sehr viel Mühe gemacht.«
Das hatte er in der Tat. Man kann gummierte Vignetten kaufen, auf denen Name und Adresse aufgedruckt sind; aber nicht weniger als tausend Stück. Also mußte irgendwo irgend jemand noch neunhunderteinundneunzig Vignetten mit meinem Namen und meiner Adresse haben: Miss Clytie Churchill, Watch Cottage, Watch Hill, Affton Wells, East Sussex. Ich zeigte Anthony eine.
»Wie viele Briefe hast du bist jetzt bekommen?«
»Das ist der neunte. Alle gleichlautend. Die anderen habe ich nicht aufgehoben.«
»Poststempel?«
»Central London. Sie kommen jeweils Ende der Woche, zwischen Donnerstag und Samstag.«
Er betrachtete die Karte in seiner Hand noch immer forschend. Sein Gesichtsausdruck besagte, daß diese schmutzige und widerliche Angelegenheit genau eine von denen war, in die ich mich immer wieder erwartungsgemäß hineinritt. Und er hat recht, dachte ich.
Ich sagte, weil ich unterschwellige Feindseligkeit verabscheue – und wenn er mir mit diesem Problem helfen sollte, mußte ich wenigstens irgendeine Art von Beziehung zwischen uns aufbauen: »Du siehst müde aus, Anthony.« Und das sollte er nicht, denn es war noch sehr früh an einem Montagmorgen. »Wie geht es dir jetzt überhaupt?« fuhr ich fort.
»Gut.« Sein Ton war schroff, abweisend. Geht dich nichts an, vielen Dank, und bitte bleib mir vom Leib. Ich wurde rot, denn ich erinnerte mich, zu spät, an die Bedingungen des gräßlichen Dokuments, Letzter Wille und Testament genannt, und an die Grausamkeit, mit der man mich über den Inhalt informiert hatte. Aber gewiß hatte er inzwischen dieses gehässige Stück Papier vernichtet und ein neues Testament gemacht. Da ich Anthony jedoch sehr gut kannte, konnte ich darauf nicht vertrauen.
Glaubte er vielleicht, ich wollte ihn aushorchen, wollte eine Erklärung über seinen Gesundheitszustand und seine Lebenserwartung? O verdammt, verdammt!
Um seine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, sagte ich hastig: »Glaubst du, ich sollte diese Karten der Polizei zeigen?«
»Nein, mit so etwas kann sie kaum etwas anfangen. Man hat dich nicht bedroht, niemand will Geld von dir.«
»Aber angenommen, es läuft darauf hinaus?« Ich erinnerte mich an das Gespräch, das ich mitgehört hatte. »Ich denke, in dieser Sache könnte eine Menge Geld stecken.« Und tausend Vignetten wiesen darauf hin, daß sich jemand auf eine lange Belagerung vorbereitet hatte.
»Erst wenn es soweit ist, kann man die Polizei hinzuziehen.«
»Wie soll ich mich in der Zwischenzeit verhalten?«
»Nun …« Er legte die Karte mit spitzen Fingern auf den Schreibtisch zurück. »Wir müssen annehmen, daß man dich im Moment nur erschrecken und nervös machen will. Irgendwo muß jemand warten und beobachten, wie du reagierst. Es hätte wenig Sinn, dir diese Schmierereien zu schicken, wenn man deren Wirkung nicht sehen könnte.«
Was für ein scheußlicher Gedanke.
»Wie Anrufer, die einen mit Obszönitäten belästigen? Die auf Hysterie hoffen, so daß man ihnen am schnellsten das Wasser abgräbt, indem man sie auslacht?«
»Darüber weiß ich nichts«, antwortete Anthony eisig.
Wieder ein Minuspunkt für die arme Clytie, die durch und durch unmoralisch ist, sich in Schwierigkeiten bringt, das natürliche Opfer von Wucherern, Erpressern und schlüpfrigen Telefonanrufen.
»Du – du denkst also, die – die Person, die mir diese Botschaften schickt, müsse jemand sein, den ich regelmäßig im alltäglichen Leben sehe, weil es sonst nicht viel Sinn hätte? Aber wer in aller Welt kann mir auf so abscheuliche Weise grollen – sich so benehmen?«
»Diese Frage kannst du als einzige beantworten«, sagte Anthony trocken wie die Wüste Gobi.
Ich strengte mich an, zermarterte mir das Hirn, aber sein Blick machte mich nervös. Nun, mein Leben war gewiß nicht ereignislos. Mit neunzehn hatte ich eine echte Feindin, eine Frau namens Eleanor Foley, eine Paranoikerin, die mich haßte wie die Pest, ihr Bestes tat, um mich zu ermorden, auch ihren eigenen Bruder umbringen wollte und zufällig für den Tod von zwei oder drei anderen Menschen verantwortlich war, von denen zwei zu meinen besten Freunden gehörten. Wäre Eleanor noch am Leben gewesen, hätte ich ihr gewiß zugetraut, mir derartige Botschaften zu schicken, es hätte sie überglücklich gemacht. Aber sie war schon lange tot, daran gab es keinen Zweifel. Und obwohl ich in meinen persönlichen Beziehungen weiterhin ziemlich unbedenklich – manche würden sagen leichtsinnig und verantwortungslos – war, konnte seit damals wohl kaum behauptet werden, ich hätte jemandem so schlimm geschadet, jemandem so tief verletzt, um einen solchen Haß, solche Gehässigkeit auszulösen.
Hastig ging ich im Geist den Kreis meiner Freunde und Kollegen durch. Kein möglicher Kandidat in der Cuisine Churchill; meine beruflichen Angelegenheiten werden streng sachlich und geschäftsmäßig gehandhabt; ich verlasse mich auf mein Personal; ich wähle es nach bestimmten Kriterien aus, erwarte Lebhaftigkeit, Flexibilität und ein fröhliches Wesen ebenso wie kulinarisches Talent und lasse mich selten täuschen; daher sind wir eine kongeniale, harmonische Gruppe. Und in meinem Privatleben …
Ich dachte an meine beiden liebsten Freundinnen Elly und Chris. Elly kenne ich seit unserer Schulzeit, und Chris habe ich mit zwanzig kennengelernt, als wir zusammen einen gräßlichen Kurs in Eilschrift besuchten. Ich erholte mich von drei gewaltsamen Todesfällen, sie sich von drei Jahren an der Londoner School of Economics. Elly, Chris und ich haben uns über Ehen, Todesfälle und schlimme Zeiten hinweggeholfen, wissen alles voneinander, was es zu wissen gibt, treffen uns zufällig oder verabredet mehrmals im Monat und sind trotz allem noch immer eng befreundet. War es vorstellbar, daß eine von ihnen plötzlich ausgerastet – Opfer einer geistigen Verwirrung geworden war?
Nein.
Es ist alles zu lange her.
»Mir fällt keine Menschenseele ein, ehrlich«, sagte ich zu Anthony.
Dann kam mir ein wirklich grotesker Gedanke.
Der einzige Mensch in meinem Bekanntenkreis, der aus seiner Empörung, seiner Wut und seiner Verachtung nie einen Hehl gemacht und sich unmißverständlich und offen über mich geäußert hatte, saß mir jetzt gegenüber.
»Du hast rückwirkend mein ganzes Leben vergiftet. Wenn ich nur an dich denke, wird mir speiübel. Deinetwegen werde ich nie wieder fähig sein, eine Frau gern zu haben, zu respektieren oder ihr zu glauben. Du hast meinen Glauben an die Menschen zerstört – und sogar meinen Glauben an Gott. Oh – ich kann deinen Anblick nicht ertragen. Du hast sogar meine Erinnerungen an Rose beschmutzt. Verdammt sollst du sein! Verdammt!«
Das war der Punkt, an dem ich gewußt hatte, daß ich raus mußte, und zwar schnell. Wird man von einer so hohen Flutwelle von Emotionen überrannt, kann man nicht diskutieren. Aber seither waren fünf Jahre vergangen. Fünf ist eine mystische Zahl. Wir streifen unser physisches Selbst ab, machen in sieben Jahren eine totale körperliche Veränderung durch; Schulden werden getilgt, die Eigentumsrechte der Siedler auf bis dato regierungseigenem Land werden gültig, Freier gewinnen die Hand ihrer Angebeteten. Gewiß sollte nach fünf Jahren eine moralische Schuld getilgt sein; zumindest sollte man die Tilgung in Erwägung ziehen.
Konnte Anthony in seiner Schreibtischschublade neunhunderteinundneunzig Vignetten versteckt haben? Konnte er so verrückt sein, daß er mir bösartige anonyme Briefe schrieb? Wenn das der Fall war, dann war es ganz bestimmt ein sensibles und absolut ins Bild passendes Stückchen Ironie, daß ich mich, trotz unserer gestörten Beziehung, um Hilfe an ihn gewandt hatte.
Doch nein: Anthony war eine solche Bosheit nicht zuzutrauen. Er war schließlich katholisch, ging treu und brav zur Beichte.
Oder vielleicht nicht mehr?
Was wußte ich über den heutigen Anthony wirklich? Er hatte nie wieder geheiratet, das wußte ich. Die Leute sagten, es sei jammerschade.
›Gehst du noch zur Beichte, Anthony?‹
Ich konnte mir vorstellen, daß ich ihm plappernd diese Frage stellen würde, und daran merkte ich, daß es für mich Zeit war zu gehen.
»Du meinst also, daß man nichts tun kann?«
»Nichts – im Moment. Wart ab, was passiert. Sehr wahrscheinlich wird sich die ganze Sache totlaufen. Der Schreiber wird gelangweilt aufgeben, wenn es keine sichtbare Wirkung gibt.«
»Wie, wenn man versuchte, die Vignettendruckerei ausfindig zu machen?«
Er zuckte die Schultern. »Ich könnte es versuchen. Aber sie werden hauptsächlich in Kleinbetrieben hergestellt, und die schießen wie Pilze aus dem Boden und verschwinden wieder.«
»Nun«, sagte ich, »es wird mir nicht schwerfallen, nichts zu tun. Ich fliege noch heute in die USA, für einen Monat vielleicht für länger.« Du siehst also, fügte ich im stillen hinzu, diese Unterredung ist kein Versuch, unsere abgebrochene Bekanntschaft fortzusetzen. Ich mache mich zu neuen Ufern auf. Clytie ist ihr eigener Herr, bitte vergiß das nicht.
»Geht es um einen Job?« erkundigte er sich höflich.
»Ich liefere Speisen und Getränke für eine medizinische Tagung.« Ich hoffte, einen wehmütigen Ausdruck in seinen Augen zu entdecken. Früher war Anthony ganz verrückt nach meinen Eierpastetchen. Ich bereite sie aus leichtem Teig mit Petersilienbutter, mit einem Hauch Parmesan und etwas Kaviar zu. Freitagabend war er immer auf einen Sprung in die Ordnance Mansions gekommen und hatte zehn bis zwölf Pastetchen hintereinander vertilgen können.
Jetzt sagte er nur: »Das ist ja ausgezeichnet. Zehn zu eins, daß der Ärger vorbei ist, wenn du zurückkommst. Was passiert mit deiner Post, während du nicht hier bist?«
»Sie wird mir nachgeschickt. Hättest du etwas dagegen, wenn ich hinterlasse, daß Briefe mit gedruckten Adreß-vignetten an dich weiter geleitet werden sollen?«
Nach einem kurzen Zögern sagte er: »In Ordnung. Ich kann verstehen, daß du nicht damit belästigt werden möchtest, solange du die Doktoren verköstigst.«
Die Ironie in seiner Stimme war nicht zu überhören. Ich stand auf, bedankte mich sachlich dafür, daß er mir seine Zeit gewidmet hatte, und verschwand durch die Tür, ehe er hinter seinem massiven Schreibtisch hervorkommen konnte – vorausgesetzt, er versuchte es überhaupt. Ich drehte mich nicht um, wollte es gar nicht sehen.
Ich lief die flachen, abgetretenen Stufen hinunter, und ich erinnerte mich an das letztemal, als ich sie tränenblind hinuntergestolpert war; und erinnerte mich an andere frühere Gelegenheiten, als ich unterwegs gewesen war, um mich von ihm im Zusammenhang mit der Cuisine Churchill Ltd. über dies oder jenes beraten zu lassen; zu einer bestimmten Zeit waren die Mulden dieser Stufen und das massive alte Treppengeländer für mich mit einer solchen Bedeutung befrachtet, hatten einen solchen Einfluß auf mich, daß ich, als ich sie jetzt sah und fühlte, für einen Moment in jenen früheren Seelenzustand zurückversetzt wurde.
Es ist vorbei, es ist erledigt. Vergiß es. Laß Vergangenes vergangen sein. Humpty Dumpty kann nicht wieder heil gemacht werden, und deine Firma floriert, du bist beruflich erfolgreich.
Eines hatte ich nicht fertiggebracht, Anthony zu erzählen. Ich vermute, wenn man regelmäßig zur Beichte geht, fallen einem intime Bekenntnisse leichter. Aber Verschlossenheit war mir schon lange zur Gewohnheit geworden, und was ich zu sagen gehabt hätte, war so widerlich – als fände man eine Made in seiner eigenen infizierten Wunde –, daß ich nicht imstande war, darüber zu sprechen. Das war sehr schade, wie es sich später erwies.
Ich holte meine Reisetasche aus dem Empfangsbüro und lief den Hügel hinunter zum Bahnhof, der eine architektonische Kostbarkeit ist, mit einer verschwenderischen Menge edler Schnörkel wie ein barocker Notenschlüssel, der sich über drei Notenlinien – oder Gleise – verteilt, die in verschiedene Richtungen streben, nach London, Hastings oder Brighton.
Beim Bücherkiosk blieb ich stehen, teilte Mrs. Fisher mit, daß ich für einen Monat verreiste, und bat sie, meine Tages- und Wochenzeitungen vorläufig abzubestellen. Dann stieg ich hinunter zu dem langen, kurvigen Bahnsteig.
Zum erstenmal hatte ich diesen Bahnhof gesehen, als ich an einem hellen, windigen Oktobertag mit Dan aus dem Londoner Zug gestiegen war.
Er war mit mir hergefahren, damit ich mir ein Haus ansah. Das Haus, in dem er geboren war und seine Kindheit verbracht hatte.
2
Wo wart ihr, Nymphen, als sich überm Haupt
des Lycidas die Flut schloß mitleidslos?
Als ich Daniel Suter kennenlernte, war ich in einem Schockzustand. Ich saß in einem Zug aus Cornwall, wo mir viel zu plötzlich zu viele schreckliche Dinge zugestoßen waren, und war unterwegs nach London, das sich, soweit es mich betraf, vor mir auftat wie das besagte Schwarze Loch im Kosmos. In Cornwall hatte ich meine liebste Freundin verloren. Sie war von einem armen, verrückten Kerl an Stelle einer anderen irrtümlich erschossen worden; er selbst war später durch einen Sturz von einem Viadukt ebenfalls ums Leben gekommen. Und so war keiner mehr da, den man beschuldigen oder trösten konnte. Außerdem hatte ich meine Chance zu lieben verloren; hatte mich mit größtem Widerstreben und unter schlimmsten Qualen aus der Nähe eines Mannes abgesetzt, für den ich auf den Scheiterhaufen gegangen wäre. Unglücklicherweise brauchte er niemanden, der für ihn auf den Scheiterhaufen ging; er brauchte nichts dergleichen. Ich hätte ihm nicht gutgetan, und obwohl ich noch so jung war, begriff ich das – zum Glück für ihn. Er war einfach, ich bin schwierig; mit der Zeit hätte ich ihm sehr geschadet. Wir wollen, wenn’s recht ist, nicht einmal seinen Namen nennen.
Ich war neunzehn.
Da fand ich mich also in diesem gottverdammten Zug wieder, der erst in sechs Stunden am Ziel sein würde. Sechs Stunden schleichender, schmerzlicher Leere. Ich war wie eine Schnecke, der man das Haus weggerissen hatte, war wund und blutete vom Nacken bis zur Ferse. Meine ganze Vergangenheit war mir gewaltsam entrissen worden; ich hatte nichts mehr, vor mir lag nur Leere. Auch – achten Sie nicht auf die Redewendungen – hatte ich ein gebrochenes Bein in einem unförmigen Gipsverband und war gezwungen, mich mühsam und nicht gerade schmerzfrei an zwei die Arme verrenkenden Krücken herumzuschleppen. Nur der liebe Gott wußte, wie ich im Zug mit den lebensnotwendigen Dingen zurechtkommen sollte; zum Beispiel durch den schmalen Gang zur Toilette zu gelangen war ein Ding der Unmöglichkeit, das war mir klar.
Wir krochen durch das feuchte, hügelige Cornwall und immer weiter bis nach Devon.
Inzwischen entdeckte ich in The Times (die freundliche Frau, die mich zum Bahnhof gefahren hatte, hatte sie mir gekauft), daß noch einer meiner Freunde gestorben war; ein Mann, den ich seit mehreren Jahren kannte und mit dem ich eine Zeitlang auch ins Bett gegangen war; er war bei einer transatlantischen Segelregatta ertrunken – würde also nie zurückkommen; allerdings hatte ich sowieso nicht mit einem Wiedersehen gerechnet, denn wir hatten uns ziemlich förmlich getrennt. Aber er war ein rücksichtsvoller, aufrichtiger Mensch, und ich hatte ihn gern gehabt. Warum, warum hat ausgerechnet er sterben müssen? fragte ich wütend die leere Luft im leeren Abteil. Wieviel wird einem eigentlich auferlegt? Findet man es irgendwo amüsant zuzusehen, daß wir uns wie zerquetschte Käfer krümmen?
Daß ich allein im Abteil war, schien das einzige Wertvolle, das ich besaß, daher wurde ich noch wütender, als in Exeter jemand zustieg und mein Alleinsein störte. Der Zug (es war ein Vormittag in der Wochenmitte) schien alles andere als überfüllt zu sein. Warum zum Teufel konnte der Mensch sich nicht woanders einen Platz suchen?
Ich hatte getrocknete Tränen auf den Wangen, und ich würde sie nicht abwischen oder sonst etwas tun, um diesem Menschen zuliebe gesellschaftliche Formen zu wahren. Ich zeigte ihm die kalte Schulter, als er sich mit seinem Gepäck auf dem Sitz gegenüber niederließ. Für mich war er einfach nicht vorhanden, und ich schaute entschlossen aus dem schmutzigen Abteilfenster, während wir an den Vororten von Exeter vorüberratterten. Meine Times rutschte zu Boden, und ich übersah es betont, als der unerwünschte Eindringling sie wortlos aufhob und auf den Sitz neben mir legte.
Ich vergrub mich in eine dumpfe, apathische Verzweiflung und begann zu hoffen, daß es mir möglich sein würde, die nächsten fünf Stunden in diesem Zustand durchzustehen, doch Daniel eröffnete nach ungefähr zwanzig Minuten das Gespräch, indem er ruhig feststellte: »Ich habe Sie natürlich sofort erkannt, als ich Sie durchs Fenster sah. Sie haben den Roman Chaos en miniature geschrieben, nicht wahr? Sie sind doch Aulis Jones?«
Dieser Eröffnungszug riß mich kurz aus meiner schmerzlichen Erstarrung, denn das hatte ich am allerwenigsten erwartet. Ja, er hatte recht, ich war Aulis Jones, zumindest war das der Name, unter dem ich mein schockierendes Buch veröffentlicht hatte, das ich mit siebzehn in einem Anflug von Trotz geschrieben hatte, um die Erwachsenen und Lehrer zu verärgern. Aulis ist mein zweiter Vorname, da ich zwischen Athen und den Thermopylen geboren wurde und meine Mutter Hellenistin war. Jones war ihr Mädchenname. Doch die meisten Leute nannten mich damals Tuesday. Aulis, ein Name, den ich nicht mag, wird nur bei ernsthaften Ereignissen hervorgeholt, an Sterbebetten, bei Beerdigungen und auf juristischen Dokumenten.
In diesem Augenblick war es mir gar nicht lieb, an mein Buch erinnert zu werden, durch das ich vor zwei Jahren berühmt-berüchtigt geworden war. Außer einem zweifelhaften Ruhm hatte es mir tausend Pfund eingebracht, die ich längst leichtsinnig auf den Kopf gehauen hatte. Kein Verlag hatte bisher auch nur das leiseste Interesse an meinem zweiten Roman Die letzte Tasse Kaffee auf dieser Welt gezeigt, und bis dato hatte ich noch keine Zeit gefunden, mein drittes Buch zu schreiben. Tatsächlich erwartete ich auch kaum, daß ich je den Wunsch haben würde, es zu tun. Ich war zu dem Schluß gekommen, daß Schreiben nicht mein Ventil war, es war mir nicht sinnlich genug, ich wurde nicht unbarmherzig dazu getrieben, als sei es eine Berufung. Es gibt da einen Protagonisten bei Tschechow – Trigorin, nicht wahr? Meiner Meinung nach Tschechow selbst, oder? –, der ständig von etwas in seinem Innern angetrieben wird, das sagt: Ich muß schreiben, ich muß schreiben. Dieses Gefühl habe ich überhaupt nicht. Ich schreibe, wie ich rollschuhlaufen gelernt habe, um alles einmal auszuprobieren. Aber man will ja nicht ununterbrochen rollschuhlaufen. »Es war ein sehr komisches Buch, hat mir großen Spaß gemacht«, fügte der Fremdling hinzu, der sich in mein Abteil gedrängt hatte.
»Gut«, sagte ich und wäre zu meiner Bestandsaufnahme der Hintergärten von Taunton (eine trostlose Stadt) zurückgekehrt, aber mein Reisegefährte wollte reden. Hatte mich offenbar mit besonderer Sorgfalt ausgesucht, um mich zu seiner Vertrauten zu machen. Als ich ihn mir jetzt genauer ansah, erkannte ich übellaunig ein Gesicht, das mich in Exeter forschend durchs Fenster angestarrt hatte. Er war den Bahnsteig entlanggegangen und hatte auf der Suche nach irgend jemandem in jeden Waggon geschaut. Anscheinend war ich dieser Jemand. Ich wage zu behaupten, daß wir alle unaufhörlich Signale aussenden, die von anderen empfangen werden, die wiederum ihrerseits … Mir war nicht bewußt, daß ich es getan hatte, aber er hatte, selbst in Hochspannung, offenbar meine Schwingungen aufgefangen.
Ich habe einen sehr feinen atavistischen Geruchssinn. Durch die Berufspraxis – alle guten Köchinnen und Köche sind von ihrem Geruchssinn abhängig – war er nur noch feiner geworden, aber dennoch scharf genug. Die Körpergerüche anderer Menschen, für den durchschnittlichen Geruchssinn nicht wahrnehmbar, übermitteln mir laute Botschaften. Ich spüre sofort, ob jemand nervös, verzweifelt oder unglücklich ist; die Menschen sondern dann unterschiedliche Gerüche ab. Ich rieche auch noch nach zehn Minuten, wenn jemand, den ich kenne, durch ein Zimmer gegangen ist. Von mir weiß ich, daß ich unter Streß einen leicht metallischen Geruch habe wie ein Stahlmesser, das man eben aus dem heißen Wasser gezogen hat. Wenn ich krank bin, wird dieser Geruch noch deutlicher, gleichgültig, wie oft ich bade, dusche oder mich mit Kölnischwasser besprühe. Manche Leute senden, wenn sie glücklich sind, so angenehme Gerüche aus wie ein reifes Weizenfeld an einem heißen Tag oder wie frisch gebackenes Brot.
Anthony roch im Bett nach gerösteten Walnüssen; George ziemlich scharf und säurehaltig; als Vergleich fällt mir bestenfalls französischer Senf ein.
Auch der Geruch nahen Todes ist daher unverkennbar.
Ich merkte also sofort, daß der Mann mir gegenüber unter starkem emotionalem Streß stand, großen Ärger und große Angst hatte; er strömte einen leichten, aber deutlichen Geruch nach Mineralien aus, wie zertrümmertes Gestein.
»Werden Sie einen zweiten Roman schreiben?« fragte er.
»Hören Sie«, sagte ich, »ich will Ihnen gern glauben, daß Sie es nicht böse meinen, aber ich fühle mich im Moment scheußlich; eine sehr liebe Freundin von mir ist vorige Woche gestorben, und eben lese ich in dieser Times, daß jemand ertrunken ist, den ich sehr gut kannte. Mir ist wirklich nicht nach Reden zumute, falls sie nichts dagegen haben.«
»Ach wissen Sie«, sagte der hartnäckige Mensch, »Ertrinken ist nicht der schlechteste Tod. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich ihn wahrscheinlich wählen.«
»Mein Freund wollte nicht sterben«, fauchte ich ihn wütend an. »Er hat sich diesen Tod nicht ausgesucht.« Dann dachte ich: Was weiß ich denn wirklich darüber? Außerdem ist das eine sehr seltsame Unterhaltung mit einem mir völlig Fremden.
Ich betrachtete ihn noch einmal sehr gründlich. Hinterher sah ich mich gezwungen zuzugeben, daß ich sein Äußeres nicht unsympathisch fand: ein schmales, kluges Gesicht, voller Charme, hohe, gutgeformte Stirn, humorvoller Mund, gute Zähne, betörende (was für ein Ausdruck, aber sehr zutreffend) haselnußbraune Augen und weiches dunkles Haar.
Und diese Brauen! Ach, armer Dan.
»Hören Sie«, sagte er überredend, »ich versuche nicht, mit Ihnen anzubändeln, meine Absichten sind streng ehrenhaft und absolut untadelig. Ich bin kein Wolf. Ich bin verheiratet, ich habe eine Ehefrau, und sie ist auch Schriftstellerin, wie Sie. Aber, um ehrlich zu sein, ich selbst bin ziemlich verzweifelt, brauche auf dieser Reise unbedingt jemanden, mit dem ich sprechen kann. Und ich dachte, Sie sähen – nun ja, mitfühlend und offen aus. Sobald wir in London sind, brauchen wir uns nie wieder zu sehen, müssen nie wieder miteinander sprechen, wenn Sie wollen. Ich werde Ihnen nicht einmal meinen Namen sagen. Ich bin ein ziemlich neurotischer Mensch, das weiß ich. Ich möchte Sie nicht belasten, möchte Ihnen nicht meine Sorgen aufladen. Aber ich schaffe es einfach nicht, eine so lange Reise ohne Gedankenaustausch mit einem sympathischen Menschen zu überstehen.«
All das war für Dan natürlich sehr charakteristisch, der ständig in einem wolkenähnlichen Zustand der Verzückung lebte, sich selbst im romantischen Licht des dunklen Fremdlings sah, und ich in meiner Niedergeschlagenheit fiel darauf herein. Er war viel älter als ich, Ende Zwanzig, schätzte ich (tatsächlich war er achtundzwanzig), interessant, schlagfertig, sensibel, doch vor allem war mir klar, daß es ihm auch schlechtging, daß er ein ernstes Problem hatte und genauso litt wie ich. Also hörte ich mir seine Geschichte an. Wenn ich mich mit seinen Problemen befaßte, half mir das vielleicht über meine eigene lähmende Verzweiflung hinweg.
Armer Dan, natürlich litt er, daran bestand kein Zweifel, aber er wollte auch eine kritische Zuhörerschaft. Ihm genügte es nicht, sein Klagelied vor einem x-beliebigen Ohr anzustimmen, er wollte ein besonderes, und das meine, das Ohr einer Frau, die dieses leicht anrüchige Buch geschrieben hatte und deren Bild in den farbigen Sonntagsbeilagen erschienen war, schien ihm das beste, das er im Zehn-Uhr-dreißiger von Penzance nach Paddington auftreiben konnte. »Heirate nie des Geldes wegen, aber geh dahin, wo Geld ist« wäre ein Sprichwort, das Dan wie ein Handschuh paßte, wenn man statt Geld Berühmtheit einsetzte.
Er war gern in der Nähe prominenter Leute, besonders der Kunst- und Literaturszene; er liebte es, mit Namen um sich zu werfen, die etwas mit Kultur zu tun hatten. Selbst bisher noch unveröffentlicht, strebte er zielsicher auf jene zu, die schon gedruckt worden waren, und pflegte ihre Bekanntschaft mit derselben Hingabe, die er Oasenblumen in der Wüste hätte angedeihen lassen. Ich muß in diesem trostlosen Zug ein einziger Glücksfall für ihn gewesen sein.
Sobald er sicher sein konnte, daß ich ihm zuhören würde, verlangte er kaum Antworten von mir, sondern breitete seine Seele vor mir aus. Zwischen Taunton und der Endstation bekam ich seine ganze Lebensgeschichte zu hören. Sein verstorbener Vater, Alkoholiker; seine Mutter, eifersüchtig und zu besitzergreifend; sein dreijähriger Dienst bei der Marine. »Wir sind seit Generationen eine seefahrende Familie«, erklärte er mir. »Einige meiner Vorfahren waren Admiräle, daher hat man vorausgesetzt, daß ich als Seeoffiziersanwärter zur Marine gehe.« Die Schrecken des Matrosenlebens, verrückter, sadistischer, strenger reglementiert, puritanischer und engstirniger als Kafkas irrster Traum; die widerwärtigen Verschrobenheiten der Kapitäne, die sich, einsamer als sonst jemand auf der Welt, in ihre Kabinen zurückziehen, abgesondert in ihren Kabinen leben müssen, Einsiedler des Establishments, Monat für Monat. Einer hatte ihn verführt; ein anderer ihn scheußlichen geistigen Quälereien unterzogen; ein dritter hatte sich hoffnungslos in ihn verliebt, war dann übergeschnappt, hatte Eier nach dem Zahlmeister geworfen und obszöne Variationen geistlicher Lieder gesungen.
Mich begannen seine Geschichten aufrichtig zu interessieren (die vom häufigen Gebrauch schon eine glänzende Patina hatten); verglichen mit solchen Abenteuern schienen meine eigenen sehr alltäglich.
»Warum schreiben Sie das nicht nieder?« fragte ich. »Es wäre ein großartiger Roman.«
Doch unglücklicherweise hatte er genau das getan. Conrad, Melville, Masefield waren seine Vorbilder gewesen. Nur, aus irgendeinem Grund wollte kein Verleger sein Buch drucken. Er hatte es bei zwanzig Verlagen versucht. Eine mögliche Verleumdungs- oder Beleidigungsklage habe sie vermutlich abgeschreckt, sagte er.
Später entdeckte ich, daß nicht das der Grund war. Der arme Dan war nicht fähig, einen einfachen, klaren Satz niederzuschreiben, wenn er ein eigenes Erlebnis schilderte. Sein Buch war schwülstiges Zeug. Merkwürdig, denn wenn er beruflich etwas zu schreiben hatte, war sein Stil unverschnörkelt und klar, und erzählen konnte er sehr fesselnd.
Mit Verletzungen, die sein Leben lang immer wieder aufbrechen würden, hatte er sich aus der Marine in den Journalismus geflüchtet. Er hatte noch immer die Absicht, Schriftsteller zu werden, und begonnen für kleine, elitäre Magazine zu schreiben – Zeitschriften von der Art, die eine Story zwar abdrucken, aber nicht dafür bezahlen. Dann hatte er in einem günstigen Moment den Absprung vom Kreativtexter (bei einer Werbeagentur) in Autoren-Workshops geschafft, besuchte Seminare und Wochenendkurse über Selbstfindung, Subjektivismus, Sexualpolitik und existentielle Methodik. Man hatte ihn aufgefordert, ein Buch über die Technik kreativen Schreibens zu verfassen, und er sollte Großbritannien bei einer internationalen Autorenkonferenz auf den Seychellen vertreten. Der Arts Council subventionierte seine Untersuchungen über verwaiste Schriftsteller.
All das beeindruckte mich sehr. Es schien mir eine viel intellektuellere Annäherung an die Literatur zu sein als meine schlichten Vorstellungen vom Bücherschreiben.
»Was ist mit Ihrer Frau?« fragte ich. »Haben Sie nicht gesagt, sie sei auch Schriftstellerin?«