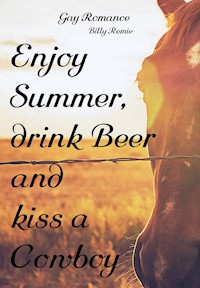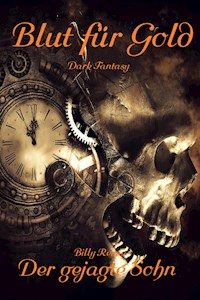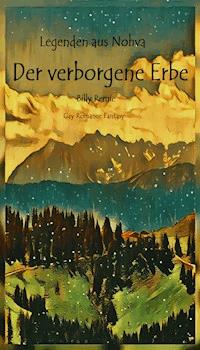
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Legenden aus Nohva 5
- Sprache: Deutsch
Der Finale 5. Band der Reihe! Die Zeit ist gekommen, die Zeit des letzten Widerstands. Gemeinsam mit seinem neuen Gefährten, Cohen, setzt Desiderius alles daran, seine Heimat vor der drohenden Dunkelheit zu bewahren. Doch während er sein Leben im Kampf gegen die Dämonen riskiert, und für seine neue Liebe seine alten Überzeugungen noch einmal überdenkt, ist sein geliebter Prinz längst von den Toten auferstanden. Wexmell ist am Leben! Beide glauben, einander durch den Tod verloren zu haben, und schlagen verschiedene Richtungen ein. Desiderius beugt das Knie vor einem neuen König, und Wexmell baut eine Streitmacht auf, um seine Heimat zu befreien. Werden sie am Ende wieder zusammenfinden? Und ist ihre Liebe stark genug, diesen Schicksalsschlag zu überstehen? Möglicherweise gibt es für Desiderius kein Weg mehr zurück, da sein Herz längst nur noch für Cohen schlägt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1355
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Billy Remie
Der verborgene Erbe
Legenden aus Nohva V
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Epilog
Danksagung
Impressum neobooks
Prolog
Seine Stiefel pochten bei jedem Schritt auf dem kahlen, feuchten Gestein. Blut tropfte aus seinen tiefen Wunden auf den Boden und hinterließ eine genaue Spur des Weges, den er voran stolperte. Das Schwert mit der geschwungenen Klinge noch fest in der Hand, die blutbeschmierte Schneide bereit zum Einsatz, doch sein verletzter Arm, in den das Monster seine Zähne geschlagen hatte, schmerzte so stark, dass er schwach an seinem Körper hinabhing, und die Spitze seines Schwertes über den Gesteinsboden zog, sodass sie Funken erzeugte.
»Du weißt doch sicher, dass uns die Kreatur in eine Falle lockt.«
Sei still, bat er sanft die andere Stimme, bitte, lass mich denken.
Es war dunkel. So dunkel, wie es in einer Höhle sein konnte. Ein Licht, hell und mystisch, am Ende des langen Gangs, wies ihm den Weg zum Herz des natürlichen Gewölbes.
Vor Jahrhunderten war dieser Ort in Vergessenheit geraten. Und vermutlich war er der erste Sterbliche seit einer Vielzahl von Jahrzehnten, der mit seinen unwürdigen Stiefeln diesen heiligen Boden betrat.
Er ging den Tunnel entlang. Schlurfte, schnaubte, am Ende seiner Kräfte. Es war kühl dort drinnen. Feuchtigkeit glänzte auf dem von Wasser glattgeschliffenen, dunkelgrauen Gestein. Das mystische Licht leuchtete darin. Wasser perlte an den Wänden hinab. Das Erklingen der Tropfen in feuchte Pfützen hallte laut in der Höhle wider.
Als er aus dem Tunnel trat, fand er sich in einer Art Grotte wieder. Der mystische Lichtschimmer wurde von einem See verursacht, der aus so klarem Wasser bestand, dass es nicht möglich war, eine Spiegelung auf der Oberfläche wahrzunehmen. So war der Tunnel unter Wasser, der aus der Höhle direkt ins Meer mündete, seinen Augen nicht verborgen.
Es gab also zwei mögliche Fluchtwege, sollte er hier nicht siegen können. Der trockene Weg, den er gekommen war, oder der nasse Weg durchs Wasser.
Wobei er nicht sicher sein konnte, wie weit der Tunnel sich erstreckte, und ob er überhaupt lange genug die Luft anhalten konnte, um ihn zu durchtauchen.
Doch es bedeutete auch, dass das Monster, das er verfolgte, wohlmöglich gar nicht mehr hier war. Und ihm stand mit seinen offenen Wunden nicht der Sinn danach, in salziges Meerwasser zu springen und ihm nachzuschwimmen, zumal es für ihn als Sterblichen unmöglich war, jenes Monster ausgerechnet im Wasser zu besiegen.
Es roch angenehm in der Höhle. Frisch. Salzig. Nach dem tobenden Meer – und Freiheit.
Vor dem See, und unmittelbar vor ihm, tat sich ein Hain auf. Eine Statue aus weißem Marmor zeigte eine schlanke Gestalt – menschlicher Natur – die elegant einen Arm in die Höhe streckte. Auf der nach oben gerichteten Handfläche befand sich eine hohe Welle, als läge die unbändige See der Welt in der Hand dieser Statue. Die andere Hand hielt eine Schlange an die flache Brust gedrückt. Der Kopf des Tieres steckte zwischen den Fingern, die das Tier zu erwürgen schienen, die Zunge züngelte heraus, die Augen waren zu giftigen Schlitzen verengt, der lange Körper um einen schmalen Unterarm geschlungen.
Die Statue trug eine Tunika, die an der rechten Schulter mit einer Spange oben gehalten wurde. Um die schmale Taille war ein Band geschlungen. Auf der einen Seite war die Statue eine zarte, junge Frau, mit weichem Gesicht, langem Haar und einer Brust, die sich perfekt in die Hand eines Mannes schmiegen würde. Auf der anderen Seite war sie ein junger anmutiger Mann, mit kurzem Haar und kindlichen Zügen, dessen Brustmuskel aus der Tunika hervorlugte.
Ein uralter, vergessener Gott, der längst von neuen, gutmütigen Göttern ersetzt wurde. Das Monster mit den vielen Gesichtern, dass die See beherrschte, und abwechselnd Seefahrer ins Unglück verführte oder die Wellen über die Küsten schwappen ließ, um alles Leben dort zu vernichten.
Das Ungeheuer, das es zu besiegen galt.
Vor der Statue stand ein uralter aus groben Stein gehauener Altar. Die Opfergaben von längst vergangenen Zeiten hätten durch die Feuchtigkeit längst verfault sein müssen, doch irgendwas hatte sie erhalten. Blumen und frische Felle bildeten eine Art Bettstatt auf dem Altar. Auf den Stufen seines Podestes lagen dem Altar Obst, Fleisch, ungeschliffene Edelsteine und sogar Gold und Silber in Form von primitiven Münzen zu Füßen. Die Gaben waren das letzte Zeugnis von den einstmalig Lebenden, die hergekommen waren, um etwas zu erbitten. Oder um die rauen Wellen der See zu besänftigen, ehe sie die bewohnten Küsten verschlangen.
Laut den Überlieferungen alter Legenden, war es lange vor seiner Zeit – lange vor der Zeit der Welt, wie die Sterblichen sie kannten – Gang und Gebe gewesen, einen dieser Haine aufzusuchen und durch mitgebrachte Opfergaben die Gunst der Götter zu erlangen.
Sein Gang war träge, er wirkte fast gelangweilt, doch es war Furcht, die seinen Schritt erlahmte. Die Einsamkeit und die Trauer dieses Ortes übertrugen sich auf ihn, sodass sich ihm die Haare im Nacken sträubten.
»Eines Tages werden auch wir vergessen sein. Egal, was du für die Welt opferst. Genau wie die Kreatur, die du jagst. Wir sind alle gleich.«
Ich weiß, seufzte er in Gedanken, aber das ist jetzt nicht wichtig.
Für einen Moment fragte er sich tatsächlich, weshalb er das Wesen jagte, und ob er die Kreatur nicht einfach ziehen lassen sollte.
Aber er konnte nicht, er hatte eine Pflicht zu erfüllen, vor der er nicht davonrennen konnte.
Vor dem Altar blieb er stehen und blickte noch einmal hinauf zu der Statue, die trotz all der Zeit wie frisch erbaut wirkte. Die Witterung konnte diesem Ort nichts anhaben, hier stand die Zeit still.
Schließlich wurde seine Erschöpfung zu groß, seine Knie knickten ein. Mit einem geradezu erleichterten Seufzen ergab er sich den Mächten der Natur und sank vor dem Hain schwer auf die Knie.
»Sie ist noch hier«, züngelte der Drache in ihm. »Ich kann sie spüren.«
»Ich weiß, dass du noch hier bist!« Seine Stimme klang kratzig, aber trotz der Erschöpfung noch erstaunlich laut. »Stell dich deinem letzten Kampf, Herrin der Gewässer!«
»Was lässt Euch annehmen, es könnte mein letzter Kampf sein?« Das Wasser blubberte leise, als die samtweiche Stimme der Gottheit erklang. Zunächst war nichts zu sehen, außer Luftblasen, die über die klare, unbewegte Oberfläche des Wassers immer weiter zum Ufer gelangten. Dann erschien ganz langsam ein Scheitel mit dunklem Haar aus dem Wasser. Die junge Frau, die langsam dem See entstieg, war das genaue Ebenbild der weiblichen Seite der Statue. Groß, graziös, schlank. Anmutig und weich. Wunderschön. Zu schön um sterblicher Natur zu sein. Dunkles, langes Haar, das trocken aus dem Wasser hervorkam, ganz anders als ihre vor Nässe triefende, blasse Haut, und die feuchte Tunika, die sich durchsichtig um ihren eleganten Körperbau schmiegte.
Ein verwegenes Lächeln lag auf ihren Lippen, als sie aus dem Wasser trat und voller Triumph ihren vollständig geheilten Körper präsentierte.
Er blinzelte ärgerlich. »Das ist kein gerechter Kampf.«
»Ihr seid sterblich. Ich bin es nicht.« Sie lachte kehlig und ließ die Arme fallen. »Habt Ihr denn wirklich geglaubt, es wäre so einfach, König Lugrain?«
Noch immer auf den Knien sitzend, streckte er den verletzten Schwertarm aus und zeigte mit der Spitze der Drachenflügelklinge auf ihre Gestalt. »Ich hätte dich schon beinahe besiegt!«
»Beinahe«, stimmte die Gottheit zu, sie schlenderte um den Hain herum, raffte dabei ihre nasse Tunika, und hinterließ feuchte Fußabdrücke auf dem Gestein. »Aber jetzt stehen die Verhältnisse anders, richtig? Jede Wunde, die Ihr mir zufügtet, König, ist geheilt, aber Eure Wunden …«, sie hielt die Nase in die Luft und atmete genüsslich ein, » … reichen tief.«
»Weil du feige geflohen bist, Monster! Ich hätte dich längst besiegt, wärest du nicht aus einem gerechten Kampf davongerannt.« Schwerfällig kam Lugrain auf die Beine. »Sei es drum. Ich verletzte dich schon einmal, Kreatur, es wird mir ein Leichtes sein, es zu wiederholen!«
Die Gottheit betrachtete Lugrain mit gesunder Vorsicht, als er sich mühsam wieder aufrichtete und den stolzen Rücken durchdrückte.
»Ihr wollt nicht aufgeben?«, fragte sie verwundert über ihn. Neugierig verengte sie ihre schönen Augen. »Trotz Wunden? Trotz, dass ich Euch überlegen bin, sterblicher König?«
Lugrain begann zu grinsen. »Ich habe bisher gerecht gekämpft, aber wenn du mit faulen Tricks und mit Magie kämpfen willst, habe auch ich noch eine Überraschung für dich …«
Sie machte einen ängstlichen Schritt zurück, als sich Lugrains sterbliche Augen in die geschlitzten Pupillen des Wesens verwandelten, das Zazar mit seiner Seele verflochten hatte. Er bleckte die Fänge und knurrte tief in der Brust.
Die Gottheit wurde sichtlich blasser.
»Sie hat Angst, weil du der erste bist, der sie verletzte.«
Ermutigt machte Lugrain einige Schritte auf sie zu. Sie wandte den Kopf etwas zur Seite, als wollte sie zurückschrecken, blieb aber trotzig vor dem Altar stehen, der zu ihren Ehren erbaut worden war.
»So schwer verletzt könnt Ihr unmöglich eine Verwandlung riskieren!«, glaubte sie, doch ihr war ihre Unsicherheit anzuhören.
»Die Gefahr ist es wert«, grollte der Drache.
Lugrain log mit höhnischen Grinsen: »Oh doch, das kann ich. Ich kann mich zu jeder Zeit verwandeln.«
Sie forschte nervös in seinen Augen, dabei machte sie fast unscheinbar einige Schritte zurück.
Lugrain nutzte ihre Unsicherheit aus und sprang mit allerletzter Kraft auf sie zu. Er packte ihre Kehle, sie zog erschrocken die Luft ein, und er drückte sie mit dem Rücken grob über den Altar. Er spürte bereits unter seinen Fingern ihre Haut weich und kühl werden, als wollte sie sich ein weiteres Mal in Wasser auflösen.
Dieses Mal entkam sie ihm nicht, er hob das Schwert an, das sein Schmied mit Hingabe für ihn gegossen, und das Zazar mit Liebe für ihn verzaubert hatte, um genau das zu tun, was er hier gerade tat: Monster zu töten.
»Wartet!«, rief sie erstick, als die Spitze der Klinge in ihren Hals drückte, und verhinderte, dass sie ihm entwichen konnte. »Ist gut, König, Ihr habt mich überzeugt.«
Lugrain runzelte seine markante Stirn. »Was meinst du damit?«
»Ihr müsst mich nicht vernichten!«
»Doch, das muss ich!«, zischte er wütend. »Wir sind im Krieg! Wegen Wesen wie dir! Mein Volk hungert, mein Volk stirb hier. Ich muss die See bändigen, damit meine Fischer wieder Nahrung finden, da die Dämonen den Wildbestand der Wälder fast vollständig ausgelöscht haben. Und anstatt den Sterblichen beizustehen, wie es die Pflicht einer angeblichen Gottheit gewesen wäre, zwingst du meine Völker in die Knie. Lässt sie Hunger leiden. Verschlingst mit deinen Wellen meine kostbaren Schiffe. Verhinderst, dass die Unschuldigen auf Inseln fliehen können, bis ich den Krieg für sie beendet habe!«
Die Wut über die Nachlässigkeit der Kreatur ließ Lugrains Schwertarm zittern.
»Du hast die Wahl«, zischte er drohend, »entweder du ergibst dich meiner Klinge, oder ich verwandle mich in das Wesen, das dazu geschaffen wurde, Kreaturen wie dich zu fressen.« Er drückte ihr das Schwert noch etwas tiefer in die Haut, bis goldenes Blut glitzernd hervorquoll.
»Ich bin noch nie einem Sterblichen wie Euch begegnet«, sagte die Gottheit geradezu fasziniert. »Ihr seid der erste Mann, dem es gelang, so viele unterschiedliche Völker zu einen, und der erste, der König eines wilden, freien Landes wurde. Ein Mann, dem es gelang, einen Halbgott-Halbdämon an sich zu binden. Ein Mann, dem zu folgen es sich lohnt. So stolz, so hartnäckig, selbst im Angesicht des Todes. Ihr wollt Euch selbst opfern, um die Völker zu retten, die Ihr zu schützen geschworen habt … Ein Märtyrer, gewiss. Doch Euren tiefsten Wunsch kennt nur Ihr selbst, und der Drache in Euch. Denn Ihr wollt sterben, selbst wenn Ihr Euer geliebtes Halbwesen dafür im Stich lassen müsst. Ihr wollt sterben, um die wiederzusehen, die Ihr einst geliebt habt. Aber Euer Tod wird Unheil anrichten, König. Euer Sohn wird viel Blut vergießen. Eure Freunde, denen Ihr den Thron überlasst, werden ihn nicht mehr hergeben, Euch werden sie aus der Geschichte verbannen. Und Euer Bellzazar … wird zerbrechen an den Spielen, die die neuen, ach so barmherzigen Götter für ihn bereithalten.«
Lugrain wollte nicht länger zuhören, zu nahe lag die Gottheit an der Wahrheit und an seinen tiefsten Ängsten. »Spar dir deinen letzten Atemzug für dein Todesröcheln auf!« Lugrain wollte zustechen …
»Ich lasse mich von Euch bändigen, König, der über die freien Länder wacht!«
Lugrain hielt überrascht inne.
»Ich werde Euch gestatten, mich zu bannen«, wiederholte die Gottheit, als Lugrain ihr fragend in die dunklen Augen blickte.
Lugrain konnte ihr nicht glauben.
»Sie sagt die Wahrheit.«
Sie könnte uns täuschen.
»Ich werde Euch helfen, den Dämonenfürsten aufzuspüren. Ich werde sogar ohne Aufstand in die Unterwelt gehen und dort verharren, solltet Ihr ihn wahrhaftig besiegen, so wie es jedem vergessenen Gott ergehen wird, solltet Ihr Erfolg haben. Ich werde die See zahm lassen und Euch ihr Siegel anheften, auf dass sie Eure Seele stets erkennt. Ihr könntet durch alle Gewässer dieser Welt schwimmen, ohne dass Euch Gefahr drohen würde. In diesem und in jedem anderen Leben, das folgen sollte.«
»Ich gehe keinen Pakt ein.«
»Pakte schließt man mit Dämonen, König«, tadelte die Gottheit. »Nein, es ist kein Pakt. Ihr wollt mich töten, doch ich ergebe mich freiwillig. Es ist ein friedliches Abkommen. Ein Bündnis!«
Lugrain nahm das Schwert runter und trat einen Schritt zurück. Er war kein Mörder, und wenn er jemanden tötete, der sich freiwillig ergab, wäre es Mord.
Froh war er damit nicht. »Du wirst einfach nur ausharren, bis du eines Tages eine Möglichkeit findest, dich zu rächen«, fürchtete er.
»Nein«, versprach die Gottheit und machte einen Schritt auf ihn zu. »Alles, was ich will, ist Euer Wort, das Ihr eines Tages zurückkehrt und mich wieder frei lasst. Ich werde mich durch das Wort des Königs von Nohva binden lassen, auf dass mich nur der wahre König von Nohva wieder frei geben kann, wenn die Zeiten besser stehen.«
»Und dann wirst du die Fischer wieder vom Weg abkommen lassen? Die Küsten überschwemmen, und mein Volk hungern lassen? Alles, was du mir anbietest, ist etwas Zeit.«
»Nein, König, der über die freien Länder wacht!« Die Gottheit fiel vor ihm auf die Knie.
Lugrain wich erschrocken einen Schritt zurück. Er war nur ein Sterblicher, mit einer verflochtenen Seele, aber dennoch sterblich. Doch vor ihm kniete eine Gottheit.
Wenn das mal kein Ereignis für eine Legende war.
»Ich gelobe dem rechtmäßigen König Nohvas die Treue«, schwor die Gottheit, »sofern er mir die Treue hält. Kommt zurück in diese Welt, König, und gebt mich frei. Vertraut mir, Ihr werdet es bitter nötig haben. Denn Euer Tod wird einen Zyklus beschreiben, den ich zu gegebener Zeit zu durchbrechen weiß. Dafür benötige ich Euer Vertrauen.«
Lugrain sah düster auf die Gottheit hinab. »Warum sollte ich dir glauben?«
»Warum sollte ich lügen?«, warf sie klug ein. »Sobald Ihr mich gebannt habt, bin ich Eurer Gnade ausgeliefert. Ich werde nur dann frei sein, wenn Ihr es wieder gestattet. Genau genommen bin ich es, der großes Vertrauen schenkt.«
»Ich werde sterben«, sagte er eindringlich. »Bald schon.« Dieser Umstand machte ihm Angst, denn er wusste von Bellzazar, dass er nach dem Tod willenlos der Gnade der Götter ausgeliefert sein würde, die er verachtete, für das, was sie Zazar antaten. Weil sie ihn verschmähten.
Das konnte für ihn nicht gut ausgehen.
»Ihr werdet Erben haben«, warf sie ein. »Der rechtmäßige König – Ihr oder Euer Erbe – werden mich freigeben. Ich werde Euch oder ihn daran erinnern, wenn die Zeit gekommen ist.«
»Ein Zyklus, sagst du?« Lugrain rieb sich das Kinn, denn auch Zazar hatte ihn davor gewarnt, die Prophezeiung zu erfüllen.
»Ja. Aber auch Prophezeiungen sind abzuwenden, mein König, jedoch nur, wenn man selbst ein Gott ist … oder zumindest ein halber Gott.« Die Gottheit grinste listig.
Lugrain verstand sofort, sein Gesicht erhellte sich. »Zazar …«
Die Gottheit nickte. »Er wird Eure Seele gänzlich befreien. Und ich werde dafür sorgen, dass ihm nichts geschieht, sollte die Zeit dafür reif sein. Ihr habt mein Wort, König.«
Nun war Lugrain ganz Ohr. »Du schwörst mir, Zazar zu beschützen?«
»Ja«, versprach die Gottheit. »Mit allen erdenklichen Mitteln. Selbst wenn es bedeuten würde, ihn zum Feind der Götter zu machen. Ich werde dafür sorgen, dass er sicher vor ihnen ist, damit er zu gegebener Zeit den Zyklus brechen kann.«
Lugrain spürte sein Herz flattern. Seit er gegen Zazars Willen entschieden hatte, sein Leben für seine Heimat zu opfern, fühlte er sich ihm gegenüber schuldig. Er hatte in seiner Traurigkeit über Zazar hinweg entschieden, ihn zu verlassen, um Surrath wiederzusehen. Jetzt hatte er die einmalige Gelegenheit, wenigstens dafür zu sorgen, dass Zazar sicher sein würde.
Doch das würde seinen Geliebten nicht vor der Einsamkeit schützen, die ihm bevorstand.
»Das halte ich für töricht, nur damit du es weißt.«
Bitte, sei ruhig, lass mich denken.
Er war es Zazar schließlich schuldig. Immerhin hatte Zazar zugestimmt, Lugrains letzten Wunsch wahr werden zu lassen. Er schloss für einen Moment die Augen und ergab sich der Vorstellung, wie so oft seit er Zazar kannte. Er sah ihn bereits in seiner Bettstatt liegen. Nackt. Er sah sich bereits hinabbeugen und den schlanken Hals lecken. Schmeckte bereits die Haut. Spürte bereits die schlanken, kühlen Finger an seinem erhitzten Körper. Fühlte bereits dunkles, kräftiges Haar in seinen Händen … Nach all der Zeit, in der er sich so sehr danach gesehnt hatte, würde Zazar ihm seinen innigsten Wunsch erfüllen. Denn schon übermorgen könnte der Kampf soweit sein. Schon in zwei Nächten könnte er sterben … Und zuvor würde er Zazar noch das egoistische Versprechen abnehmen, nie mehr bei einem anderen Mann zu liegen. Denn diesen Gedanken könnte er nicht ertragen, selbst im Tode nicht.
Er hatte viele Männer geliebt. Nach Surraths Tod hatte er in vielen Lagern gelegen, er hatte zugelassen, dass die zarten Berührungen von Menschen ihn eine Weile heilten, aber es war immer nur ein schwacher Trost gewesen, nur Ablenkung. Zazar … Zazar war der eine, den er immer begehrt hatte. Der eine, für den er eine seltsame Liebe empfand. Tief und innig, eine geradezu verzweifelte Liebe.
Doch sein Herz hatte immer nur Surrath gehört.
Immer.
Aber Surrath wartete bereits in der Nachwelt. In der Welt, in die Zazar ihnen nicht folgen konnte. Lugrain war innerlich zerrissen, weil er nicht sagen konnte, was er lieber täte. Hier bei Zazar bleiben oder sterben und Surrath wiedersehen.
Letztlich war es eine Entscheidung, die sein Herz für ihn traf. Er würde sterben. Surrath war der Mann, zu dem er gehörte.
»In Ordnung«, hörte er sich sagen und öffnete die Augen. »Ich bin einverstanden mit dieser Abmachung.«
Die Herrin der Gewässer grinste.
Lugrain hob sein Schwert und legte die Klinge in die andere Handfläche, er zog die silberne Schneide über die Haut. Sie war so scharf, dass er keinerlei Druck benötigte, um Blut hervorfließen zu lassen.
Er streckte die Hand nach unten. »Ein Blutbann.«
Lachend kam die Gottheit auf die Beine. »Nein, König Lugrain, so bannt man einen Dämon. Aber ich bin ein uralter Gott. Zwar vergessen, aber dennoch göttlicher Natur.« Sie umfing sein Handgelenk mit sanften Fingern, führte seine Hand zu ihrem Mund und leckte keck über die Wunde.
Ungläubig zog Lugrain seine Hand wieder zu sich heran. Die Wunde war geschlossen, nur ein leichter Striemen blieb auf der Haut zurück.
»Und wie bannt man einen Gott?«, fragte er befürchtend.
Die Gottheit flog geradezu auf ihn zu und schmiegte sich an ihn wie ein Seidentuch, das von einer warmen Windböe gegen ihn geblasen wurde.
»Mit Schmerz und Blut bannt man Dämonen«, hauchte sie und nestelte mit den Fingern an der Schnürung seines Umhangs. »Mit Freude und Liebe einen Gott.«
Lugrain versteifte sich …
»Ähm.« Er umfing ihre Handgelenke, entfernte sie verlegen und trat nervös einen Schritt zurück. »Ich fürchte, dazu wird es nicht …«
»Oh, verzeiht, König.« Sie lachte sich in ihre Hand, ihre Wangen färbten sich rot. Sie sah an sich hinab und bemerkte: »Das ist die falsche Gestalt, nicht wahr?«
Mit einer schnellen Drehung veränderte die Gottheit ihren Körper. Aus der wunderschönen jungen Frau wurde der anmutige junge Mann der anderen Seite der Statue.
Lugrain blinzelte, zweifelte allmählich an seinem Verstand.
»So ist es recht?«, fragte der Gott mit plötzlich dunkler, rauchiger Stimme.
Lugrain räusperte sich verlegen. »Ich … ähm …«
»Niemand wird es je erfahren«, versprach er mit dunkler Stimme und löste die Spange der weißen Tunika. Sie fiel raschelnd zu Boden, und er stand nackt da. Das mystische Licht aus dem See der Grotte strahlte auf seinen sagenhaften Körper. Er war wunderschön. Anmutige Muskeln, groß und schlank, wie ein junger Schwertkämpfer. Die Schultern breiter als die umwerfend schmalen Hüften … Lugrain hätte ihn gern von hinten gesehen …
Er schüttelte den Kopf. Wusste, dass seine Trance teils davon verursacht wurde, dass er sterblicher Natur war und von einem Gott verführt wurde.
Doch als der Gott an ihn heran schwebte und erneut an seinem Umhang nestelte, hielt Lugrain ihn nicht zurück.
Der Umhang fiel zu Boden, und Lugrain starrte mit dunkler Lust in die großen Augen des perfekten Gesichts. »Was ist deine wahre Gestalt?«
»Ich bin ein Gott«, erinnerte er Lugrain schmunzelnd, »genau genommen habe ich keine wahre Gestalt. Ich bin weder richtig männlich, noch richtig weiblich. Ich bin göttlich.«
Lugrains Finger wanderten wie von selbst in das kühle, dunkle Haar, das ihn vom ersten Anblick an sehr an Bellzazars schönes Haar erinnert hatte. Es war kurz, aber dennoch nicht zu kurz, sodass es ihm ein Leichtes war, in die kräftigen Strähnen zu packen und den Kopf in den Nacken zu zwingen. Vor ihm präsentierte sich eine schlanke Kehle. Er beugte sich vor und fuhr mit der Zunge eine kräftige Sehne entlang nach oben.
Hatte je ein Sterblicher die Haut einer Gottheit kosten dürfen? Selbst wenn es sich hier nur um einen Gott handelte, an den niemand mehr glaubte?
Er hob den Kopf und sah in das lüsterne Gesicht, das ebenso begierig zu sein schien wie er selbst es war. »Wie lautet dein Name?«
Der Gott antwortete schmunzelnd: »Levidetha.«
»Haben wir eine verbindente Abmachung, Levidetha?«
»Ja, König Lugrain.« Levidethas Finger fuhren gespreizt über Lugrains Brustpanzer nach oben und zerrten ihn dann an den Schultern zum Altar. »Liegt bei mir, und wenn Ihr gut genug seid, habt Ihr die See gebannt. Kommt, und nehmt mich. Kostet von dem, das nur wenige vor Euch kosten durften. Zeigt mir, welche Macht in einem wahren König steckt, und wenn sie mir groß genug erscheint, lass ich mich bezwingen.«
»Und wenn nicht?«
Nicht, dass er Zweifel an seinem Können diesbezüglich hätte.
Levidetha grinste: »Nur ein wahrhaft mutiges Herz vermag es, einen Gott zu bannen. Seid Ihr nur dem Titel nach ein König, aber nicht im Herzen, wird Euch meine Macht bei der Vereinigung noch heute Nacht das Leben kosten.«
Aber Lugrain war der einzig wahre König!
»Hoffentlich tötet uns dein Stolz heute Nacht nicht.«
Vertrau mir, so wie ich dir, bat er den Drachenteil in sich.
Lugrain ließ sich zum Altar führen, zarte Finger lösten die Riemen seiner Rüstung, während sein Mund mit den Lippen Levidethas verschmolz. Nach und nach wurde ihm mit spielerischer Neckerei die Rüstung abgestreift. Nach und nach wurden seine Wunden geheilt, nur durch eine sanfte Berührung der kühlen Hände, die über seinen starken Kriegerkörper strichen.
Der Drache in ihm grollte lüstern. »Das ist besser, als ihn zu töten.«
Wenn doch nur jeder Kampf so schön ausgehen könnte …
Lugrain bettete den nackten Körper Levidethas auf dem Blumenmeer des Altars und schob sich nackt zwischen seine kühlen Schenkel. Die Haut, die er berührte, war kühl wie Wasser, an manchen Stellen war es so, als tauchte er die Fingerkuppen in die Oberfläche eines Sees. Levidetha schmeckte nach Salz, wie das Meer, das er beherrschte.
Lugrain beugte den Kopf hinab und legte die Lippen an das Ohr der Gottheit. »Hiermit banne ich dich, Gott der Gewässer«, hauchte er und drang mit einem dunklen Stöhnen in den kühlen Körper ein, der sich ihm augenblicklich entgegenwölbte. »Auf dass du vom heutigen Tage an nur dem wahren Königsblut treu ergeben sein wirst!«
1
Teil 1: Hoffnung in der Not.
Aus der größten Not heraus, werden Helden geboren, die durch die dunkelsten Schatten des Krieges das schwache Licht längst vergessener Hoffnung bringen. Doch die wahren Helden einer Legende, sind nicht so leicht zu erkennen, wie wir glauben möchten.
Er schlug die Augen auf. Und für einen wunderbaren Moment schwebte er zwischen Traum und Erwachen. Für einen kostbaren Moment wusste er nicht, wo er war. Und in diesem kleinen Moment war die Welt noch in Ordnung, das Leben noch erstrebenswert. Doch nur ein weiterer Augenblick musste verstreichen, und seine Erinnerung kam erschreckend klar zurück.
Das Inferno eines roten Sonnenaufgangs fiel durch den dünnen Schlitz samtener Vorhänge und spiegelte sich in dem Silber der Maske wieder, die auf dem Kopfkissen neben ihm lag.
Wexmell gähnte müde und stützte sich zunächst auf einen Ellenbogen. Er rubbelte sich mit einer Hand das zerknitterte Gesicht, war überrascht, dass er sich, seit Wochen der Schlaflosigkeit, endlich mal wieder einigermaßen erholt fühlte.
Es war die erste Nacht, in der er nicht von Tod und Verlust geträumt hatte. Genau genommen, erinnerte er sich gar nicht daran, was er geträumt hatte. Aber es musste etwas Schönes gewesen sein, denn wenn er nach der Erinnerung suchte, fühlte er ein warmes Gefühl in der Herzgegend, fast wie das Gefühl von Freude oder Glück. Und das hatte er die letzten Wochen wahrlich nicht empfunden.
Trotzdem, als er wie jeden Morgen die unberührte Seite in seinem Bett ansah, fühlte er eine innerliche Leere, die ihn in einen tiefen Abgrund zu stürzen drohte.
Wexmell streckte die Hand aus und krallte die Finger in das leere Laken, sein Blick fiel auf die silberne Maske, die er vor jedem Schlafengehen auf dem zweiten Kissen deponierte, um sich seinem Geliebten so nahe wie möglich zu fühlen.
Für einen Moment schloss er die Augen und legte die Fingerknöchel an die kalte Wange, versuchte sich einzureden, er berührte Desiderius‘ Gesicht.
Schließlich beugte er sich vor, gab der Maske einen Kuss und stand endlich auf.
Er öffnete zuerst die Vorhänge und ließ das Morgenrot auf seine blasse, nackte Haut treffen, ehe er nach seiner Kleidung griff und sie mit Blick auf den Sonnenaufgang gemächlich überstreifte.
Großkönig Melecays Schneider hatte ihm auf eigenen Wunsch hin »einfache« Kleider angefertigt. Eine Lederhose aus Bärenleder, robuste Stiefel zum Jagen und Reiten, einen kurzen, dunklen Umhang und ein einfaches, helles Stoffhemd mit Schnürung. Alles ohne jeden Hauch von feiner Seide.
Seine Rüstung wollte er noch nicht anlegen. Er wusste, die Zeit dafür kam gewiss noch früh genug.
Bevor er seine Gemächer verließ, legte er die silberne Maske in eine Schublade einer massiven Ebenholzkommode, machte noch sein Bett, und hinterließ alles so feinsäuberlich, dass er den Bediensteten keinerlei Arbeit aufhalste.
Wie es eben Wexmells Art war, wollte er niemandem zur Last fallen.
Wie jeden Morgen war es noch still in den Räumen und im Hof der dunklen Burg des Großkönigs von Carapuhr. Als er an der Küche vorüberging, hörte er dahinter leise die Köche, die das Frühstück vorbereiteten.
Wexmell verzichtete wie jeden Morgen darauf. Später, wenn er wieder zurückkam, würde er eine Schale warme Ziegenmilch trinken, aber so kurz nach dem Aufstehen war seinem Magen noch nicht danach, etwas aufzunehmen.
Wie erwartet fand er die königlichen Ställe verlassen vor. Bis auf die Pferde und die schnarchenden Wachen, an denen er sich vorbei schlich, weil er die Männer nicht wecken wollte.
Er schmunzelte über sie. Wenn Melecay diese Nachlässigkeit bemerkte, würde er sicherlich toben. Weshalb Wexmell dem Großkönig nichts davon erzählen wollte. Aber er würde den Wachen wohl beim nächsten Antreffen raten, sich zusammenzunehmen. Keiner wusste besser als er, dass jeder Zeit mit Attentätern zu rechnen war.
Wexmells Schritte waren leise, während er die Stallgasse abging. Er öffnete das Tor der neu erbauten Erweiterung und blickte vom Stall aus auf weitläufige Weiden. Das Gras stand hoch und leuchtete saftig grün in der Morgenröte. Über den sanften Hügeln lag etwas Dunst, wie es Carapuhr nach der Nacht eigen war. Die Morgensonne traf auf sein Gesicht, sie warf den Schatten seiner schlanken Gestalt auf den gepflasterten Boden der Gasse. Die Pferde hoben ihre müden Köpfe, einige scharrten mit den Hufen, drängten nervös nach dem Frühstück oder dem Auslauf auf der Weide.
Wexmell wandte sich von dem idyllischen Anblick des Morgennebels ab, der über den Weiden hing, und holte aus einer Kammer seinen eigens für ihn angefertigten Sattel und das Zaumzeug.
Beides legte er vor der Tür seines weißen Hengstes ab. Das Tier war schon wach. Erwartungsvoll hob es den Kopf über die Stalltür und schnaubte Wexmell ins Haar, als wollte es sagen: »Da bist du ja endlich, ich warte schon seit Stunden.«
»Guten Morgen, mein Hübscher!«, verwendete Wexmell die Begrüßung, mit der auch Desiderius seinen Wanderer jeden Morgen begrüßt hatte. Er hob den Arm und strich dem ungestümen Hengst über die breite Stirn, fegte ihm das weiße Haar zur Seite. »Na, bereit für den Ausritt?«
Karic legt seine weichen Nüstern an Wexmells Gesicht und schnaubte ihn erneut an.
Wexmell lachte leise und öffnete die Tür zum Stall.
Lange hatte Wexmell überlegt, wessen Namen er seinem Hengst geben konnte. Für einen Moment hatte er natürlich mit der Vorstellung geliebäugelt, ihn Desiderius zu taufen. Doch das hätte er nicht übers Herz gebracht. Jedes Mal, wenn er das Tier gesehen hätte, hätte es ihn nur an die Leere in seinem Herzen erinnert.
Dann war ihm sein geliebter Bruder eingefallen. Wexmell hatte natürlich all seine Geschwister geliebt, aber er und Karic hatten doch eine ganz besondere Beziehung zueinander gehabt. Der älteste und der jüngste Sohn des Königs, sie waren unzertrennlich gewesen. Sie hatten immer ihre Späße untereinander getrieben, hatten anderen Streiche gespielt, waren ein Herz und eine Seele gewesen, bevor Karic sich mit Silva verlobte, und Wexmell nur noch Augen für Desiderius hatte. Wexmell hatte Karic immer vertraut, ihm wegen seines großen Selbstbewusstsein und seiner leichten Arroganz geliebt.
Eigenschaften, die auch dieser wilde, ungestüme Hengst zeigte. Selbstvertrauen und Eigenwille. So war Wexmell die Entscheidung letztlich nicht schwergefallen.
Als Wexmell in den Stall trat, senkte der Hengst den Kopf und stupste ihn leicht an, forderte Zuneigung und Streicheleinheiten. Wexmell schlang wie jeden Morgen die Arme um den großen Kopf, dessen Stirn sich an seine Brust drückte, und legte das Gesicht an die weiche Mähne seines Pferdes. Für einen Moment genoss er den Trost, dem ihm das Tier jeden Morgen schenkte, als spürte es, dass jeder weitere Tag ohne Desiderius für Wexmell unerträglich war.
Er machte sich los, um Karic zu striegeln, zu satteln und aufzuzäumen. Schließlich führte er das Tier aus dem Stall, holte noch Bogen und einen gefüllten Köcher aus einer Kammer, und ritt aus dem Burgtor, noch bevor die Königsfamilie in ihren Betten erwachte.
Er spürte nicht, dass ihn argwöhnische Blicke von der Mauer aus folgten.
Das wahrscheinlich schönste am wilden Carapuhr war, dass man nicht lange reiten musste, um der Zivilisation zu entfliehen. Unweit der königlichen Burg entfernt, konnte Wexmell auf Karics Rücken in einem tiefen Tannenwald verschwinden. Auch hier lag der Dunst noch dicht über dem Boden, wie an einem frühen Herbstmorgen, dabei war es längst Sommer in Carapuhr.
Kaum hatte er den bekannten Trampelpfad erreicht, der auf eine Hügellichtung hinaufführte, trieb er Karic in den Galopp. Wexmell fiel in den Schwung der Gangart ein. Karic hatte einen sanften Galopp, geschmeidig, Wexmell wurde im Sattel leicht vor und zurück gewogen, wie ein Kind in der Wiege. Er spannte den Oberkörper an, ließ die Zügel etwas lockerer und gab Karic mehr Freiheiten.
Der Hengst nahm sie sich sofort und wurde schneller, etwas ungestümer. Dankbar galoppierte er den schmalen Pfad durch den Wald entlang, nahm mit Freuden jedes Bisschen Freiheit, die Wexmell ihm gewährte.
Reiter und Tier liebten die frühmorgendlichen Ausritte, so still, so einsam, so unendlich frei.
Oben auf dem Hügel angekommen hielt Wexmell im hohen Gras an und stieg ab. Er führte Karic an einen einsamen Baum, der am Rande der sanften Absteige stand, getrennt von all den anderen Bäumen, die die Lichtung umrandeten.
Wexmell musste Karic anbinden, so leid es ihm tat, denn der Hengst war nun mal nicht Wanderer. Wanderer hatte immer freilaufen können, er wäre nie von Desiderius‘ Seite gewichen. Er war wie ein treuer Hund gewesen, mehr Freund als Reittier.
Oh ihr grausamen Götter, selbst das Pferd seines Geliebten hatten sie ihm genommen. Was hätte Wexmell nicht alles dafür gegeben, wenigstens den Hengst wieder herbeirufen zu können, doch keiner konnte sich erklären, wohin das Tier verschwunden war. Es ist in jener Nacht davongelaufen, in der sie überfallen worden waren. Vielleicht hatten Rahffs Männer den Hengst sogar mitgenommen.
Wexmell band die Zügel um den Baumstamm, ließ Karic aber genügend Raum, damit er den Kopf senken und grasen konnte. Dann nahm er Pfeil und Bogen und stakste in den Wald.
Es dauerte nicht lange, bis er das erste Tier im Blick hatte.
In geduckter Haltung schlich er näher heran, den Pfeil locker in den Bogen gelegt, aber noch nicht gespannt. Zunächst hielt er den braunen Fellrücken für eines von Carapuhrs absurd großen Eichhörnchen, doch dann stellte es sich als Kaninchen heraus.
Für einen Moment stockte Wexmell, nicht wissend, was er jetzt tun sollte. Desiderius hatte ihm einst die rührende Geschichte darüber erzählt, weshalb er keine Kaninchen jagte und aß. Genau jene Geschichte kam ihm wieder in den Sinn. Jene Geschichte, und all die anderen, die sie sich damals an dem Fluss erzählt hatten, bevor sie sich im Schutz der hohen Gräser geliebt hatten. Damals, als sie noch so jung gewesen waren, sich gerade erst kennengelernt hatten und herausfanden, was sie von einander erwarten konnten …
Es schien ein anderes Leben gewesen zu sein.
Wexmell atmete tief durch, dann spannte er den Bogen und zielte. Genau wie Luro es ihm unzählige Male gezeigt hatte, hielt er die Luft an und erfasste seine Beute. Er schätzte die Entfernung ab, erwog, ob das Kaninchen sich bewegen würde – und wohin. Korrigierte den Pfeil, zielte etwas höher, mehr links, wegen des Windes. Er musste nur noch loslassen, und …
Er verharrte. Schweiß perlte an seiner Schläfe hinab.
Warum konnte er es nicht? Er aß gern Kaninchen. Er ging gerne Jagen, seit er sicher im Umgang mit dem Bogen war. Er mochte es, den Köchen in der Burg eine Freude zu machen, wenn er ihnen nach dem Ausritt am Morgen frisches Fleisch vorbeibrachte, dass sie für sich selbst zubereiten und ihren Familien mitbringen durften.
Es war doch nur ein Kaninchen, sprach er auf sich selbst ein. Desiderius war nicht mehr hier, um etwas an seiner Beute auszusetzen zu haben. Er würde Wexmell nicht mehr tadeln können, ihm keinen seiner griesgrämigen Blicke mehr zuwerfen können.
Nie mehr.
Und Wexmell würde nie mehr die Gelegenheit haben, ihm diesen zynischen, verbissenen Ausdruck aus den verhärteten Mundwinkeln zu küssen.
Nie mehr.
Wexmell blinzelt die Tränen fort, die ihm in den Augen brannten. Er hatte in seinem Leben jetzt schon wahrlich genug geweint, er war es leid.
Tu es, drängte er sich. Niemand würde daran Anstoß nehmen.
Noch einmal spannte er die Bogensehne, richtete den Pfeil auf das Kaninchen und …
Er konnte nicht.
Ermüdet sackte er zusammen und ließ sich auf die Knie nieder. Seine Arme fielen mutlos an den Seiten herab, in der einen Hand den Pfeil, in der anderen den Jagdbogen.
Wenn er nicht einmal fähig war, ein Kaninchen zu töten, nur weil Desiderius es nicht getan hätte, wie sollte er je über ihn hinwegkommen?
Wobei »hinwegkommen« ohnehin die falsche Bezeichnung dafür war. Wexmell wollte nicht darüber hinwegkommen, dass sein Geliebter jetzt tot war, dass sie sich nie wiedersehen würden. Aber er erhoffte sich doch zumindest, dass dieser elende Schmerz in seinem Herzen langsam abklang. Dass er nachts schlafen konnte. Und dass er nicht jeden winzigen Augenblick seines Lebens daran denken musste, dass er Desiderius verloren hatte.
Es zerriss ihn innerlich so sehr, dass er kaum zu hoffen wagte.
Das Schlimmste, das ihn hätte passieren können, war Desiderius zu verlieren, und genau das war eingetroffen.
Wie sollte er damit umgehen?
Wenn er doch nur irgendein Zeichen erhalten würde. Irgendein Gefühl. Oder zumindest irgendetwas spüren würde, das ihm das Gefühl gab, Desiderius wachte noch über sie alle.
Doch da war nichts. Nichts war von Desiderius übrig. Nichts war geblieben.
Gänzlich unerwartet drängte sich eine Bewegung in sein Blickfeld. Wexmell sah auf und bemerkte ein weiteres Kaninchen, das aus dem Busch hoppelte. Es gesellte sich zu dem anderen, ihre langen Ohren zuckten aufgeregt, ihre winzigen Nasen ruckten schnell auf und ab, ihre Zähne rupften das Gras aus dem Boden und ihre Köpfe flogen nervös hin und her.
Sie bemerkten ihn nicht, zu reglos kniete er da und beobachtete sie.
Das dazugekommene Kaninchen hoppelte dicht an das andere, drängte sich dagegen und stupste es mit dem Kopf an. Sie begrüßten sich. Das eine Kaninchen leckte dem anderen über die Stirn, putzte es sorgfältig, woraufhin das Frühstück eingestellt wurde, und das Kaninchen, das geputzt wurde, seinen Kopf drängend seinem Artgenossen entgegenschob.
Wexmells Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln.
Und dann tat die Natur etwas völlig Unpassendes im Angesicht dieses lieblichen Moments. Der Instinkt der Tiere ging mit ihnen durch. Das eine Kaninchen bestieg das andere und rammelte es ungehalten im Dunst des Morgens.
Für einen Moment sah Wexmell ziemlich belämmert aus der Wäsche, ehe er das Geräusch in seiner Kehle nicht mehr zurückhalten konnte. Er begann leise zu lachen.
»Vermisst du es?«
Wexmell fuhr mit einem leisen Aufschrei herum.
Der Mann hinter ihm, der lässig mit einer Schulter am Baumstamm gelehnt hatte – er musste ihn schon länger beobachtet haben – bedeutete ihm, sitzen zu bleiben.
Wexmell lächelte etwas verlegen. »Was denn? Das Rammeln?«
Lachend schlenderte Allahad auf ihn zu. Er ruckte mit der Schulter, woraufhin sein Falke mit dem rot gefiederten Kopf die Flügel ausbreitete und in den Himmel abhob.
»Die Zweisamkeit«, korrigierte Allahad und setzte sich zu Wexmell auf den feuchten Boden. Er sah ihm schelmisch in die Augen. »Und das Rammeln.«
Wexmell senkte schmunzelnd den Kopf. Da er das Knien leid war, zog er die Beine hervor und setzte sich auf den Hintern. »Ich wusste nicht, dass schon jemand wach ist«, wich er der Frage aus.
Allahad fuhr sich durch sein schulterlanges, unordentliches Haar, das ganz genauso wirkte, als hätte es vor Kurzem erst ein gewisser Jemand mit den Händen durchwühlt.
Für einen Moment beneidete Wexmell Allahad und Luro darum, dass sie einander hatten. Aber das Gefühl dauerte nicht allzu lange an. Dafür war Wexmell einfach zu … nett. Er konnte auf seine engsten und ältesten Freunde nicht neidisch sein, nur weil sie das Glück hatten, dass sie beide noch am Leben waren.
So jemand war er nicht. Und er wollte es auch nicht sein.
»Luro ist auch auf der Jagd«, erklärte Allahad und blickte dann gen Himmel.
Wexmell folgte dem Blick ohne etwas zu erkennen. Zweifellos, so ging es ihm in jenem Moment durch den Kopf, flog Allahads Falke zu dem Jäger im Wald, um über ihn zu wachen.
Nicht, dass Luro Schutz nötig gehabt hätte. Aber so war das eben unter Männern von diesem Schlag. Allahad konnte ebenso wenig wie Luro den Beschützerinstinkt abstellen. Genauso war es Desiderius immer ergangen, obwohl er nach zwanzig Jahren allmählich gelernt hatte, Wexmells Fähigkeiten zu vertrauen.
Wexmell senkte den Kopf und atmete schwer durch. »Er fehlt mir jeden Tag mehr«, gab er müde zu.
»Uns allen«, erwiderte Allahad, und gab Wexmell das Gefühl, mit seiner Trauer nicht gänzlich allein zu sein. Das tat unheimlich gut.
»Willst du etwas hören, das dich kurzzeitig aufmuntern wird?«, fragte Allahad und lächelte Wexmell amüsiert zu.
Wexmell zuckte mit den Achseln. »Ja, natürlich.«
»Der Rammler da …«, Allahad nickte zu den Kaninchen und deutete mit einem ausgestreckten Finger auf sie, » … erinnert mich stark an Luros ungestüme Versuche, den Part des Besteigers zu übernehmen.«
Wexmell drang sich das Bild auf, das Allahad ihm beschrieb. Er brach in Gelächter aus und stieß Allahad mit der Schulter an. »Du bist furchtbar. Und gemein!«
Allahads leises Kichern war dunkel. »Nein, ehrlich. Frag ihn, er wird es nicht leugnen.«
»Danke, doch ich verzichte.« Aber Wexmell war dankbar für den kurzen Moment, den Allahad ihn zum Lachen gebracht hatte. Er wischte sich eine Lachträne aus dem Augenwinkel und sagte aufrichtig: »Danke, Allahad, ich weiß deine Mühen zu schätzen. Aber vergiss nicht, dass es nicht deine Pflicht ist, mich aufzumuntern.«
»Wir sind Freunde«, sagte Allahad ernst, »Familie, Wexmell! Es ist meine Pflicht. Und es ist eine Pflicht, die ich nicht als solche empfinde. Außerdem … wie oft hast du mir mit Rat zur Seite gestanden? Ich will dich trösten, soweit es mir zusteht, weil du es zweifellos auch für mich oder Luro – ach was rede ich da, für einfach alle tun würdest. Jetzt verdienst du es, dass andere für dich da sind.«
Wexmell lächelte ihn teils gerührt, teils traurig an. »Ich danke dir.«
Freunde wie diese zu haben, bedeutete Wexmell alles auf der Welt. Ohne Luro und Allahad wäre er in den letzten Wochen sicherlich in einen tiefen Abgrund gestürzt. Sie hatten ihn immer wieder aufgefangen. Sie hörten ihm zu. Oder er ihnen. Sie gaben sich gegenseitig Trost und Halt. Wie eine Familie es eben einfach tut.
»Luro und ich …«, begann Allahad zögerlich und senkte den Blick zu Boden, »… wir haben beide schon am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, einen Geliebten zu verlieren. Und ich denke … Also ich möchte dir schon seit Tagen etwas sagen, doch weil Desiderius mein engster Freund war, fällt es mir schwer, diese Worte über meine Lippen zu bringen …«
Neugierig betrachtete Wexmell sein Profil.
Allahad sah ihm ernst in die Augen. »Du wirst verzweifelt sein, lange. Du wirst traurig sein, lange. Aber irgendwann, da kommt der Moment … da wirst du dich gut fühlen. Glücklich sein. Und wenn der Moment da ist …«, es war Allahad anzusehen, dass es ihm schwerfiel, weiter zu sprechen, » … empfinde keine Schuld.«
Wexmell begann zu lächeln, denn er konnte mit absoluter Sicherheit garantieren: »Das wird nicht geschehen.«
Allahad nahm gequält den Blick von Wexmell. »Das dachte ich auch einmal.«
»Ich bin nicht du.« Es war kein Tadel, sondern nur eine liebgemeinte Erinnerung.
»Nun denn, vielleicht findest du keine Liebe mehr«, lenkte Allahad ein, weil er wohl zu dem Schluss gekommen war, dass Wexmell für diese Art von Gespräch noch nicht bereit war.
Dafür war es wahrlich noch zu frisch.
Allahad sah Wexmell wieder in die Augen. »Aber du wirst eines Tages wieder etwas anderes als Trauer empfinden. Ob du willst oder nicht. Und ich will dir nur sagen, dass du, wenn es soweit sein sollte, keine Schuld empfinden musst. Ich möchte nur sagen … wir verurteilen dich nicht, ganz egal, was geschieht.«
Die Loyalität seiner Freunde rührte Wexmell bis tief in seine verletzte Seele. Er lächelte Allahad nur dankbar an. Er brachte in jenem Moment keine Worte hervor, die ausgedrückt hätten, wie ergriffen er war.
Er drehte das Gesicht und blickte nachdenklich in den Wald. Allahads Worte gingen ihm einen Moment im Kopf herum. Und er musste sich fragen, was er empfinden würde, wäre er tot und Desiderius noch am Leben. Wenn es anders herum wäre, wenn er von der Nachwelt heraus Desiderius im Leben beobachten und glücklich sehen würde, vielleicht neu verliebt …
Ja, der Gedanke machte ihn für einen Augenblick wütend, doch dann besann er sich wieder.
Das Glück seines Geliebten wäre ihm wichtiger als sein eigenes Empfinden. Denn er wäre dann tot, und Desiderius musste weiterleben.
Wexmell glaubte fest daran, dass es Desiderius nur wichtig wäre, dass Wexmell glücklich war. Wo auch immer er jetzt sein mochte.
Trotzdem fragte Wexmell nachdenklich an Allahad gewandt: »Würdest du es Luro gönnen, wenn du tot und er am Leben wäre? Glück ohne dich?«
Allahad senkte den Kopf, er blieb Wexmell die Antwort schuldig. In dieser Sache kannte Wexmell den eifersüchtigen Schurken ohnehin so gut, dass er die Antwort bereits wusste.
Die Sonne war während ihres Gesprächs weiter gen Himmel gewandert und sandte gemächlich ihre Strahlen durch die Tannenbäume.
Seufzend hielt Wexmell das Gesicht in die Sonne und schloss die Augen. »Darüber mache ich mir gar keine Gedanken, Allahad. Einzig und allein, wo er jetzt sein mag, interessiert mich.«
Er spürte Allahads neugierige Augen auf seinem Profil.
»Die ganze Zeit schon erwarte ich eine Art Zeichen«, gestand Wexmell und streckte die Hand leicht aus, als milder Morgenwind um sie herum einen Bogen beschrieb, sodass ihre Haare zur Seite gedrückt wurden. »Etwas, das mich ihn spüren lässt. In der Luft. Im Wasser. In der Erde, auf der wir sitzen. Im Feuer, das unser Essen wärmt. Irgendwo. Irgendetwas. Aber …«
»Da ist nichts«, flüsterte Allahad traurig, als erginge es ihm ebenso.
Wexmell öffnete die Augen und betrachtete den Schurken. Er saß leicht nach vornegebeugt neben ihm und hatte einen Ast vom Boden aufgehoben, mit dem er Spiralen in den von Tannennadeln übersäten Waldboden malte.
»Ich spüre gar nichts«, sagte Wexmell düster.
Allahad hob verwundert über Wexmells finstere Stimme den Blick.
»Ich müsste doch etwas spüren!«, glaubte Wexmell, ihm war seine Verwirrung deutlich anzuhören. »Das er tot ist! Ich spüre es nicht, Allahad.« Wexmell lehnte sich zu seinem alten Freund und klopfte sich auf die Brust, wo sein gebrochenes Herz schlug. »Hier drinnen müsste ich es doch spüren! Ich habe immer gedacht, wenn er eines Tages vor mir stirbt, würde ich es mit jeder Faser meines Körpers wissen. Es müsste sich anfühlen, als hätte jemand die andere Hälfte meines Herzens rausgeschnitten. Sie müsste tot sein. Aber da ist nichts. Ich fühle mich noch genauso wie zuvor, nur voller Unglauben.«
Allahad forschte mit einem Blick in Wexmells Augen, der deutlich werden ließ, dass er Wexmell zutiefst bemitleidete, weil er ihn für leicht von Sinnen hielt.
Seufzend wandte Wexmell sich ab. Niemand würde es je verstehen. Weil niemand die Tiefe der Liebe je verstehen würde, die Desiderius und er für einander empfanden, ob im Leben oder im Tod.
»Er ist tot, Wexmell«, sagte Allahad einfühlsam, aber erschreckend endgültig. »Wir wünschten alle, es wäre anders.«
Es gab keine Worte, die Allahad begreiflich machen konnten, was Wexmell meinte.
»Vielleicht will dein Herz es nicht glauben, weil du … ihn nicht mehr sehen konntest. Seine sterbliche Hülle.«
»Seine Leiche?«, brachte Wexmell barsch hervor. Ja, nicht einmal diese hatte Rahff zurück nach Carapuhr schicken wollen. Wer wusste schon, was mit Desiderius nach der Hinrichtung geschehen war …
Daran konnte Wexmell nicht denken, ihm wurde übel dabei.
Zumindest, so tröstete er sich mehr schlecht als recht, war Desiderius‘ Leiche dort, wo er immer hatte sein wollen. In ihrer Heimat.
»Es tut mir leid«, sagte Allahad ernüchtert. »Ich bin kein so guter Tröster wie du.«
»Das liegt derweil an dem, den zu trösten du versuchst, nicht an dir, dem Tröster«, sagte Wexmell und zwang sich zu einem Lächeln.
Allahad erwiderte es.
Doch Wexmells Blick glitt wieder ab, seine Miene verdüsterte sich erneut, als er über seine andere Sorge nachdachte, die ihn schon solange quälte. Er musste es loswerden, ehe es ihn verschlang, auch auf die Gefahr hin, seinem Freund die gleiche Angst aufzubürden, die er mit sich herumtrug.
»Ich war tot! Ich war dort, in der Nachwelt. Ich kann mich an alles erinnern, was ich dort gesehen habe …«, verzweifelt nach Rat ersuchend sah Wexmell Allahad in die Augen, » … und wenn er auch tot ist … warum habe ich ihn dann nicht gesehen?« Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Warum waren wir nicht … zusammen dort?«
Diese Frage verschlug Allahad die Sprache. Er öffnete die Lippen, holte sogar Luft, doch dann schüttelte er nur entschuldigend den Kopf.
Tief durchatmend drehte Wexmell das Gesicht gen Wald und starrte in die Leere. »Ist es das, was auf uns wartet?«, fragte er mehr sich selbst als Allahad. »Eine leere Welt, die wir allein füllen müssen? Dürfen wir uns im Angesicht des Todes nicht damit trösten, unsere Geliebten wieder zu sehen, die vor uns von dieser Welt schieden?«
»Er war nicht dort?«, fragte Allahad nach.
»Nein«, bestätigte Wexmell seufzend. »Niemand war dort.«
»Vielleicht … weil du doch gar nicht richtig tot warst«, glaubte Allahad. »Du hast weder Zazar gesehen, noch sonst irgendwen. Vielleicht war alles nur ein Traum.«
»Vielleicht«, stimmte er zu. Aber richtig glauben wollte er es nicht.
Doch was wäre die Alternative? Dass er die Ewigkeit nach dem Tod ohne Desiderius verbringen würde? Das wollte er nicht glauben. Er wollte nicht glauben, dass sie sich nie mehr wiedersehen würden.
Nie mehr …
Der Gedanke machte ihn wahnsinnig.
Und wenn doch, wenn der Tod doch nur eine Ewigkeit der Einsamkeit bedeutete, dann machte es auch keinen Unterschied, ob er lebte oder starb. Genauso gut konnte er sich zusammennehmen und seine mentale und körperliche Kraft dazu verwenden, die Welt der Sterblichen etwas besser zu machen. Seinen und Desiderius‘ Traum zu verfolgen. Seine Versprechen gegenüber Melecay zu halten. In die Heimat zurückkehren. Seinen Freunden die Gelegenheit zur Rache verschaffen.
Für Desiderius‘ Traum, für sich selbst, für Karrah, Luro und Allahad, wollte Wexmell nicht verzagen, weshalb er sich immer noch auf den Beinen hielt, obwohl die Last der Welt ihn allmählich zu erdrücken begann.
Bald würden sie aufbrechen. In wenigen Tagen schon. Sie würden ins gefährliche Elkanasai reisen und einen Kaiser bezwingen.
Oder zumindest den wahnwitzigen Versuch dazu unternehmen.
Melecay tat es aus Angst vor dem Kaiserreich, oder wohl mehr aus Rache und Machtgefühl. Wexmell tat es aus Pflichtbewusstsein, wegen der Sklaven und wegen der Bedrohung, die sich bis nach Nohva ausbreiten konnte.
Erst Elkanasai, dann Nohva. Mithilfe der kaiserlichen Truppen müsste Rahff gezwungen sein, zu kapitulieren. Und wenn nicht, machte es auch keinen Unterschied mehr, er würde sterben.
Wexmell war kein Mensch der Gewalt, so ein Mann wollte er auch nicht sein. Er war auch niemand, der von Hass zerfressen sein konnte. Doch Rahff hatte ihm tiefe Wunden zugefügt, und Wexmell würde das nicht dulden. Allein für Desiderius musste er den Verräter vom Thron stürzen. Trotzdem hoffte Wexmell, Rahff würde aufgeben, um einen Krieg zu verhindern.
Doch bevor es überhaupt soweit war, stand Wexmell noch eine lange Reise und eine gefährliche Aufgabe bevor. Erst einmal musste er lebend nach Elkanasai reisen, mitten ins Herz der Hauptstadt, und irgendwie den Kaiser stürzen, ohne dafür getötet zu werden.
Dazu brauchte es mehr als Mut, es brauchte Gerissenheit.
Er wusste nicht, ob er schon dazu bereit war.
Schlimmer als diese Sorgen, war noch der Gedanke, dass Luro und Allahad durch ihn in Elkanasai zu Schaden kamen, bevor sie die Möglichkeit hatten, ihre Heimat wiederzusehen. Ganz zu schweigen von Karrah, die jetzt Mutter und Ehefrau war.
Wexmell hatte darüber nachgedacht, sie nicht mitzunehmen, aber Karrah war zu eigensinnig. Wenn sie etwas wollte, konnte sie niemand davon abbringen. Sie hatte den Starrsinn von Desiderius, eindeutig!
Der Vergleich ließ ihn lächeln.
Letztlich war es nicht seine Entscheidung gewesen, sondern ihre. Sie würde ihn begleiten, und er würde ihre Zauberkraft vermutlich auch brauchen. Selbst wenn nicht, war es immer beruhigend, eine geschickte Heilerin bei sich zu wissen.
Melecays Bruder Melvin hatte getobt. Er wollte, dass Karrah hierblieb, zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn, dafür wollte Melvin mitreisen.
Da war ihm Melecay jedoch dazwischengekommen. Der Großkönig hatte sein Machtwort gesprochen. Melvin musste in Carapuhr bleiben, er musste das Land regieren, während Melecay und Dainty abwesend waren.
Es stand schon seit Wochen fest, wer bleiben und wer gehen würde. Sie alle warteten teils ungeduldig und teils befürchtend auf den Tag der Abreise.
Als hätte er seine Gedanken gelesen, sagte Allahad nachdenklich: »In Elkanasai reinzukommen wird nicht schwer. Ich befürchte nur, dass es nicht so einfach sein wird, dort lange zu überleben.«
»Nein, das wird es garantiert nicht.« Und Wexmell hatte schon jetzt das unbehagliche Gefühl, dass er Carapuhr nie wiedersehen würde. Das machte ihn traurig, denn er liebte dieses Land.
Allahad wandte ihm das Gesicht zu, als drängte sich ihm urplötzlich eine Frage auf, die keinen Aufschub duldete. »Darf ich fragen, weshalb du dich letztlich doch entschlossen hast, nach Elkanasai zu gehen?«
Wexmell hätte viele gute Gründe nennen können, und alle hätten zu einem geringen Teil sogar der Wahrheit entsprochen. Doch nachdem er kurz den Kopf schuldig hängen gelassen hatte, hob er das Gesicht wieder an und erwiderte Allahads brennenden Blick. »Die Wahrheit?«
Allahad rang sich ein Schmunzeln ab. »Bist du überhaupt in der Lage, zu lügen?«
Wexmell lachte leise auf. »Wohl nicht.« Dann ließ er seufzend und ergebend Schultern und den Kopf hängen. Er starrte in den Nebel, der über den Waldboden kroch und der sich ganz gemächlich verzog, während der Vormittag anbrach.
»Die Wahrheit ist«, hauchte er gestehend, »dass ich hoffte, durch diese Mission vergessen zu können.«
Voller Mitgefühl und Verständnis verzog Allahad seine Mundwinkel. Er legte Wexmell eine Hand auf die Schulter und drückte sie aufmunternd. »Das kann ich gut verstehen. Und ich spreche für Luro und mich gemeinsam, wenn ich sage, dass wir dir guten Gewissens und mit dem Herzen folgen. So wie seitjeher, mein Kronprinz.«
Nur zwei Tage nach diesem Gespräch reisten sie ab, genau einen Tag bevor eine verzauberte Taube mit einer Nachricht aus Nohva im Könighaus Carapuhrs eintraf.
2
Die Pergamentrolle in ihrer Hand knisterte, je fester sie sie umschloss. Ihr Blick gereichte über den Balkon ihrer Gemächer zum fernen Horizont. Sie war nachdenklich, in sich gekehrt, und voller Furcht, während hinter ihr in ihren privaten Räumen ihre Kinder miteinander auf dem Boden saßen und mit Rollo, ihrem Hund, spielten. Eine Amme bewachte die drei Geschöpfe.
Vor ihrem inneren Auge sah sie noch immer die geschriebenen Worte vor sich, die auf dem Zettel standen, den sie eisern umklammerte. Er war schon vor Tagen angekommen.
Flüchte so schnell du kannst mit den Kindern und unserem Ungeborenen zu den Rebellen. Ich treffe dich dort. In Liebe, C.
Cohen.
Endlich hatte er den richtigen Weg gewählt, dachte Sigha bei sich. So lange hatte sie versucht, ihn dazu zu drängen, weil sie selbst nicht mehr hier sein wollte, nachdem ihr geliebter Raaks im Krieg gefallen war. Hätte sie sich damals nicht in Raaks verliebt – dem Kronprinzen – hätte Sigha schon im Jugendalter das Gebirge verlassen, um sich den Rebellen anzuschließen. Gerne auch als Kriegerin. Doch dann hatte sie ein Kind empfangen – und alles hatte sich verändert.
Und auch jetzt, obwohl sie es sich ersehnt hatte, bekam sie Furcht davor, diesen Schritt zu wagen. Stünde nur ihre eigene Sicherheit auf dem Spiel, wäre sie schon vor Tagen aus der Burg geflohen. Es wäre ihr ein leichtes gewesen, da König Rahff noch mit schweren Wunden kämpfte und bettlägerig war. Niemand schenkte ihr große Beachtung.
Sie hätte längst fliehen können.
Doch Sigha zögerte. Denn sie musste auch an die Sicherheit ihrer Kinder denken. Sie waren noch so jung, und Sigha erwartete bereits das nächste. Natürlich wollte sie, dass Cohen sein leibliches Kind in die Arme schließen konnte, doch was für eine Mutter wäre Sigha, wenn sie ihre unschuldigen Kinder in den Krieg führte?
Denn genau das würde wohl geschehen. Die Rebellen waren Krieger, Kämpfer des Aufstandes. Vielleicht hatten Kinder und Schwangere dort nichts verloren.
Andererseits … wie viel sicherer waren sie hier auf der Burg? Die Schavellens hatten es bereits geschafft, Rahffs letzten rechtmäßigen Erben in eine Falle zu locken. Jetzt blieb dem König nicht einmal sein Bastard, denn Cohen hatte sich gegen ihn gestellt.
Warum?
Sigha hätte ihn gerne danach gefragt. Was war dort draußen geschehen? Was hatte Cohens festgefahrene Meinung geändert? Warum dieser plötzliche Sinneswandel?
Letztlich waren die einzig noch verbliebenen Erben der Linie der Youris Sighas Kinder, Marks und Ilsa. Und sie ahnte, dass das kranke Missfallen der Schavellens nun auf sie fallen würde.
Egal, was Sigha tat, ob sie floh oder hierblieb, ihre Kinder waren überall in Gefahr. Und das war das Schlimmste für eine Mutter. Sie konnte ihre Kinder nicht schützen.
Aber sie würde ihr Möglichstes tun.
Zärtlich strich sie sich über die sanfte Wölbung ihres Leibs. Obwohl sie Cohen nicht als Gatten liebte, liebte sie ihr gemeinsames Kind.
Doch wo sollte es aufwachsen? In welche Welt sollte es reingeboren werden?
In ihrer Verzweiflung hatte sie früh an jenem Morgen den Rat der Hexen aufgesucht, die tief im Wald versteckt verweilten, und den Verzweifelten die Zukunft verkündeten.
Wie befürchtet, rieten sie umgehend zur Flucht. Angeblich hätten sie genau das schon vor Monaten kommen sehen. Das Kind in Sighas Leib – sie musste es zu seinem Vater bringen. Nur so würde es überleben.
Was ihr Leben und das Leben ihrer beiden älteren Kinder betraf – die Kinder des Mannes, den sie so sehr geliebt und verloren hatte – hielten die Weissagungen keine Antworten bereit.
Aber so war das mit den Hexen, sie gaben nur preis, was sie preisgeben wollten, um die Geschehnisse der Welt nach ihren eigenen Maßstäben zu formen.
Sigha hatte das immer gewusst, trotzdem suchte sie den Rat des Zirkels, weil sie nicht wusste, wo sie sonst um Rat bitten sollte.
Bei der Kirche? Wie lächerlich das klang, in den Ohren einer Frau, die von ihrer Kirche dazu gezwungen wurde, dem Willen der Männer zu unterliegen.
Trotzdem zögerte Sigha weiterhin, denn sie sorgte sich um Marks und Ilsa, wollte nicht, dass die beiden inmitten eines Krieges heranwuchsen.
Doch fern waren die Kämpfe ohnehin nicht mehr. Sigha blickte auf den düsteren Schatten am Horizont, der sich immer weiter ausbreitete. Die Dämonen nahmen sich all das, was der Krieg bereits in Brand gesteckt hatte.
Ihr Land war dem Untergang geweiht. Und Sigha war zu verzweifelt, um eine endgültige Entscheidung zu treffen.
Jetzt schien es ohnehin zu spät.
Vor wenigen Augenblicken hatte Sigha über das Geschwätz der jungen Amme erfahren, dass König Rahff wohlauf war und seine Gemächer verlassen hatte, um sein Amt walten zu lassen. Der König war nicht leicht zu töten, und jetzt wieder genesen genug, um seine Untertanen zu bewachen.
Dazu zählten auch Sigha und ihre Kinder.
Kaum hatte sie den Gedanken zu Ende gebracht, stieß jemand die Türen zu ihren Gemächern auf, sodass die Kinder mit einem leisen Aufschrei aufsprangen und zurückwichen.
Sigha drehte sich um, sie raffte die Röcke ihres grünen Seidenkleides, das ihrer dunklen Haarmähne schmeichelte – die sie bei Hof hochgesteckt tragen musste – und eilte vom Balkon ins Innere ihrer Räumlichkeiten.
»Was soll das?«, fragte sie barsch.
König Rahffs düstere Miene schlug ihr augenblicklich entgegen. Er war in den Raum gestampft und stand nun groß und imposant vor ihr, hinter ihm die königliche Leibgarde, stumme Männer mit reglosen Mienen, wie teilnahmslose Statuen.
»Nimm die Kinder und geh mit ihnen spazieren, Frida!«, trug er der Amme auf, ohne den starren Blick von Sighas trotziger Miene zu nehmen.
»Ja, Eure Hoheit. Sofort, Eure Hoheit.« Die eingeschüchterte junge Frau legte die Stickerei fort, an der sie gearbeitet hatte, und ging auf die Kinder zu.
Sigha wollte sich ihr in den Weg stellen, als die Leibgarde des Königs plötzlich vorschoss und sie ohne eine Waffe zu heben allein durch seine Körpersprache bedrohte.
Wütend – trotz ansteigender Nervosität – warf Sigha einen Blick ins Rahffs Miene.
Der König sah blass aus, sehr kränklich. Sein Kopf war mit einem nässenden Verband umwickelt, der die eine Hälfte seines Gesichts verbarg. Sigha hatte Geschichten über die tiefe Wunde des Königs gehört, sie jedoch nie selbst gesehen. Neugierig war sie schon, wie das Gesicht unter dem Verband nun aussah.
»Mami?«, quiekte Ilsa ängstlich.
Sigha zwang sich, ihrer Tochter zuzulächeln, die sich dagegen sträubte, aus dem Raum gebracht zu werden. »Schon gut, Schatz. Geh mit Frida. Ich komm sofort nach.«
Die kleine Maus schien skeptisch. Sigha nickte ihrem Sohn zu, der seine Schwester an die Hand nahm und sie mit sich zog, dabei beruhigend auf sie einredete.
Rahff sah ihnen nach und sagte nachdenklich: »Er ist ein tapferer kleiner Bursche. Klug. Stark. Beschützt schon jetzt seine Schwester.«
»Er kommt nach mir.« Es bereitete Sigha Freude, den König zu reizen, indem sie ihren Kindern nur Eigenschaften ihrer eigenen, unbedeutenden Bauersfamilie zusprach, statt zuzulassen, dass Rahff behauptete, Marks könnte nach seinen Vorfahren kommen.
König Rahff ging nicht darauf ein. Er sah Sigha an, doch seine harschen Worte richteten sich an seine Männer: »Lasst uns allein!«
Ohne das geringste Zögern wurde der gebellte Befehl befolgt. Doch Sigha war sich sicher, dass sie vor der Tür ihre Position bezogen.
»Ein einfaches Bitten darum, mit mir zu sprechen, hätte vollkommen genügt!«, sagte sie, nachdem sie alleine waren. Sie hasste die zur Schaustellung von Macht, wie Rahff sie gerade präsentiert hatte.