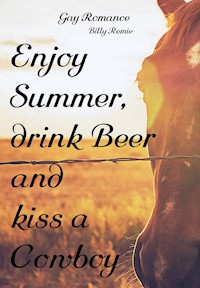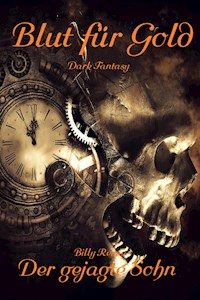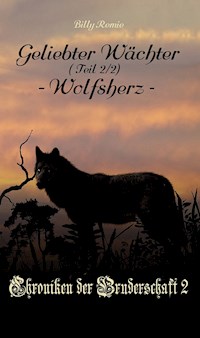
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Bruderschaft 2
- Sprache: Deutsch
Er hat sich das Herz für ihn herausgeschnitten, doch noch ist ihr Bund nicht geschlossen. Zurück in der Welt der Sterblichen, werden Cohens und Bellzazars Gefühle auf eine harte Probe gestellt, denn Cohen sieht sich seiner verflossenen Liebe gegenüber. Bellzazar lässt keinen Zweifel daran, dass er auf Desiderius – seinen eigenen Bruder – eifersüchtig ist, doch für derlei Argwohn ist weder der richtige Ort noch die richtige Zeit. Sie werden gnadenlos gejagt, während sie mit alten und neuen Gefährten durch den tiefsten Dschungel Zadests streifen, um zum Herzen der Herrin zu gelangen, damit sie verbannt werden kann. Cohens neues Leben als Dämon birgt so einige neue Fähigkeiten, die ihn seinem alten Leben ferner - und Bellzazar näherbringen. Es werden Mächte entfesselt, die lieber hätten schlafen sollen, es werden alte und neue Bande geschlossen, dunkle Geheimnisse offenbart und alte Gefühle hervorgebracht. Ebenso erwacht ein neues Feuer, eine Liebe, die Cohen sich zu Lebzeiten nie erträumt hätte. Bellzazar öffnet ihm sein Herz, mehr als je jemanden zuvor. Je dichter der Dschungel und dunkler die Nächte, je heller brennt ihre Liebe. Und Cohens Loyalität wächst, genauso wie seine dunkle Seite. Bellzazar versucht, ihn vor dem Dunkel in seiner Seele zu bewahren, doch wenn das Leben seines Fürsten in Gefahr schwebt, gibt es keinen Preis mehr, den Cohen nicht bereit wäre, zu zahlen. Aber wem gehört am Ende wirklich Cohens Herz? Und werden sie es zum Portal schaffen, um ihre Aufgabe zu erfüllen? – Das Finale des zweiteiligen Gay-Fantasy-Abenteuers "Geliebter Wächter" und Beginn der "Chroniken der Bruderschaft".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1038
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Billy Remie
Geliebter Wächter 2: Wolfsherz
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Teil 1 – Verlorene Söhne des Westens
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil 2 – Lauf des Schicksals
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Epilog
Über den Autor
Impressum neobooks
Teil 1 – Verlorene Söhne des Westens
Hätten wir gewusst, was uns bevorsteht, hätten wir niemals einen Fuß vor die Tür gesetzt. Doch wenn wir nie gewagt hätten, den ersten Schritt zu gehen, hätten wir aufgehört zu existieren.
So gingen wir – wir alle – unserem Schicksal entgegen, obwohl es uns Pflichten auferlegte, die wir uns selbst niemals zugetraut hätten.
Kapitel 1
Es dauerte nur einen Augenblick. Die Stille auf dem Platz. Doch dieser Augenblick schien wie eingefroren, die Welt stand still und das gähnende Schweigen zog sich eine gefühlte Ewigkeit dahin.
Als das Maul des Drachen zuschnappte, erstarrte die Zeit. Von dem Mann, der sich zwischen sie und den Drachen gestellt hatte, war nichts mehr zu sehen, nichts war übrig. Kein Arm, keine Hand, kein Fuß, nicht einmal ein Stück Stoff, er war innerhalb eines Wimpernschlags komplett ausgelöscht. Hätte man in jenem Augenblick, als es geschah, geblinzelt, wäre der Mann wie durch Geisterhand verschwunden, als hätte er nie existiert.
Kacey spürte den heißen Atem des Prinzen im Nacken, der ihn umklammerte und nach dem ersten Schock ungläubig ausatmete. Dessen Arme, die wie dicke Eisenketten um Kaceys Taille geschlungen waren, lockerten sich, als hätten sie von dem einen auf den anderen Moment plötzlich all ihre Kraft verloren. Sie glitten ab und hingen schlaff und nutzlos am Boden.
»Nein«, hauchte jemand in Kaceys Nähe, zudem er sich nicht umdrehte. Er spürte, wie der schlanke Bursche, der den Prinzen und Kacey vom Platz gezerrt hatte, fassungslos auf die Knie sank.
Dann hörte er Gebrüll und das Flackern schwerer Umhänge. Drei in schwarz gewandete Krieger stürmten durch die Reihen der fassungslosen Zuschauer, angeführt von einem schmäleren, kleineren Mann mit goldenen Locken.
Kacey war für einen Moment wie gefangen von dem Krieger, der mit gezogener Waffe furchtlos auf den Drachen – auf Ragon! – zustürmte. Dieser Mann … sah aus wie sein Spiegelbild!
Kacey blinzelte. War dies sein Vater? War dies der Kaiser? Aber er trug nicht das grüngelbe Wappen des Kaiserreichs, er trug einen Drachen, der sich um eine öffnende Lilie schlängelte, auf seinem wehenden Umhang, genau wie die drei Krieger, die ihm folgten.
Ragon warf den Kopf herum, als er die Angreifer bemerkte. Geschickt rollte sich der schlanke Krieger unter Ragons Flügel, wich seinem Schwanz aus und attackierte seine Vorderklaue. Ragon machte einen verwunderten Satz zur Seite und peitschte warnend mit dem Schwanz. Aber die Angreifer setzten ihm nach.
»Nein! Ragon, nicht!« Kacey sprang ebenfalls auf, wollte eine weitere Katastrophe verhindern. Es überraschte ihn, dass ihn niemand aufhielt. Der Prinz, der ihn festgehalten hatte, war wie erstarrt und ließ Kacey einfach davonrennen, genau wie die beiden, die bei ihm standen und in ihrem Unglauben eingefroren schienen.
»Ragon!«, brüllte Kacey dem Drachen entgegen. Doch dieser kauerte sich bereits in Kampfstellung, als seine Angreifer auf ihn zustürmten.
Kacey wollte sich auf seinen geduckten Flügel werfen. Lieber würde er noch einmal Fliegen, als auch nur einen Augenblick länger in dieser Stadt zu bleiben. Er musste hier fort, bevor sie ihn wieder ergriffen und doch noch einsperrten. Wie sollte er ihnen erklären, wer er war und was er wollte? Sie würden ihm jetzt nicht mehr glauben. Und zu allem Überfluss hatte sich Ragon wegen ihm in einen Drachen verwandelt und hatte einfach so einen Mann verschluckt! Einfach so!
Die Angst beflügelte seine Beine, er rannte, als sei die Unterwelt ihm auf den Fersen, dabei war Ragon nicht so weit entfernt gewesen, wie es sich jetzt anfühlte. Der Lauf kam ihm ewig vor, die Entfernung zu dem rettenden Drachen schien endlos zu sein.
Und dann spürte er plötzlich Magie im Nacken, schwer und mächtig knisterte sie in der Luft und ließ ihn beinahe keuchen. So eine starke Energie hatte er noch nie gespürt. Rein instinktiv warf er sich flach auf den Boden und fühlte nur noch den eiskalten Hauch eines Magiegeschosses, das über ihn hinweg flog. Ein Eiskristall so scharf und groß wie ein Drachenzahn flog auf Ragon zu. Er traf seine Schuppen oberhalb des Vorderbeins, doch das beeindruckte ihn nicht.
Drachen waren magieresistent. Das Geschoss vereiste seine Flanke, doch er schüttelte den Frost einfach ab wie lästigen Sand. Dann reckte er den Kopf und zeigte die Zähne, öffnete jedoch nicht das Maul zum Brüllen.
Plötzlich kam Bewegung in die Stadt, die Wachen erwachten aus ihrer ungläubigen Starre und riefen nach Drachenschützen. »Nein!«, brüllte wieder jemand, und dann rannte auch schon der Riese los, der geholfen hatte, Kacey vom Platz zu zerren, um sich mit den anderen Schwertkämpfern auf Ragon zu stürzen. Furchtlos rannte diese wahre Naturgewalt auf Ragon zu und brüllte dabei: »Schießt auf den Flügel! Schießt auf seine Flügel!«
Mehr Eisgeschosse und nun auch Pfeile regneten auf Ragon herab, der den Flügel über den Kopf hob und dann einen mächtigen Satz zur Seite machte, um den verbissenen fünf Kriegern auszuweichen, die seine Unterseite unermüdlich angriffen.
Kacey konnte die Unruhe und Angst in Ragons Augen erkennen, wie ein Tier in der Falle. Er war nicht aggressiv, er hatte nur Kacey beschützen wollen. Ragon wehrte sich nicht einmal richtig, doch das hinderte die Angreifer nicht daran, ihn erlegen zu wollen.
»Verschwinde!«, brüllte Kacey und stemmte sich gleichzeitig hoch. »Ragon! Flieg weg!« Dann rannte er wieder auf ihn zu und winkte, als wollte er ihn verscheuchen. »Flieg weg!«
Seinetwegen sollte Ragon nicht verletzt werden!
Ein unterdrückter Laut entkam der Drachenkehle, als ein Drachenpfeil – ein massiver Pfeil mit einer Silberspitze – ein Loch in seinen Flügel schlug. Das brachte Ragon zum Straucheln. Weitere Pfeile schlugen mit einem dumpfen Laut in seine Flanke und in seinen Hals ein, blieben stecken. Ragon schwankte, als ginge er gleich zu Boden, schüttelte die Pfeile ab und versuchte, sich mit seinen Flügeln zu schützen.
Warum flog er denn nicht weg?
»Nein!« Kacey brannten Tränen in den Augen. Hilflos blieb er stehen und drehte sich mitten auf dem Platz herum. Niemand achtete auf ihn, ein Pfeil verfehlte ihn sogar nur sehr knapp und zerbrach auf dem harten Boden.
»Hört auf!«, brüllte er verzweifelt. »Bitte, hört auf! Er ist nicht böse! Bitte, er ist nicht böse!« Er versuchte, sich schützend vor Ragon aufzubauen, aber niemand hörte auf ihn. Natürlich nicht, er war nebensächlich, gegenüber einem Drachen, der einen der ihren verschluckt hatte. Zumal er vor Ragon vermutlich wirkte wie ein Staubkorn, das sich schützend vor einen Elefanten stellte.
»Ragon!«, schrie plötzlich eine allzu bekannte Stimme über den Platz. Kaceys Kopf flog herum und er hätte vor Erleichterung beinahe geschluchzt. Fen rannte mit wütender Miene über den Platz auf ihn zu. Ragon warf sofort den Kopf zu ihm herum. »Weg hier!«, brüllte Fen und rannte Kacey beinahe um. Er schlang einen Arm um dessen Taille, ohne anzuhalten, und stürmte weiter auf Ragon zu, der seine Angreifer mit einem Schlag seines verletzten Flügels zurückwarf und Fen Deckung vor den Pfeilen gewährte.
Kacey hing wie ein Kleidersack in Fens Arm und wurde durchgerüttelt, als Fen ihn an seine steinharte Seite presste und sich leichtfüßig mit einer Hand an Ragons Schuppen hinauf zu seinem Rücken hangelte. Kacey klammerte sich an ihn und schloss die Augen, wie er es bei ihrem ersten Flug getan hatte. Er spürte das mächtige Beben unter ihnen, als Ragon sich aufbäumte und dann losmarschierte. Mit zwei Sprüngen hob er ab und flog so tief über die Stadt, dass er die Schützen auf den Wällen umwarf. Das wütende und verzweifelte Brüllen der Krieger hallte ihnen hinterher und erschütterte Kacey bis ins Mark. So viel Hass war ihm noch nie entgegengeschlagen.
Was hatte er nur angerichtet? Der Wind peitschte ihm ins Gesicht, während er sich an Fen schmiegte und insgeheim darum betete, dass er nur einen Alptraum träumte.
Kapitel 2
Er war nicht verliebt. Nein, das konnte nicht sein. Er war in seinem ganzen Leben noch nie verliebt gewesen, und er lebte schon ziemlich lange. Er hielt die Verliebtheit für eine Laune der Natur, die nur sterbliche Wesen befiel, da Sterbliche nicht das Wissen innehatten, das er besaß, weil sie schlicht ihren Trieben und Gefühlen unterlegen waren. Wie Tiere in der Paarungszeit.
Er hatte geliebt, gewiss, sehr lange und sehr tief und wahrhaftig. Aber er war nie verliebt gewesen. Es waren zwei völlig verschiedene Dinge. Verliebtheit war flüchtig, aber überschwänglich, sie machte blind und hochmütig. Liebe war anders, sanfter, ruhiger, ewiglich. Das eine war ein Sturm auf hoher See, das andere ein stilles Gewässer, aber dafür tief und unergründlich.
Nein, er war nicht verliebt. Aber etwas war anders als damals, aufwühlender. Bewegender.
Mit mahlendem Kiefer und verschränkten Armen lehnte Bellzazar am Bettpfosten und starrte auf den Mann in seinem Bett hinab. Cohen schlief auf dem Bauch, ein Bein angewinkelt, das andere ausgestreckt und die Arme unter das Kissen geschoben, als umarmte er es. Wie ein Kind, das sich nach Nähe sehnte und stattdessen nur in Stoff gepresste Federn liebkoste.
So schlief er immer, ganz gleich wie Bellzazar ihn ablegte oder aus Interesse drehte und wendete, Cohen rollte irgendwann immer wieder in diese eine Position, das Gesicht nach Süden gerichtet. Bellzazar hatte viel Zeit gehabt, Cohens Schlafgewohnheiten zu studieren, seit dieser sich … wandelte.
Noch war sein Körper nicht vollständig regeneriert, er setzte sich aus dunkler Magie, schwarzen Partikeln und seinen Erinnerungen zusammen. Bellzazar hatte ihm ein Teil seines unsterblichen Herzens eingesetzt und nun floss durch Cohens Venen kein Menschenblut, sondern Wolfsblut. Aber seine Seele musste zunächst noch mit der neuen Hülle verschmelzen, und sie war nicht im einwandfreien Zustand, sie heilte zusätzlich noch. Das konnte dauern. Nachdem er kurz erwacht war und Bellzazar ihm die neue Wahrheit offenbart hatte – dass er nun ein Dämon war – hatte Bellzazar ihn wieder ins Bett geschickt. Cohen war zu schwach gewesen, um zu protestieren. Nun schlief er schon seit einer gefühlten Ewigkeit tief und fest.
Und Bellzazar wachte über ihn, während er ihn mit Blicken durchbohrte und darüber nachgrübelte, was mit seinen Gefühlen los war.
Eines wusste er, er würde keine roten Wangen bekommen, wenn Cohen ihn anlächelte, er würde keinen Blumen die Blütenblätter ausreißen, verträumt seufzen oder gar ihre Initialen in eine Rinde ritzen und mit einem Herz versehen.
Er war nicht verliebt, er hatte nicht das Bedürfnis, sich in jedem Augenblick in Cohen zu versenken, auch wenn ihn die fleischliche Begierde das ein oder andere Mal überkam. Er wollte nicht jeden Moment seines Daseins in Cohens Nähe verbringen, ihn ständig anstarren und ihn immerzu berühren, dem Klang seiner dunklen Stimme lauschen, und überhaupt drehte sich sein ganzes Dasein nicht nur darum, sich an Cohen reiben zu wollen, wie eine läufige Hündin.
Aber eines wusste er, sein zerschnittenes Herz fühlte sich warm und heil an, wenn er Cohen in seinem Bett liegen sah, als gehörte er genau dorthin. Bellzazar wollte, dass er dorthin gehörte, dass er schlicht ihm gehörte. Wenn sie sich berührten, prickelte seine Haut. Cohens Blicke ließen ihn die Einsamkeit vergessen, die ihn wie einen Schatten begleitete. Er sehnte sich nicht immer zu danach, aber wenn es geschah, genoss er es wie nie zuvor.
Und als er dachte, er würde Cohen für immer verlieren, hätte er lieber das gesamte Universum mitsamt allen Welten niedergebrannt, als ihn gehen zu lassen.
Er hätte gar sich selbst oder seinen Bruder geopfert, wenn es nötig gewesen wäre.
Und das machte ihm Angst, denn es hatte noch nie irgendetwas oder jemanden gegeben, das oder den er über Desiderius gestellt hätte.
Bei Cohen war der Gedanke ganz präsent, Bellzazar dachte seit Stunden darüber nach. Was wäre, wenn er vor die Wahl gestellt würde, Cohens Leben gegen Desiderius`? Er war auf die Frage aufmerksam geworden, als ihm auffiel, wie leicht und instinktiv ihm die Entscheidung gefallen war, er oder Cohen. Er hätte sich das Herz auch dann herausgeschnitten, wenn es dafür sein eigenes Ende bedeutet hätte.
Und sein Herz kannte auch die Antwort auf die andere Frage: Cohen. Er würde sich immer wieder für Cohen entscheiden.
Nur, dass dieser sich niemals für Bellzazar entscheiden würde, stünde er vor der gleichen Wahl.
Bellzazar machte sich nichts vor, auch wenn Cohen in seinem Bett lag und duldete, dass er ihn berührte, ihn sogar nahm, seine große Liebe war und würde immer Desiderius sein und bleiben.
Wie tragisch, dachte er bei sich und seufzte. Sein Herz krampfte, aber er ignorierte es. Er kannte das Gefühl, er war gewohnt, zu leiden. Liebe war Leid, deshalb war er auch nie verliebt gewesen. Er hatte diesen verblödeten Zustand immer sofort übersprungen, hatte gleich die Liebe gespürt, die blieb, wenn der Nebel aller Triebe verflogen war.
Trotzdem schmerzte es mehr als sonst, wenn er zu sehr darüber nachdachte. Er schüttelte den Kopf und vertrieb die Gedanken. Er wollte gar nicht so genau darüber nachdenken, wem Cohens Liebe gehörte, im Moment sollte er einfach genießen, dass dieser in seinem Bett lag. Auch wenn nur die Lust auf Fleisch sie vereinte. Das war besser als nichts.
Verdammt, hatte er das gerade wirklich gedacht? Besser als nichts?
Nun ja, irgendwie war dem auch so. Denn Cohen war seitjeher das einzige Geschöpf, das es vermochte, die Einsamkeit zu vertreiben. Und das nicht nur aus diesen Räumlichkeiten, sondern allein durch den Gedanken an ihn aus Bellzazars Bewusstsein.
Nein, nein, neckte ihn eine innere Stimme, du bist ganz bestimmt nicht verliebt…
Nicht verliebt! Er schüttelte den Kopf. Aber er befürchtete, dass es bereits viel schlimmer war.
Schlimmer…
Na ja, wem machte er denn eigentlich etwas vor? Er hatte diese seltsame Anziehung zu Cohen schon gespürt, als er noch bei Desiderius lag. Und es überraschte ihn nicht, Cohen besaß die Jägergabe, zudem auch noch eine besonders mächtige Art davon. Deshalb hatte der Drachengeist in Desiderius auf ihn reagiert, und deshalb reagierte auch Bellzazars innerer Totenwolf auf ihn.
Es brachte nichts, darüber nachzugrübeln, gegen die Macht der Natur kam nicht einmal ein Dämonenfürst an. Sie beschritt eigene Wege und Ziele, die sich dem Einfluss aller Magie entzog.
Wie gesagt, alles, was er wusste, war, dass Cohen in seinem Bett lag, und ihn dieser Umstand mehr als glücklich stimmte.
Er war es schlicht nicht gewohnt, glücklich zu sein. Nicht nach all den Jahrtausenden voller Verachtung, Argwohn, Einsamkeit und Kälte.
Aber jetzt, in diesem Moment war er es. Und damit bewies er mal wieder eine äußerst egoistische Haltung, denn immerhin hatte er Cohen zu einem Dämon gemacht, um glücklich zu sein.
Er konnte nicht behaupten, dass er Reue empfand. Höchstens ein gewisses Bedauern, dass Cohen nun etwas war, dass er abgrundtief verabscheut hatte.
Ob er sich nun selbst hasste?
Bellzazar stieß sich vom Bettpfosten ab und kletterte auf die Matratze. Cohen erwachte nicht, auch als er sich an dessen Seite drängte und ihm über die nackte Schulter strich. Die ausgeprägten Muskeln seines Oberarms fühlten sich so steinhart an, wie sie aussahen, aber die Haut darüber war warm und samten, fast zu weich für diesen strammen Körper.
Er war schön, Cohen war schon immer schön gewesen, das wollte Bellzazar gar nicht bestreiten. Doch ihn überraschte, dass er solch eine lodernde Begierde für einen Mann empfinden konnte. Natürlich hatte er auch bei Männern gelegen und einen Mann geliebt, aber wenn es rein um Begierde ging, stellte Cohen alles in den Schatten. Weiber, Kerle … alles dazwischen. Auf seine starke, männliche Art war er schön, doch sein Gesicht war es, was Bellzazar immer mal wieder den Atem raubte, wenn er unvorbereitet hineinsah. Selbst jetzt im Schlaf barg es diese tiefe, geheimnisvolle Ausstrahlung, eine unerschütterliche Entschlossenheit, Stärke und Stolz. Es wirkte immer ein wenig einsam und verloren, aber nicht schwach. Cohen war wie ein Gestrandeter, der nirgendwo richtig hingehörte, aber immer kämpfte, immer auf der Suche nach … irgendetwas, das nur er kannte. Vermutlich wusste er selbst nicht, was ihm fehlte, um zufrieden zu sein.
Das hatten sie gemein.
Und man wollte ihn retten, ihm eine Hand entgegenstrecken und auf eine schwimmende Insel ziehen. Man wollte das Geheimnis hinter seiner ewig andauernden Melancholie ergründen.
Vielleicht konnte Bellzazar das. Hier und jetzt.
Er rückte an Cohen heran, spürte ein Prickeln unter der Haut, als er dessen Wärme und Geruch wahrnahm. Auch als Dämon roch er nach Frost, der sich über eine Blumenwiese legte. Frisch und lieblich zugleich, das Versprechen auf einen unschuldigen, stillen Morgen.
Bellzazar zog ihn an sich, schloss die Augen und vergrub das Gesicht in seinem seidenen, rotbraunen Haar, um ihn im Traumreich aufzusuchen. Dort, wohin die Dämonen gingen, wenn sie träumten.
*~*~*~*
Er saß mit angezogenen Beinen an einem flachen Ufer und starrte auf einen glitzernden Bach, der sich über graues Gestein einen Weg durch hohe Berge bahnte. In den winzigen Tälern zwischen den Bergriesen waren die Wiesen mit roten Blumen getüncht und teilweiße mit einer puderzuckerartigen Schneedecke bedeckt.
Cohen genoss das Gefühl der Kälte auf der Haut und den Geruch des Frostes in der Nase. Es war der Geruch seiner früheren Heimat. Das südliche Gebirge Nohvas, wo er als Bastard geboren wurde und ein Leben voller Schicksalsschläge angetreten hatte. Doch ihn verbanden auch gute Erinnerungen mit seiner Heimat. Sie war im Krieg immer seine sichere Zuflucht gewesen, dort hatte er sich zum ersten Mal richtig verliebt – wenn auch in den falschen Mann –, seinen ersten Kuss bekommen, seine beste Freundin getroffen, die Kinder seines Bruders großgezogen und ein eigenes gezeugt. Er hatte den Anblick der majestätischen Berge, die über allem thronten, so sehr geliebt. Ebenso wie den Schnee und die weißen Wälder, wenn der harte Winter hereinbrach, meist so plötzlich, dass er die Sommerblumen noch auf den Berghängen einfror.
Doch das hier war nicht seine Heimat, das wusste er, es war nur das, was er sehen wollte. Er war nicht wirklich dort, aber auch die Illusion war schön. Vielleicht sogar noch schöner, denn hier besaß er beide Augen und keine hässliche, zugenähte Augenhöhle verunstaltete sein Gesicht. Hier war er der, der er sein wollte. Zumindest äußerlich. In einer Illusion, in einem Traum, den er selbst träumte, gab es keine Makel. Selbst die Kälte fühlte sich wohltuend und keineswegs schneidend an.
Cohen spürte ihn, noch ehe er ihn hören konnte. Meist konnte man ihn nicht bemerken, er war im Stande, sich völlig lautlos heranzuschleichen, vor allem in dieser Gestalt.
Cohen blinzelte den Wolf an, der am Ufer entlang gemächlich auf ihn zukam. Er war groß für einen Wolf, knochig und kränklich, sein schwarzes Fell wirkte stumpf und fiel an manchen Stellen aus, außerdem waren seine Ohren ein wenig zu lang, schmal und spitz. Ein Monster, durch und durch, wären da nicht diese schwarzen, bodenlosen Augen, die ihm so sehr vertraut waren wie seine eigenen, wenn er in eine spiegelnde Wasseroberfläche blickte.
Der Wolf gab ein Winseln von sich, als Cohen ihn nur ansah, und kam mit geducktem Kopf angetrabt. Er schlug mit der Pfote neben Cohen bittend auf den Boden, kaum, dass er in Reichweite war.
Als Cohen sich nicht rührte, legte Bellzazar sich neben ihm ab und schmiegte mit einem weiteren Winseln den Kopf auf Cohens Schenkel. Große, schwarze Augen sahen zu ihm auf, die durch den Körperkontakt tiefblau aufleuchteten. Die langen Ohren waren eingeknickt und drückten Unterwürfigkeit aus.
Cohen musste sich ein Schmunzeln verkneifen. Bellzazar war vielleicht mehrere Jahrtausende alt, aber er war noch so verspielt und anschmiegsam wie ein hinter den Ohren grüner Bursche. Und damit traf er leider genau Cohens schwachen Punkt. Wie könnte er ihm in dieser Gestalt widerstehen? Wobei dabei ausnahmsweise keine sexuelle Komponente eine Rolle spielte, natürlich nicht. Und genau darum ging es, er fühlte keine Begierde, aber trotzdem raste sein Herz, wenn Bellzazar sich so aufdringlich an ihn schmiegte und seine Nähe und Berührung suchte.
»Weißt du«, seufzte Cohen und kraulte Bellzazar hinter den Ohren, »das wäre herzerwärmender, würdest du nicht halb verwest aussehen.«
Bellzazar gab ein tierisches Schnauben von sich und erhob sich wieder in eine aufrechtsitzende Position, wobei er so majestätisch und stolz aussah wie ein Löwe. »Du bist auch nicht in jeder Lebenslage eine Augenweide, Coco«, knurrte der Wolf.
Cohen zuckte so erschrocken zurück, als habe er sich die Hand an Bellzazar verbrannt, und sackte dabei auf seinen Ellenbogen, um nicht gänzlich umzukippen.
»Was ist?«, fragte der Wolf mit dunkler, grollender Stimme, wobei sich seine Lefzen bei jeder Silbe unnatürlich für einen Wolf bewegten. »Wenn du gerade aufgewacht bist, siehst du aus wie ein betrunkener Katzenbär. Von deinem Mundgeruch ganz zu schweigen.«
Fassungslos starrte Cohen ihn an. »Du … du kannst sprechen?«
Bellzazar schnaubte, dann hob er die Pfote und strich sich über die lange Schnauze, als wollte er sich den Nasenrücken drücken. »Ich bin ein Gott, natürlich kann ich sprechen.«
»Und … das sagst du mir erst jetzt?«, rief Cohen anklagend aus.
Der Blick des Wolfes war so ungerührt wie er nur sein konnte, es fehlte nur noch, dass er mit den Achseln zuckte. »War es denn davor je von Belang?«
Der Konter entwaffnete Cohens Zorn, aber er verzog genervt das Gesicht, als er sich wieder aufrecht hinsetzte. Räuspernd zog er seine Weste glatt und wich Bellzazars Blick aus, indem er wieder auf den glitzernden Bachverlauf starrte.
»Du musst gerade von Mundgeruch sprechen«, konterte er verlegen, »ich kann ihn bis hierher riechen.«
Ein belustigtes Funkeln schimmerte in den Augen des Wolfes, Cohen konnte es im Augenwinkel ganz genau sehen.
Seufzend wandte er seine ganze Aufmerksamkeit wieder der Landschaft zu und nahm sie mit allem, was sie bot, tief in seinem Herzen auf. Bellzazar folgte seinem Blick und spitzte die Ohren, als gefiele ihm, was er sah.
Für einen Moment war es lieblich ruhig und friedlich, so als würde die Zeit stillstehen. Er wünschte, dieser Moment würde ewig dauern und er müsste nie wieder aufstehen. Mit Bellzazar einfach hier zu sitzen und die Verbindung zwischen ihnen zu spüren, die greifbarer war als der Wind um sie herum, erfüllte ihn schlicht mit einem Frieden, den er niemandem hätte begreiflich machen können.
Er hätte es wohl auch nicht zugegeben.
Trotzdem runzelte er nach einem Moment die Stirn und stellte fest: »Etwas ist anders als sonst.«
Bellzazar gab einen Laut von sich, der sich wie ein Seufzen anhörte. »Du bist ja jetzt auch … anders.«
»Wir sind nicht wirklich hier«, warf Cohen ein und betrachtete mit Wehmut die Berge hinter dem Bachverlauf, »das ist nicht die Wirklichkeit.«
»Genau genommen, ist es schon Wirklichkeit, aber eben eine andere als jene, die du kennst«, warf Bellzazar mit seiner knurrenden Stimme ein, »du träumst. Das hier ist das Traumreich. Aber das heißt nicht, dass alles hier nicht auch irgendwie existiert. Was du siehst ist auch dann wahrhaftig, selbst wenn es verschwindet, sobald du die Augen öffnest.«
Cohen verzog die Lippen zu einem traurigen Ausdruck. »Es fühlt sich nicht an, als würde ich träumen, das meinte ich. Ich kann … fühlen. Mehr als je zuvor. Ich kann sogar den Wind fühlen, wie er durch die Bäume zieht, das Wasser, wie es die Steine im Bach schleift, das Leben in den Grashalmen.« Ratlos schüttelte er den Kopf. »Ich konnte in meinen Träumen noch nie irgendetwas fühlen.«
»Weil du ein Mensch warst«, erklärte Bellzazar und streckte dann seinen langen Körper genüsslich aus, ehe er den Wolfskopf wieder unter Cohens Arm hindurchzwängte und sich halb auf dessen Schoß legte. »Wenn Dämonen träumen, wandeln sie durch Träume. Manche von ihnen sind in der Lage, Sterbliche im Traumreich ausfindig zu machen und zu verführen, so können sie von ihnen Besitz ergreifen oder sie gar verzaubern. Du wirst dich daran gewöhnen, dein Verstand schläft eigentlich nie, und jetzt als Dämon nimmst du das ganz bewusst wahr. Das Traumreich ist auch nur eine andere Geisterwelt.« Seine Wolfsaugen leuchteten mystisch, als er beruhigend zu Cohen aufsah. »Deine Seele ist nun in der Lage, sich ganz frei und ganz bewusst hier zu bewegen, als wärest du wach, weil du im Grunde gar keinen Schlaf mehr benötigst. Wenn du in der anderen Welt einschläfst, bist du in dieser Welt wach, und schläfst du in dieser, erwachst du in der anderen.«
Cohen streckte die Beine aus und legte einen Arm um Bellzazars Hals. Sein schwarzes Fell fühlte sich speckig und heiß an, trotzdem grub er die langen Finger tief hinein und kraulte ihn ausgiebig. »Das ist mir zu kompliziert. Sagen wir einfach, als Dämon ist alles etwas anders.«
Der Wolf grollte, was sich wie ein dunkles Kichern anhörte, und rieb mit geschlossenen Augen den Kopf an Cohens flachem Bauch. »Langsam lernst du, nicht alles zu zerdenken.«
»Ja«, seufzte er und musste leicht lächeln. Und es fühlte sich gut an, nicht ständig alles zu hinterfragen und zu ergründen, Erklärungen zu suchen und immer nach Antworten zu forschen. Er hatte viel mehr Zeit für andere Gedanken.
Vielleicht war die Tatsache, dass er jetzt ein Dämon war schuld, aber irgendwie waren ihm gewisse Dinge gleichgültiger als vor dieser Wandlung. Vor allem die Tatsache, wo er war und bei wem er war und was er mit ihm gemacht hatte.
Hatte er zuvor noch eine gewisse Scham und Reue verspürt, wenn er daran dachte, wie er sich Bellzazar einfach hingegeben hatte, wurde ihm bei der Erinnerung jetzt nur noch warm.
Und wäre Bellzazar jetzt in Menschengestalt… Cohen schloss die Augen und stellte sich sehr lebhaft vor, wie er sich rittlings auf diesen rollen und gleichzeitig seine Hand unter das schwarze Hemd gleiten lassen würde. Wie er sich hinabbeugen und seine Zunge in Bellzazars Mund schieben würde. Allein der Gedanke, ihn zu berühren und zu schmecken und ihrer fleischlichen Begierde einfach ohne Hemmung nachzugeben, verursachte ihm einen prickelnden Schauer. Denn er wusste, wie stark sein Körper auf Bellzazar reagierte, wie intensiv sich seine Berührungen anfühlten, und dass er Cohen Erfüllung schenken würde.
Als hätte er Cohens inneren Nervenkitzel gespürt, knurrte Bellzazar leise und hob den Kopf an.
»Du bist jetzt ein Dämon, Coco«, sagte er mit mühsam beherrschter Wolfsstimme, »das heißt, du nährst dich von falschen und bösen Gefühlen. Von Leid, Gier und Wollust. Nicht, dass ich es nicht genießen würde, aber dennoch. Versuch wenigstens, dagegen anzukämpfen.«
Bellzazar erhob sich und schüttelte sein schwarzes Fell, als hätte ihn eine Armee Ameisen erfasst, die er abzuschütteln versuchte.
»Nein!«, sagte Cohen entschlossen und stand auf. »Warum sollte ich?« Er ballte die Hände zu Fäusten und sah entschlossen auf Bellzazar herab. »Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, meine Gefühle zu verschleiern, mich zu verstecken und zu verleugnen. Ich war ein Jäger, der seine Gabe vor der Kirche verbergen musste, für die ich kämpfte, weil mein Vater sich entschloss, ihr zur Macht zur verhelfen. Ich musste meine Liebe zu Männern vor dieser Kirche verstecken, und musste meine Begierde gegenüber meinem Bruder vor allem und jedem verbergen! Ich habe mein Leben lang mich selbst verleugnet und immer in Angst gelebt.« Seine Stimme war aufgebracht, er sprach sich geradezu in Rage. »Ich lebte ein schauriges, lebensfeindliches Leben auf dem Schlachtfeld.«
Bellzazar setzte sich wieder auf seinen fellbesetzten Hintern und legte neugierig den Wolfskopf schief, wobei seine zu langen Ohren wippten.
»Das ist jetzt vorbei!« Cohen ging vor ihm auf die Knie und sah ihm von Angesicht zu Angesicht tief in die blauen Augen. »Ich habe mein Leben im Schatten verbracht, Bell, und es immer dem Dienen anderer gewidmet, habe nie an mich gedacht. Aber jetzt habe ich eine zweite Chance. Du hast sie mir geschenkt! Ich mag ein Dämon und unsterblich sein, aber dennoch ist es eine zweite Gelegenheit, zu dem zu werden, der ich hätte werden können, wenn ich für, statt gegen meine Gefühle gekämpft hätte.«
»Und wer bist du?«, fragte ihn Bellzazar mit gelangweilter Stimme. Er kannte die Antwort, sie kannten sie beide.
Doch davon ließ Cohen sich nicht entmutigen. Er stieß den Atem schwer aus und ließ die angespannten Schultern sinken. »Das gilt es für mich, herauszufinden.«
Einen Moment lang forschten die mystischen Wolfsaugen in Cohens blutroten Iriden, als hielte er sein Gefühlshoch für einen Trugschluss. Vielleicht war dem auch so, vielleicht würde auf die Euphorie, die sein knappes Überleben ausgelöst hatte, ein schwarzes, trostloses Tief folgen.
Aber im Moment ging es Cohen gut und er wollte zuversichtlich bleiben.
»Ich will nicht mehr gegen mich selbst ankämpfen«, erklärte Cohen ruhiger.
Bellzazar verzog die Lefze wie zu seinem berühmten, schiefen Lächeln. »Ich wünschte, du könntest jetzt sehen, was ich sehe.«
Cohen musste schmunzeln. Er spielte das Spiel mit. »Und was siehst du?«
Die Züge des Wolfes wurden bedeutungsschwer, seine Stimme ernst. Wahrhaftig. »Ein Feuer, das heller und heißer als die Sonne lodert.«
Cohen zuckte mit den Achseln und wandte verlegen den Blick an. »Vielleicht bin ich zu überschwänglich, in Anbetracht der Tatsache, was ich jetzt bin. Aber ich fühlte mich nie … stärker.«
»Weil du es bist. Die dämonische Kraft wird sich immer weiter in dir ausbreiten«, warnte Bellzazar ihn und stand auf, um sich mit dem Kopf an seine Brust zu schmiegen. Auf einmal hatte Cohen das Gefühl, als wäre er in seinem Bewusstsein nicht mehr allein, als wäre Bellzazar mit ihm verschmolzen und sandte lebendige Wärme in sein Herz. »Du musst aufpassen, dass dich kein Hochmut befällt, Coco. Kämpfe gegen deine dämonische Seite an, dann wirst du nicht zu dem, was du einst abgrundtief gehasst hast.«
Cohen geriet ins Grübeln. Er schlang den Arm um Bellzazars Hals und legte den Kopf auf seinen. Er horchte tief in sich hinein und spürte die Kräfte in seinem Inneren gegeneinander aufbegehren. Da war der Wille, alles gleichgültig werden zu lassen und nur noch an sich selbst zu denken, stärker und unbesiegbar zu werden, sich gar an jenen zu rächen, die ihm einst Leid zugefügt hatten – nicht, dass davon noch jemand lebte. Aber da war auch … Wärme und Liebe, die ihn ermahnte, sich vor dem Hass in Acht zu nehmen.
Es fiel ihm nicht schwer, die Liebe festzuhalten, er musste nur an eine gewisse Person denken.
»Du weißt, ich würde nie jemandem absichtlich Leid zufügen«, sagte er laut zu Bellzazar.
»Das nicht«, stimmte der Wolf zu, »wenn jemand dazu gemacht ist, seiner dunklen Seite zu widerstehen, dann du. Aber so leicht ist es nicht, Coco. Du musst niemandem wehtun, um deine dämonische Seite zu füttern, es genügt bereits, wenn du in die sterbliche Welt trittst und jemand in deiner Nähe Leid empfindet. Du wirst es aufsaugen wie trockene Erde einen Tropfen Regen.«
Cohen verspürte nun doch einen Anflug Nervosität. Er hob den Kopf und Bellzazar sah ihm ins Gesicht. »Dann kann ich gar nichts tun, um es zu verhindern? Es passiert einfach? Ich werde mich einfach an dem Leid anderer laben, bis ich kalt und unberechenbar werde?«
»Doch, du kannst etwas tun, ich werde dich lehren, das Leid auszuschließen oder es zumindest in dir einzuschließen, statt dich daran zu weiden.« Seine Wolfsaugen begannen tiefblau zu schimmern und erweckten eine Anziehungskraft, die stärker war als jedes warme Leuchten in tiefster, kalter Dunkelheit. »Ich werde mich um dich kümmern.«
Und Cohen hegte keinen Zweifel daran. Nicht seit … Sein Blick fiel auf die Narbe, die sich über die Brust des Wolfes schlängelte. Es wuchs kein Fell dort, weil die Narbe zu frisch war.
Auch Cohen konnte seine Narbe noch spüren, sie spannte und erinnerte immer wieder an das, was geschehen war.
Als könnte er es je vergessen, dachte er bei sich.
»Zazar!« Der panische Ruf durchhallte das gesamte Traumreich. Cohen riss den Kopf hoch, die wunderschöne Stimme schien von überall und nirgendwo herzukommen. Als würde sie über ihnen schweben, wie ein Gott, der aus dem Himmelsreich zu ihnen hinab rief. So fern lag er mit seinem Vergleich nicht, denn er kannte die Stimme.
Bellzazar bog den Kopf, als würde er lauschen.
»Zazar!«, brüllte Korah erneut.
Cohen stand auf und sah sich im Gebirge um, doch es war leer, nicht einmal ein Tier war in den bewaldeten Berghängen auszumachen.
»Korah«, sagte Bellzazar zu ihm, »er ist in unser Zimmer gestürmt.« Dann lauschte er wieder und blickte gen Himmel, als könnte er Korah beobachten, doch als Cohen den Kopf in den Nacken legte sah er nur weiße, flauschige Wolken.
»Bellzazar! Vater!« sie lauschten der angespannten Pause. »Cohen!« Cohen war es, als rüttelte ihn jemand, wobei das Gefühl seltsam … fern war. Wie ein Windhauch unter der Kleidung. »Ihr müsst aufwachen«, rief Korah aufgebracht. »Zazar, du musst sofort kommen, es ist etwas Schlimmes passiert!«
Cohen sah nervös zu Bellzazar. Der Wolf schloss die Augen und gab ein tierisches Murren von sich.
»Ich glaube, es ist an der Zeit, aufzuwachen.«
Kapitel 3
Der nächste Donner ließ ihn zusammenzucken. Das Zimmer war stockdunkel, aber draußen tobte ein wütender Sturm, laut und bedrohlich, wie ein Ungeheuer, das über die Burg gekommen war und alles unter sich zermalmen wollte.
Mit großen angstgeweiteten Augen zog der Junge im Bett die purpurne Samtdecke über die Nase und rutschte tiefer in die vielen Kissen. Er konnte den Blick nicht von dem Fenster nehmen, durch das trotz der schweren Vorhänge das Licht der Blitze durchzuckte. Es warf grässliche Schatten durch einen Schlitz in dem zugezogenen Stoff, die Drachenstatuen und knorrigen Bäume aus dem Garten zeichneten immer wieder kurzweilen Monster auf die Wände in seinem Gemach. Große Monster mit Klauen und Reißzähnen, die sich über dem Bett aufbäumten und sich auf ihn werfen wollten.
Der Junge hatte schreckliche Angst und kroch beim nächsten Blitz, der einen dämonischen Schatten in sein Zimmer warf, mit einem panischen Laut aus seinem übergroßen Bett.
Er versteckte sich unter der Matratze, doch das brachte nichts, seine Angst hatte so beharrlich wie ein Monster die Krallen in ihn geschlagen. Ihm ging es nicht gut, ihm war übel und er hatte bereits seit dem Einschlafen schlimme Alpträume. Aber er hatte nicht gewagt, nach seinem Vater zu rufen. Der tobende Sturm jagte ihn jedoch solche Furcht ein, dass er keinen Augenblick länger glaubte, allein sein zu können, ohne panisch los zu kreischen.
Die Angst übermannte ihn und ließ ihn mit Tränen in den Augen aus dem großen, leeren, beängstigen Gemach flüchten. Doch als er die Tür zum hell erleuchteten Gang öffnete, drehte er sich noch einmal um, rannte auf nackten Sohlen zum Bett und schnappte sich ein Kissen – als Waffe oder nur zum Trost – und rannte dann hinaus, dem warmen Licht der Fackeln entgegen, die die ganze Nacht in den Fluren der Festung brannten.
Im Licht beruhigte sich sein rasender Herzschlag etwas, aber noch immer fürchtete er sich. Der Donner grollte über die nackten Wände, der Berg, auf dem die Festung stand, schien zu beben, es krachte und splitterte bei beinahe jedem Blitz, mal nah, mal fern. Die Wachhunde bellten und der Regen setzte überlaut ein, wie unheilvolle Trommeln, die immer schneller schlugen.
Er wollte nicht allein sein, seine kindliche Angst saß zu tief und er sehnte sich nach dem Schutz und der Wärme seiner Eltern.
Er rannte natürlich zuerst den Flur entlang zur Turmtreppe und hinauf zur Tür seiner Mutter. Natürlich eilte er zu seiner Mutter, wie es vermutlich jeder Junge getan hätte. Mit dem Kissen an der Brust, das fast so groß war wie er, blieb er jedoch unschlüssig stehen, statt zu klopfen. Er drehte langsam den Kopf über die winzige Schulter und blinzelte. Im Turm des Hexenzirkels war es finster, kalt und grabesstill, sodass der Donner noch lauter hallte als in seinen Gemächern. Die Blitze stachen durch die Buntglasfenster, als wollten sie dem Ungeheuer, das über die Festung gekommen war, den Standort des Jungen preisgeben.
Panisch wollte er in das Zimmer seiner Mutter stürmen, doch wie immer rannte er nur gegen eine verschlossene, schwere Tür. Sie öffnete auch nicht, als er mit einer Hand aufgebracht gegen die Tür schlug und nach ihr rief. Tränen rannen über seine zarten Wangen, aber seine Mutter erhörte seinen Ruf nicht.
Das hatte sie nie, sie brauchte Ruhe, um ihre Kräfte aufzufüllen, deshalb durfte er niemals nachts zu ihr ins Bett kriechen. Er sei ein Junge und müsse lernen, seine Angst zu besiegen. Trotzdem führte sein kindliches Herz ihn immer wieder zuerst zu ihr.
Der Turm wirkte bedrohlich, verlassen, der Junge kam sich unerwünscht vor, einsam. Wieder ließ ihn die Angst rennen, dabei stolperte er beinahe die Treppe des Turms hinab. Als er dieses Mal in das Licht der Flurfackeln tauchte, beruhigte er sich nicht. Aus irgendeinem unbestimmten Grund hatte er plötzlich Angst, ganz allein zu sein. Dass ihn seine Familie verlassen hätte. Dass seine Mutter vielleicht gar nicht in ihrem Zimmer war, sondern verschwunden, und sie deshalb nicht öffnete. Vielleicht waren sie vor dem Unwetter geflohen und hatten ihn vergessen. Furcht ließ ihn weinen und schneller laufen. Es war still, zu still, und die Festung wirkte bei Nacht noch riesiger und verwirrender als je zuvor. Er war drauf und dran, sich unter einer Fackel zusammen zu kauern und nach einer Wache zu rufen, die nachts die Treppenaufgänge bewachten.
Doch bevor seine Furcht ihn gänzlich übermannte, schafften es seine zitternden Beine, ihn zu der Tür seiner Väter zu tragen.
Sie war geschlossen, das wunderte ihn, sie war niemals geschlossen, sondern immer nur angelehnt. Aber eine Flut anheimelnden Lichts sickerte durch den Türspalt hervor. Er atmete erleichtert auf, er war nicht allein, seine Familie hatte ihn nicht einfach mitten in der Nacht verlassen.
Mit tränennassen Wangen stampfte er in kindlicher Manier auf die Tür zu und drehte den Knauf ohne zu klopfen.
»Vater…?«, begann er mit leiser, heller Stimme und spähte in den Raum hinein.
Das Kaminfeuer brannte wie frisch entzündet, überall standen Kerzen und fluteten den Raum, und die Samtvorhänge waren fest verschlossen. Natürlich waren sie das, seine Väter schlossen die Vorhänge immer richtig, es war die Frau, die ihm das Leben geschenkt hatte, die sie immer nur nachlässig zuzog, sodass das Mondlicht Schattenmonster an die Wände malen konnte, vor denen er sich jede Nacht vor dem Einschlafen fürchtete.
»Vater?«, hakte er nach, dabei bebte sein Stimmchen. Er öffnete die Tür noch weiter und suchte mit tränenverschleiertem Blick den Raum ab.
Sie waren im Bett. Zusammen. Aber sie schliefen nicht und sie bemerkten ihn auch nicht. Ihr amüsiertes Gelächter auf den Decken und ihr nacktes Gerangel übertönte den Sturm.
Der Junge erschrak sich und zog den Kopf zurück, mit hochroten Wangen zog er schnell die Tür zu. Er wusste nicht ganz genau, was sie taten, aber natürlich hatte er eine Ahnung, dass es nicht für seine Augen bestimmt war. Und dass sie gerade keinen Platz für ihn hatten.
Schon einmal hatte er sie gestört, als sie unbekleidet gekämpft hatten – so hatten sie es genannt. Doch damals hatten sie ihn bemerkt und zu sich geholt, doch irgendwie wollte er sie nicht noch einmal stören. Es war ihm peinlich, was er gesehen hatte. Unsagbar peinlich.
Aber immerhin waren sie da und ihr gedämpftes Gelächter war durch die Tür zu vernehmen, sodass er sich davor kauerte und das Kissen umarmte. Müdigkeit überkam ihn, als sich sein Herz etwas beruhigte. Falls die Monster zurückkämen, waren seine Väter jetzt zumindest ganz nah.
»Hast du Angst?«
Erschrocken sah er auf, als sich ein kleiner Schatten aus einer Nische löste. Sein Bruder trat hinter einer mannshohen Vase hervor und setzte sich neben ihn.
Riath nickte nur und grub die Nase in sein Kissen, weil er sich für seine Furcht schämte. Angst machte einen Mann schwach, sagte seine Mutter immer.
»Ich auch«, gestand Xaith und schürzte die Lippen. »Mutter sagt, ich solle es aussitzen.«
Riath sah ihn an. »Meine Mutter hat die Tür verschlossen.«
Xaith nickte. Er fummelte nervös an seinen Fingern, weil er kein Kissen hatte, an das er sich klammern konnte.
Eine Weile saßen sie so da, während der Sturm wütete und es im Zimmer ihrer Väter stiller wurde. Sie hatten sich selten etwas zu sagen, waren sich aber in diesem Moment seltsam nahe. May und Sarsar schliefen vermutlich bei ihren Müttern, Vaaks bekam vermutlich nicht einmal etwas von dem Sturm mit, denn nichts brachte ihn aus der Ruhe.
Aber sie… sie waren allein, wenn die Tür ihrer Väter geschlossen war.
Seltsamerweise war die Nähe zu seinem stillen Bruder tröstend. Riath wurde schläfrig, er musste gähnen. Und als aus dem Gemach hinter ihnen ein seltsames Klopfen ertönte, sah Xaith ihn an.
»Willst du in mein Bett kommen?«, fragte er und seine Drachenaugen leuchteten im Schein der Fackeln wärmer und anheimelnder als es jedes Kaminfeuer vermocht hätte.
Riath hätte vor Erleichterung beinahe eine Träne verloren, doch er nickte nur steif.
Sein Bruder nahm ihn an der Hand und zog ihn hoch, gemeinsam schlurften sie zu ihrem Flur zurück.
»Ich lasse einfach die Tür auf«, sagte Xaith, »dann vertreibt das Licht aus dem Flur die Schattenmonster.«
Normalerweise machten Riath und Xaith sich über die Ängste des anderen lustig, aber nicht in jener Nacht. Riath nickte nur stumm und drückte sein Kissen an sich. Xaiths Zimmer war kleiner und wirkte dadurch nicht so bedrohlich, weil man alles erkennen konnte. Es gab weniger finstere Ecken, in denen etwas Böses lauern konnte.
Zusätzlich zündete Xaith für Riath noch eine Kerze im Raum an, obwohl ihre Väter ihnen verboten hatten, Licht brennen zu lassen, wenn sie schlafen gingen, aus Furcht, etwas konnte Feuer fangen.
Erst als Xaith um ihn herum ging, krabbelte Riath auf das Bett und schlüpfte unter die warme Decke. Xaith legte sich zu ihm und sie rückten nahe zueinander. Riath zitterte trotzdem, als es lautstark donnerte.
»Hab keine Angst, Riri, gemeinsam sind wir stark. Kein Monster kann uns holen, wenn wir zusammen sind«, beruhigte Xaith ihn und strich ihm über den Kopf.
Selbstverständlich schmiegte Riath die Wange an die schmale Schulter seines Bruders und legte einen Arm um ihn, sowie Xaith einen um ihn legte.
»Schlaf«, sagte Xaith, »ich passe auf dich auf.«
Und Riath glaubte ihm, denn obwohl sie gleichalt waren, hatte Xaith immer auf ihn aufgepasst.
Sie schliefen wieder ein, während der Sturm seinen Höhepunkt erreichte, doch er konnte ihnen keine Furcht mehr einjagen. Jetzt nicht mehr.
Fortan rannte Riath nicht mehr zuerst in den Turm, wenn er sich nachts fürchtete, er rannte immer wieder zu seinem Bruder, dessen Tür immer offenstand. Bis sie beide zu alt waren, um sich noch vor Schattenmonstern und Donner zu fürchten…
Er schlug die Augen auf, als im Nebenraum eine Tür knallte, ansonsten blieb er unbewegt. Noch immer herrschte eine hörbare Aufregung in der Villa und auch in der ganzen Stadt, Wachen trabten umher, Ratgeber rannten von Zimmer zu Zimmer, Drachenjäger wurden gerufen.
Die Bestie war zwar fort, aber auch der König von Nohva.
Allmählich machte sich der Schlafmangel bemerkbar, in seinem Kopf fühlte sich alles seltsam dumpf an und er spürte ein stetig stärker werdendes Hämmern unter der Schädeldecke, seine Augenlider waren schwer und gereizt, selbst das Atmen war ein Kraftakt.
Riath bewegte sich ein wenig auf seinem Stuhl hin und her, um seinen steifen Rücken zu lockern, doch das brachte nichts. Er war hundemüde, wie man zu sagen pflegte, doch an Schlaf war nicht zu denken. Nicht nachdem … nachdem er zugesehen hatte, wie sein Vater im Maul des Drachen verschwand, und nichts dagegen unternommen hatte.
Er war wie gelähmt gewesen. Er und Xaith. Sie hatten nichts getan, einfach nur mit offenen Mündern zugesehen, unfähig, sich zu bewegen. Sie schämten sich, Riath wusste, dass Xaith sich genauso schlecht und schwach fühlte wie er, er sah es in dessen aschgrauen Gesicht.
Es war schrecklich gewesen, diese lähmende Fassungslosigkeit, die Angststarre und das Gefühl, des Unglaubens, das alles wie in einem Alptraum wirken ließ.
Riath stand noch unter Schock, er konnte und wollte nicht glauben, was geschehen war. Und als er sich in dem Raum umsah, in dem sie beisammensaßen, erblickte er die gleiche Starre in den Gesichtern seiner Geschwister.
»Es geht ihm gut!« Wexmell versuchte, ihnen seine Furcht nicht zu zeigen, aber sie konnten sie spüren. Sie kannten Wexmell immerhin ihr ganzes Leben, und er war nie aufgebracht im Zimmer auf und ab gegangen und hatte mit Tränen gekämpft. Aber für sie wollte er stark sein. »Ich wüsste es, wenn es nicht so wäre!«
Riath beobachtete ihn, wie er in seinem Gemach ruhelos auf und ab ging und sich die Brust rieb, als krampfte sein Herz.
Sie hatten sich alle auf das Zimmer ihrer Väter zurückgezogen, als der Drache auf und davon war. Wexmell hatte ihm nacheilen wollen, aber seine Pflicht ihnen gegenüber hatte ihn hiergehalten. So hatte Kaiser Eagle Späher und Drachenjäger ausgesendet, die dem Drachen gefolgt waren.
Sie warteten nun auf eine Nachricht von diesen.
Riath hoffte, es wäre nicht die Nachricht, dass ihr Vater nicht wieder kommen würde…
Der Gedanke schmerzte so sehr in seiner Brust, dass er sie sich ebenfalls rieb und sich auf seinem gepolsterten Stuhl, der neben der Tür stand, nach vorne lehnte.
May und Sarsar saßen steif auf der Bettkante, Sarsar war ein Grauen ins Gesicht geschrieben, wie Riath es bei seinem Bruder noch nie gesehen hatte. Sarsar war immer … eine Spur gleichgültig. Nicht aber an jenem schicksalshaften Morgen, als die Dämmerung am Horizont einen Lichtstrahl zeigte, und sie annahmen, ihr Vater, der König, wäre für immer von ihnen gegangen.
Sie hatten es nicht kommen sehen, sich nie vorstellen können, einer ihrer Väter könnte von jetzt auf gleich von dieser Welt scheiden.
Der einzige, der wie immer recht gefasst wirkte, war Vaaks. Natürlich Vaaks. Der ruhige Riese, dachte Riath bei sich und mahlte mit den Kiefern. Mit durchbohrenden Augen starrte er hinüber zum Fenster, wo Xaith noch immer wie eine Statue des Grauens vor sich hinstarrte, genau wie an jenem Tag, als er seine Mutter getötet hatte, nur dass ihm jetzt kein Blut im Gesicht klebte. Er saß auf der Fensterbank und seine Schultern hingen tief. Vaaks setzte sich neben ihn – dicht neben ihn, zu dicht – nachdem er eine Weile aus dem Fenster gesehen hatte, und fuhr mit seinen kräftigen Fingern zwischen Xaiths schlankere, beinahe filigrane Finger, um sie festzuhalten, und drückte aufmunternd zu.
Wie selbstverständlich lehnte Xaith sich an Vaaks` starke Schulter und rieb die Wange daran, um eine stille Träne fortzuwischen, genau wie Riath es damals in dieser stürmischen Nacht bei ihm getan hatte.
Er hasste es, die beiden so eng zusammen zu sehen, er hasste es abgrundtief. Und er hasste den Umstand, dass er nicht einfach aufstehen und Xaith in den Arm nehmen konnte, um in dessen Wärme und Geruch zu versinken und die Angst um ihren Vater zu teilen, wie sie früher immer die Angst vor der Dunkelheit geteilt hatten.
Er fühlte sich allein, regelrecht im Stich gelassen.
Riath hasste die Kluft zwischen ihnen so sehr, aber noch mehr hasste er es, wenn jemand anderes Xaith tröstete, wenn er sich tief im Inneren nach Xaiths Trost sehnte.
Aber er konnte niemandem außer sich selbst die Schuld darangeben, dass Xaith ihm ferner war als alle anderen in diesem Raum. Er hasste sich selbst für das, was aus ihm geworden war.
Wexmell ging noch immer nervös im Zimmer auf und ab, jeder Augenblick, in dem sie keine Neuigkeiten erfuhren, zog sich quälend langsam dahin. Die Zeit war wie Sand, der sich durch eine winzige Öffnung drängte und träge hinabrieselte. Jetzt brach der Morgen an, aber die Nacht hatte sich angefühlt wie drei ganze Tage Dunkelheit und Ungewissheit.
»Er kommt zurück«, Wexmell nickte, als redete er es sich selbst ein, »es geht ihm gut, ich weiß, dass es ihm gut geht, ich …«
May stand plötzlich auf und stellte sich ihm in den Weg. »Ganz bestimmt«, sagte sie, obwohl in ihren Augen die gleiche Hoffnungslosigkeit wie in allen anderen stand. Sie rieb beruhigend Wexmells Arm, als dieser sie ansah, als würde er sie nicht erkennen, er blinzelte verwundert.
»Du solltest zu Kaiser Eagle gehen, Vater«, schlug sie vor, »er wird von seinen Spähern doch sicher zuerst über Neuigkeiten unterrichtet.«
Wexmell verzog zweifelnd das Gesicht und sah alle im Raum nacheinander an. »Aber ich kann euch doch jetzt nicht …«
»Geh!«, forderte Vaaks ihn auf und nickte ihm zu. »Wir kommen zurecht.« Dann sah er Xaith an und legte einen Arm um ihn, denn er hatte die Augen geschlossen.
Riath musste ein tiefes Knurren unterdrücken. Zwischen denen beiden war etwas passiert, er konnte es geradezu riechen. Sie waren sich nähergekommen, ihre ganze Körpersprache schrie es heraus. Wie nahe sie sich waren, wie selbstverständlich sie sich berührten und anlehnten. Es war offensichtlich, dass sie sich auf eine Weise nähergekommen waren, die ihm unter gar keinen Umständen gefiel.
Wexmell zögerte noch, doch dann siegte seine eigene Unruhe. »In Ordnung, aber bleibt hier«, er ging bereits zur Tür, »der Orden bewacht den Gang.«
Es war unsinnig, aber sie nickten nur noch. Als ob es der Drache nur darauf abgesehen hätte, zurück zu kommen, um auch noch sie zu verspeisen, und dann auch noch durch die Tür kommen würde…
Aber keiner wollte Wexmell jetzt widersprechen, ihr Vater war schon aufgebracht genug.
Als sich die Tür hinter ihm schloss, ging May zu Vaters Tisch und schenkte ihnen allen Wein ein. Ohne ein Wort ging sie reihum und verteilte Kelche. Vaaks und Sarsar nahmen einen, aber Riath lehnte ab, und Xaith öffnete nicht einmal die Augen, obwohl er wach zu sein schien, denn seine Atmung ging schnell.
Riath wollte jetzt nicht trinken, der Wein machte ihn gleichgültig und unberechenbar, außerdem fühlte sich sein Magen flau an. Er hatte auf dem Fest schon zu viel getrunken, hatte mit May einen Saufwettbewerb veranstaltet und war von ihr unter den Tisch gesoffen worden. Doch als er die schimmernden Schuppen gesehen hatte, war er schlagartig wieder nüchtern gewesen. Aber nicht die Schuppen des Drachen, sondern jene auf einem schmalen, schwungvollen Rücken...
May stellte sich wieder an den Tisch, hob den Kelch und raunte: »Auf Vater!«
»Auf Vater«, stimmte Vaaks rau mit ein – und sie tranken.
Sarsar jedoch streckte den Arm aus und kippte den Kelch, ein Schluck Wein tröpfelte zu Boden und er sagte leise: »Für die Alten Götter.« Dann stellte er den Kelch auf den Boden, ohne davon getrunken zu haben und kniete sich neben die kleine, rote Pfütze. Verwundert beobachteten sie ihn, als er sich darüber beugte und in tiefe Konzentration verfiel.
»Was machst du?«, fragte May.
Aber Sarsar hob nur eine Hand, um ihr zu bedeuten, dass sie schweigen sollte.
May sah Riath an, und sie zuckten beide mit den Schultern. Sie hatten jetzt keine Geduld, um sich mit ihrem wunderlichen Bruder rumzuschlagen. Magie war ohnehin nicht ihr Metier, und Sarsar würde sie ohnehin nicht einweihen, das tat er nie. Der Einzige, mit dem er über Magie sprach, war Xaith, aber dieser kümmerte sich gerade nicht um das, was Sarsar tat.
Riaths grüner Blick wanderte wie von selbst wieder zu dem frischen Liebespaar auf der Fensterbank, man konnte förmlich riechen, wie sich die zarte Blüte der Liebe zwischen ihnen entfaltete. Die Angst um ihren Vater brachte sie näher zusammen, als Riath lieb war.
Er lehnte sich wieder zurück, verschränkte die Arme vor der massigen Brust, sodass die helle Seide spannte, und schloss die Augen. Kaum waren seine Lider zugefallen, sah er wieder dieses grüne Schimmern vor sich. Diesen ansehnlichen, hübschen Rücken mit dem anmutigen Schwung, in der Taille fast so schmal wie ein Weib, aber die Schulterblätter eines Mannes. Und natürlich diese dunkelgrünen Schuppen, die wie mit Diamantstaub bestäubt glitzerten. Und dann diese großen Augen, die ihn befürchtend über die Schulter hinweg angesehen hatten, leuchtend, frostblau, im silbrigen Licht des Mondes…
Allein die Erinnerung an diesen Burschen ließ sein Innerstes vibrieren und war eine hervorragende Ablenkung von allem anderen. Von Xaiths und Vaaks` offensichtlicher Zuneigung, und von der Angst um seinen Vater. Nur ein Gedanke an diese schimmernde Rückseite, und er konnte nur noch daran denken, wie sie sich wohl anfühlen würde.
»Ich weiß, wo er ist«, sagte Sarsar plötzlich mit ernster Miene. »Ich weiß, was geschehen ist.«
Riath öffnete die Augen und schnaubte. »Und das hat dir eine Weinpfütze gesagt, ja?«
Mit einem schneidenden Blick sah Sarsar ihn an. »Einem Troll kann man nicht erklären, wieso der Regen fällt.«
Riath runzelte zugleich verwirrt und wütend die Stirn. Verdammt, er hasste es, wenn Sarsar solche Sachen sagte, er verstand sie einfach nicht.
»Und warum hast du das erst jetzt gemacht, Lord Schlauberger?«
»Weil ich nicht wusste, ob die Alten Götter mich erhören und ich Wexmell keine falschen Hoffnungen machen wollte«, konterte Sarsar schnippisch. Er wandte sich an Xaith, der ihn neugierig beobachtete, und verkündete erleichtert: »Es geht ihm gut! Vater lebt!«
Kapitel 4
Es war der Geruch, der ihn letztlich aus der tiefen Schwärze zog. Ein Geruch, der ihm eigentlich fremd war und doch eine zutiefst vertraute Note transportierte, die in seine Nase stieg, um all seine Sinne zu wecken. Das erste, was er fühlte, war Sehnsucht und Traurigkeit, die ihn so heftig wie ein Wirbelsturm überkam und ihn stöhnen ließ. Für einen Moment kam er sich wie in der Zeit zurückversetzt vor. Dieser Geruch… er war so vertraut und löste das höchste allen Sehnens in ihm aus. Sein Herz war hin- und hergerissen zwischen freudiger Aufregung und schmerzhaftem Zerreißen.
Er spürte, wie sich sein Körper von selbst auf den Rücken drehte, der Boden war hart und seine Kleidung fühlte sich nass und klebrig an. Blinzelnd versuchte er, die Augen zu öffnen, warmer Sonnenschein stach ihm in die Pupillen und seine schwarzen Wimpern waren verklebt. Etwas lief ihm in die Augen und er schloss sie wieder schmerzvoll. Stöhnend rieb er mit Daumen und Zeigefinger die brennende Flüssigkeit von seinen Lidern.
Als nächstes nahm er neben dem Geruch auch Geräusche wahr. Ein pfeifender Wind, wie er nur auf einem Berggipfel wütend zischen konnte, und leises Stimmengewirr, das nach und nach immer lauter wurde, weil er immer mehr Bewusstsein erlangte.
Ein Schatten fiel über ihn und er zwang die Augen auf, während er in seinem langsam erwachenden Verstand nach Erinnerungen wühlte.
Das Gesicht, das über ihm schwebte, klärte sich nach einigem Blinzeln. Und es war ihm nicht fremd, ganz und gar nicht. Der andere legte den Kopf schief und lächelte zurückhaltend, als sei er ein verängstigtes Kind, das er nicht verschrecken wollte.
»Ich muss tot sein«, sagte Desiderius rau und streckte seine Hand nach dem Gesicht aus, um es sanft zu berühren. Beinahe wäre er zusammengezuckt, als er die lebendige Haut unter seinen Fingerspitzen spüren konnte. Fassungslos strich er über die Wange zu dem warmen Mund, über den lebendiger Atem floss. Das konnte nicht wirklich sein!
»Du bist nicht tot«, antwortete Cohen, der quick lebendig über ihm hockte und das Gesicht unter einem schwarzen Umhang vor dem hellen Tageslicht schützte. Nun strich er ihm mit zwei Fingern das nasse, klebrige Haar aus der Stirn. »Aber du wurdest gerade buchstäblich ausgekotzt und bist etwas … vollgesabbert. Kein Wunder, dass du durcheinander bist.«
Desiderius hörte nicht die Worte aus Cohens Mund, er starrte ihn einfach an und versuchte zu begreifen, dass er nicht nur einen sehr intensiven Traum hatte.
Das Letzte, woran er sich erinnerte, war das Maul des Drachen, danach war es sehr schwarz geworden und durch den schwefelhaltigen Atem im Mund des Tieres hatte er schnell das Bewusstsein verloren.
Und im nächsten Moment öffnete er die Augen und sah Cohens Gesicht über sich schweben. So, wie er es kannte, eine verboten süße Mischung aus Jugend und markanter Männlichkeit.
»Du … du … lebst?«, raunte er und sperrte den Mund auf.
Cohens Mimik nahm etwas Bedauerndes an. »Nicht ganz. Aber das ist eine lange Geschichte, ich …«
Weiter kam er nicht, Desiderius hatte bereits sein Gesicht gepackt und ihn zu seinem Mund herabgezogen. Ihre Lippen lagen übereinander und Desiderius saugte intensiv an Cohens bittersüßem Mund, Tränen brannten in seinen Augen, Tränen der ungläubigen Freude, ebenso wurde ihm der Hals verräterisch eng.
Nur am Rande bekam er mit, dass Cohens Kuss nur zurückhaltend war, regelrecht notgedrungen. Seine Lippen waren hart und wollten sich nicht so recht verführen lassen. Doch das war Desiderius im Moment gänzlich gleich. Er küsste Cohen voller Inbrunst und konnte ein überschwängliches Lachen nicht zurückhalten, wobei sein Verstand noch immer nicht begreifen konnte, wie verflucht noch mal Cohen hier sein konnte. Bei ihm. Warm und lebendig und …
Verdammt, er würde sicher gleich aufwachen und feststellen, dass er nur geträumt hatte. Deshalb hielt er Cohens Mund umso entschlossener fest auf seinem.
Es war kein Kuss der Leidenschaft, sondern ein Kuss der puren, fassungslosen Freude, die ihm auch letztlich ein paar Tränen bescherte.
Er wollte nie wieder aus diesem schönen Traum aufwachen. Nie wieder.
Doch da legte ihm Cohen eine Hand auf die Brust und drückte ihn ziemlich nachdrücklich auf den Boden, um sich von ihm lösen zu können. Er keuchte, als hätte ihn eine heftige Erregung ergriffen und atmete daraufhin schwer. »Langsam, ich muss vorsichtig mit … sterblichem Kontakt umgehen.«
Verwirrt blinzelte Desiderius zu ihm auf, doch als Cohens Gesicht nicht wie ein Traumgebilde einfach verschwand, konnte nichts seine Freude trüben.
»Es ist kein Traum«, flüsterte er rau und lachte dann ziemlich dümmlich auf, sodass Cohen über ihn schmunzeln musste. Verdammt, dieses schöne, schüchterne Schmunzeln, das er so sehr vermisst hatte. »Du lebst! Das ist kein Traum, du bist wirklich hier!« Desiderius wollte Cohens Umhang lüften, aber dieser hinderte ihn sofort daran und drückte ihm die Hände auf die Brust. Desiderius machte sich frei und griff stattdessen wieder nach Cohens Gesicht, musste es in seine Finger nehmen, es fühlen, es begutachten und streicheln. Cohen ließ ihn mit einem nachsichtigen Blick gewähren.
Da fiel es ihm auf und seine Mimik verzog sich zu einem tiefen Grübeln. »Was ist damit passiert?«, fragte er und tippte unter Cohens verbliebenes Auge. Er hatte dieses große, rehbraune Auge so sehr geliebt, dass es ihm jetzt regelrecht einen Stich versetzte, weil es blutrot schimmerte.
Etwas stimmte hier nicht. Und zwar gewaltig.
Cohen senkte den Blick und legte eine Hand um Desiderius` Arm, um sich aus dessen Griff zu befreien. »Eine lange, nicht ganz so amüsante Geschichte.«
Desiderius brauchte keine Erklärung, er wusste, was dieses Auge bedeutete, und als es ihm klar wurde, konnte er es auch spüren. Sein göttlicher Sinn verriet ihm alles, was er wissen musste.
Mit steinharter Miene presste er durch die Lippen: »Du bist ein Dämon!«
Cohen sah ihn nicht an, sein Mund war ein schmaler, zusammengepetzter Strich, während er lediglich bejahend nickte.
Desiderius schlug die Faust in den Boden und versuchte, sich aufzurichten. »Wo ist er?« Er hatte nur noch einen Gedanken. »Wo ist der Mistkerl, ich bring ihn um! Ich bring ihn um, das schwöre ich, dieses Mal bring ich ihn um!«
Etwas stieß ihm hart gegen die Brust und katapultierte ihn wieder auf den Rücken. Verwundert blinzelte er, als Cohen ihn entschlossen ansah.
»Das wirst du nicht!«, knurrte sein einstmals Geliebter.
Desiderius schnaubte. »Ich kann mir denken, wem du dieses Dasein verdankst…«
»Ich wäre jetzt nicht mehr hier, wäre ich kein Dämon«, verkündete Cohen sehr ernst und brachte Desiderius damit zum Schweigen. »Ich wäre nirgendwo mehr. Es ist nicht das, was ich mir nach meinem Tod vorgestellt hätte, aber es ist bestimmt nicht so, wie du denkst. Keine Folter machte mich zum Dämon, sondern ein großes Opfer, für das ich sehr dankbar bin. Bilde dir kein vorschnelles Urteil, Desiderius M`Shier, das war schon immer deine größte Schwäche.«
Noch immer argwöhnisch betrachtete er Cohens Gesicht, doch er zügelte sein Temperament, denn er konnte im Moment ohnehin noch nicht so recht begreifen, wie das alles möglich sein konnte.
Cohen war ja nicht erst seit gestern fort, er war sehr, sehr lange tot gewesen, und sie hatten viele Jahre gehabt, um sich damit abzufinden. Doch jetzt, nach all der Zeit, saß er wieder vor ihm und starrte ganz lebendig auf ihn herab. Zwar als Dämon, aber dennoch war er Cohen. Sein Cohen.
Er war nur erleichtert, dass dessen Seele nicht Jahre lang gefoltert worden war, um dann als geschwärztes, dunkles Wesen wiedergeboren zu werden. Er hätte es nicht ertragen, zu wissen, dass Cohen all die Jahre gelitten hatte, während er die Zeit voller Liebe und Frieden genossen hatte.
Ein Räuspern erklang hinter Cohen, der sich sofort über die Schulter sah. Und da war er, der Übeltäter, dem Cohen sein neues Leben verdankte, dachte Desiderius zynisch, während er zwischen den beiden hin und her sah.
»Ich trübe die Wiedersehensfreude nur ungern, aber…«
»Leck mich.«