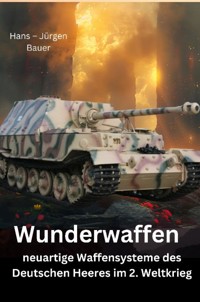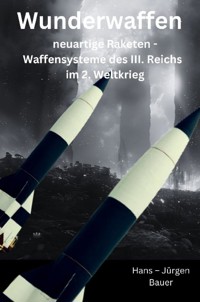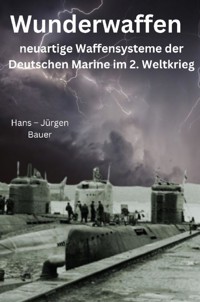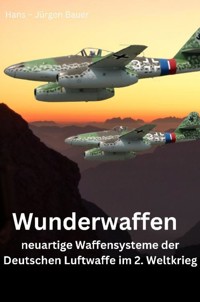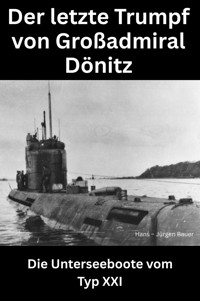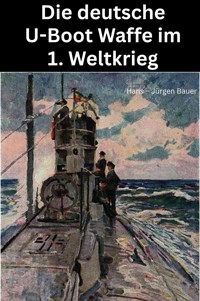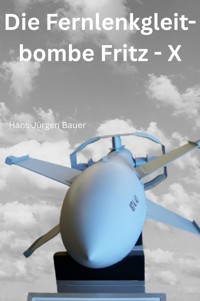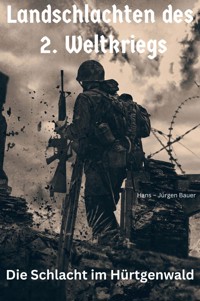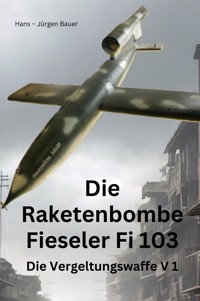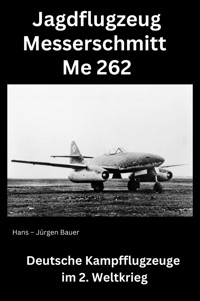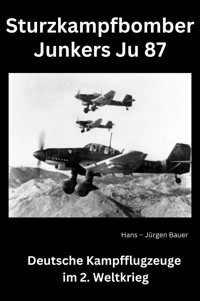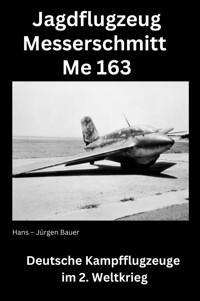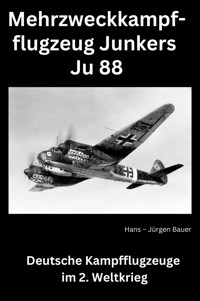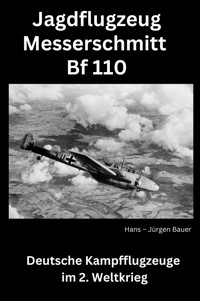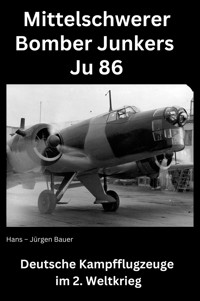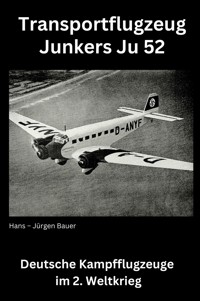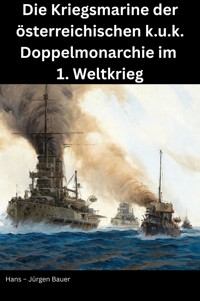
Die Kriegsmarine der österreichischen k.u.k. Doppelmonarchie im 1. Weltkrieg E-Book
Hans-Jürgen Bauer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Kriegsmarine der österreichischen k.u.k. Doppelmonarchie im 1. Weltkrieg Die Flotte der k.u.k. Kriegsmarine galt zu Beginn des 1. Weltkrieges als eine der zehn größten Kriegsflotten der Welt, war jedoch die kleinste unter den Flotten der europäischen Großmächte. Grund dafür war, dass die Monarchie eine ausgesprochen kontinentale Macht ohne sonderlich ausgeprägte überseeische Interessen war. Ihre Hauptaufgaben waren: - Sicherung der eigenen Küste - Sicherung der österreichisch-ungarischen Handelsschifffahrt - Präsenz auf den Weltmeeren Hierfür war die Marine aber hinreichend gerüstet. Die leichten Einheiten (Zerstörer (amtlich: Torpedofahrzeuge) und Torpedoboote) und die Rapidkreuzer waren für eine Kriegsführung auf der Adria und besonders an der dalmatinischen Küste optimal geeignet. Die modernen Schlachtschiffe der Tegetthoff-Klasse waren als Antwort auf den Schlachtschiffbau Italiens ebenfalls für den Einsatz auf der Adria und im sonstigen Mittelmeer konzipiert. Das Marinekommando unter dem Kommandanten Admiral Anton Haus rechnete mit (dem eigentlich verbündeten) Italien, Russland und eventuell Frankreich als möglichen Kriegsgegnern, ein Krieg gegen Großbritannien war nicht vorstellbar. Dieses Werk beschreibt die Geschichte der k.u.k. Marine von den Anfangszeiten in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 1. Weltkriegs. Darin werden auch die technischen Details der einzelnen Schiffe bzw. der Schiffsklassen und deren Einsätze beschrieben. Das Werk ist mit umfangreichem zeitgenössischem Bildmaterial illustriert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kriegsmarine der österreichischen k.u.k. Doppelmonarchie im 1. Weltkrieg
IMPRESSUM:
Autor: Hans-Jürgen BauerHerausgeber:M. PrommesbergerHändelstr 1793128 Regenstauf
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Vorwort
Kapitel 2: Anfänge der österreichischen Marine
Kapitel 3: Gründung als Kriegsmarine
Kapitel 4: Wilhelm von Tegetthoff
Kapitel 5: Seegefecht vor Helgoland
Kapitel 6: Konflikt mit Preußen
Kapitel 7: Die Seeschlacht von Lissa
Kapitel 8: Reformierung der Kriegsmarine
Kapitel 9: Österreichische Expeditionsfahrten
Kapitel 10: Aufbruch in die Moderne
Kapitel 11:Kriegsschiffbau vor 1905
Turmschiffe
Linienschiffe Monarch Klasse
Linienschiffe Habsburg Klasse
Linienschiffe Erzherzog Karl Klasse
Panzerkreuzer
Torpedokreuzer Panther Klasse
Geschützte Kreuzer
Kleine Kreuzer Zenta-Klasse
Kapitel 12: Flottenkommandanten 1898 - 1919
Kapitel 13:Pola – der Hauptkriegshafen der k.u.k. Marine
Kapitel 14: Kriegsschiffbau nach 1905
Schlachtschiffe Radetzky-Klasse
Schlachtschiffe Tegetthoff-Klasse
Rapidkreuzer
Zerstörer der Tatra Klasse
Kapitel 15: Der Kriegsausbruch
Kapitel 16: Der Kriegseintritt Italiens
Kapitel 17:Die Sperre von Otranto
Kapitel 18:Der Matrosenaufstand von Cattaro
Kapitel 19:Die Versenkung der Szent István
Kapitel 20:Das Ende der k.u.k. Marine
Kapitel 21:Die k.u.k. Seeflieger
Kapitel 22: Die U-Bootwaffe
Kapitel 23: Die Donauflottille
Kapitel 24: Schlussbemerkung
Kapitel 1: Vorwort
Die österreichische Marine war die Gesamtheit aller militärischen Einheiten Österreichs zu Wasser. Die Gesamtheit der zivilen und Handelsschifffahrt wird als österreichische Handelsmarine bezeichnet. Die militärische Schifffahrt hatte ihren Ursprung in der seit dem 16. Jahrhundert existierenden Donauflottille und der seit Ende des 18. Jahrhunderts bestehenden Mittelmeerflotte. Bis zum Ausgleich von 1867 zwischen dem Kaisertum Österreich und dem Königreich Ungarn wurde sie als österreichische Kriegsmarine oder k. k. Kriegsmarine bezeichnet. Danach operierte sie bis 1918 als k. u. k. Kriegsmarine. Auf ihrem Höhepunkt vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs galt sie als die sechstgrößte Marine der Welt. Die wichtigsten Seehäfen waren Triest (heute Italien) und Pola (heute Kroatien) im Küstenland. Wichtige Donauhäfen waren Linz und Korneuburg.
Mit der Niederlage der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und der Auflösung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im Jahre 1918 war auch das Schicksal der Kriegsmarine besiegelt. Die Schiffe der Mittelmeerflotte und Teile der Donauflottille gingen in den Besitz der Siegermächte über. Die nicht von den Siegermächten beanspruchten Teile der Flotte wurden am Ende des Krieges dem neuen südslawischen Nationalrat übergeben. Der Republik Österreich blieben nur einige Patrouillenboote auf der Donau. Die letzten beiden Patrouillenboote stellten im Herbst 2006 ihren Dienst ein.
Kapitel 2: Die Anfänge der österreichischen Marine
Zwar gelangten bereits im 14. Jahrhundert erste Küstenlandstriche der kroatischen Adriaküste in habsburgischen Besitz, doch überließ man lange Zeit den Seehandel und dessen Verteidigung gegen maurische und osmanische Freibeuter der Eigeninitiative der Küstenbewohner. In den Kriegen gegen das osmanische Reich ab dem 16. Jahrhundert kam es zur Gründung einer kaiserlichen Donauflottille, um den osmanischen Flussstreitkräften etwas entgegenzusetzen und die Landoperationen zu unterstützen. Ausgehend von der Überlegung, dass sich Schiffstypen, die sich auf dem Meeren bewährt hatten, auch für die Donau eignen müssten, wurden im 17. und 18. Jahrhundert allerdings viel zu groß dimensionierte Schiffe gebaut. Die mit erheblichem Aufwand hergestellten Donaufregatten (wie z. B. die 1768 vom Stapel gelaufene Theresia) konnten auf der Donau kaum manövrieren und liefen wegen ihres großen Tiefgangs immer wieder auf Grund. Für eine Absicherung österreichischer Kolonialpläne reichte diese Seemacht nicht aus. Unter Kaiser Joseph II. kam es zur Gründung einer österreichischen Kriegsmarine, die mangels finanzieller Mittel jedoch nur wenige Kriegsschiffe umfasste. Mit dem Frieden von Campoformio im Jahre 1797 gelangten Venedig, Istrien und Dalmatien in österreichischen Besitz, die venezianische Marine mit eingeschlossen. Venedig blieb während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Haupthafen der Kriegsmarine; später wurde sie durch eigene Kriegshäfen in Pola und Cattaro abgelöst. Diese 1797 gegründete Marine wurde als „Österreichisch-Venezianische Marine“ (k.k. Veneta Marine) bezeichnet. Die Mannschaften und die Offiziere kamen nahezu alle aus Venetien, sprachen Venetisch und waren durch die nautische, militärische, kulturelle und historische Tradition Venedigs geprägt. Im Jahr 1829 bombardierten österreichische Kriegsschiffe marokkanische Häfen an der Atlantikküste, die man der Piraterie verdächtigte. Erste „echte“ militärische Erfahrungen machten Erzherzog Friedrich und die Besatzungen österreichischer Kriegsschiffe an der Seite britischer Kriegsschiffe 1840 vor der syrischen Küste, wo sie als Teil der Quadrupelallianz den Osmanen halfen, den ägyptischen Vizekönig zurückzudrängen.
Die Bedeutung der Kriegsschiffsflotte für Österreich zeigte sich 1864 durch die Seesiege Wilhelm von Tegetthoffs bei Helgoland im Deutsch-Dänischen Krieg. In dessen Zeit als oberster Admiral der Kriegsmarine begannen dringend notwendige Reformen, wie die Einführung einer einheitlichen Dienstsprache zur Beendigung von Verständigungsproblemen unter den kroatischen, italienischen und österreichischen Seeleuten auf hoher See, und die nachhaltige Modernisierung der Flotte. Die italienische Marine war bis dahin der österreichischen noch deutlich überlegen. Entscheidender Wendepunkt war jedoch die Seeschlacht von Lissa, in welcher Österreich 1866 die zahlenmäßig überlegenen Italiener durch die Rammtaktik besiegte. Diese ersten großen Erfolge der österreichischen Marine garantierten auch die benötigten finanziellen Mittel zur Modernisierung der Flotte. Holz als Baumaterial wurde zusehends durch Eisen ersetzt, die Seeschlacht von Lissa sollte auch die letzte Schlacht bleiben, die durch Einsatz von Rammkreuzern entschieden wurde. Doch dazu später mehr.
Von diesem Zeitpunkt an war Österreichs Marine in der Adria eine ernst zu nehmende Seestreitkraft. Neben militärischen Aufgaben kam der Kriegsmarine auch eine volkswirtschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung zu, die sich in zahlreichen Forschungsreisen österreichischer Kriegsschiffe manifestierte. Zahlreiche Reisen zu allen Kontinenten erfolgten zum Ausbildungszwecke der Mannschaft, wobei das „Flagge-Zeigen“ auf den Weltmeeren zu Prestigezwecken ein erwünschter Nebeneffekt war.
Kapitel 3: Gründung als Kriegsmarine
Angehörige der österreichischen Marine um 1840 Marine-Matrosenkorps, Marineinfanterie und Marineartillerie. Zeitgenössische Darstellung
Obwohl die seit Ende des 18. Jahrhunderts existierende Kriegsmarine die österreichische Flagge zeigte, war sie ursprünglich venezianisch dominiert, machte doch die einst venezianische Flotte, die 1797 im Frieden von Campo Formio in österreichischen Besitz gelangte, das Herzstück der österreichischen Kriegsmarine aus. Es gab vorerst kaum deutschstämmige Marineoffiziere und Seeleute, diese kamen alle aus dem venezianisch geprägten Teil der Monarchie.
1848, im Zuge der Revolution in Österreich und Ungarn wollte sich neben anderen italienischen Provinzen auch Venedig von Österreich lösen und dem italienischen Risorgimento anschließen. Diesem Aufstand schlossen sich auch die österreichischen Soldaten und Seeleute venezianischer Abstammung an, so dass die k.k. Kriegsmarine einen großen Teil ihrer Schiffe an Venedig verlor, das zunächst erfolgreich in seiner Unabhängigkeitsbewegung war. Während es in ganz Österreich Unruhen gab und Radetzky die österreichischen Truppen zurückzog, sammelten sich die treu gebliebenen Besatzungen mit ihren Kriegsschiffen in Triest, Pola und Fiume. Nach dem Sieg Radetzkys über die Italiener 1849 bei Novara und dem darauf folgenden Frieden zog sich die sardinische Flotte aus der Adria zurück und ermöglichte es so der österreichischen Marine, sich an der Blockade von Venedig zwecks Rückeroberung zu beteiligen.
Um die österreichische Kriegsmarine neu aufzubauen, machte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Oberbefehlshaber. Gefunden wurde dieser in der Person des dänischen Kommodore 1. Klasse Hans Birch Dahlerup. Er wurde im Februar 1849 in Olmütz vom jungen Kaiser Franz Joseph I. persönlich empfangen, zum Marinekommandanten ernannt und zugleich zum Vizeadmiral und Feldmarschallleutnant befördert. An der Adria angekommen, sah er sich der schwierigen Aufgabe gegenüber, aus den Resten der nicht zu den italienischen Aufständischen übergegangenen österreichischen Flotte eine neue Seemacht zu bilden. Durch sein bestimmtes Auftreten und seine überlegenen Kenntnisse gelang es ihm bald, Respekt zu erlangen und die Arbeit in Gang zu setzen. Man bemühte sich verstärkt um österreichische Seeleute, die Kommandos wurden verstärkt in Deutsch und Venezianisch gegeben, und die italienischen Namen der Schiffe wurden ins Deutsche übersetzt. Mit dem Bau neuer Schiffe wurde ebenfalls begonnen. Nach der Rückeroberung von Venedig verblieb der Sitz des Marineoberkommandos vorläufig in Triest. Stimmen, die für Pola plädierten, wurden aber schon damals laut, was Dahlerup aber ablehnte. Trotzdem kam am 20. November 1850 der Befehl, in Pola ein Marinearsenal zu errichten. Zu Schulungszwecken verkehrten die Schiffe der Kriegsmarine zwischen den österreichischen Adriahäfen und sicherten auch die griechischen und türkischen Gewässer gegen Seeräuber. 1850 wurde Deutsch als allgemeine Dienstsprache eingeführt. Im August 1850 bat Dahlerup um seinen Abschied und ihm folgte Feldmarschallleutnant Graf Franz von Wimpffen, ein Offizier des Landheeres. Während dessen Kommandozeit wurde das bisherige Marinekollegium in eine Marineakademie umgewandelt und der Ausbau von Pola beschleunigt. 1854 legte Graf Wimpffen das Kommando nieder.
Am 10. September 1854 wurde Erzherzog Ferdinand Maximilian von Kaiser Franz Joseph I., seinem Bruder, zum neuen Oberkommandanten der österreichischen Kriegsmarine ernannt. 1859 kam es abermals zum Krieg mit Italien im Sardinischen Krieg. Dieser sah Erzherzog Ferdinand Maximilian in der Doppelfunktion als Oberkommandant der Kriegsmarine und als Generalgouverneur von Lombardo-Venetien. Der Umstand, dass die Flotte noch nicht die notwendige Stärke erreicht hatte, erlaubte es nicht, diese offensiv gegen den Feind einzusetzen. Es galt vielmehr, mögliche feindliche Angriffe abzuwehren. In dem am 10. November 1859 geschlossenen Frieden von Zürich blieb der Zugang zur Adria erhalten und damit die Kriegsmarine.Das Jahr 1860 brachte die Eingliederung des Flottillenkorps in die Kriegsmarine: die Lagunen-, die Gardasee- und die Donauflottille unterstanden nicht mehr länger dem Landheer. Und dann liefen im Jahr 1861 die ersten modernen Kriegsschiffe Österreichs vom Stapel Es handelte sich um die Panzerfregatten Salamander und Drache, denen 1862 die Kaiser Max folgte.
1864 folgte Erzherzog Ferdinand Maximilian dem Ruf aus Mexiko und wurde Kaiser von Mexiko. Sein Nachfolger wurde Viceadmiral Ludwig von Fautz als Chef der Marinesektion (1865–1868). Erzherzog Leopold war von 1865 bis 25.Feber 1868 Inspektor der Marinetruppen und der Flotte, eigentlich ein Offizier des Landheeres.
Kapitel 4: Wilhelm von Tegetthoff
Wilhelm von Tegetthoff (* 23. Dezember 1827 in Marburg an der Drau, Untersteiermark; † 7. April 1871 in Wien) war Vizeadmiral und Kommandant der österreichischen bzw. österreichisch-ungarischen Kriegsmarine.
Erziehung zum Seeoffizier
Wilhelm von Tegetthoff wurde 1827 als Sohn eines k.k.Oberstleutnants geboren. Die Familie Tegetthoff war im 18. Jahrhundert von Maria Theresia geadelt worden, deren Initialen sie auch im Wappen führt. Mütterlicherseits war er mit dem Wiener Bürgermeister Baron Seiller verwandt. Tegetthoff hätte, wäre es nach seinen Eltern gegangen, einen Zivilberuf ergriffen, es zog ihn jedoch zur See und sein Vater ließ ihn gewähren. So besuchte er von 1840 bis 1845 das österreichische Marinekollegium in Venedig und wurde dort als Marinekadett ausgemustert. Am 23. Juli 1845 ging er erstmals im regulären Dienst an Bord eines Schiffes. Die Revolution von 1848 und die folgenden Veränderungen förderten Tegetthoffs schnelle Karriere. Zum Seeoffizier ernannt, machte er während der Jahre 1848 und 1849 die Blockade von Venedig mit und wurde danach bei vielen Fahrten und Expeditionen der kaiserlichen Marine bis in die Levante und zu den sogenannten Barbareskenstaaten verwendet.
Erste Erfolge
1854 wurde Tegetthoff zum Kommandanten des Kriegsschoners „Elisabeth“ berufen. Zu dieser Zeit wurden die Schiffe, auch die Kriegsmarine, intensiv auf die Dampfkraft umgerüstet. 1855 erhielt er das Kommando über den Raddampfer Taurus, der sein Einsatzgebiet im Donaudelta hatte, wo die Interessen Österreichs, Russlands und des Osmanischen Reichs aufeinander und auf das wachsende Selbstbewusstsein der dort siedelnden Völker stießen. Der junge Seeoffizier fiel dort durch hervorragende Leistungen auch im diplomatischen und organisatorischen Bereich auf. 1859/1860 nahm er, von Marinekommandant Erzherzog Ferdinand Max, Bruder von Kaiser Franz Joseph I., berufen, an der Reise des Erzherzogs nach Brasilien teil. Die weitere Karriere ging sehr schnell voran: 1861 wurde Tegetthoff zum Linienschiffskapitän (entspricht in der Deutschen Marine einem Kapitän zur See, im Heer einem Oberst) befördert. Damit verbunden war das Kommando der österreichischen Flottenabteilung in der Levante.
Sieg bei Helgoland 1864
Im Deutsch-Dänischen Krieg, auf deutscher Seite von Österreich und Preußen geführt, kämpfte er 1864 gegen Dänemark. Das Seegefecht bei Helgoland (9. Mai 1864) wurde von den Österreichern trotz erheblicher Verluste als Sieg betrachtet. Damit war der Weg frei zur nächsten Beförderung: Der erst 37-jährige Offizier wurde zum Contreadmiral befördert.
Sieg bei Lissa 1866
Sein Sieg in der Seeschlacht von Lissa am 20. Juli 1866 gegen die italienische Flotte im verlorenen Deutschen Krieg (Preußen und Italien gegen Österreich und den Deutschen Bund), machte ihn zu einem Seehelden. Für seine Rammtaktik gegen die überlegene italienische Flotte erhielt er das Kommandeurkreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens und wurde zum Vizeadmiral befördert.
Anton Romako: Admiral Tegetthoff in der Seeschlacht von Lissa, 1878–1880
1866 bis 1867 führten ihn Studienreisen nach Frankreich, Großbritannien und in die Vereinigten Staaten. Mittlerweile wurde der Kaiserstaat mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 zur Doppelmonarchie umgebaut.
Admiral und Marinekommandant
Ferdinand Max war am 10. April 1864 zum Kaiser von Mexiko ausgerufen worden und hatte auf alle Funktionen in Österreich verzichten müssen. Von 1865 bis zu seinem Tode füllte Tegetthoff die Funktion eines Marinekommandanten aus. Erzherzog Leopold, ab 1865 Marinetruppen- und Flotteninspector, wurde von Franz Joseph I. am 25. Februar 1868 seines Postens enthoben. Der Kaiser ernannte gleichzeitig Vizeadmiral Tegetthoff in Nachfolge von Vizeadmiral Ludwig von Fautz zum Chef der Marinesektion und somit Stellvertreter des Reichskriegsministers für Marineangelegenheiten und gleichzeitig zum neuen Commandanten Sr. Majestät Kriegsmarine und vereinigte so alle Funktionen in seiner Person. Durch die gebündelte Befehlsgewalt konnte er – gegen den Widerstand des Generalstabs – seine Reformvorhaben bezüglich der österreichischen Kriegsmarine in kurzer Zeit bis zu seinem frühen Tod vorantreiben. Seine Innovationen blieben bis zur Niederlage und zum Ende der Doppelmonarchie im Herbst 1918 in Kraft.
Tod
Tegetthoff erkrankte 1871 im Alter von 43 Jahren an einer Lungenentzündung, an der er am 7. April 1871 verstarb. Sein Grab befindet sich auf dem St.-Leonhard-Friedhof in Graz. Er hinterließ seinen Brüdern sein gesamtes Vermögen: die bescheidene Summe von 267 Gulden und 40 Kreuzern. Einem Gulden des Jahres 1871 entsprechen in heutiger Kaufkraft rund sechs Euro.
Kapitel 5: Seegefecht vor Helgoland
1864 zogen Österreich und Preußen gemeinsam gegen Dänemark in den Krieg um Schleswig-Holstein, in dessen Verlauf es zum Seegefecht vor Helgoland kam. Zunächst erhielt Wilhelm von Tegetthoff den Befehl, im Mittelmeer befindliche dänische Handelsschiffe zu kapern und dänischen Kriegsschiffen den Aufenthalt im Mittelmeer unmöglich zu machen.
Nach Beginn des Krieges am 1. Februar 1864 erklärte Dänemark am 26. Februar eine Seeblockade gegen alle schleswig-holsteinischen und am 8. März auch gegen alle preußischen Häfen. Die dänische Seeblockade wurde zunächst von der Schraubenfregatte Niels Juel und später von der Schraubenkorvette Dagmar sichergestellt. Letztere brachte bereits am 18. März vor Texel den hamburgischen Schoner Tekla Schmidt auf. Da die preußische Marine zu schwach war, um der dänischen entgegenzutreten, entsandte Österreich Anfang März 1864 aus dem Mittelmeer ein Geschwader unter Linienschiffskapitän Wilhelm von Tegetthoff mit den beiden Fregatten Schwarzenberg und Radetzky sowie dem Kanonenboot Seehund. Die Seehund wurde im Ärmelkanal bei einem Unfall beschädigt und musste einen englischen Hafen anlaufen. Anfang Mai erreichte das restliche österreichische Geschwader die Nordsee. Preußen hatte wegen des drohenden Krieges ein kleines Geschwader unter dem Befehl von Korvettenkapitän Gustav Klatt aus dem Mittelmeer in die Heimat zurückbeordert. Es bestand aus dem Raddampfer Preussischer Adler und den beiden Kanonenbooten Basilisk und Blitz. Die beiden Geschwader vereinigten sich vor Texel. Dänemark bildete seinerseits Ende März ein Nordseegeschwader unter Orlogskapitän Edouard Suenson, das aus der Niels Juel, der Dagmar und der Schraubenkorvette Hejmdal bestand. Zu seinen Aufgaben gehörte der Schutz dänischer Handelsschiffe, das Aufbringen deutscher Schiffe und das Bekämpfen feindlicher Kriegsschiffe in der Nordsee. Nachdem die Dagmar durch die Schraubenfregatte Jylland abgelöst wurde, patrouillierte das dänische Geschwader in der Nordsee und erwartete die Österreicher.
Das Seegefecht
Gemälde der Schlacht von Niels Carl Michael Flindt Dahl
Das dänische Geschwader näherte sich von Norden. Gegen 10 Uhr wurde ein Schiff vor Helgoland gesichtet, aber es handelte sich nur um die britische Fregatte Aurora. Direkt danach entdeckten die Dänen weitere fünf Schiffe in Richtung Südsüdwest. Die beiden Geschwader nahmen Kurs aufeinander, und gegen 13:15 Uhr eröffnete die Schwarzenberg das Feuer. Die Dänen erwiderten das Feuer erst bei deutlich geringerem Abstand. Die Österreicher nahmen einen mehr westlichen Kurs, um vor den dänischen Schiffen deren Kurs zu kreuzen, woraufhin diese etwas nach Backbord abdrehten. Während die Kanonenboote zurückgeblieben waren, passierten sich die übrigen feindlichen Schiffe unter heftigem Beschuss in einem Abstand von etwa 1800 Metern. Tegetthoff wendete sofort, um zu verhindern, dass die Kanonenboote abgeschnitten würden. Mit Kurs Südwest liefen die beiden Geschwader danach unter starkem gegenseitigem Beschuss auf Parallelkurs. Während sich die Niels Juel und die Schwarzenberg beschossen, konzentrierte sich das Feuer der Jylland und der Hejmdal auf die Radetzky. Die preußischen Kanonenboote waren so weit entfernt, dass ihr Feuer wirkungslos blieb. Gegen 15:30 Uhr fing die Schwarzenberg Feuer und konnte den Kampf nicht fortsetzen. Tegetthoff gab das Signal zum Abbruch und das österreichisch-preußische Geschwader zog sich, im Feuerschutz der Radetzky, in die neutralen Gewässer der damals zu Großbritannien gehörenden Insel Helgoland zurück. Da das dänische Flaggschiff Jylland genau zu diesem Zeitpunkt einen Treffer in die Kommandantenkammer erhalten hatte, der ihre Ruderanlage beschädigte, kam der dänische Versuch, die Gegner noch abzufangen, zu spät. Das britische Kriegsschiff Aurora beobachtete das Gefecht und stand bereit, das britische Hoheitsgebiet zu verteidigen. Deshalb musste Suenson die Verfolgung gegen 16:30 Uhr abbrechen. Das Seegefecht war beendet.
Das dänische Geschwader hatte 14 Tote und 55 Verwundete zu beklagen, die österreichischen Schiffe 32 Tote und 59 Verwundete. Die preußischen Schiffe hatten keinerlei Verluste.
Fregatten Schwarzenberg, Radetzky, Niels Juel und Jylland, Korvette Hejmdal. Im Hintergrund preußische Kanonenboote. (Kupferstich des Seegefechts)
Das Ergebnis des Seegefechts
Die Dänen warteten außerhalb der Hoheitsgewässer Helgolands, aber im Schutze der Dunkelheit zogen sich die österreichischen und preußischen Schiffe nach Cuxhaven zurück. Das dänische Geschwader wurde nach Kopenhagen zurückbeordert, da ab dem 12. Mai 1864 der Waffenstillstand in Kraft trat. Die Blockade war damit aufgehoben und der Krieg entschieden. Sowohl in Dänemark als auch in Österreich wurde das Ergebnis des Gefechts als Sieg betrachtet. Das dänische Geschwader wurde bei der Ankunft in Kopenhagen begeistert gefeiert, und Österreich beförderte Tegetthoff zum Konteradmiral.
Kapitel 6: Konflikt mit Preußen
Trotz des gemeinsamen österreichisch-preußischen Siegs über Dänemark blieben die Spannungen um die Vorherrschaft in Deutschland bestehen. 1866 verbündete sich Preußen mit Italien, Preis für die italienische Waffenhilfe gegen Österreich war Venedig.
Karte des Deutschen Bundes 1815–1866
Urheber Ziegelbrenner
Unter der Regierung des Habsburger Kaisers Franz Joseph I. unternahm vor allem Felix Fürst zu Schwarzenberg für Österreich einige Versuche, den Deutschen Bund bundesstaatlicher zu machen. Hauptziel war ein Großösterreich, also eine Erweiterung des Deutschen Bundes um alle Gebiete Österreichs. Im Jahr 1863 legte Österreich die Frankfurter Reformakte vor. Die bundesstaatlichere Verfassung hätte Österreichs Führung über den Deutschen Bund bestätigt und bestärkt und es zum Führungsstaat eines großdeutschen, monarchischen, föderalen Staatenbundes in Mitteleuropa gemacht. Im Gegensatz dazu bemühte sich Preußen schon seit 1849/50, Kleindeutschland als Erfurter Union zu verwirklichen. Dieser Bundesstaat sollte alle deutschen Gebiete außer Österreich umfassen, aber insgesamt konservativer und föderalistischer als das Reich der Frankfurter Nationalversammlung sein. Allerdings gelang es Preußen schon zu Beginn nicht, Bayern und Württemberg für diese Politik zu gewinnen, und später sprangen mit Hannover und Sachsen weitere Mittelstaaten ab. Nach der Herbstkrise 1850, in der es fast zum Krieg zwischen Preußen bzw. der Union und vor allem Österreich und Bayern gekommen wäre, musste Preußen diese Unionspolitik aufgeben. In seinem Bundesreformplan vom 10. Juni 1866 stellte Preußen schließlich ein preußisch-bayerisch geführtes Kleindeutschland vor, der den Einfluss der Habsburger auf die mitteldeutschen Gebiete eliminierte. Dieser innerdeutsche Konflikt um die „Großdeutsche Lösung“ oder die „Kleindeutsche Lösung“ stürzte Österreich schließlich in einen Zweifrontenkrieg: Preußen und einige verbündete deutsche Kleinstaaten im Norden und im Süden Italien, das die Gelegenheit sah, die restlichen „unerlösten“, unter österreichischer Herrschaft stehenden Gebiete zu „befreien“. Der Preis, den Preußen für die italienische Waffenhilfe zahlte, war Venetien – auf Österreichs Kosten.
Um nicht aus dem Zweifronten-Krieg einen Dreifronten-Krieg werden zu lassen, schloss Österreich mit Frankreich einen Nichtangriffspakt. Allerdings war das Kriegsglück nicht auf der Seite der Habsburger. Am 3. Juli 1866 wurde die Schlacht von Königgrätz zur Katastrophe für Österreich, und die österreichische Südarmee musste nach dem Sieg bei Custozza eiligst nach Norden verlegen, um Wien vor den anmarschierenden Preußen zu schützen. Als Schutz der österreichischen Adriaküste vor weiteren Angriffen der Italiener blieb nur die Flotte.
Kapitel 7: Die Seeschlacht von Lissa
Datum 20. Juli 1866
Ort Vis, Kroatien
Ausgang Sieg Österreichs
KonfliktparteienKönigreich Italien (1861–1946) Italien
Österreich
BefehlshaberItalien: Carlo di Persano
Österreich: Wilhelm von Tegetthoff
TruppenstärkeItalien 28 Schiffe
Österreich 26 Schiffe
VerlusteItalien 2 Schiffe, 612 Tote, 38 Verwundete
19 Gefangene
Österreich: kein Schiff, 38 Tote,
138 Verwundete
Vorgeschichte
Im Juni 1866 brach der Krieg zwischen Preußen und Österreich aus. Italien, mit Preußen alliiert, erklärte Österreich den Krieg und sandte Truppen in die Lombardei. Obwohl die italienische Armee den Österreichern zahlenmäßig überlegen war, wurde sie am 24. Juni besiegt und zum Rückzug gezwungen. Die Preußen retteten die Situation, indem sie die Österreicher in der Schlacht von Königgrätz (heute: Hradec Králové) am 3. Juli schlugen. Die Niederlage in Königgrätz und die Information, dass die Österreicher über einen Waffenstillstand verhandelten, zwang die italienische Marine zum Zug. Die Italiener wollten die österreichischen Gebiete an der Adria einnehmen, um sie in den Friedensverhandlungen als Verhandlungsgegenstand zu nutzen. Der Kommandeur der italienischen Flotte, Admiral Carlo Persano, kreuzte vom 9. bis zum 11. Juli auf der geografischen Breite von Lissa, ohne die Österreicher aktiv anzugreifen. Persanos passives Verhalten wurde stark kritisiert und der Oberbefehlshaber der Marine befahl ihm, irgendeine erfolgversprechende Aktion zu unternehmen. Folglich wurde beschlossen, die Insel Lissa (kroat. Vis), das sogenannte „Gibraltar der Adria“, einzunehmen.
Die österreichische Flotte war zu dieser Zeit veraltet. Konteradmiral Wilhelm von Tegetthoff griff zur Improvisation: er ließ seine Schiffe mit Eisenplatten, Eisenbahnschienen und Ketten behelfsmäßig panzern. Die Verteidigung von Lissa bestand aus 1.833 Soldaten, starken Festungen und Küstenbatterien (Wellington, Bentainks, Magnaremi und Nadpostranje) mit insgesamt 88 Kanonen. Weiter existierte eine Polizeistation auf dem Hügel Hum (585 Meter) mit einer Telegrafenverbindung zum Festland über die Insel Hvar. Die italienische Flotte verließ Ancona, den italienischen Flottenstützpunkt, am Nachmittag des 16. Juli und erreichte Lissa, ohne einen detaillierten Operationsplan vorbereitet zu haben.
Italienischer Angriff auf Lissa
Persanos Flotte kreuzte am 17. Juli bei Lissa, aber zu weit entfernt, um von den Verteidigern gesehen zu werden. Das einzige Schiff, das sehr nahe herankam, war das Aufklärungsschiff RN Messaggero, welches den Stabschef der Flotte an Bord hatte, um die Positionen der Küstenbatterien und Festungen aufzuklären. Am nächsten Tag näherte sich die ganze Flotte der Insel und startete den Angriff. Doch der Festungskommandant von Lissa, Oberst David Freiherr von Urs de Margina, hielt die Italiener geschickt in Schach, bis ihm Wilhelm von Tegetthoff mit der österreichischen Flotte zu Hilfe eilen konnte. Einige italienische Panzerschiffe wurden zum Hafen von Hvar gesandt, um die Telegrafenverbindung Vis-Hvar-Split zu unterbrechen. Weitere Aufklärungsschiffe wurden nach Nordwesten entsandt. Das Gros der Flotte griff Lissa schließlich am 18. Juli um 10:30 Uhr an drei verschiedenen Positionen an. Das erste Geschwader von Panzerschiffen unter Kommandant Giovanni Vacca eröffnete das Feuer auf die österreichischen Batterien bei Komiža. Das zweite Geschwader, unter dem Kommando von Persano selbst, attackierte den Hafen von Lissa, während das dritte Geschwader, bestehend aus hölzernen Fregatten unter Giovanni Battista Albini, angewiesen war, die Batterien in Nadpostranje zu zerstören und Truppen in der Bucht von Rukavac anzulanden. Das erste Artillerieduell zeigte, dass die Küstenbatterien (speziell die in Komiža) zu hoch für die italienischen Kanonen lagen. Folglich zogen sich die italienischen Schiffe nach einigen Stunden nutzlosen Bombardements zurück und unterstützten das zweite Geschwader beim Angriff auf den Hafen von Lissa.
Am nächsten Tag (19. Juli) zog sich die gesamte Flotte vor dem Hafen von Lissa zusammen und griff geschlossen an. Die Italiener bekamen Unterstützung durch das moderne, turmbestückte Panzerschiff RN Affondatore und einige Truppentransporter. Diese Schiffe nahmen ebenfalls am Angriff auf den Hafen von Lissa teil. Obwohl vier Panzerschiffe in den Hafen eindringen konnten, wurde der Widerstand der Verteidiger nicht wesentlich geschwächt.
Ausgangssituation der Schlacht von Lissa
Ablauf der Schlacht