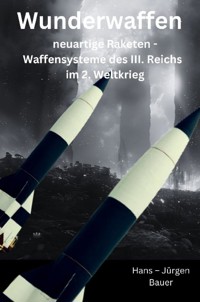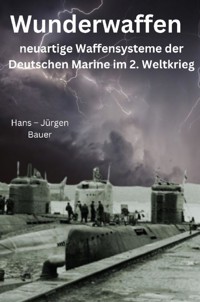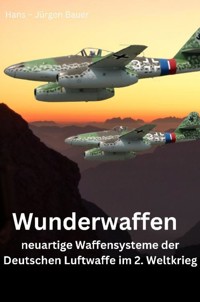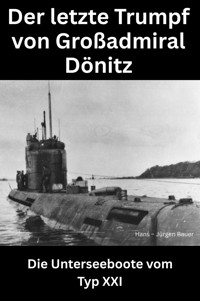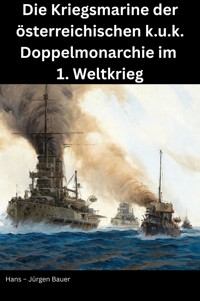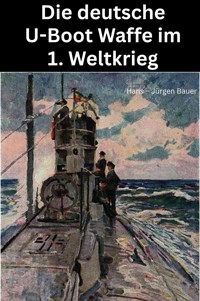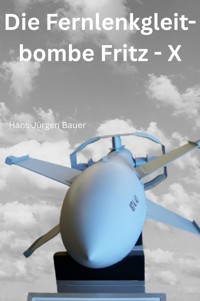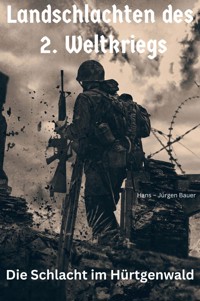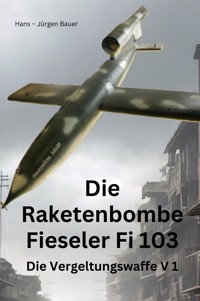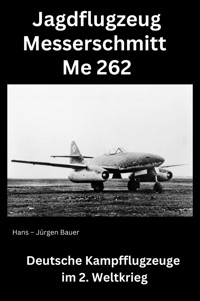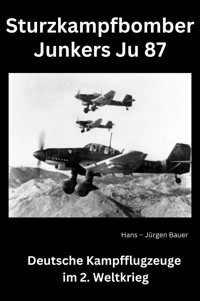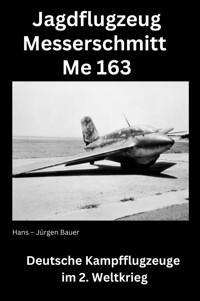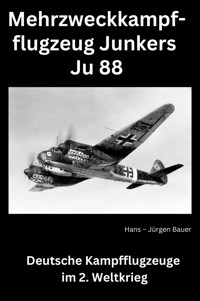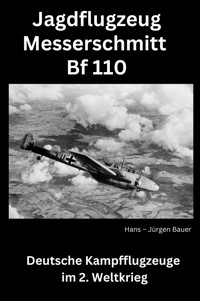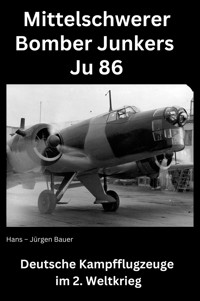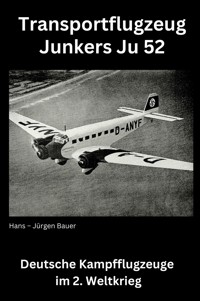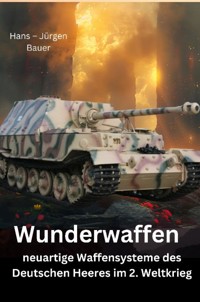
Wunderwaffen - neuartige Waffensysteme des Deutschen Heeres im 2. Weltkrieg E-Book
Hans-Jürgen Bauer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wunderwaffen - neuartige Waffensysteme des Deutschen Heeres im 2. Weltkrieg Der Begriff "Wunderwaffe" wurde während des Zweiten Weltkriegs vom Propagandaministerium des nationalsozialistischen Deutschlands für einige revolutionäre "Superwaffen" verwendet wurde. Die meisten dieser Waffen blieben jedoch Prototypen, die entweder nie den Kriegsschauplatz erreichten, oder wenn doch, dann zu spät oder in zu geringen Stückzahlen, um eine militärische Wirkung zu entfalten. Im deutschen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Wunderwaffe im Allgemeinen eine Universallösung, die alle mit einem bestimmten Thema zusammenhängenden Probleme löst, und wird meist ironisch verwendet, weil er illusionär ist. Als sich die Kriegssituation für Deutschland ab 1942 verschlechterte, wurden Behauptungen über die Entwicklung revolutionärer neuer Waffen, die das Blatt wenden könnten, zu einem immer wichtigeren Teil der Propaganda, die die deutsche Regierung an die Deutschen richtete. In Wirklichkeit erforderten die in der Entwicklung befindlichen fortschrittlichen Waffen in der Regel lange Entwicklungs- und Testphasen, und es bestand keine realistische Aussicht, dass das deutsche Militär sie vor Kriegsende einsetzen konnte. Der Historiker Michael J. Neufeld stellte fest, dass "das Nettoergebnis all dieser Waffen, ob eingesetzt oder nicht, darin bestand, dass das Reich viel Geld und technisches Know-how verschwendete, um exotische Geräte zu entwickeln und zu produzieren, die wenig oder gar keinen taktischen und strategischen Vorteil brachten". Einige wenige Waffen erwiesen sich jedoch als durchaus erfolgreich und hatten großen Einfluss auf die Nachkriegsentwicklung. Dieses Buch beschreibt die neuartigen Waffensysteme "Wunderwaffen", die für das Deutsche Heer entwickelt wurden. Das Werk ist mit umfangreichem zeitgenössischem Bildmaterial illustriert. Umfang 158 Seiten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wunderwaffenneuartige Waffensysteme des Deutschen Heeres im 2. Weltkrieg
IMPRESSUMJürgen PrommersbergerHändelstr 1793128 Regenstauf
Einleitung & Vorbemerkung
Der Begriff Wunderwaffe wurde während des Zweiten Weltkriegs vom Propagandaministerium des nationalsozialistischen Deutschlands für einige revolutionäre "Superwaffen" verwendet wurde. Die meisten dieser Waffen blieben jedoch Prototypen, die entweder nie den Kriegsschauplatz erreichten, oder wenn doch, dann zu spät oder in zu geringen Stückzahlen, um eine militärische Wirkung zu entfalten. Die V-Waffen, die schon früher entwickelt wurden und vor allem gegen London und Antwerpen zum Einsatz kamen, gehen auf denselben Fundus an hochinnovativen Rüstungskonzepten zurück. Im deutschen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff Wunderwaffe im Allgemeinen eine Universallösung, die alle mit einem bestimmten Thema zusammenhängenden Probleme löst, und wird meist ironisch verwendet, weil er illusionär ist.
Als sich die Kriegssituation für Deutschland ab 1942 verschlechterte, wurden Behauptungen über die Entwicklung revolutionärer neuer Waffen, die das Blatt wenden könnten, zu einem immer wichtigeren Teil der Propaganda, die die deutsche Regierung an die Deutschen richtete. In Wirklichkeit erforderten die in der Entwicklung befindlichen fortschrittlichen Waffen in der Regel lange Entwicklungs- und Testphasen, und es bestand keine realistische Aussicht, dass das deutsche Militär sie vor Kriegsende einsetzen konnte. Als einige fortschrittliche Entwürfe wie der Panther-Panzer und das U-Boot Typ XXI überstürzt in Produktion gingen, erwies sich ihre Leistung für das deutsche Militär und die Führung als enttäuschend, was auf unzureichende Tests vor der Produktion oder schlecht geplante Konstruktionsprozesse zurückzuführen war. Der Historiker Michael J. Neufeld stellte fest, dass "das Nettoergebnis all dieser Waffen, ob eingesetzt oder nicht, darin bestand, dass das Reich viel Geld und technisches Know-how verschwendete (und dabei auch viele Zwangs- und Sklavenarbeiter tötete), um exotische Geräte zu entwickeln und zu produzieren, die wenig oder gar keinen taktischen und strategischen Vorteil brachten". Einige wenige dieser Waffen erwiesen sich jedoch als durchaus erfolgreich und hatten großen Einfluss auf die Nachkriegsentwicklung.
Dieses Buch betrachtet die Entwicklung der sogenannten „Wunderwaffen“ für das Heer. Auch hier gilt, wie für alle anderen Entwicklungen auch, dass zu sehr auf teilweise technisch anspruchsvolle Konzepte gesetzt wurde, anstatt mit den begrenzten Ressourcen bereits erprobte Waffen in größeren Stückzahlen zu fertigen.
Gepanzerte Fahrzeuge / Flakpanzer
Flakpanzer Kugelblitz
Der Flakpanzer IV Kugelblitz war eine deutsche Flugabwehrkanone mit Eigenantrieb, die während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde. Bis zum Ende des Krieges wurde nur eine Versuchsproduktion von fünf Stück fertiggestellt. Im Gegensatz zu früheren Selbstfahrlafetten verfügte er über einen vollständig geschlossenen, drehbaren Turm.
Modell im Maßstab 1/35
By KFS - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4198458
Der Bedarf an einer spezialisierten Flugabwehrkanone, die mit den Panzerdivisionen mithalten konnte, war für die Wehrmacht immer dringender geworden, da die Luftwaffe ab 1943 immer weniger in der Lage war, die Truppen gegen feindliche Jagdbomber zu schützen. Daher wurde eine Vielzahl improvisierter und speziell konstruierter Selbstfahrlafetten gebaut, viele davon auf dem Fahrgestell des Panzer IV, angefangen beim Flakpanzer IV Möbelwagen (eine Notlösung) bis hin zu den Modellen Wirbelwind und Ostwind. Bei diesen Entwürfen handelte es sich jedoch um hohe, nach oben offene Konstruktionen mit suboptimaler Panzerung. Diese Mängel sollten mit dem Kugelblitz, der letzten Entwicklung des Flakpanzers IV, behoben werden.
Flakpanzer Möbelwagen in Nordfrankreich, 21. Juni 1944
By Bundesarchiv, Bild 101I-301-1955-05 / Kurth / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0
de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477040
Der erste Vorschlag für den Kugelblitz sah vor, einen modifizierten, für U-Boote entwickelten Flugabwehrturm auf das Fahrgestell des Panzer IV zu montieren. Dabei sollten zwei 30-mm-Geschützen MK 303 Brünn zum Einsatz kommen. Dies war eine Konfiguration, die als Doppelflak bekannt war. Dies wurde jedoch als unpraktisch aufgegeben, da die Entwicklung dieses Geschützes noch nicht abgeschlossen war und die gesamte Produktion dieses Geschützturms für die deutsche Kriegsmarine reserviert war.
Stattdessen verwendete die Kugelblitz die 30-mm-Kanone MK 103/Pz in einer Zwillingsflak 103/38-Anordnung. Die MK 103 war auch in Einzellafetten in Flugzeugen wie der Henschel Hs 129 in einer Bauchlafette und in der zweimotorigen Dornier Do 335 eingebaut worden. Jede 30-mm-Kanone konnte 450 Schuss pro Minute abfeuern.
Modell "Kugelblitz" mit hochgekurbelten Geschützen
By Konrad Lackerbeck - Self-photographed, CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1830204
Der Kugelblitz kombinierte das Fahrgestell und den Grundaufbau des Panzers IV mit einem neu konstruierten Schwenkturm. Dieser Turm war vollständig geschlossen, hatte einen Überkopfschutz und war um 360° drehbar. Die geplante Massenproduktion kam wegen der Bombardierungen der Rüstungsindustrie durch alliierte Luftangriffe nicht zustande. Als die Produktion des Panzer IV eingestellt werden sollte, wurde weiter an der Umstellung auf das Jagdpanzer 38(t) Hetzer-Fahrgestell gearbeitet, das wiederum auf dem Panzer 38(t) basierte. Es wurden jedoch keine Prototypen auf Basis des Hetzer-Fahrgestells fertiggestellt.
By Darkone - Own work, CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3885851
Der Kugelblitz war bei Kriegsende noch nicht fertig entwickelt. Es wurden lediglich fünf Prototypen gebaut, und es ist unklar, was mit den wenigen gebauten Kugelblitzen geschah. Ein Kugelblitz-Flakpanzer war in die Kämpfe bei Spichra (Thüringen) verwickelt, wo er zerstört wurde.
Ein vollständiger Kugelblitz-Turm ist heute in der Lehrsammlung der Heeresflugabwehrschule in Rendsburg ausgestellt. Eine unvollständige Kugelblitz-Wanne existiert ebenfalls noch (allerdings ohne den Turm selbst) und befindet sich in einer Privatsammlung.
Flakpanzer Coelian oder Flakpanzer 341
Der deutsche Flakpanzer Coelian war ein Entwurfsmodell der Firma Rheinmetall mit zwei 3,7-cm-Fla-Kanonen in einem geschlossenen Turm auf der Wanne des Panzerkampfwagen V Panther.
Nach der Luftschlacht um England und den massiven Verlusten der deutschen Luftwaffe im Krieg gegen die Sowjetunion – besonders während der Schlacht von Stalingrad und nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg – wurde die deutsche Luftwaffe zunehmend in die Defensive gedrängt. Infolgedessen nahm auch die Bedrohung durch feindliche Jagdbomber-Verbände für die deutsche Wehrmacht zu. Daraufhin gab das Oberkommando der Wehrmacht den Auftrag, einen Flakpanzer auf der Basis des Fahrgestells des Panthers zu entwerfen, der den Veränderungen des Krieges Rechnung tragen sollte. Die Firma Rheinmetall entwickelte daraufhin den Turm „Coelian“ in verschiedenen Varianten, da das OKW immer wieder neue Ansprüche stellte und moderne Ausführungen der herkömmlichen Fla-Kanonen eingebaut werden mussten. Daher gab es für einen Turm mit der gleichen Code-Bezeichnung mehrere Ausführungen. Eine Attrappe wurde hergestellt, aber es kam zu keiner (Serien-)Produktion, weil im Mai 1944 der Turm für eine 5,5-cm- statt der vorgesehenen 3,7-cm-Kanone konzipiert werden sollte.
Von MARCO AURÉLIO ESPARZ…, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68899980
Zum wiederholten Male konnte die Produktion dieses Reißbrett-Panzers nicht anlaufen, weil die Landung in der Normandie durch die Alliierten, die zunehmende strategische Bomberoffensive der Alliierten und die Rohstoffknappheit einen Bau verzögerten. Immerhin wurde gegen Mitte Februar 1945 ein Holzmodell mit der gewünschten 5,5-cm-Zwillingskanone aufgestellt.
Jagdpanzer
Panzerselbstfahrlafette für 12,8-cm-Kanone 40
Die 12,8-cm-Selbstfahrlafette L/61 (Pz.Sfl. V) oder auch Panzerselbstfahrlafette für 12,8-cm-Kanone 40 entstand im Zweiten Weltkrieg aus der versuchsweisen Montage einer schweren Flugabwehrkanone auf dem Fahrgestell des Panzer-Entwicklungsmodell VK 30.01 von Henschel. Bei Projektbeginn zur Bekämpfung von Bunkern und Panzerkuppeln entwickelt, wurden die beiden Prototypen erstmals beim Überfall auf die Sowjetunion als schwere Panzerjäger eingesetzt und gingen Ende 1942 verloren.
Zeichnung einer deutschen Jagdpanzerselbstfahrlafette VK 3001 mit 12,8cm L/61. Basierend auf dem Fahrzeug in Kubinka und diversen Fotos aus dem Krieg
Von Alexpl - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4850989
Bereits im Jahr 1939 beauftragte das deutsche Heereswaffenamt die Entwicklung verschiedener Fahrzeuge zur Bekämpfung von Festungsanlagen, bestehend aus Bunkern und Panzerkuppeln. Diese Fahrzeuge sollten in der Lage sein, über größere Distanz Anlagen, wie die französische Maginot-Linie, durch direkten Beschuss auszuschalten. Die Entwicklung des schwersten Fahrzeugs unter dem Projektnamen Schwerer Betonknacker wurde gemeinschaftlich den Unternehmen Rheinmetall-Borsig (Hauptwaffe und Aufbau) und Henschel (Fahrgestell) übertragen. Aufgabe war es, die gerade neu entwickelte schwere 12,8-cm Flak 40 als Hauptbewaffnung in eine Selbstfahrlafette zu integrieren. Hierfür waren insbesondere Änderungen an der Lafette und am Rücklauf- und Vorholsystem des Geschützes erforderlich. Es wurde die 12,8-cm-Kanone L/61 geschaffen. Als Fahrgestelle dienten zwei Prototypen des von Henschel als Panzer-IV-Nachfolger entwickelten VK 30.01 (H). Aufgrund der Größe der Waffe und ihres Gewicht von 7 Tonnen war es erforderlich, die VK 30.01 Wannen von Henschel zu verlängern. Der Bau der beiden Prototypen erfolgte zum Jahreswechsel 1941/42 bei Rheinmetall-Borsig in Düsseldorf.
Das Gewicht aus Fahrgestell, Aufbau und Waffe war bereits bei der Planung des Fahrzeugs mit ca. 36 t höher als ursprünglich für das Fahrwerk VK 30.01 geplant. Das Rohr der Waffe ragte 2,7 m weit über die Wanne hinaus. Gegenüber dem VK 30.01 begann die Laufwerkskonfiguration mit einer auf der Kette außenlaufenden Laufrolle und war insgesamt um eine Laufrolle verlängert. Hinzu kam, dass der Abstand zwischen letzter Laufrolle und Leitrad durch die Verlängerung der Wanne auf 7 m erheblich vergrößert wurde. Jede Laufrolle war durch einen Drehstab gefedert, wobei die beiden letzten Laufrollen auf beiden Seiten nach einer ersten Erprobung mit stärkeren Drehstäben versehen wurden, da es ansonsten beim Schuss zu einer derart starken Nickbewegung kam, dass der Richtschütze das Ziel verlor. Die Kette bestand aus 85 Kettengliedern von 520 mm Breite.
Von Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK - VK30.01(H) “Sturer Emil”, CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63532241
Der Antrieb bestand aus einem 11,6-ltr-Maybach HL 116 Sechszylindermotor mit 310 PS, einer Dreischeibenkupplung und einem 6-Gang ZF SSG 77 Aphon-Getriebe und ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, wobei jedoch die durchschnittliche Marschgeschwindigkeit bei 20 km/h lag. Der Kraftstoffvorrat von 450 l gab dem Fahrzeug eine Reichweite von 170 km auf der Straße und 80 km im Gelände. Um hinten im Aufbau einen Kampfraum zu schaffen, wurde der Motor nach vorne verlegt. Ein großer Nachteil der Konstruktion war, dass bei allen Motorwartungen die gesamte Kanone ausgebaut werden musste. Im Kampfraum waren Halterungen für 15 Geschosse und 13 geschlossene Vorratshalterungen für Patronen montiert. Hinzu kamen Halter für zwei MP 40 und Munition, eine Leuchtpistole, sechs Stielhandgranaten, Verbandkasten, Feuerlöscher, Feldflaschen und Gasmasken und den Ansetzer. Der Fußboden bestand aus einem Lattenrost, bei dem die Rohrfixierung, welche hinten am Verschluss der Waffe einhakte, im Gefecht in einer Aussparung versenkt werden konnte.
Der Richtschütze saß links und hatte ein Selbstfahrlafetten-Zielfernrohr Typ Sfl. Z.F.1a/1, wie es auch in Sturmgeschützen verwendet wurde. Der Kommandant hatte ein drehbares Rundblickfernrohr für beide Augen. Die beiden Ladeschützen hielten sich im hinteren Kampfraum auf. Regulär wurde der Kampfraum über eine kleine Türe am Fahrzeugheck bestiegen. Der Fahrer saß alleine vorne in einem Erker, der eine nach oben zu öffnende Luke und einen seitlichen Notausstieg hatte. Damit der Fahrer nicht sofort zum Ziel feindlichen Beschusses wurde, gab es auf der rechten Seite des Fahrzeugs noch einen Attrappenerker. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen konnte der oben offene Kampfraum mit einer Plane geschlossen werden. Die Panzerung betrug an der vorderen Front 50 mm, an den Seiten zwischen 20 und 30 mm und am Heck 15 mm. Die Waffe hatte einen maximalen Seitenrichtbereich von 12°. Dabei konnte 7° nach rechts und 5° nach links gerichtet werden. Der Höhenrichtbereich ging von −15° bis +10°, wodurch auch Feuerstellungen am Hinterhang möglich wurden.
Nachdem bei Fertigstellung kein Bedarf mehr für den Einsatz gegen befestigte Anlagen bestand, verfügte die Organisationsabteilung des Heeres am 15. Mai 1942, dass die beiden Panzerselbstfahrlafette für 12,8-cm-Kanone 40 und eine noch verfügbare 10,5-cm-Selbstfahrlafette IV a „Dicker Max“ zu einem Panzerjäger-Zug zusammengefasst werden sollten. Dieser Zug wurde in die Panzerjäger-Abteilung (Sfl.) 521 eingegliedert. Unter dem Befehl von Oberleutnant Kurt Hildebrandt ging die Abteilung im Sommer 1942 an die Ostfront. Zwischenzeitlich waren die beiden Fahrzeuge von den Besatzungen nach den bekannten Figuren von Wilhelm Busch als „Max“ und „Moritz“ bezeichnet worden. Während des Einsatzes kam, ähnlich wie bei der 10,5-cm-Selbstfahrlafette, bei der Truppe der Name „Sturer Emil“ für die Fahrzeuge auf.
Ein Einsatzbericht beschreibt, wie diese Fahrzeuge auf große Distanz gegnerische Fahrzeuge erfolgreich zerstören konnten, doch geht aus dem Bericht hervor, dass diese einmal erkannt schnell zum Ziel des gegnerischen Feuers wurden und es die Besatzungen tunlichst vermieden, die riesige Seitenfläche zum Gegner hin zu exponieren. Ein Foto zeigt das Fahrzeug Nr. 2 mit 22 Abschussmarkierungen. Beide Fahrzeuge gingen bei Kämpfen mit der Roten Armee während der Schlacht von Stalingrad verloren.
Ein von der sowjetischen Armee am Ende der Kämpfe im Raum Stalingrad erbeutetes Fahrzeug war über lange Jahre im Panzermuseum Kubinka ausgestellt. Heute steht es in der Nähe im Patriot Park.
Panzerjäger Tiger (P) „Ferdinand/Elefant“
Der Panzerjäger Tiger (P) „Ferdinand“, später nach Umbau mit dem Suggestivnamen „Elefant“, (Sd.Kfz. 184) war ein schwerer Jagdpanzer der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.
Ein restaurierter Jagdpanzer Elefant
Von Scott Dunham - Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6675639
Der Panzerjäger „Tiger P“ für 8,8-cm Pak 43/2 (Sf.) (Sd.Kfz. 184), so geführt in den Unterlagen des Generalinspekteurs der Panzertruppe von November 1943 bis April 1944, erhielt schon vor seiner Auslieferung an die Truppe einen deutlich weniger „sperrigen“ Beinamen für den Alltagsgebrauch. Benannt nach Ferdinand Porsche, der für die Antriebskonzeption des Fahrzeugs verantwortlich zeichnete, ist bereits für eine Besprechung mit Adolf Hitler vom 6. Februar 1943 die Bezeichnung Sturmgeschütz auf Fahrgestell Porsche Tiger mit langer 8,8 Kanone (Ferdinand) dokumentiert. Jedoch wurde der Name auf Hitlers persönlichen Wunsch hin im November 1943 nochmals geändert mit der Anweisung, das Fahrzeug künftig mit „Elefant“ zu bezeichnen. Infolgedessen ist es im Bestand der Schweren Panzerjäger-Abteilung 653 ab Mai 1944 als s.Pz.Jg VI (P) 8,8 cm Pak 43/2 L/71 „Elefant“ aufgeführt.
Beschädigter Panzerjäger „Elefant“ bei Nettuno, Italien 1944
Von Bundesarchiv, Bild 101I-313-1004-25 / Vack / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5477141
Während des Jahres 1941 hatte Ferdinand Porsche als Mitglied der deutschen Panzerkommission von dem Plan des Heereswaffenamtes (HWA) erfahren, einen schweren Panzer zu entwickeln. Er schaffte es, einen von der Industrie unabhängigen Entwicklungsauftrag für sein Entwicklungsbüro in Stuttgart zu erhalten. Seine Entwicklergruppe begann mit einem Fahrzeug, das als VK 30.01 (P) bekannt geworden ist. Aus diesem Projekt wurde letztlich als zweiter Typ eines schweren Panzers der VK 45.01 (P), der im Entwicklungsprogramm des Heereswaffenamt im Wettbewerb mit dem später als Tiger I in Serie gefertigten Panzerkampfwagen-Entwurf der Firma Henschel stand.
Frühzeitig finanzierte das HWA die Fertigung von Bauteilen für eine Serie von 100 Fahrzeugen. Doch letztlich wurde das Projekt nach der Fertigung von einigen Prototypen und Versuchsfahrzeugen beendet. Noch immer waren jedoch noch 90 Fahrzeugwannen und Bauteile für deren Komplettierung zu einem schweren Panzerfahrzeug vorhanden. Noch im Herbst 1942 wurde entschieden, dass diese für den Bau eines schweren Sturmgeschützes genutzt werden sollten. Nach der Entscheidung zum Bau des künftigen schweren Jagdpanzers wurde die Firma ALKETT in Berlin mit der Entwicklung beauftragt, weil sie viel Erfahrung mit dem Bau und der Konzeption solcher Fahrzeuge hatte. Die ungewöhnliche Antriebstechnik führte zur Einbeziehung von Porsche und seinem Entwicklungsteam, um die Antriebseinheit zu verlegen und neu aufzubauen.