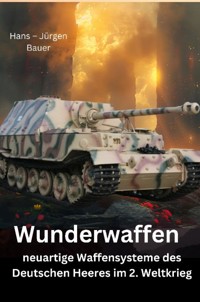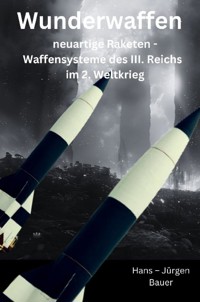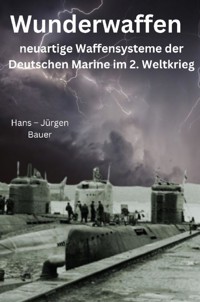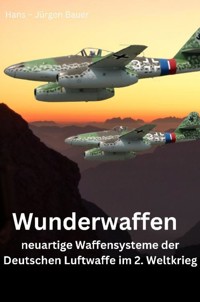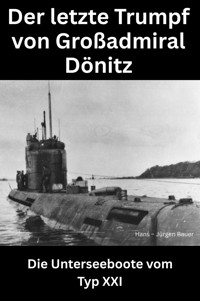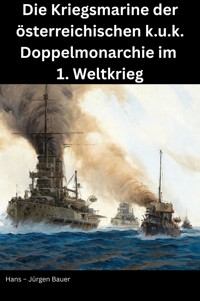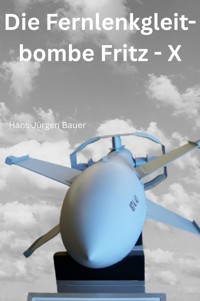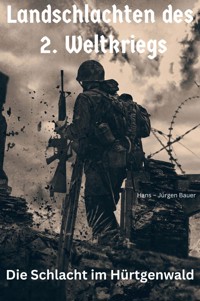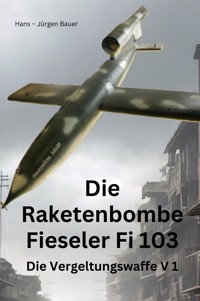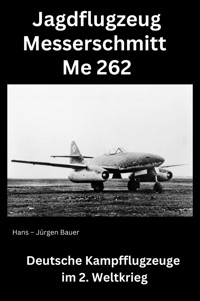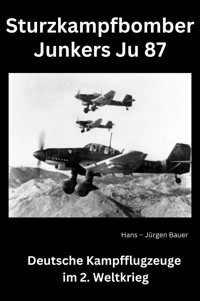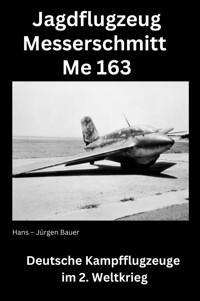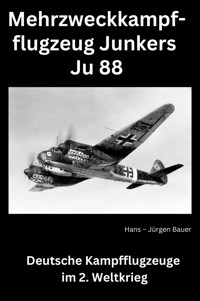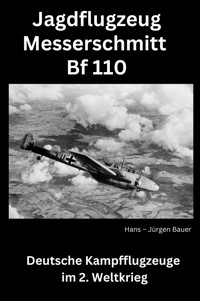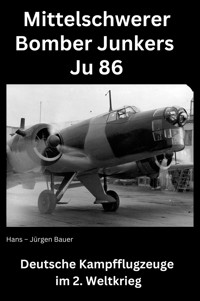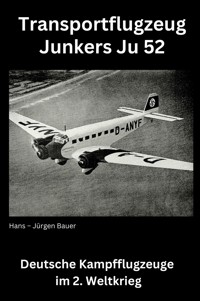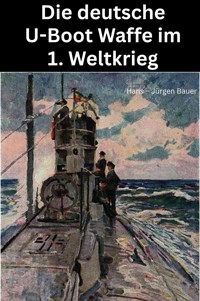
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die deutsche U-Boot Waffe im 1. Weltkrieg Anfangs von der deutschen Admiralität noch belächelt, spielte die deutsche U-Boot-Waffe im Kampf gegen die Handelsrouten der Alliierten, vor allem in den Gewässern um die britischen Inseln und im Mittelmeer, eine immer größere Rolle. Die deutschen U-Boote versenkten dabei fast 5.000 Schiffe mit einer Bruttoregistertonne von über 12 Millionen und verloren 178 Boote und etwa 5.000 Mann im Kampf. Die Alliierten waren jedoch in der Lage, eine relativ konstante Tonnage an Schiffen zur Verfügung zu halten, was auf eine Kombination aus Schiffsbau und Gegenmaßnahmen, insbesondere die Einführung von Konvois, zurückzuführen war. Dieses Werk beinhaltet die Geschichte dieses verbissen geführten Kampfes, beschreibt Taktik und die einzelnen U-Boot Typen und gibt Beispiele über ausgewählte Einsatzfahrten von bestimmten U-Booten. Dazu werden auch die technischen Details, die Entwicklungen während des Krieges und die Varianten beschrieben. Das Werk ist mit umfangreichem zeitgenössischem Bildmaterial illustriert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die deutsche U-Boot Waffe im 1. Weltkrieg
IMPRESSUM:
Autor: Hans-Jürgen BauerHerausgeber:M. PrommesbergerHändelstr 1793128 Regenstauf
Inhaltsverzeichnis:
Frühe Entwicklungen bis zum ersten Weltkrieg
Der U-Bootkrieg im ersten Weltkrieg
Flotten U-Boote Typ UA
Einschub: U-Boot Fallen / Q-Ships
Flotten U-Boote Typ UB
U-Boot Technik: Petroleum- und Dieselmotoren
Minenleger U-Boote
Handels U-Boote und U-Kreuzer
U-Boot Technik: die Torpedowaffe
Sie kamen zu spät: Typ UD 1, UF und UG
Frühe Entwicklungen bis zum ersten Weltkrieg
Der Brandtaucher
Sebastian Wilhelm Valentin Bauer (* 23. Dezember 1822 in Dillingen an der Donau; † 20. Juni 1875 in München) war ein deutscher Erfinder, der das erste moderne Unterseeboot nach seinen Plänen in Kiel erbauen ließ und 1851 am Tauchversuch teilnahm.
Wilhelm Bauer erlernte zunächst das Drechslerhandwerk und trat dann in ein Reiterregiment ein. Dort erfand er einen Hebezug zum Transport von Kanonen. Im Dienstgrad eines Korporals nahm Bauer in der 10. Feldbatterie des bayrischen Hilfskorps am Schleswig-Holsteinischen Krieg teil. In Düppel hatte Bauer am 13. April 1849 beim Anblick dänischer Einheiten, die bei Sonderburg über eine Pontonbrücke vorrückten, erstmals die Idee, durch den Einsatz einer Unterwasserwaffe eine Verteidigungslinie schaffen zu können − in diesem Fall für die von den Dänen beschossene sächsische Brigade.
Noch während seines Einsatzes in Jütland studierte Bauer die natürlichen Bewegungsabläufe des Seehundes, um mit Hilfe dieser Kenntnisse einen technischen Apparat zu entwerfen. Doch der Berliner Waffenstillstand vom 10. Juli 1849 beendete den Einsatz der Truppen des Deutschen Bundes, und Bauer musste nach Bayern zurückkehren. Er stellte im Herbst 1849 seinen Entwurf einer sachverständigen Kommission vor. Die Ablehnung des Entwurfes veranlasste Bauer zur Rückkehr nach Schleswig-Holstein. Am 30. Januar 1850 trat er als Unteroffizier in die schleswig-holsteinische Armee ein. Stationiert wurde der Soldat in Rendsburg.
Schon wenige Tage später wandte sich Bauer mit seinen Plänen für einen Tauchapparat an die militärische Führung. Sie kommandierte ihn im März 1850 zur Realisierung eines Modells nach Kiel, verbunden mit dem Auftrag an die schleswig-holsteinische Flottille (Kriegsmarine), eine Kommission einzusetzen. Anhand von Plänen sollte sie die Chancen des Apparates prüfen. Die Kommission gelangte zu einem zustimmenden Urteil.
Weil trotz der relativ positiven Beurteilung des Projektes das Einwerben öffentlicher Mittel erfolglos blieb, versuchte Bauer auf privatem Wege die Finanzierung eines ersten Apparates zu realisieren. Hierfür erhielt Bauer in Rendsburg eine Beurlaubung, wo Offiziere ihn unterstützten. Zunächst sollte der Apparat in Büdelsdorf in der Carlshütte erstellt werden. Doch wegen mangelnder Kapazitäten kam es 1850 zum Bau des ersten Unterseebootes mit dem Namen Brandtaucher (wegen seiner außergewöhnlichen Form auch Eiserner Seehund genannt) bei der Maschinenfabrik und Eisengießerei Schweffel & Howaldt in Kiel durch August Howaldt. Bauer hatte die Umsetzung seiner Pläne gegen massiven Widerstand zeitgenössischer Experten durchsetzen können. Nach der Entscheidung zum Bau mussten jedoch die Entwurfspläne aus Kostengründen drastisch geändert werden: Die Wandstärke wurde deutlich von 12,5 mm auf 6 mm verringert, der Spantenabstand vergrößert, die vorgesehene Trimmung durch Ballast und Trimmtanks wurde durch ein verschiebbares Gewicht aus 500 kg Gusseisen ersetzt, das Ballastwasser wurde in den Rumpf anstatt in Ballasttanks geleitet.
Auf Grund des Zusammenbruch der Schleswig-Holsteinischen Erhebung startete Wilhelm Bauer gemeinsam mit dem Zimmermann Friedrich Witt und dem Schmied Thomsen am 1. Februar 1851 eine Testfahrt des Brandtauchers. Das Unterseebot war noch nicht vollendet und aus Geldmangel auch unvollkommen ausgerüstet. Es sank auf den Grund der Kieler Förde. Der Rumpf gab nach und Wasser brach ein. Die Besatzung konnte sich aus eigener Kraft retten. Im Sommer 1887 wurde der Brandtaucher beim Bau des Kieler Torpedohafens geborgen. Heute befindet er sich im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Ein Funktionsmodell eines Tauchbootes von Wilhelm Bauer aus dem Jahr 1852 befindet sich im Deutschen Museum in München.
Der Brandtaucher sollte Schiffe, Brücken und Hafenanlagen unterhalb der Wasserlinie angreifen und in Brand setzen. Aus dem Bootsinneren sollte dazu mit Stulpenhandschuhen und Greifarmen ein rund 50 kg schwerer Explosivkörper, der Brand, an den feindlichen Objekten befestigt werden. Aufgrund dieser Idee trägt das erste deutsche und älteste erhaltene U-Boot der Welt den Namen Brandtaucher.
Daten Länge: 8,07 m
Breite: 2 m
Höhe: 3,76 m
Verdrängung: 30,5 t (getaucht)
Copyright: Jan Wellen
Copyright Georg761 in der Wikipedia auf Russisch
Versuchs-U-Boot (1897)
Das Versuchs-U-Boot wurde 1897/98 bei den Howaldtswerken in Kiel gebaut und gilt als missglückter Versuch im Bau von U-Booten.
Seit den Pionierarbeiten von Wilhelm Bauer mit dem 1850 in Kiel von der Maschinenfabrik und Eisengießerei Schweffel & Howaldt gebauten Brandtaucher war es in Deutschland um die U-Bootentwicklung weitgehend still geworden. In anderen Ländern wurde wesentlich intensiver geforscht, so in Spanien, Russland, England, Schweden und den USA. Mehrere Erfinder arbeiteten in Frankreich an der Entwicklung von U-Booten. Typisch für diese Frühzeit des U-Bootbaus war, dass die Boote nicht selten in Eigeninitiative der Erfinder gebaut wurden, so auch bei den Howaldtswerken. Das Interesse der jeweiligen Marine des Landes konnte nur selten geweckt werden.
Baunummer 333
Auf eigene Rechnung konstruierte und baute die Kieler Werft unter der Baunummer 333 ein experimentelles Tauchboot nach einem Entwurf des deutschen Marineoffiziers und Torpedoingenieurs Karl Leps. Der zylindrische Rumpf des 40-t-Versuchs-U-Bootes hatte vorne ein Torpedorohr und lief hinten spindelförmig zur vierflügeligen Schraube aus. Die Länge des außen glatten Bootes betrug 13 bis 14 m, die größte Breite wird mit 2,40 m angegeben. Angetrieben wurde es von einem umsteuerbaren 120-PS-Elektromotor, der bei Überwasserfahrten für eine Geschwindigkeit von 6 bis 7 Knoten sorgte. Die Akkumulatoren für die Stromversorgung standen auf dem Schiffsboden. In dem kastenförmigen Kiel unter dem Bootskörper saßen die Tauch- und Trimmzellen, die einzeln geflutet und mit Druckluft aus einem Torpedoluftkessel gelenzt werden konnten. Zusätzlich befanden sich hier auch von innen ausklinkbare eiserne Ballastgewichte.
Vorne und hinten besaß das Boot je ein wasserdichtes Kollisionsschott, das vorne auch als Stützschott für ein Torpedoablaufrohr diente. Der Mündungsdeckel konnte von innen betätigt werden. Die Steuerung erfolgte über zwei Horizontalruder am Ende von etwa 400 mm breiten Stabilisierungsblechen, die in halber Höhe um den Bootskörper liefen und einem Seitenruder, das sich vor der Schraube befand, die durch einen Ruderschutzbügel geschützt war.
Durch einen in der Mitte des Schiffes aufgenieteten Taucherhelm mit vier Bullaugen hatte die Schiffsführung nur beschränkte Beobachtungsmöglichkeiten. Das Boot besaß keine Belüftungs- und Ventilationsanlage und muss innen sehr nass gewesen sein, wohl auch ein Grund für die vielen Havarien der elektrischen Anlage. Die Verschlussluke für den Einstieg lag hinter dem Ausguckhelm. Nach Bildquellen zu urteilen ist das Boot noch umgebaut worden und hat statt des als „Turm“ dienenden Taucherhelms einen etwas größeren Aufbau erhalten. Kommandant des Bootes war Kapitän Arp, gefahren wurde mit weiteren 2 – 3 Mann Besatzung.
In offenem Gewässer wurden nur Überwasserfahrten durchgeführt, wobei auch Kaiser Wilhelm den Neubau 1901 auf der Kieler Förde sah, als das Boot an seiner Yacht SMY Hohenzollern vorbeifuhr.
Bei den Probefahrten musste zur Erneuerung der Druckluft oft die Förde zum Torpedoschießstand der Berliner Firma Schwartzkopff in Düsternbrook gequert werden. Weil die Konstruktion als wenig betriebssicher galt, sind nie eigene Tauchversuche unternommen worden. Um die Dichtigkeit des Schiffskörpers zu prüfen, erfolgte lediglich eine Absenkung mit einem Schwimmdock, bei der die Besatzung über ein Belüftungsrohr mit der Oberfläche in Verbindung blieb. Interesse an diesem wenig leistungsfähigen Boot bestand offensichtlich nicht. Als es später wegen zerfressener Bodenbleche durch ausgetretene Akkusäure sank, wurde es nach der Bergung hinter einem Holzverschlag aufgelegt und vermutlich um 1902 verschrottet.
Versuchs U-Boot Forelle
Die Forelle war ein 1902 gebautes deutsches U-Boot. Nach dem Brandtaucher wurde 1897 in Deutschland das Versuchsboot 333 auf der Howaldtwerft in Kiel gebaut. Es trug die Bau-Nr. 333, da jedoch zu dieser Zeit keinerlei Interesse an dem U-Boot bestand, wurde es vermutlich um 1902 verschrottet.
Ab Juni 1902 wurde auf der Germaniawerft in Kiel unter strenger Geheimhaltung und ohne Auftrag der Marine ein weiteres Versuchstauchboot mit Elektroantrieb gebaut. Sein damaliger Tarnname war »Leuchtboje«, später erhielt es den Namen Forelle. Es basierte auf den Plänen des Ingenieurs Raymondo Lorenzo d’Equevilley-Montjustin, der sich seinerseits an die Erkenntnisse der Konstrukteure Claude Goubet, Gustave Zédé und Isaac Peral sowie des Engländers Waddington hielt. Es diente zur Erprobung der Eigenschaften von Unterseebooten, zur Überprüfung der Kriegstauglichkeit solcher Fahrzeuge und um Grundlagen zum Bau größerer U-Boote zu erwerben.
Die Forelle wurde als das erste kriegsbrauchbare deutsche U-Boot angesehen, auch wenn die vom Konstrukteur erhoffte Geschwindigkeit bei weitem nicht erreicht wurde. Sie hatte zwei seitlich am Rumpf angebrachte Torpedorohre, einen Kommandoturm, ein kurzes Sehrohr, eine Luftreinigungsanlage mit einem Lufttrockenkasten und zwei Stahlflaschen für je 1000 Liter Sauerstoff bei Normaldruck sowie eine Lenzpumpe. Da sie ursprünglich als Beiboot für größere Kriegsschiffe vorgesehen war, gab es hierfür Hebeaugen.
Der Durchmesser des Druckkörpers betrug nur 1,66 m. Das Ausstoßen eines Torpedos erfolgte mit Druckluft, wobei für einige Sekunden eine relativ große Schlagseite von bis zu 20° auftrat. Der Kommandoturm wurde später um 300 mm erhöht und der hölzerne Aufbau auf dem Druckkörper vergrößert.
Der Antrieb erfolgte über einen Elektromotor mit fester Drehzahl, die Geschwindigkeitseinstellung über die Drehflügelschraube. Als Energiequelle diente eine Batterie mit 108 Zellen Torf-Akkus von je 65 kg Masse und 715 Amperestunden (Ah) Kapazität bei zehnstündiger Entladung, die von der Watt-Akkumulatorenfabrik in Zehdenick geliefert wurden. Die Torf-Akkus hatten nur eine kurze Lebensdauer. Um die Stabilität zu verbessern, wurde die Batterie später um 14 Zellen verkleinert. Bei 4 kn betrug der Fahrbereich 25 sm.
Im Herbst 1903 besichtigte Kaiser Wilhelm II die Forelle. An den Versuchsfahrten in der Eckernförder Bucht nahm am 23. September 1903 auch Prinz Heinrich von Preußen teil.
1904, inmitten des russisch-japanischen Kriegs, wurde die Forelle zwei russischen Marineoffizieren bei einer Probefahrt bei Eckernförde präsentiert. Die Kaiserlich Russische Marine kaufte das Boot und gab am 20. April den Bau dreier weiterer U-Boote in Auftrag. Dabei handelte es sich um 205-Tonnen-Boote, die auf einer Weiterentwicklung der Pläne der Forelle durch Maxime Laubeuf basierten. Am 20. Juni 1904 wurden alle vier U-Boote per Eisenbahn von Kiel nach Sankt Petersburg exportiert.
Ab August 1904 war die Форель (Forelle) in Vladivostok stationiert. Im Einsatz behauptete sie sich mittelmäßig erfolgreich, bis sie bei einem Unfall am 10. Mai 1910 sank. Das Boot wurde anschließend gehoben und abgewrackt.
U-Boot Klasse UA (Petroleumantrieb)
Unterseeboot SM U1
U 1 ist das erste deutsche Militär-U-Boot und wurde am 14. Dezember 1906 von der Kaiserlichen Marine in Dienst gestellt. Heute befindet sich U 1 im Deutschen Museum in München.
Vorgeschichte
Nach dem erfolgreichen Test des Experimental-U-Boots Forelle im Jahre 1902 gab das Reichsmarineamt nach langem Zögern dem Marineingenieur Gustav Berling am 4. April 1904 den Auftrag, ein U-Boot zur Seekriegsführung zu bauen. Berling wandte sich an die Germaniawerft in Kiel. Dabei lehnte sich sein Entwurf an die drei zuvor an Russland exportierten U-Boote der Karp-Klasse an. Maßgeblich basierte das Boot auf den Patenten des bei Krupp beschäftigten spanischen Ingenieurs Raimondo Lorenzo d’Equevilley Montjustin, der zuvor für den führenden französischen U-Boot-Konstrukteur Maxime Laubeuf gearbeitet hatte.
Um den Ansprüchen des Reichsmarineamts an das neue U-Boot zu genügen, mussten allerdings einige konstruktive Änderungen vorgenommen werden, wodurch sich der Bau des Bootes verzögerte. Der Leiter des Reichsmarineamtes, Alfred von Tirpitz, verlangte ein Unterseeboot mit einer Verdrängung von 347 Tonnen, einem Aktionsradius von 1.400 sm (2.593 km) und Geschwindigkeiten von 10,8 kn (20 km/h) über und 8,7 kn (16 km/h) unter Wasser.
Bau und Indienststellung
Im April 1905 wurde schließlich mit dem Bau begonnen. Die wesentlichen Neuerungen gegenüber der Forelle betrafen – neben den Größenausmaßen – hauptsächlich den Druckkörper, die horizontale Anordnung der Torpedorohre sowie den Antrieb. Bei U 1 handelt es sich um ein sogenanntes Zweihüllenboot. Es bot Platz für zehn Mann Besatzung, konnte rund zwölf Stunden unter Wasser bleiben und eine Tiefe von bis zu 30 m erreichen. Außerdem wollte man aus Sicherheitsgründen anstatt gefährlicher Benzinmotoren, mit denen man bis dahin schlechte Erfahrungen gemacht hatte, zwei je 147 kW (200 PS) starke Petroleummotoren einsetzen, die jedoch zu dieser Zeit erst noch fertiggebaut werden mussten. Für die Unterwasserfahrt setzte man auf ebenso starke Elektromotoren. Schließlich wurde am 14. Dezember 1906, nach mehreren Testfahrten, das erste deutsche Militär-U-Boot von der Kaiserlichen Marine als SM U 1 in Dienst gestellt. Sein erster Kommandant war Kapitänleutnant Erich von Boehm-Bezing.
Einsatz und Verbleib
U 1 wurde ausschließlich zu Testzwecken und als Schulungsboot eingesetzt. Heimathafen war Eckernförde, wo zur Erprobung aller U-Boote ein U-Boot-Anleger, der so genannte Isern-Düker-Steg, gebaut wurde. 1919 sollte es, wie alle anderen deutschen U-Boote, zerstört oder ausgeliefert werden. Oskar von Miller, der Gründer des Deutschen Museums, konnte das Boot für das Museum retten. Das teilweise abgewrackte Boot wurde in Einzelteilen per Eisenbahn nach München transportiert. Dort ist es bis heute als Ausstellungsstück des Deutschen Museums zu besichtigen.
Schiffsdaten
Bauwerft Germaniawerft, Kiel
Stapellauf 4. August 1906
Indienststellung 14. Dezember 1906
Verbleib Ausstellungsstück im Deutschen Museum, München
Länge 42,39 m (Lüa)
Breite 3,8 m
Verdrängung aufgetaucht: 238 t / getaucht: 283 t
Besatzung 12 Mann
Maschine 2 Körting Petroleum-Motoren
2 Elektromotoren
Maschinenleistung 400 PS (294 kW)
Propeller 2
Tauchtiefe, max. 30 m
Höchstgeschwindigkeit getaucht 8,7 kn (16 km/h)
Höchstgeschwindigkeit aufgetaucht 10,8 kn (20 km/h)
Bewaffnung1 Torpedorohr ∅ 45 cm (3 Schuss)
Copyright der folgenden drei Bilder: Jorge Royan (Aufnahmen aus dem deutschen Museum)
Maschinenraum
Zentrale und Periskop
Torpedo & Batterieraum
Unterseeboot SM U3
SM U3 (Seiner Majestät Unterseeboot 3) war ein deutsches U-Boot der Kaiserlichen Marine. Es wurde am 13. August 1907 in Auftrag gegeben und in der Kaiserlichen Werft Danzig auf Kiel gelegt. Der Stapellauf erfolgte am 27. März 1909, die Auslieferung am 29. Mai 1909.
Vor dem Ersten Weltkrieg
Am 17. Januar 1911 ereignete sich der einzige deutsche U-Boot-Unfall vor dem Ersten Weltkrieg. U 3 sank im Kieler Hafen. Vermutlich wurde einer der Ballasttanks versehentlich geflutet. Taucher befestigten mehrere Stahlseile an der Hülle, und es wurde versucht, U 3 mittels des Schwimmkrans Langer Heinrich zu heben. Es gelang, das Schiff bis auf Torpedorohrhöhe zu heben und anschließend fast die komplette Mannschaft durch selbiges zu retten, bevor diese durch das Chlorgas der auslaufenden Akkumulatoren bleibende gesundheitliche Schäden erlitt. Der Versuch, das Boot weiter anzuheben, um die im Turm festsitzenden Männer zu retten, schlug jedoch fehl, und so musste gewartet werden, bis das U-Boot-Hebeschiff SMS Vulkan einsatzbereit war. Dies war jedoch zu spät für die drei Marinesoldaten, Kapitänleutnant Ludwig Fischer, Leutnant z.S. Kalbe und U-Obermatrose Rieper, die verstarben.
Erster Weltkrieg
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde U 3 auf vier Feindfahrten in die Ostsee geschickt, wo es in Kooperation mit anderen deutschen Kriegsschiffen gegen die russische Marine vorgehen sollte. Es stellte sich jedoch bald die Untauglichkeit von U 3 für derlei Kriegseinsätze heraus. Daher wurde es noch im August 1914 zum Schulboot umfunktioniert und blieb bis Kriegsende Teil der Ausbildungsflottille in Kiel.
Technische Daten
U-Boot-Typ: Zweihüllen-Hochsee-Boot
U-Boot-Klasse: U3 - U4
Verdrängung: 420 Tonnen (über Wasser) / 510 Tonnen (unter Wasser)
Länge: 51,28 m
Breite: 5,60 m
max. Tauchtiefe: 50 m
Antrieb: Petroleummotoren 2×173 kW
E-Maschinen 2×371 kW
Bewaffnung 2 Bugrohre/2 Heckrohre/6 Torpedos
1×5 cm (Artillerie)
Besatzung: 3 Offiziere / 19 Mannschaften
Geschwindigkeit: 11,5 kn (21 km/h) über Wasser
9,5 kn (18 km/h) unter Wasser
Einsätze: 4 Feindfahrten
Erfolge: keine
Verbleib: Am 27. Januar 1919 in Kiel abgewrackt
Unterseeboot SM U6
SM U 6 (Seiner Majestät Unterseeboot 6) war ein petroleum-elektrisches U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. U6 lief am 18. Mai 1910 bei der Germaniawerft in Kiel vom Stapel und wurde am 12. August 1910 in Dienst gestellt. Die Kommandanten des U-Bootes waren Wilhelm-Friedrich Starke, Otto Steinbrinck und Reinhold Lepsius.
In vier Kriegseinsätzen erzielten die Kommandanten und ihre Besatzungen 13 Versenkungen gegen Handelsschiffe der Entente und neutraler Staaten mit einer Gesamttonnage von 4.654 BRT.
Am 15. September 1915 befand sich U 6 vor der norwegischen Küste westlich von Stavanger. Wegen der kalten Luft waren die Abgase der Verbrennungsmotoren weithin sichtbar. Das britische U-Boot E16 unter Kommandant E. Talbot sichtete U 6 und schoss aus knapp 500 Metern Entfernung querab beide Bugtorpedos auf das deutsche U-Boot ab. Einer der Torpedos traf U 6 unterhalb des Kommandoturms. Daraufhin sank U 6 auf folgender Position ♁58° 55′ N, 5° 10′ O. Von den 29 Besatzungsmitgliedern überlebten 5. Auch Oberleutnant zur See Reinhold Lepsius befand sich unter den Toten.
Technische Daten
U-Boot Typ: Zweihüllen-Hochsee-Boot
Serie: U 5 – U 8
Bauwerft: Germaniawerft, Kiel
Verdrängung: 505 Tonnen (über Wasser) / 636 Tonnen (unter Wasser)
Länge: 57,30 m
Breite: 5,60 m
Tiefgang: 3,55 m
Druckkörper ø: 3,75 m
max. Tauchtiefe: 30 m
Antrieb: Petroleummotoren 900 PS
E-Maschinen 1040 PS
Geschwindigkeit: 13,4 Knoten (über Wasser)
10,2 Knoten (unter Wasser)
Bewaffnung: 2 Bug- und 2 Heckrohre, 6 Torpedos
1 Revolver-Kanone (bis Ende 1914)
1 x 50-mm-Kanone (ab 1915)
Besatzung: 4 Offiziere und 24 Mannschaften
Erfolge: 13 versenkte Handelsschiffe
Verbleib: Am 15. September 1915 vor der norwegischen Küste durch das britische U-Boot E16 versenkt.
Unterseeboot SM U9
SM U 9 war ein petroleum-elektrisches U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.
Technische Daten
Das Zweihüllen-Hochsee-Boot war 57,38 m lang, 6,00 m breit, hatte einen Tiefgang von 3,13 m sowie eine Verdrängung von 493 Tonnen über und 611 Tonnen unter Wasser. Der Durchmesser des Druckkörpers betrug 3,65 m. Damit konnte es in 50–90 Sekunden auf maximal 50 m Abtauchen. Der Antrieb erfolgte über Wasser mit 1000 PS starken Petroleummotoren und unter Wasser mit Elektromotoren (1160 PS). Damit waren Geschwindigkeiten von 14,2 Knoten (über Wasser) bzw. 8,1 Knoten (unter Wasser) möglich. Die sechs mitgeführten Torpedos konnten über zwei Bug- und zwei Heckrohre verschossen werden.
Geschichte
U 9 wurde als erstes Boot seiner Klasse (U 10, U 11 und U 12) am 15. Juli 1908 in Auftrag gegeben und in der Kaiserlichen Werft in Danzig auf Kiel gelegt. Der Stapellauf erfolgte am 22. Februar 1910, die Auslieferung am 18. April 1910. Am 16. Juli 1914 gelang es der Mannschaft von U 9 − zum ersten Mal überhaupt – während einer Tauchfahrt Torpedos nachzuladen.
Am 22. September 1914 versenkte U 9 unter dem Kommando von Kapitänleutnant Otto Weddigen ca. 50 km nördlich von Hoek van Holland nacheinander die drei britischen Panzerkreuzer HMS Aboukir, HMS Hogue und HMS Cressy. Dabei verloren etwa 1.500 Menschen ihr Leben, ca. 800 konnten gerettet werden. Auf der nächsten Feindfahrt konnte das Boot am 15. Oktober vor Aberdeen den britischen Geschützten Kreuzer HMS Hawke versenken. Nach Weddigen und seiner Besatzung bekam nun auch das Boot selbst eine Auszeichnung, indem es fortan ein Eisernes Kreuz am Turm führen durfte. Außer U 9 wurde im Ersten Weltkrieg nur dem Kleinen Kreuzer SMS Emden diese Ehrung zuteil.
Am 12. Januar 1915 wurde der Erste Wachoffizier Johannes Spieß Otto Weddigens Nachfolger. Unter seinem Kommando verlegte U 9 in die Ostsee und wurde dort zum Minenleger umgebaut. Am 5. November 1915 wurde ein russisches Minensuchboot versenkt. Dies war der fünfte Kriegsschiffserfolg von U 9. Spieß kommandierte U 9 bis zum 19. April 1916. Anschließend wurde es bis Kriegsende in Kiel als Schulboot eingesetzt. Am 26. November 1918 wurde das Boot an Großbritannien ausgeliefert und 1919 in Morecambe, Lancashire, abgewrackt.
Insgesamt unternahm U 9 sieben Feindfahrten und versenkte dabei fünf Kriegsschiffe mit 44.173 Tonnen und 13 Handelsschiffe mit 8.636 BRT. Kein anderes Boot hat während des Ersten Weltkrieges mehr Kriegsschiffe versenkt.
Unterseeboot SM U14
SM U 14 war ein deutsches U-Boot der Kaiserlichen Marine, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Es wurde am 23. Februar 1909 in Auftrag gegeben und in der Kaiserlichen Werft Danzig auf Kiel gelegt. Der Stapellauf erfolgte am 11. Juli 1911, die Auslieferung am 24. April 1912.
Erster Kommandant nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Kapitänleutnant Walther Schwieger, der am 7. Mai 1915 mit U 20 das britische Passagierschiff Lusitania versenkte. Ihm folgte Ende 1914 Kptlt. Otto Dröscher. Am 16. April 1915 übernahm Oberleutnant zur See Max Hammerle das Kommando auf U 14. Bis Ende Mai 1915 hatte U 14 keine unmittelbaren Kampfeinsätze.
Auf seiner ersten Feindfahrt versenkte U 14 am 2. Juni 1915 den mit Kohle beladenen dänischen Frachter Cyrus mit 1.669 BRT. Einen Tag später wurde der schwedische Frachter Lappland (2.238 BRT) versenkt, der mit einer Ladung Eisenerz auf dem Weg von Narvik nach Middlesbrough war.
Am 5. Juni 1915 begegnete U 14 dem bewaffneten Fischerboot Oceanic II vor der schottischen Küste bei Peterhead, östlich von Aberdeen. U 14 gab einen Warnschuss ab, worauf die Oceanic II sofort das Feuer eröffnete. Nachdem Hammerle erkannt hatte, dass U 14 dem gegnerischen Schiff waffentechnisch unterlegen war, befahl er umgehend zu tauchen. Durch ein beschädigtes Flutventil sank nur das Bootsheck, während der Bug oberhalb der Wasserlinie blieb. Zwischenzeitlich waren weitere bewaffnete Trawler eingetroffen und nahmen aus kurzer Distanz den an der Oberfläche befindlichen Bug unter Beschuss. Hammerle ließ das Boot komplett auftauchen. Nach einem Rammstoß des Trawlers Hawk gab er den Befehl zum Verlassen des sinkenden U-Bootes. Die Besatzung wurde mit Ausnahme des Kommandanten vollständig von den britischen Schiffen gerettet. U 14 sank auf der Position ♁57° 10′ N, 1° 10′ O.
Weitere Bilder von Booten mit Petrol – Antrieb
U-Boot-Klasse UD
Bei der U-Boot-Klasse UD handelte es sich um U-Boote, die ursprünglich für Österreich-Ungarn gebaut wurden. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs wurden sie von der Kaiserlichen Deutschen Marine übernommen. Die U-Boot-Klasse UD ist nicht zu verwechseln mit dem 1918 in Auftrag gegebenen U-Kreuzer mit Turbinenantrieb SM UD 1 der Kaiserlichen Marine.
Bereits 1913 hatte Österreich-Ungarn fünf U-Boote bei der Germaniawerft bestellt. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs im Juli 1914 wurden die Boote nach Verhandlungen mit Österreich von der deutschen Marine übernommen und fertiggestellt. Sie wurden zwischen Juli und September 1915 als SM U 66 bis SM U 70 in Dienst gestellt.
Technische Daten Typ UD
Verdrängung: 791 t (über Wasser)
933 t (unter Wasser)
Länge: 69,50 m
Breite: 6,30 m
Tiefgang: 3,79 m
Druckkörper: Ø 4,15 m
max. Tauchtiefe: 50 m
Tauchzeit: 40–100 s
Antrieb: Dieselmotoren 2 × 1150 PS
E-Maschinen 2 × 620 PS
Geschwindigkeit: 16,8 kn (über Wasser)
10,3 kn (unter Wasser)
Fahrbereich: