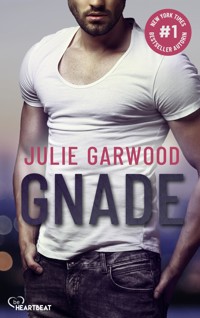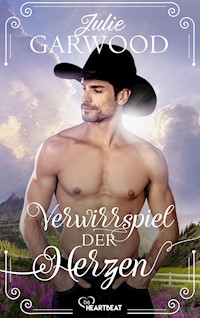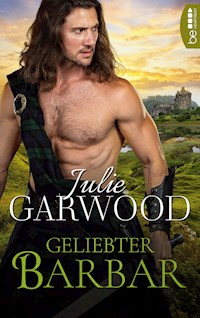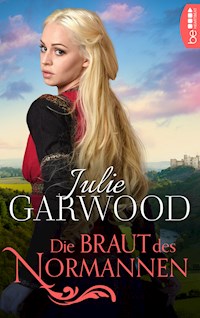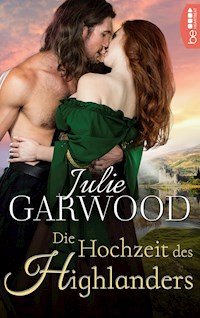7,99 €
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Romance – Liebe und Leidenschaft in Rose Hill, Montana
- Sprache: Deutsch
New York City, 1860: Auf einem Abfallhaufen finden vier Straßenjungen einen Korb mit einem Baby. Spontan beschließen sie, es Mary Rose zu nennen und wie eine Schwester großzuziehen. In Montana bauen sie gemeinsam eine Ranch auf, wo Mary Rose im Schoß ihrer neuen Familie glücklich heranwächst.
Eines Tages erscheint der schottische Anwalt Harrison Stanford McDonald auf der Ranch und verliebt sich auf der Stelle in Mary Rose. Schon bald erwidert diese seine Gefühle, doch dann enthüllt er ihr ein nahezu unglaubliches Geheimnis, das ihr Leben von Grund auf verändern wird ...
Liebe und prickelnde Leidenschaft in Rose Hill, Montana - die fesselnd-sinnliche Trilogie der Bestsellerautorin Julie Garwood um die Familie Clayborne:
Band 1: Die Tochter des Lords
Band 2: Verwirrspiel der Herzen
Band 3: Leg dein Herz in meine Hände
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Über die Autorin
Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
New York City, 1860: Auf einem Abfallhaufen finden vier Straßenjungen einen Korb mit einem Baby. Spontan beschließen sie, es Mary Rose zu nennen und wie eine Schwester großzuziehen. In Montana bauen sie gemeinsam eine Ranch auf, wo Mary Rose im Schoß ihrer neuen Familie glücklich heranwächst.
Eines Tages erscheint der schottische Anwalt Harrison Stanford McDonald auf der Ranch und verliebt sich auf der Stelle in Mary Rose. Schon bald erwidert diese seine Gefühle, doch dann enthüllt er ihr ein nahezu unglaubliches Geheimnis, das ihr Leben von Grund auf verändern wird ...
Julie Garwood
Die Tochter des Lords
Aus dem amerikanischen Englisch von Eva Malsch
Kein Mensch ist eine Insel und ganz allein; jeder ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlands; wenn das Meer einen Erdklumpen hinwegspülte, wäre Europa kleiner, so wie auch eine Landzunge und das Haus deiner Freunde oder dein eigenes kleiner wäre; mit dem Tod jedes Menschen stirbt etwas von mir, denn ich bin mit der Menschheit eng verbunden; und darum suche nie zu wissen, für wen die Totenglocke läutet, sie läutet für dich.
John Donne,
Devotions upon Emergent
Occasions, Meditation XVII
Prolog
New York City, 1860
Sie fanden das Kind auf einem Abfallhaufen, und die Ratten hatten es glücklicherweise noch nicht erreicht. Zwei Biester waren bereits auf den Deckel des Korbs gekrochen und nagten am Geflecht, drei andere zerrten mit ihren scharfen Zähnen an den Seitenwänden, und alle gebärdeten sich wie verrückt. Denn sie rochen Milch und zartes Fleisch.
In dieser Hintergasse war die Bande zu Hause. Drei der vier Jungen schliefen in Holzkisten, mit altem Stroh ausgekleidet. Eine ganze Nacht lang hatten sie gestohlen und gekämpft, und vor lauter Erschöpfung hörten sie das Geschrei des Babys nicht.
Das Kind wurde von Douglas gerettet, dem vierten Banditen, der gerade an der Straßenecke Wache hielt. Zuvor hatte er eine Frau im dunklen Mantel beobachtet, die mit dem Korb in die Gasse gelaufen war, und leise gepfiffen, um die anderen zu warnen. Sie blieb kurz stehen, warf über die Schulter einen verstohlenen Blick zur Straße zurück, dann eilte sie in die Mitte der Gasse und warf den Korb auf den Abfallberg, der sich an einer Mauer türmte. Dabei murmelte sie unentwegt vor sich hin. Die Worte verstand Douglas nicht, denn sie wurden von seltsamen Lauten übertönt, die aus dem Korb drangen und wie Katzengemaunze klangen.
Offensichtlich fürchtete sich die Frau. Ihre Hand zitterte, als sie die Kapuze ihres Umhangs tiefer in die Stirn zog. Vielleicht fühlte sie sich schuldig, weil sie ein altes, krankes Haustier aussetzte, das niemand mehr haben wollte. So schnell die Beine sie trugen, rannte sie zur Straße, und Douglas pfiff wieder, diesmal lauter. Sofort sprang das älteste Bandenmitglied auf, ein entlaufener Sklave namens Adam. Douglas zeigte auf den Korb, dann folgte er der Frau. Aus der Tasche ihres Umhangs hatte er ein dickes Kuvert ragen sehen und beschlossen, die Gelegenheit zu nutzen. Möglicherweise konnte er ein kleines Geschäft machen, denn immerhin war er der beste elfjährige Taschendieb in der Market Street.
Adam schaute ihm nach, dann versuchte er, den Korb zu ergreifen. Doch die Ratten ließen sich ihre Beute nicht so leicht entreißen. Mit einem scharfkantigen Stein schlug er einem Tier auf den Kopf, worauf es laut quietschte und floh. Dann zündete er eine Fackel an und schwenkte sie vor dem restlichen ekligen Viehzeug. Sobald es verscheucht war, trug er den Korb zu den Kisten, wo seine Gefährten schliefen, und ließ ihn beinahe fallen, als er ein Wimmern hörte. »Travis, Cole, wacht auf! Douglas hat was gefunden.«
Ein paar Schritte entfernt setzte er sich auf den Boden, an eine Ziegelwand gelehnt, stellte den Korb, aus dem es winselte, ab und wartete, bis die beiden Jungen zu ihm kamen. Cole ließ sich zu seiner Rechten nieder, Travis an der anderen Seite.
»Was ist los, Boss?«, fragte Travis und gähnte. Vor einem Monat hatten die drei Banditen den entlaufenen Sklaven zu ihrem Anführer ernannt und bei dieser Entscheidung sowohl ihrem Verstand als auch ihren Gefühlen gehorcht. Mit seinen fast vierzehn Jahren war er der älteste und intelligenteste von ihnen. Außerdem hatte er sie alle vor dem sicheren Tod gerettet. In den Hintergassen von New York City, wo nur die Stärksten überlebten, spielten Vorurteile gegen Schwarze keine Rolle. Hunger und Gewalt beherrschten die Nacht, und beide waren farbenblind.
»Ich weiß nicht, was das ist ...«, begann Adam.
»Ein Korb, das sieht man doch«, wurde er von Cole unterbrochen. »Vielleicht ist die Schließe am Deckel aus echtem Gold.«
Adam zuckte die Achseln, und Travis, der Jüngste, ahmte die Geste nach. Dann nahm er die Fackel entgegen, die der Boss ihm reichte, und hielt sie hoch, damit alle den Korb inspizieren konnten. »Sollen wir auf Douglas warten, bevor wir das Ding aufmachen? Wohin ist er denn gegangen?«
»Sicher kommt er gleich zurück.« Adam berührte die Schließe.
»Moment mal, Boss!«, warnte Cole. »Da drin bewegt sich was – und es wimmert.« Er zog sein Messer. »Hörst du’s auch, Travis?«
»Ja. Wenn das eine Schlange ist, die uns beißt ...«
»Unsinn!«, erwiderte Cole ärgerlich. »Hast du nur Stroh im Hirn? Schlangen wimmern nicht. Wahrscheinlich ist’s ein Kätzchen.«
Beleidigt senkte Travis den Kopf. »Wenn wir den Korb nicht aufmachen, finden wir’s nie raus.«
Adam nickte zustimmend, öffnete die Schließe und hob den Deckel ein wenig hoch. Nichts sprang ihm entgegen, und er seufzte erleichtert. Dann nahm er den Deckel ab. Alle drei Jungen spähten in den Korb, schnappten nach Luft, konnten nicht glauben, was sie sahen.
Da lag ein Baby, schön wie ein Engel, in seligem Schlaf. Ein Daumen steckte im Mund, hin und wieder greinte es leise. Adam war der erste, der sich von seiner Überraschung erholte. »Großer Gott!«, flüsterte er. »Wie kann man so einen Schatz wegwerfen?«
»So was tun die Leute immer wieder«, entgegnete Cole und versuchte, seine unmännliche Aufregung zu verbergen. »Die Reichen und die Armen. Da gibt’s keinen Unterschied. Irgendwas fällt ihnen auf die Nerven, und sie werfen’s einfach weg. Hab ich recht, Travis?«
»Klar«, bestätigte der kleine Junge.
»Boss, hast du nicht die Geschichten über das Waisenhaus gehört, die Douglas und Travis erzählt haben?«, fragte Cole.
»Dort habe ich viele Babys gesehen«, erklärte Travis, bevor Adam antworten konnte. »Die wurden im zweiten Stock untergebracht und manchmal einfach vergessen. Dann gingen sie elend zugrunde.« Bei dieser Erinnerung bebte seine Stimme. »Dieses arme Wurm hier würde das auch nicht überleben. Es ist noch viel zu klein.«
Cole runzelte die Stirn. »Glaubst du, es ist ein Junge?«
»O ja. Er ist kahl. Nur Jungen kommen mit Glatzen auf die Welt.«
Dieses Argument überzeugte Cole. Er wandte sich zum Anführer. »Was machen wir mit ihm?«
»Jedenfalls werfen wir ihn nicht weg.« Es war Douglas, der diese Entscheidung traf. Die anderen blickten zu ihm auf, verblüfft über den zornigen Klang seiner Stimme. »Ich hab alles beobachtet. Vorhin fuhr eine Kutsche die Straße runter. Ein elegant gekleideter Mann stieg aus, den Korb unter dem Arm. Weil er unter einer Laterne stand, sah ich sein Gesicht ganz deutlich – und die Frau auch. Die hatte an der Ecke auf ihn gewartet. Er ging zu ihr und redete auf sie ein. Offenbar fürchtete sie sich, und er wurde wütend. Warum – das merkte ich bald.«
»So? Warum denn?«, fragte Cole.
»Offenbar wollte sie den Korb nicht nehmen.« Douglas kauerte sich neben Travis auf den Boden. »Immer wieder schüttelte sie den Kopf. Der Mann zog einen dicken Umschlag aus der Tasche, hielt ihn der Frau vor die Nase, und da besann sie sich anders. Blitzschnell riss sie ihm das Kuvert aus der Hand, steckte es ein, und ich ahnte, dass da was Wichtiges drin sein muss. Dann nahm sie den Korb. Der Mann kletterte wieder in den Wagen und fuhr davon.«
»Und was tat sie?«, wollte Travis wissen.
»Sie lief in unsere Gasse und warf den Korb weg. Auf den achtete ich nicht, denn ich dachte, eine alte Katze würde drin sitzen. Ein Baby – darauf wär’ ich nie gekommen, sonst hätte ich mich doch nicht aus dem Staub gemacht. Also, ich war mächtig neugierig auf das Kuvert und schlich der Frau nach.«
»Hast du’s gekriegt?«, wisperte Travis, und Douglas kicherte.
»Natürlich – ich bin ja nicht umsonst der beste Taschendieb von der Market Street: Die Frau hatte es verdammt eilig, aber ich konnte mich trotzdem an sie ranmachen. In der Menge, die zum Mitternachtszug drängte, nahm ich ihr den Umschlag weg, und die dumme Gans merkte gar nichts.«
»Und was ist in dem Kuvert?«, erkundigte sich Cole.
»Das werdet ihr nicht glauben.«
Ungeduldig verdrehte Cole die Augen. Warum musste Douglas immer alles so spannend machen? Das fiel den anderen gewaltig auf die Nerven. »Hör mal, wenn du nicht endlich ...«
Aber Travis unterbrach die Drohung. »Erst mal muss ich was Wichtiges sagen.« Der Inhalt des Kuverts interessierte ihn nicht im mindesten. »Wenn wir den kleinen Kerl nicht hier liegenlassen, wem wollen wir ihn dann geben?«
»Also, ich kenne niemanden, der ein Baby haben will«, gab Cole zu und rieb sich das glatte Kinn, so wie er es bei älteren, stoppelbärtigen Gaunern gesehen hatte. Er glaubte, das würde die anderen beeindrucken. »Wozu ist so ein winziges Kind überhaupt nutze?«
»Wahrscheinlich zu gar nichts«, erwiderte Travis. »Aber vielleicht später, wenn’s größer wird ... Dann könnten wir ihm einiges beibringen.«
»Was, zum Beispiel?« Vorsichtig berührte Douglas die Stirn des Babys mit einem Zeigefinger. »Seine Haut fühlt sich wie Seide an.«
Travis erwärmte sich für die Idee, das Baby zu erziehen. »Also, du bildest ihn zum Taschendieb aus, Douglas. Das kannst du wirklich gut. Und du, Cole, zeigst ihm, wie man richtig gemein ist. Ich hab schon oft beobachtet, wie du dreinschaust, wenn du glaubst, man hätte dir unrecht getan. Bring’s ihm doch bei! Das sieht wirklich grauenhaft aus!«
Erfreut über das Kompliment, grinste Cole ihn an. »Ich habe ein Schießeisen gestohlen.«
»Wann?«, fragte Douglas.
»Gestern. Und sobald ich ein bisschen Munition geklaut habe, lerne ich, wie man damit feuert. Bald bin ich der schnellste Schütze von der Market Street. Und wenn ihr mich ganz nett drum bittet, erziehe ich diesen kleinen Burschen zum zweitschnellsten.«
»Und ich erkläre ihm, wie man alles findet, was man braucht«, erbot sich Travis. »Darin bin ich wirklich gut, was, Boss?«
»Ja«, bestätigte Adam. »Sehr gut.«
»Dann wären wir die beste Bande von New York City, und alle würden sich ganz schrecklich vor uns fürchten«, wisperte Travis. Seine Augen begannen zu strahlen, und seine Stimme nahm einen träumerischen Klang an. »Sogar Lowell und seine Freunde, diese Bastarde.« Damit meinte er eine rivalisierende Gang, die ihnen allen insgeheim Angst einjagte.
Eine Zeitlang schwiegen die Jungen, um über diese beglückenden Zukunftsaussichten nachzudenken. Dann strich Cole wieder über sein Kinn. »Und du, Boss, könntest ihm alles über diese Bücher erzählen – ich meine, was du bei deiner Mama gelernt hast. Vielleicht wird er dann genauso schlau wie du.«
»Ja, von dir könnte er lesen und schreiben lernen«, fügte Travis aufgeregt hinzu. »Und niemand würde ihm deshalb den Rücken auspeitschen.«
»Wenn wir ihn behalten, müssen wir ihm erst mal dieses alberne Kleid ausziehen.« Angewidert musterte Douglas die weißen Spitzenrüschen, die das Baby einhüllten. »Niemand darf ihn auslachen.«
»Das traut sich keiner, weil ich ihn sonst umbringe«, versprach Cole.
»Alle Babys tragen solche Sachen«, behauptete Travis. »Das habe ich gesehen.«
»Und wie wollen wir ihn füttern?«, fragte Cole.
»Im Korb liegt eine Milchflasche, und wenn sie leer ist, füll ich sie wieder«, erklärte Travis. »Wahrscheinlich hat er noch keine Zähne, deshalb kann er nichts Richtiges essen. Also braucht er nur Milch – und ein paar Windeln. Die besorge ich auch.«
»Wieso weißt du so viel über Babys?«, erkundigte sich Cole.
»Einfach so.« Travis zuckte die Achseln.
»Und wer wickelt ihn, wenn er sich angepinkelt hat?«, fragte Douglas.
»Da wechseln wir uns ab«, schlug Cole vor.
»Hinter McQueenys Haus hängen oft Windeln an der Wäscheleine«, erzählte Travis, »und winzige Kleider. Die könnte ich mir für unseren Kleinen schnappen. Und wie soll er heißen?«
»Es muss ein ganz besonderer Name sein«, meinte Cole.
»Mein Pa hieß Andrew«, verkündete Douglas.
»So?«, entgegnete Cole. »Und nach dem Tod deiner Ma hat er dich ins Waisenhaus gesteckt, oder?«
»Ja«, gab Douglas zu und senkte den Kopf.
»Nach jemandem, der sein Kind weggegeben hat, können wir unser Baby nicht nennen. Wo’s doch selber schon auf dem Müll gelandet ist! Der Name deines Pas würde ihm nur Unglück bringen. Ich finde, der kleine müsste Sidney heißen, nach diesem eleganten Burschen, der das Lottogeschäft in der Summit Street betrieben hat. Erinnerst du dich an ihn, Douglas?«
»Klar. Der war hoch angesehen.«
»Und er starb eines natürlichen Todes. Das ist wichtig. Er hat sich von niemandem abmurksen lassen. Wirklich, ein vorbildlicher Mann.«
»Und der Name klingt gut«, meinte Travis. »Stimmen wir doch ab!«
Douglas hob seine schmutzige rechte Hand. »Ich bin dafür. Wer noch?«
Alle außer Adam folgten seinem Beispiel. Während der letzten Minuten hatte er geschwiegen, und das war nur Cole aufgefallen. »Stimmt was nicht, Boss?«
»Das weißt du doch. Ich muss von hier verschwinden. In dieser Stadt würde ich nicht überleben, und ich war schon viel zu lange hier. Nun muss ich in den Westen gehen. Dort finden mich die Söhne meines Besitzers nicht. So wie jetzt will ich nicht mehr leben. Jeden Tag muss ich mich in dunklen Hintergassen verstecken, bis es Nacht wird. Da draußen in der Wildnis kann man untertauchen. Also kann ich euch nicht helfen, das Baby großzuziehen, und deshalb will ich auch nicht mitreden, wenn ihr einen Name aussucht.«
»Ohne dich schaffen wir’s aber nicht, Adam«, jammerte Travis. »Du darfst uns nicht verlassen.« Wie ein verängstigter kleiner Junge brach er in Tränen aus. »Bitte, bleib bei uns!«, rief er flehend.
Seine schrille Stimme weckte das Baby, und es begann zu schreien.
Adam griff in den Korb, berührte den Bauch des Kindchens, und seine Hand zuckte sofort wieder zurück. »Oh, es ist klatschnass!«
»Dann müssen wir ihm die Windel abnehmen, Boss, oder es kriegt einen wunden Hintern«, erläuterte Travis.
Das Baby begann zu strampeln, und die Jungen beobachteten es fasziniert.
»Wenn es das Gesichtchen so zusammenkneift, kriegt es lauter Falten«, wisperte Douglas. »Süßes kleines Ding, was?«
Cole nickte und wandte sich zu Adam. »Du bist der Boss, und du musst ihm die Windel abnehmen.«
Dieser Verantwortung wollte sich der älteste Bandit nicht entziehen. Er holte tief Atem, schnitt eine Grimasse, dann schob er seine Hände unter die Arme des Babys und hob es langsam aus dem Korb. Nun schlug es die Augen auf. Im Licht der Fackel, die Travis hochhielt, erblickten sie alle ein strahlendes Blau.
»Könnte dein Bruder sein, Cole«, meinte Travis. »Er hat deine Augen.«
Die Arme stocksteif ausgestreckt, hielt Adam das Baby fest und hatte keine Ahnung, was er nun tun sollte. Womöglich würde er ihm wehtun. Schließlich bat er Cole, das Kleidchen hochzuheben und die Windel zu entfernen.
»Warum ich?«, beschwerte sich Cole.
»Weil du direkt daneben stehst. Beeil dich! Wenn er sich bewegt, entschlüpft er mir womöglich, und ich lasse ihn fallen.«
»Ein neugieriger kleiner Kerl, was?«, sagte Travis zu Douglas. »Schau, wie er uns anstarrt! So ernst!«
Aufgeregt hielt Cole den Atem an, während er das Baby von der nassen Baumwollwindel befreite. Klatschend landete sie neben dem Korb am Boden. Er wischte sich die Hände an seinen Hosenbeinen ab, dann griff er nach dem Babykleidchen, um es nach unten zu ziehen. Und da erkannte er die Wahrheit. Um sich zu vergewissern, schaute er noch einmal ganz genau hin.
Sidney war ein Mädchen. Ein kahlköpfiges Mädchen. Helle Wut erfasste ihn. Was zum Teufel sollten sie mit einem nichtsnutzigen Mädchen anfangen? Nein, damit wollte er nichts zu tun haben. Es war wohl am besten, wenn sie das Kind wieder auf den Müll warfen.
Aber schon nach wenigen Sekunden stimmte es ihn um. Gerade wollte er wütend die Stirn runzeln, als es ihn ansah. Er wollte wegschauen, doch das konnte er einfach nicht. Mühelos hielt das Kind seinen Blick fest, und dann zog es ihn vollends in Bann. Es lächelte. Von diesem Moment an war er verloren, mit Leib und Seele gehörte er der Kleinen.
»Von jetzt an ist alles anders«, erklärte er. »Wir können nicht die beste Gang von New York City werden. In diesen Hintergassen, zwischen lauter Gaunern darf sie nicht aufwachsen. Sie braucht eine Familie.«
»Sie?« Beinahe ließ Adam das Baby fallen. »Willst du mir vielleicht erzählen, dass Sidney ein Mädchen ist?«
Cole nickte. »Wenn sie ein Junge wäre, hätte sie bestimmte Körperteile.«
»Gott steh uns bei!«, wisperte Adam.
»Ein Mädchen können wir nicht brauchen«, murmelte Travis. »Das sind doch nur lästige Heulsusen.«
Die anderen Jungen ignorierten ihn und schauten Adam an, der unglücklich die Stirn runzelte.
»Was ist los, Boss?«, fragte Cole.
»Ein Schwarzer dürfte kein lilienweißes kleines Mädchen in den Händen halten.«
»Immerhin hast du sie vor den Ratten gerettet. Wenn sie älter wäre und das alles verstehen könnte, würde sie dich vor lauter Dankbarkeit küssen. Außerdem weiß sie nicht, ob du schwarz oder weiß bist.«
»Ist sie denn blind?«, fragte Travis verblüfft.
»Nein«, murmelte Cole ungeduldig, »aber zu klein, um diese Art von Hass zu begreifen. Wenn Babys zur Welt kommen, hassen sie gar nichts. Das muss man ihnen erst beibringen. Wenn sie Adam anschaut, sieht sie nur einen – einen Bruder. Und große Brüder beschützen ihre kleinen Schwestern, nicht wahr? Ein heiliges Gesetz. Vielleicht weiß dieses kleine Ding schon was davon.«
»Ich habe meiner Mama versprochen, so weit nach Westen zu fliehen, bis ich mich in Sicherheit bringen kann«, erklärte Adam. »Und sie sagte, wahrscheinlich bricht ein Krieg aus, und wenn alles vorbei ist, könnte sie auch befreit werden. Dann will sie mir nachkommen. So lange muss ich am Leben bleiben. Darauf habe ich ihr mein Wort gegeben. Und was man seiner Mama verspricht, sollte man halten.«
»Nimm doch das Baby mit«, schlug Cole vor.
»Dann hängen sie mich ganz sicher auf«, entgegnete Adam verächtlich.
»Verdammt, du bist ja auch nicht aufgehängt worden, nachdem du diesen Bastard umgebracht hast, deinen Besitzer, erinnerst du dich?«
»Und du bist viel zu schlau, um dich fangen zu lassen, Adam«, betonte Douglas.
»Ich fühle mich auch wie der Bruder dieses kleinen Mädchens«, verkündete Cole. Als die anderen ihn verwundert anstarrten, fügte er hastig hinzu: »Wenn man so was zugibt, ist man keineswegs feige. Ich bin stark, und das ist ein winziges Bündelchen, das Brüder wie Adam und mich braucht, damit’s anständig aufwachsen kann.«
»Anständig?«, wiederholte Douglas. »Was weißt du schon davon?«
»Nichts«, gestand Cole. »Aber Adam weiß alles darüber. Nicht wahr, Boss? Du kannst reden und lesen und schreiben wie ein Gentleman. Das alles hat deine Mama dir beigebracht, und jetzt musst du mir Unterricht geben. Meine kleine Schwester soll mich nicht für einen Trottel halten.«
»Er könnte uns alle unterrichten«, meinte Douglas.
»Aber ich will auch ihr Bruder sein«, meldete sich Travis wieder zu Wort. »Wenn ich erwachsen werde, bin ich groß und stark, was, Douglas?«
»Klar«, stimmte Douglas zu. »Wisst ihr, was ich denke?«
»Was denn?« Trotz seiner Sorgen grinste Adam, denn soeben hatte ihn das Baby angelächelt. Offenbar gefiel es dieser Kleinen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Ihr Lächeln erwärmte sein Herz und linderte den Kummer, der ihn seit der Trennung von seiner Mama quälte. Wie ein Himmelsgeschenk war das Kind in seine Arme gelegt worden, und jetzt musste er es lieben und beschützen. »Manchmal frage ich mich, ob der Allmächtige weiß, was Er tut«, flüsterte er.
»Natürlich weiß Er das«, erwiderte Douglas. »Und Er will sicher, dass wir uns einen anderen Namen für unser Baby ausdenken. Sidney passt nicht zu einem Mädchen. Hoffentlich wachsen ihr bald Haare. Ich mag keine glatzköpfige kleine Schwester.«
»Mary«, platzte Cole heraus.
»Rose«, sagte Adam gleichzeitig.
»Meine Mama hieß Mary«, erklärte Cole. »Sie starb bei meiner Geburt, und später erzählten mir Nachbarn, sie sei eine gute Frau gewesen.«
»Und meine Mama heißt Rose«, berichtete Adam. »Die ist immer noch eine gute Frau.«
»Jetzt schläft das Baby wieder ein«, wisperte Travis. »Leg’s in den Korb zurück, Boss. Da drin hab ich ein paar saubere Windeln gefunden. Ich will mal versuchen, die Kleine zu wickeln, dann könnt ihr euch über den Namen streiten.«
Adam gehorchte, und alle schauten zu, wie Travis das Kind ungeschickt in eine frische Windel hüllte. Als er diese schwierige Aufgabe erfüllt hatte, schlief es tief und fest.
»Da gibt’s nichts zu streiten.« Douglas deckte das Baby zu, während Adam und Cole die Gründe angaben, warum sie es nach ihren Müttern nennen wollten. Diplomatisch beendete er die Diskussion. »Sie heißt Mary Rose. Mary nach deiner Mama, Cole, und Rose nach deiner, Boss.«
Zufrieden grinste Cole, und auch Adam stimmte zu.
»Nun müssen wir Pläne schmieden«, flüsterte Douglas, um das Baby nicht zu wecken. »Am besten steigen wir morgen in den Mitternachtszug. Bis dahin musst du alle Sachen besorgen, die Mary Rose braucht, Travis. Ich kaufe die Fahrkarten. Und du, Adam, versteckst dich mit dem Baby im Frachtwaggon. Einverstanden?«
»Eine gute Idee«, antwortete Adam.
»Und wie willst du die Karten kaufen, Douglas?«, fragte Cole.
»Das Kuvert, das ich der Frau weggenommen habe, steckt voller Geld. Und da sind auch ein paar alte Papiere mit komischer Schrift und Siegeln. Keine Ahnung, was draufsteht. Ich kann ja nicht lesen. Dafür weiß ich ganz genau, wie Geld aussieht. Damit kommen wir weit genug, und der Boss kann irgendwo im Westen ein Stück Land für uns abstecken.«
»Zeig mir mal die Papiere!«, verlangte Adam.
Bereitwillig zog Douglas das Kuvert aus der Tasche und zeigte es dem Anführer. Beim Anblick der Geldscheine stieß Adam einen leisen Pfiff hervor. Dann studierte er die beiden Papiere. Ein Blatt war mit Zahlen und Zeichen bedeckt, deren Sinn er nicht verstand. Und das andere sah aus wie eine leere, aus einem Buch herausgerissene Seite. Am oberen Rand standen ein paar handgeschriebene Zeilen – das Geburtsdatum des Babys und sein Gewicht. Diese Angaben las er laut vor.
»Also haben sie nicht nur Mary Rose weggeworfen, sondern auch ihre Papiere«, murmelte Douglas empört.
»Als ich im Waisenhaus ankam, hatte ich gar keine Papiere«, erzählte Travis. »Ein Glück, dass ich meinen Namen schon kannte. Und jetzt will ich euch was vorschlagen. Ich bin hier der Einzige, der nicht von der Polizei gesucht wird. Also sollte Mary Rose meinen Nachnamen bekommen. Wir alle sollten so heißen. Wie Geschwister. Von dieser Minute an sind wir alle Claybornes. Einverstanden?«
»Kein Mensch wird mich für einen Clayborne halten«, wandte Adam ein.
»Wen interessiert schon, was die anderen glauben?«, entgegnete Cole. »Wir bitten niemanden um seine Einwilligung und wollen nur in Ruhe gelassen werden. Wenn du sagst, du bist ein Clayborne, und wir sagen, du bist ein Clayborne, wer sollte da widersprechen. Und falls das irgendwem nicht passt, muss er sich erst einmal mit uns auseinandersetzen – wenn er unbedingt Ärger haben will. Und vergesst nicht – ich habe ein Schießeisen! Sicher kann ich bald damit umgehen und alle Schwierigkeiten aus der Welt schaffen.«
Die anderen nickten, nur Adam seufzte skeptisch. Feierlich legte Douglas eine Hand auf den Korb. »Wir fliehen für Mama Rose – und wir bilden eine Familie für unsere kleine Mary Rose. Jetzt sind wir Brüder.«
»Ja – Brüder!«, gelobte Travis und berührte Douglas’ Hand.
Auch Cole schloss sich dem Bund an. »Für Mary Rose und Mama Rose. Und wir sind Brüder, bis der Tod uns scheidet.«
Adams Zögern schien eine halbe Ewigkeit zu dauern. Aber dann umschloss er Coles Hand, die auf den anderen lag. »Brüder«, schwor er, und seine Stimme bebte vor Rührung. »Für die beiden Rosen.«
3. Juli 1860
Liebe Mama Rose, ich schreibe Dir an Mistress Livonias Adresse, und ich hoffe, Du bist bei guter Gesundheit, wenn Dich mein Brief erreicht. Nun werde ich Dir meine wundervolle, abenteuerliche Reise in den Westen schildern. Aber zuerst muss ich Dir von unserer neuen Familie erzählen. Jetzt hast Du eine Namensschwester, Mama. Sie heißt Mary Rose ...
Alles Liebe,
John Quincy Adam Clayborne
1
Montana Valley, 1879
Endlich würde das Baby nach Hause kommen. Cole wartete neben seinem Wagen auf die Postkutsche, die bald an der Straßenbiegung auftauchen musste. Wie die Staubwolke über dem Hügel verriet, konnte es nicht mehr lange dauern. Vor lauter Aufregung konnte er kaum stillstehen. So schmerzlich hatte er sich nach Mary Rose gesehnt ...
Ob sie sich in den letzten Monaten sehr verändert hat, überlegte er. Dann musste er über diesen dummen Gedanken lachen. Immerhin war sie schon erwachsen gewesen, als sie die Ranch vor einem Jahr verlassen hatte, um die Schule zu besuchen. Vielleicht zeigten sich jetzt noch etwas mehr Sommersprossen auf ihrer Nase, und sie trug das Haar länger. Ansonsten würde sie so aussehen wie zuvor.
Allen hatte sie gefehlt. Tagsüber gab es viel zu tun auf der Ranch, und sie fanden keine Zeit, um an Mary Rose zu denken. Doch beim Abendessen erinnerten sie sich wehmütig an die Stunden, in denen sie ihnen befohlen hatte, ihre neuen Speisen zu kosten. Sie war eine gute Köchin, aber keiner mochte die ausgefallenen französischen Saucen, die sie über alles zu schütten pflegte.
Die Postkutsche hatte sich um eine Stunde verspätet, und das bedeutete, dass der alte, bärbeißige Clive Harrington das Gespann lenkte. Natürlich musste er Mary Rose unterwegs die neuesten Klatschgeschichten erzählen, und das gutmütige Mädchen würde es nicht übers Herz bringen, ihn zur Eile anzutreiben. Die beiden waren dicke Freunde, wenn auch niemand in Blue Belle verstand, warum. Ständig jammerte der mürrische Clive über dieses und jenes – nach Coles Meinung ein höchst unangenehmer Zeitgenosse.
Sobald er auftauchte, leerten sich die Gehsteige in der Stadt. Niemand konnte diesen notorischen Nörgler ertragen. Nur wenn er Mary Rose erblickte, ging eine seltsame Verwandlung mit ihm vor. Plötzlich trug er ein lächerliches Grinsen zur Schau und scharwenzelte wie ein Narr um sie herum. Und sie mochte den alten Hurensohn wirklich, kümmerte sich rührend um ihn, lud ihn an Feiertagen zum Essen ein und flickte sogar seine Kleider.
Einmal im Jahr erkrankte Harrington, meistens um die Zeit, wo das Vieh zusammengetrieben wurde, aber manchmal schon einen Monat früher. Dann stand er vor der Clayborne-Tür, den Hut in der Hand, und fragte, wie er sein mysteriöses Leiden kurieren könne. Selbstverständlich war das nur ein mieser Trick. Aber Mary Rose quartierte ihn im Gästezimmer ein und verhätschelte ihn eine volle Woche lang, bis er sich wieder besser fühlte.
Während der alte Knacker nun die Pferde zügelte, putzte er sich geräuschvoll die Nase. Cole ahnte bereits, dass ein weiterer Krankenurlaub geplant war. Kaum blieb die Postkutsche stehen, als auch schon die Tür aufflog und Mary Rose heraussprang. »Endlich daheim!«, jubelte sie, raffte die Röcke und rannte zu ihrem Bruder. Der Hut fiel ihr vom Kopf und landete im Staub. Krampfhaft versuchte Cole, seine ernste, kühle Miene beizubehalten, denn Harrington sollte nicht das Gerücht verbreiten, einer der Claybornes sei mittlerweile völlig verweichlicht. Und Cole liebte es, den Bewohnern von Blue Belle Angst zu machen. Doch das fröhliche Gelächter seiner Schwester wirkte ansteckend, und er stimmte ein. Zum Teufel mit seinem Leumund!
Kein bisschen hatte sie sich verändert. Übermütig wie eh und je ... Eines Tages würde sie ihre besorgten Brüder noch ins Grab bringen, weil sie stets das Herz auf der Zunge trug. Kreischend warf sie sich in seine Arme, und er küsste ihren Scheitel, dann empfahl er ihr, sich nicht so verrückt aufzuführen. Sie war nicht beleidigt. Die Hände in ihre Hüften gestemmt, trat sie zurück und musterte ihn. »Du bist immer noch ein hübscher Bursche, Cole. Hast du jemanden umgebracht, während ich auf der Schule war?«
»Natürlich nicht!«, fauchte er, lehnte sich an den Wagen und versuchte, sie strafend anzustarren.
»Ich glaube, du bist ein bisschen gewachsen. Und dein Haar ist heller geworden. Woher stammt diese Narbe auf deiner Stirn? Von einem Kampf?« Ehe er antworten konnte, wandte sie sich zu Harrington. »Clive, hat sich mein Bruder auf eine Schießerei eingelassen, als ich weg war?«
»Nein, wenn ich mich recht entsinne, Miss Mary.«
»Oder eine Messerstecherei?«
»Ich glaube nicht«, antwortete Clive.
Das schien sie zu überzeugen, und sie lächelte wieder. »Wie schön, dass ich wieder zu Hause bin! Jetzt lasse ich mich nie wieder fortschicken, und wenn Adam noch so steif und fest behauptet, das sei gut für meinen Geist und meine Seele. Meine Ausbildung ist abgeschlossen, und ich habe sogar Papiere, die das beweisen. Was für ein herrlicher Frühlingstag! Oh, ich liebe die Hitze und den Wind und den Staub! Hat Travis sich wieder mal in der Stadt geprügelt? Schon gut, Cole«, fügte sie rasch hinzu, »du würdest mir’s ohnehin nicht erzählen. Aber Adam sagt mir alles. Übrigens hat er mir viel öfter geschrieben als du. Ist der neue Stall fertig? Kurz vor Schulschluss bekam ich einen Brief von Mama Rose. Immer wieder wundere ich mich, weil das mit der Post so gut klappt. In was für modernen Zeiten wir leben. Und nun sag mal ...«
Nur mühsam konnte Cole dem Wortschwall seiner Schwester folgen. Sie redete so schnell wie ein Politiker. »Nun halt mal die Luft an«, unterbrach er sie. »Ich kann nur eine Frage nach der anderen beantworten, und jetzt muss ich Harrington erst mal helfen, dein Gepäck abzuladen.«
Wenige Minuten später waren Mary Roses Truhe, ein paar Kartons und drei Koffer hinten im Wagen verstaut. Sie kletterte auf die Ladefläche, wühlte in ihren Sachen, und Cole meinte, sie solle ihre Suche daheim fortsetzen. Doch sie ignorierte diesen Vorschlag. Unbeirrt schloss sie eine Schachtel und öffnete eine andere. Clive, der danebenstand, grinste sie an. »Miss Mary, ich habe Sie wirklich vermisst«, flüsterte er, errötete wie ein Schuljunge und warf einen kurzen Blick auf ihren Bruder, um sich zu vergewissern, dass er nicht ausgelacht wurde.
Cole gab vor, er hätte nichts gehört, und wandte sich ab, ehe er die Augen verdrehte. Aber Mary Rose freute sich über das Geständnis. »Oh, mir haben Sie auch gefehlt, Clive. Sind alle meine Briefe angekommen?«
»Klar, Miss Mary, und ich hab sie mehrmals gelesen.«
»Das freut mich. Natürlich habe ich Ihren Geburtstag nicht vergessen und Ihnen was mitgebracht.« Endlich fand sie das gesuchte Päckchen und gab es ihm.
»Ein Geschenk für mich?«, flüsterte er ungläubig.
»Zwei Geschenke. Die eine Überraschung steckt in der anderen.«
»Und das ist es?«, fragte er und strahlte wie ein Kind zu Weihnachten.
Mary Rose ergriff seine Hand und stieg vom Wagen. »Wie gesagt, es soll eine Überraschung sein. Deshalb hab ich’s ja auch in dieses hübsche Papier gewickelt. Vielen Dank für die Fahrt, die war wundervoll.«
»Und Sie sind mir nicht böse, weil Sie nicht bei mir auf dem Kutschbock sitzen durften?«
»O nein.«
Harrington wandte sich zu Cole und erklärte: »Das wollte sie unbedingt, aber ich fand, für eine so feine junge Dame würde sich so was nicht schicken.«
»Allerdings nicht«, bestätigte Cole. »Jetzt fahren wir los, Mary Rose.« Ohne ihre Zustimmung abzuwarten, kletterte er auf den Wagensitz und packte die Zügel.
Doch vorher musste sie ihren Hut holen. Das Geschenk sorgsam unter den Arm geklemmt, als müsste er einen kostbaren Schatz hüten, kehrte Clive zur Postkutsche zurück.
Nun traten sie endlich die Heimfahrt an. Während Cole die Fragen seiner Schwester beantwortete, entfernte sie fast alles, was zu einer »feinen« Dame gehörte. Erst streifte sie die weißen Handschuhe ab, dann zog sie die Nadeln aus dem Nackenknoten, und die dichte blonde Mähne fiel auf ihren Rücken. Vergnügt schüttelte sie ihre Locken. »Wie gut, dass ich mich nicht mehr wie eine Lady benehmen muss. Das ist furchtbar anstrengend.«
Cole lachte, und sie wusste, dass sie von ihm kein Mitgefühl erwarten durfte.
»Sicher würdest du nicht lachen, wenn du ein Korsett tragen müsstest. Ich finde es einfach unnatürlich, den Körper so eng zusammenzuschnüren.«
»Musstest du dieses Ding in der Schule tragen?«, fragte er entsetzt.
»Ja, aber ich tat’s nicht. Niemand merkte was. Glücklicherweise zog ich mich nicht in aller Öffentlichkeit an und aus.«
»Oh, hoffentlich nicht!«
Als sie den ersten Steilhang erreichten, musste er das Tempo der Pferde drosseln. Mary Rose drehte sich um und passte auf, dass ihr Gepäck nicht vom Wagen fiel. Auf dem Gipfel zog sie ihre marineblaue Jacke aus, hängte sie über die Rückenlehne der Bank, dann öffnete sie die Blusenknöpfe am Kragen und an den Manschetten. »Etwas Merkwürdiges ist in der Schule geschehen, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Im Januar kam eine neue Klassenkameradin aus Chicago zu uns. Ihre Eltern begleiteten sie und halfen ihr, sich einzugewöhnen. Stell dir vor, die Mutter des Mädchens wuchs in England auf und glaubte, mich zu kennen.«
»Unmöglich! Du warst nie in England. Vielleicht hast du sie woanders getroffen?«
Mary Rose schüttelte den Kopf. »Daran würde ich mich sicher erinnern.«
»Erzähl mir alles.«
»Ich ging über den Schulhof, lächelte die Neuankömmlinge höflich an, und plötzlich begann die Mutter des Mädchens zu schreien, laut genug, um die Wasserspeier am Emmet Building zu erschrecken. Auch ich bekam’s mit der Angst zu tun. Sie zeigte mit dem Finger auf mich, und ich wurde schrecklich verlegen.«
»Und dann?«
»Mit beiden Händen griff sie sich an die Brust und sah aus, als würde sie zusammenbrechen.«
»Was hast du denn getrieben?« Sofort war Coles Misstrauen erwacht, und er befürchtete, dass sie ihm nicht die ganze Geschichte anvertraut hatte. Immer wieder beschwor sie Ärger herauf, und dann staunte sie über die Konsequenzen.
»Gar nichts!«, beteuerte sie. »Ich benahm mich wie eine perfekte Lady. Wieso glaubst du denn, ich wäre schuld am Anfall dieser armen Frau gewesen?«, fragte sie vorwurfsvoll.
»Weil du’s in solchen Situationen meistens bist. Hattest du deine Waffe bei dir?«
»Natürlich nicht. Wirklich, ich weiß mich zu benehmen.«
»Und wie ging’s dann weiter?«
»Nachdem sie sich beruhigt hatte, erklärte sie mir, sie hätte mich für eine Bekannte gehalten – eine gewisse Lady Agatha Sowieso. Sie behauptete, ich wäre dieser Dame wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Na und? Viele Frauen sind blond und haben blaue Augen. Das ist keineswegs ungewöhnlich.«
»Soll das heißen, dass ich unscheinbar und hässlich bin?«
»Klar«, log er, um sie zu necken. In Wirklichkeit war Mary Rose bildschön. Zumindest hatte ihm das jeder heiratsfähige Mann in der Stadt versichert. Er selbst sah in seiner Schwester eher ein gutmütiges, süßes kleines Ding, das allerdings ein wildes Temperament entwickeln und eine Menge Ärger machen konnte.
»Adam findet mich hübsch«, entgegnete sie und stieß ihn mit der Schulter an. »Und er sagt immer die Wahrheit. Außerdem kommt’s nur auf das Herz an. Mama Rose schreibt mir, ich sei ihre schöne Tochter, obwohl sie mich nie gesehen hat.«
»Willst du endlich aufhören, mich mit diesem eitlen Geschwätz zu langweilen, Mary Rose?«
»Ja, schon gut«, erwiderte sie lachend.
»Und an deiner Stelle würde ich mir keine Sorgen machen, nur weil du irgendeiner Frau ähnlich siehst.«
»Oh, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Etwa einen Monat später ließ mich die Schulleiterin in ihr Büro rufen. Dort erwartete mich ein älterer Mann, und auf dem Schreibtisch lag meine Akte.«
»Wieso wusstest du, dass es deine war?«
»Weil ich die dickste Akte von der ganzen Schule hatte, und der Einband war ziemlich abgegriffen.« Sofort erriet sie, was er dachte. »Du brauchst gar nicht so wissend zu grinsen, Cole. Im ersten Schuljahr stellte ich einiges an, das gebe ich zu. Damals hatte ich Heimweh und wollte rausgeworfen werden. Aber danach war ich sehr brav.«
»Erzähl mir von diesem Mann, der im Büro gewartet hat.«
»Das war ein Anwalt. Er stellte mir alle möglichen Fragen nach meiner Familie und wollte wissen, wie lange wir schon in Montana leben und wo unsere Mutter ist. Dann sollte ich meine Brüder beschreiben. Aber ich fand, das alles würde ihn nichts angehen.«
»Hat er erklärt, warum er’s wissen wollte?«
»Er erzählte mir, es würde um ein großes Erbe gehen, und ich sei vermutlich eine jahrelang vermisste Verwandte. Beunruhigt dich das?«
»Ein bisschen. Es gefällt mir nicht, wenn man sich für uns interessiert.«
»So schlimm war’s gar nicht«, versuchte sie ihn zu besänftigen.
»Zuvor hatte Eleanor mich die halbe Nacht wach gehalten, über irgendeinen Affront gejammert und mich dran gehindert, für meine Englischprüfung zu lernen. Aber weil dieser Anwalt zu Besuch kam, wurde ich erst am nächsten Tag geprüft.«
»Ich dachte, du wolltest dich nicht mehr mit Eleanor abgeben.«
»Das hatte ich auch nicht vor. Leider wollte kein anderes Mädchen das Zimmer mit ihr teilen. Und so flehte mich die Schulleiterin praktisch auf Knien an, Eleanor wieder bei mir aufzunehmen. Armes Ding! Sie hat so ein gutes Herz, wenn sie’s auch meistens versteckt. Es ist nicht leicht, mit ihr auszukommen.«
»War sie so hysterisch und extravagant wie eh und je?« Schon oft hatte Mary Rose ihre Brüder mit Geschichten über Eleanors Possen amüsiert.
»O ja. Ob du’s glaubst oder nicht, sie verließ die Schule eine Woche vor den anderen, ohne sich zu verabschieden. Irgendwas stimmte nicht mit ihrem Vater, aber sie wollte mir nicht verraten, was los war. Fünf Nächte lang weinte sie sich in den Schlaf, dann verschwand sie. Ich wünschte, sie hätte sich mir anvertraut, und ich wäre gern bereit gewesen, ihr zu helfen. Nach ihrer Abreise fragte ich die Schulleiterin, was das zu bedeuten habe. Sie wollte mir auch nichts erzählen, aber sie verzog angewidert die Lippen. Eleanors Vater hatte beabsichtigt, der Schule eine größere Summe für den Anbau eines neuen Schlafsaals zu spenden. Nun erklärte mir die Direktorin, darauf müsste sie nun verzichten.« Nach einer kleinen Pause fügte Mary Rose hinzu: »Und jetzt muss ich dir was gestehen. In der Nacht, bevor Eleanor wegfuhr, forderte ich sie auf, nach Rosehill zu kommen, wenn sie irgendwann meine Hilfe braucht.«
»Warum, um Himmels willen?«, fragte Cole.
»Sie schluchzte so herzzerreißend und tat mir leid. Aber keine Bange, sie kommt sicher nicht auf unsere Ranch. Für ihren Geschmack ist die Wildnis hier draußen viel zu unzivilisiert.« Seufzend runzelte sie die Stirn. »Ich bin ihr schon ein bisschen böse, weil sie einfach abgereist ist, ohne mir auf Wiedersehen zu sagen. Immerhin war ich ihre einzige Freundin in der Schule. Nun ja, reden wir nicht mehr von ihr. Dieser Anwalt ist viel interessanter. Glaubst du, er wird sich nach uns erkundigen?«
»Allerdings. Reg dich nicht auf«, fügte er rasch hinzu, als er ihre bestürzte Miene sah. »Darum kümmern wir uns erst, wenn’s soweit ist.« Dann wechselte er das Thema und erzählte von der Ranch. Während Mary Roses Abwesenheit hatten die Brüder noch ein Stück Land erworben. Gerade kaufte Travis in Hammond das Material, das sie benötigten, um das Weideland für die Pferde einzuzäunen. Wenige Minuten später erreichten sie Rosehill.
Mit acht Jahren hatte Mary Rose ihrem Zuhause diesen Namen gegeben. Auf einem nahen Hügel fand sie Blumen, die sie für Rosen hielt. Darin sah sie eine Botschaft des Allmächtigen, der ihnen mitteilen wollte, sie dürften dieses Stück Land niemals verlassen. Adam wollte ihr die Freude nicht verderben und verschwieg, dass es keine Rosen, sondern nur gewöhnliche Stechapfelblüten waren. Außerdem dachte er, wenn seine Schwester die Ranch taufte, würde ihr das ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit geben. Bald war das Clayborne-Anwesen in ganz Blue Belle mit diesem phantasievollen Namen bezeichnet worden.
Rosehill lag inmitten eines Tals, im Herzen von Montana. Rings um das Haus erstreckte sich flaches Land. Adam hatte beschlossen, das Heim der Claybornes im Zentrum dieser Ebene zu errichten, damit sich niemand unbemerkt nähern konnte. Von Überraschungen hielt er ebenso wenig wie seine Brüder. Um völlig sicherzugehen, baute er sogar einen Wachturm.
Im Norden und Westen grenzten majestätische Berge mit verschneiten Gipfeln an die Wiesenflächen. Die niedrigeren Hügel im Osten konnte man nicht als Weideland benutzen. Dort gingen Trapper auf Biber-, Bären- und Wolfsjagd. Hin und wieder klopfte ein müder Fallensteller an die Tür, bat um eine Mahlzeit und ein freundliches Gespräch. Adam schickte niemals einen hungrigen Mann fort, und wenn der Gast ein Bett für eine Nacht brauchte, wurde er in der Schlafbaracke einquartiert.
Es gab nur einen einzigen Weg, die Ranch mühelos zu erreichen – auf der Hauptstraße, die von Blue Belle über einen Hügel heranführte. Viele Fremde waren schon müde, wenn sie die Anlegestelle der Flussboote erreichten. Falls sie dann Pferdewagen benutzen mussten, um ihr Hab und Gut zu transportieren, dauerte es oft anderthalb Tage, bis sie in Blue Belle ankamen. Die meisten blieben in Perry oder Hammond. Nur fest entschlossene Gemüter oder Flüchtlinge wagten sich weiter. Man munkelte zwar, in den nördlichen Bergen könne man nach Gold schürfen, aber bis jetzt hatte man noch keins gefunden. Deshalb war das Land ziemlich dünn besiedelt.
Anständige, gottesfürchtige Familien, die sich hier niederlassen wollten, durchquerten die Wildnis in langen Planwagen, oder sie fuhren mit den Flussbooten, die auf dem Missouri verkehrten. Solche Leute bevorzugten die größeren Städte, wo die Bürgerwehr alles Gesindel verscheuchte.
Anfangs hatte die Bürgerwehr gute Dienste geleistet, aber nun stellte sie ein bedrohliches Problem dar, denn die Wächter pflegten jeden aufzuhängen, der ihnen missfiel. Oft wurden schnelle, ungerechte Urteile verkündet. In manchen Fällen genügten vage Gerüchte, und schon wurde ein Mann aus seinem Haus gezerrt und am nächstbesten Baum aufgeknüpft. Selbst wenn man einen Stern trug, war man der Willkür gewisser Bürgerwehrtruppen ausgeliefert.
Die Außenseiter und Revolverschwinger, die leicht verdientes Geld suchten und der Lynchjustiz entrinnen konnten, verließen die größeren Städte wie Hammond, um sich in Blue Belle herumzutreiben. Deshalb hatte die Stadt einen wohlverdienten zweifelhaften Ruf erworben. Trotzdem lebten auch ein paar anständige Familien in Blue Belle. Adam meinte, ihr schwerer Fehler sei ihnen erst bewusst geworden, nachdem sie sich hier angesiedelt hatten.
Seiner Schwester erlaubte er nicht, allein nach Blue Belle zu fahren. Und da er die Ranch niemals verließ, mussten Travis, Douglas oder Cole sie begleiten, wenn sie Besorgungen in der Stadt erledigen wollte. Die Brüder wechselten einander ab, und wenn sie keine Zeit fanden, blieb Mary Rose eben zu Hause.
Auf dem Hügel, der die Hauptstraße von der Ranch trennte, zügelte Cole das Gespann. Er wusste, worum Mary Rose ihn bitten würde, und da rief sie auch schon: »Bitte, bleib stehen und lass mich die Aussicht genießen! So lange war ich nicht hier.« Tränen glänzten in ihren Augen. »Wenn du das siehst – fühlst du dich da genauso wie ich?«
»Das fragst du jedes Mal, wenn ich dich nach Hause bringe«, erwiderte er lächelnd. »Ja, mir geht’s genauso.« Er reichte ihr sein Taschentuch, das er schon seit langer Zeit nur ihr zuliebe bei sich trug. Als kleines Mädchen hatte sie sich die Nase an seinem Hemdsärmel abgewischt. Aber das erlaubte er ihr natürlich nicht mehr.
Glücklich betrachtete sie die Ranch und die Berge ringsum. So gut sie dieses Panorama auch kannte – jedes Mal, wenn sie es wiedersah, war sie überwältigt von der Schönheit dieser Landschaft. Hier spürte sie die enge Verbundenheit zwischen dem Himmel und der Natur. Und nur seiner Schwester gestand Cole, dass der Anblick seiner Heimat auch ihn zutiefst bewegte.
»Sie lebt, Mary Rose, und ist schön wie eh und je.«
»Warum glaubst du, Montana wäre eine Frau?«
»Weil sie sich wie eine Frau benimmt, launisch und eitel. Niemals wird sie sich von einem Mann zähmen lassen. Natürlich ist sie eine Frau – und sicher die einzige, die ich jemals lieben werde.«
»Mich liebst du doch auch.«
»Du bist keine Frau, Mary Rose, sondern meine Schwester.«
Ihr Gelächter verhallte zwischen den Kiefernstämmen, und Cole lenkte die Pferde den sanft abfallenden Rang hinunter.
»Wenn sie eine Frau ist, hat sie uns liebevoll umarmt. Ob meine Rosen schon erwachen?«
»Mittlerweile müsstest du wissen, dass das keine Rosen sind. Nur ganz gewöhnliche Stechapfelblüten.«
»Das weiß ich, aber sie sehen wie Rosen aus.«
»O nein!«
Ständig stritten sie, und Mary Rose seufzte zufrieden. Welch ein Glück, die Ranch wiederzusehen! Das Ziegelhaus war nicht besonders eindrucksvoll, aber sie fand es schön. Im Sommer saßen sie auf der Veranda, die das einstöckige Gebäude an drei Seiten umgab, und abends hörten sie die Musik der Nacht. Da sie ihren ältesten Bruder nirgends entdeckte, rief sie: »Ich wette, Adam sitzt wieder über seinen Büchern.«
»Warum glaubst du das?«
»An einem so schönen Tag würde er draußen arbeiten, wenn er seine Buchhaltung nicht erledigen müsste. Oh, ich kann’s kaum erwarten, ihn zu begrüßen. Beeil dich, Cole!«
Alle ihre Brüder hatten sie vermisst, und jedem brachte sie Geschenke mit – einen Karton voller Bücher für Adam, Zeichenpapier und neue Federn für Cole, der Pläne für einen Anbau entwerfen wollte, Medizin und Striegel für Douglas’ Pferde, ein neues Tagebuch für Travis, der die Familienchronik niederschrieb, außerdem mehrere Kataloge und Saat für den Garten. Die würde sie unter Adams Anleitung hinter dem Haus verstreuen. Und dann sollten sie alle auch noch Schokolade und Flanellhemden bekommen.
Das Wiedersehen war so schön, wie sie sich’s ausgemalt hatte. Bis spät in die Nacht saß die Familie beisammen, denn es gab viel zu erzählen. Den Anwalt, der Mary Rose in der Schule besucht hatte, erwähnte Cole erst, nachdem sie zu Bett gegangen war. Er wollte sie nicht beunruhigen. Umso größere Sorgen machte er sich selber. Ebenso wenig wie die anderen glaubte er an Zufälle, und so erörterten sie alle möglichen Gründe, die den Anwalt veranlassen mochten, Informationen über die Clayborne-Familie zu sammeln.
Als Jungen hatten Cole und Douglas einiges angestellt. Doch das alles lag schon sehr lange zurück, und die Gangster, die sie bestohlen hatten, lebten in weiter Ferne – wenn sie überhaupt noch auf Erden weilten. Deshalb dachten sie, man hätte ihre Missetaten längst vergessen. Es war Adam, dem eine ernste Gefahr drohte. Hatten die Söhne seines einstigen Sklavenmeisters diesen Anwalt beauftragt, den Flüchtling aufzuspüren?
Einen Mord vergaß man niemals, das wussten sie alle. Um zwei Menschenleben zu retten, hatte Adam ein anderes zerstört. Es war reiner Zufall gewesen, aber für die Umstände würden sich die Söhne nicht interessieren. Ein Sklave hatte ihren Vater getötet. Und sie würden weder ruhen noch rasten, bis der Mord gerächt war.
Einige Sekunden lang diskutierten sie im Flüsterton, dann erklärte Adam, es sei albern, sich jetzt schon aufzuregen. Man müsse erst einmal abwarten. »Und wenn wir tatsächlich bedroht werden?«, fragte Cole.
»Dann tun wir alles, um einander zu schützen.«
»Niemandem werden wir gestatten, dich aufzuhängen, Adam«, beteuerte Travis. »Damals hast du nur getan, was du tun musstest.«
»Jedenfalls müssen wir uns in Acht nehmen«, betonte Adam.
Ein Monat verstrich in friedlicher Einsamkeit, und sie glaubten schon, der Anwalt würde niemals auftauchen.
12. November 1980
Liebe Mama Rose, Dein Sohn hat gesagt, ich soll Dir zeigen, wie gut ich schreiben kann. Deshalb bekommst Du diesen Brief. Wenn Mary Rose schläft, üben wir alle Grammatik und Rechtschreibung. Dein Sohn ist ein guter Lehrer. Er lacht nicht, wenn wir Fehler machen, und wenn wir uns mächtig anstrengen, hilft er uns. Ich glaube, jetzt gehöre ich zu Dir, weil wir doch alle Brüder sind.
Dein Sohn Cole
2
Ohne eine einzige Frage zu stellen, erfuhr Harrison Stanford MacDonald alles über die Familie. Er hatte viel über die gesetzlosen Städte im Wilden Westen gehört und gelesen. Und so wusste er, dass dort Fremde in zwei Gruppen eingeteilt wurden – die Männer, die man ignorierte und in Ruhe ließ, weil sie sich um ihren eigenen Kram kümmerten und beängstigend wirkten, und die anderen, die umgebracht wurden, weil sie zu viel fragten.
Der Ehrenkodex des Westens verblüffte Harrison. Die Siedler hielten zusammen, wenn es galt, ihresgleichen gegen Außenseiter zu verteidigen. Aber es störte sie nicht, wenn jemand seinen Nachbarn tötete – vorausgesetzt, es gab gute Gründe dafür.
Auf der Reise nach Blue Belle beschloss Harrison, die Vorurteile gegen Fremde zu nutzen. Um zehn Uhr morgens kam er an und verwandelte sich in den gemeinsten Hurensohn, der diese Stadt jemals heimgesucht hatte.
Er zog den neuen schwarzen Hut tief in die Stirn, klappte den Kragen des langen braunen Staubmantels hoch und schlenderte die breite Sandstraße, die hier Main Street genannt wurde, so arrogant entlang, als würden ihm alle Häuser zu beiden Seiten gehören. Seine Miene erweckte den Eindruck, er würde jeden umbringen, der ihm in den Weg trat. Genau das beabsichtigte er, und er glaubte sein Ziel zu erreichen, denn er beobachtete eine Frau, die bei seinem Anblick die Hand ihres Sohnes packte und davonrannte.
Beinahe hätte er gelächelt, doch das wagte er nicht. Wenn er sich freundlich gab, würde er nichts über die Claybornes herausfinden. Und so behielt er seinen bedrohlichen, hasserfüllten Blick bei. Alle waren entzückt.
Zuerst suchte er den allseits beliebten Saloon am Ende der Straße auf, bestellte eine Flasche Whiskey und ein Glas. Falls der Besitzer des Etablissements diesen Wunsch am helllichten Vormittag seltsam fand, ließ er sich nichts anmerken. Harrison setzte sich mit der Flasche und dem Glas an einen runden Tisch in die dunkelste Ecke, den Rücken zur Wand, und wartete auf einen neugierigen Gesprächspartner.
Allzu lange musste er sich nicht gedulden. Bei seiner Ankunft war der Saloon leer gewesen. Doch dann sprach sich herum, der Fremde sei hier hereingegangen, und zehn Minuten später zählte Harrison neun weitere Gäste. Sie saßen an den anderen Tischen und starrten ihn an. Gleichmütig schaute er vor sich hin. Der Gedanke, so früh am Morgen tatsächlich Whiskey zu trinken, drehte ihm den Magen um, und so ließ er die bernsteinfarbene Flüssigkeit nur im Glas kreisen, die Stirn nachdenklich gerunzelt. Schließlich schlurften Schritte über den Holzboden heran.
Instinktiv schob Harrison den Mantel beiseite und griff nach seiner Waffe. Doch er zog sie nicht, und er erkannte erst jetzt, dass seine automatische Reaktion sehr gut zu der feindseligen Rolle passte, die er in Blue Belle spielen wollte.
»Sind Sie neu in der Stadt, Mister?«
Langsam hob Harrison den Kopf. Der Mann, der diese lächerliche Frage stellte, war offenbar von den anderen hergeschickt worden – ein unbewaffneter alter Kauz mit Pockennarben und das hässlichste Individuum, das Harrison je gesehen hatte. Die blinzelnden braunen Augen nahm man kaum war, denn das ganze runde Gesicht wurde von einer gewaltigen Knollennase beherrscht.
»Wer will das wissen?«, entgegnete Harrison mürrisch.
»Ich heiße Dooley«, verkündete die Kartoffelnase grinsend. »Darf ich mich ein bisschen zu Ihnen setzen?«
Statt zu antworten, musterte Harrison ihn nur und wartete ab, was nun geschehen würde.
Dooley deutete das Schweigen als Zustimmung und nahm Platz. »Suchen Sie jemanden in der Stadt.« Nachdem Harrison den Kopf geschüttelt hatte, wandte sich der Mann zum aufmerksamen Publikum. »Er sucht niemanden. Billie, bring mir ein Glas – falls dieser Fremde mir was von seinem Whiskey abgibt. Sind Sie ein Revolvermann, Mister?«
»Ich lass mich nicht gern ausfragen.«
»Nein, Sie sind kein Revolvermann. Das dachte ich mir gleich. Sonst hätten Sie gehört, dass Webster erst gestern davongeritten ist. Der hat einen Gegner gesucht. Aber den Gefallen tat ihm niemand, nicht mal Cole Clayborne, und Webster kam nur seinetwegen nach Blue Belle. Cole ist der schnellste Schütze in dieser Gegend. Jetzt lässt er sich nicht mehr in Schießereien verwickeln, schon gar nicht, seit seine Schwester von der Schule nach Hause gekommen ist. Sie mag diese Ballerei nicht, und sie meint, Cole darf nicht in Verruf geraten. Adam passt auf ihn auf. Das ist der älteste Bruder, der geborene Friedensstifter und sehr schlau. Sobald man sich mit seinem Aussehen abgefunden hat, merkt man’s – das ist der Mann, an den man sich wenden muss, wenn man einen guten Rat braucht. Wollen Sie sich hier ansiedeln, oder sind Sie nur auf der Durchreise?«
Billie, der Saloonbesitzer, stellte zwei Gläser auf den Tisch und winkte einem Mann, der bei der Tür saß. »Komm rüber, Henry, und bring deinen Freund zum Schweigen! Der fragt den Leuten ein Loch in den Bauch, und er soll nicht schon vor dem Lunch abgeknallt werden. Das ist schlecht fürs Geschäft.«
Die Fragen, die nun folgten, beantwortete Harrison nur einsilbig. Henry und Billie hatten sich hinzugesellt. Offenbar waren die drei Männer gute Freunde. Sie klatschten gern, erzählten Geschichten über Stadtbewohner, und Harrison prägte sich alle Informationen ein. Schließlich kam die Verfügbarkeit von Frauen zur Sprache.
»Die sind in dieser Gegend selten wie Diamanten«, erklärte Dooley, »aber da haben wir sieben oder acht, mit denen man was anfangen kann. Ein paar sind recht hübsch, zum Beispiel Catherine Morrison. Ihrem Pa gehört der Gemischtwarenladen. Sie hat schönes braunes Haar und immer noch alle Zähne.«
»Aber Mary Rose Clayborne kann sie nicht das Wasser reichen«, warf Billie ein.
Alle, die im Saloon saßen, stimmten zu, und ein Graukopf rief: »Eine echte Schönheit!«
»Und herzensgut«, fügte Henry hinzu.
Dooley nickte. »Ja, sie kümmert sich um jeden, der Hilfe braucht.«
»Von weither kommen die Indianer angelaufen, nur um eine Locke von ihrem goldblonden Haar zu ergattern«, berichtete Henry. »Und sie gibt’s ihnen, wenn auch widerstrebend. Die Rothäute glauben, das würde ihnen Glück bringen. Nicht wahr, Billie?«
»Klar. Ein paar Mischlinge versuchten sie mal von der Ranch zu entführen und behaupteten später, Miss Marys blaue Augen hätten sie verzaubert. Wisst ihr noch, was dann geschah?«
Dooley brach in Gelächter aus. »Damals hat sich Adam nicht wie ein Friedenstifter aufgeführt, was, Ghost?«
»Allerdings nicht!«, bestätigte ein Mann mit dichtem weißem Haar und langem, zottigem Bart. »Einen dieser Entführer riss er beinahe entzwei, und seither wagt es niemand mehr, sich an dem Mädchen zu vergreifen.«
»Ein Jammer, dass Miss Mary nicht umworben wird ...«, seufzte Billie. »Mittlerweile müssten schon drei Babys an ihren Rockzipfeln hängen.«
Harrison fragte nicht, warum es ihr an Bewerbern mangelte. Aber Dooley klärte ihn bereitwillig auf. »Keiner will sich mit ihren vier Brüdern anlegen. Auch Sie sollten sich von ihr fernhalten, Mister.«
»Mit dem will sie ohnehin nichts zu tun haben!«, schrie Ghost, und Dooley nickte.
»Sie interessiert sich nur für die Armen und Schwachen. Wahrscheinlich fühlt sie sich dazu verpflichtet, solche Leute zu umsorgen.«
»Immer wieder schleppt sie irgendeine Jammergestalt nach Hause und ärgert ihre Brüder«, ergänzte Billie. »Aber die finden sich damit ab.«
»Uns mag sie auch, und wir sind keine Schwächlinge«, betonte Dooley.
»Natürlich nicht«, bekräftigte Henry. »Sie sollen keinen falschen Eindruck gewinnen, Mister. Miss Mary mag uns, weil wir schon so lange da sind. Also hat sie sich an uns gewöhnt. Übrigens, bald können Sie das Mädchen begutachten. Hoffentlich wird sie heute von ihrem Bruder Douglas begleitet.«
»Warum?«, fragte Billie.
»Er soll mal nach meiner Stute sehen. Die benimmt sich so komisch.«
»Falls Sie einen guten Hengst brauchen, Mister«, wandte sich Dooley an Harrison, »Douglas hat einen ganzen Stall voll. Er reitet wilde Pferde zu, und manchmal verkauft er sie. Nicht an jeden! Er schaut sich die künftigen Besitzer seiner Lieblinge genau an. Eigentlich ist er kein richtiger Tierarzt, aber er weiß sehr gut Bescheid – wenn er’s auch nicht mag, dass wir ihn Doc nennen.«
»Was für Geschäfte treiben Sie denn?«, wollte Billie von Harrison wissen.
»Ich befasse mich mit Rechtssachen.«
»Davon werden Sie nicht satt. Sonst tun Sie nichts?«
»Ich gehe auf die Jagd.«
»Also sind Sie ein Trapper?«
Harrison schüttelte den Kopf. »Nicht direkt«, antwortete er ausweichend, denn er wollte diesen Männern nicht auf die Nase binden, dass er ein verschollenes Kind suchte, das inzwischen eine erwachsene Frau war.
»Haben Sie’s schon mal mit Viehzucht versucht?«, fragte Henry. »Dafür würden Sie sich eignen, weil Sie so groß und breitschultrig sind – wie die Claybornes. Möchten Sie uns nicht verraten, wie Sie heißen?«
»Harrison MacDonald.«
»Und woher kommen Sie?«
»Ich bin in Schottland geboren und in England aufgewachsen, auf der anderen Seite des Atlantiks.«
»Diese Stadt könnte einen Anwalt gebrauchen«, meinte Billie. »Wir haben keinen in dieser Gegend. Wenn Adam Clayborne ein Problem nicht lösen kann, müssen wir nach Hammond reiten. Sicher wird sich Richter Burns freuen, wenn Sie ihn unterstützen. Er regt sich immer schrecklich auf, wenn er mit uns zusammenarbeiten muss. Wie nennt er uns doch gleich?«, fragte er Dooley.
»Ignoranten.«
»Ja, genau. Also, wenn Sie mich fragen – dieses Rechtswesen ist furchtbar kompliziert. Man muss so viele Formulare ausfüllen.«
»Früher war’s viel einfacher, ein Stück Land zu kriegen!«, rief Ghost. »Man setzte sich einfach drauf, und schon war man der Besitzer. Nun muss man Geld zahlen und Papiere ausfüllen.«
»Nun, wollen Sie sich hier niederlassen? Bringen Sie doch ein Plakat an Morrisons Schaufenster an! Da können Sie jeden Monat ein paar Dollar verdienen.«
Harrison zuckte die Achseln. »Jetzt weiß ich noch nicht, was ich tun werde. Vielleicht bleibe ich hier, vielleicht aber auch nicht.«
»Haben Sie genug Geld, um sich über Wasser zu halten, bis Sie eine Entscheidung treffen?«
Selbstverständlich wusste Harrison, wie unklug es gewesen wäre, von seinem Geld zu erzählen. »Nein, nur für ein paar Tage.«
»Sie können ja auf einer Ranch arbeiten«, riet Dooley. »Kräftig genug sind Sie.«
»Genau das habe ich mir auch schon gedacht«, log Harrison.
»Und was hat Sie nach Blue Belle geführt?«, erkundigte sich Billie. »Ich weiß, das geht mich nichts an, aber ich bin nun mal neugierig, Mister.«
»Nennen Sie mich doch Harrison. Wenn Sie’s wirklich wissen wollen, ich habe mich auf ein sinnloses Unternehmen eingelassen. Zumindest glaubt das der Mann, für den ich arbeite.«
»Dann haben Sie schon einen Job?«, fragte Dooley.
»Jetzt bin ich gerade im Urlaub.«
»Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, die mit dem Gesetz zusammenhängt«, bat Ghost.
»Was interessiert Sie denn?«
»Ich überlege mir, ob ich ein Pferd stehlen soll«, erklärte Ghost, stand auf und kam zum Tisch herüber. »Also, dieser Kerl, an den ich denke, hat mir vor Jahren die Frau weggenommen. Und deshalb würde ich nichts Falsches tun. Das Gesetz steht doch auf meiner Seite?«
Nur mühsam unterdrückte Harrison ein Lächeln. Ghost sollte nicht glauben, der Fremde würde sich über ihn lustig machen. »Leider muss ich Sie enttäuschen. Der Stolz wäre auf Ihrer Seite – das Gesetz nicht.«
»Das habe ich ihm schon gesagt«, verkündete Dooley grinsend. »Wenn er Lloyd ein Pferd stiehlt, wird ihn die Bürgerwehr aufhängen.«
Diese Antwort missfiel Ghost. Während er zu seinem Platz zurückkehrte, murmelte er etwas Unverständliches vor sich hin. Nun wandten sich auch die anderen mit diversen Problemen an Harrison, und in der nächsten Stunde erteilte er kostenlose juristische Ratschläge. Er hatte in Oxford studiert und seine Lehrzeit in England absolviert, aber auch für einen Fabrikbesitzer gearbeitet, der seine Erzeugnisse zur amerikanischen Ostküste verschiffte. Deshalb kannte der junge Anwalt das Rechtswesen der Vereinigten Staaten, denn er hatte sich über die Import- und Exportvorschriften informieren müssen.
Die Unterschiede zwischen der englischen und der amerikanischen Rechtsprechung faszinierten ihn. Begierig verschlang er alle Berichte über ungewöhnliche Fälle, die ihm in die Hände fielen.
Seine Leidenschaft für die Gesetze und sein Mitleid mit Menschen, die in Not geraten waren, hatten ihn in vielen Kreisen unbeliebt gemacht. Weil er für den mächtigen Lord Elliott arbeitete, missachtete man ihn nicht, warf ihm aber die unpopulären Probleme vor, für die er seine Zeit opferte.
Bald erwarb er sich einen fragwürdigen Ruf als Fürsprecher der Armen in den Londoner Slums. Das kostete ihn seine Verlobung mit Lady Edwina Homer, die ihm brieflich mitteilte, sie könne keinen Mann heiraten, der ständig Skandale heraufbeschwöre. Seine Freunde warnten ihn und versuchten, ihn von seiner lächerlichen Meinung abzubringen, die Armen in England müssten genauso viele Rechte erhalten wie die Reichen. Aber Harrison hatte entschieden erwidert, niemals würde er ihren elitären, egoistischen Standpunkt vertreten.
»Vielleicht sind die Gesetze in England anders als hier«, meinte Ghost, ging wieder zu Harrison und schaute ihn hoffnungsvoll an. »Sollte ich das Pferd stehlen, wird man mich womöglich gar nicht aufhängen, weil Lloyd mit dem ganzen Ärger angefangen hat.«
Bedauernd schüttelte Harrison den Kopf. »Ich kenne die amerikanischen Gesetze, und ich weiß, man würde Sie für schuldig befinden.«
Plötzlich flog die Schwingtür des Salons auf. »Da kommt Miss Mary, und Cole reitet hinter ihr.« Sofort rannte der Mann, der diese Neuigkeit verkündet hatte, wieder davon.