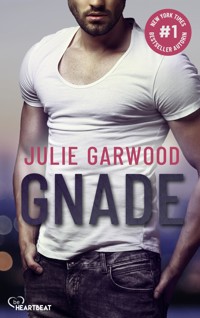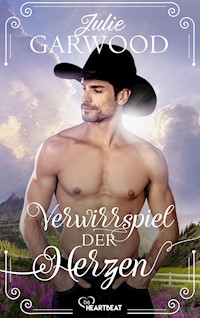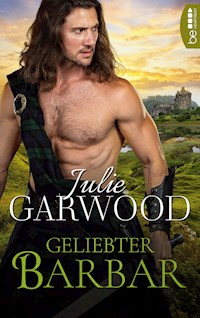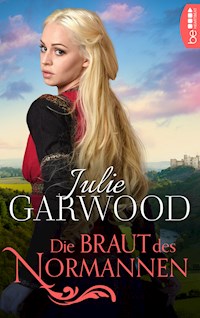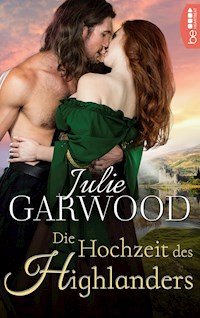4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nick Buchanan Family & Friends
- Sprache: Deutsch
Das Böse ist auf der Jagd ...
Eigentlich war die Todesliste der Hotelerbin Regan Madison nicht ernst gemeint - eine alberne Übung in einem Selbsterfahrungsseminar. Aber als ihre Liste einem Killer in die Hände fällt, beginnt ein tödliches Spiel: Alle ihre Feinde sterben einer nach dem anderen. Gemeinsam mit dem attraktiven Detective Alec Buchanan muss Regan herausfinden, wer ihre privaten Rachefantasien zu grausamer Realität werden lässt. Während die Anziehungskraft zwischen den beiden immer größer wird, kommt ihnen auch der Serienmörder gefährlich nahe ...
Spannung pur - die prickelnde Romantic Suspense Reihe um die Familie Buchanan und ihre Freunde von New York Times Bestsellerautorin Julie Garwood:
Band 1: Zum Sterben schön
Band 2: Gnade
Band 3: Ein mörderisches Geschäft
Band 4: Mord nach Liste
Band 5: Sanft sollst du brennen
Band 6: Schattentanz
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Epilog
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Eigentlich war die Todesliste der Hotelerbin Regan Madison nicht ernst gemeint – eine alberne Übung in einem Selbsterfahrungsseminar. Aber als ihre Liste einem Killer in die Hände fällt, beginnt ein tödliches Spiel: Alle ihre Feinde sterben einer nach dem anderen. Gemeinsam mit dem attraktiven Detective Alec Buchanan muss Regan herausfinden, wer ihre privaten Rachefantasien zu grausamer Realität werden lässt. Während die Anziehungskraft zwischen den beiden immer größer wird, kommt ihnen auch der Serienmörder gefährlich nahe ...
Julie Garwood
Mord nach Liste
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Fischer
Prolog
Der erste Schultag auf der exklusiven Briarwood School war der schlimmste Tag im Leben der fünfjährigen Regan Hamilton Madison. Er war so schrecklich, dass sie nie wieder hingehen wollte.
Am Morgen war sie in der Annahme aufgebrochen, die Vorschule würde wunderbar sein. Warum auch nicht? Schon ihre Brüder und ihre Mutter hatten davon geschwärmt, und es gab keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. Auf ihre neue Schuluniform war Regan besonders stolz: ein blau-grau karierter Faltenrock, eine weiße Bluse mit spitzem Kragen, eine marineblaue Krawatte, dazu ein passender grauer Blazer mit einem hübschen goldenen Wappen und den Initialen der Schule auf der Brusttasche. Regan saß auf der Rückbank der familieneigenen Limousine und ließ sich zur Schule chauffieren. Ihre Locken wurden von blauen Spangen gebändigt, ausdrücklich von der Schule genehmigt. Alles, was Regan trug, war nagelneu, sogar die weißen Kniestrümpfe und die marineblauen College-Schuhe.Regan nahm an, dass sie in Briarwood so zuvorkommend behandelt werden würde wie in den vergangenen zwei Jahren im Kindergarten. Die unentwegt lächelnden Betreuer dort hatten Regan und die anderen neun Kinder der Gruppe verhätschelt und sie von morgens bis abends gelobt. Regan war überzeugt, dass der erste Tag in Briarwood so ähnlich verlaufen würde. Vielleicht sogar noch besser.
Eigentlich hatte ihre Mutter sie zur neuen Schule begleiten wollen, so wie es die Mütter – zum Teil sogar die Väter – der anderen neuen Schulkinder taten. Doch aus Gründen, auf die Regans Mutter, wie sie ihrer Tochter versichert hatte, keinen Einfluss hatte, musste sie bei ihrem neuen Freund in London sein und konnte nicht rechtzeitig nach Chicago kommen.
Großmutter Hamilton wäre gerne mit Regan gefahren, war jedoch ebenfalls bei Freunden im Ausland und würde erst in zwei Wochen zurückkehren.
Am Vortag hatte Regan ihrer Mutter am Telefon versichert, Mrs Tyler, die Haushälterin, bräuchte sie nicht zur Schule zu bringen. Daraufhin hatte ihre Mutter vorgeschlagen, dass Regans älterer Bruder Aiden dies übernehmen solle. Regan wusste, dass er sich sofort einverstanden erklärt hätte. Aiden war siebzehn und hätte zwar wenig Lust gehabt, es aber trotzdem getan, wenn sie ihn gefragt hätte. Er würde alles für sie tun, genau wie ihre anderen Brüder, Spencer und Walker.
Regan beschloss, allein zu ihrer neuen Klasse zu gehen. Sie war jetzt ein großes Mädchen. Der beste Beweis dafür war ihre Schuluniform, und falls sie sich verlief, würde sie einfach einen lächelnden Lehrer um Hilfe bitten.
Es stellte sich heraus, dass die Schule ganz anders war, als Regan erwartet hatte. Sie hatte nicht gewusst, dass der Unterricht in Briarwood den ganzen Tag dauerte. Sie war auch nicht auf die vielen Kinder vorbereitet, die die Schule besuchten. Doch was sie am meisten verstörte, waren die gehässigen Mitschüler. Und die waren einfach überall. Die größte Angst hatte Regan vor einem älteren Mädchen, das die Vorschüler terrorisierte, wann immer die Lehrer nicht hinschauten.
Als die Kinder um drei Uhr nachmittags nach dem Läuten der Schulglocke gehen durften, war Regan so verschüchtert und erschöpft, dass sie sich auf die Unterlippe beißen musste, um nicht zu weinen.
In der kreisförmigen Auffahrt reihten sich Autos und Limousinen aneinander. Evan, der Chauffeur der Hamiltons, stieg aus und kam auf Regan zu.
Regan sah ihn zwar, war aber zu müde, um ihm entgegenzulaufen. Er eilte zu ihr, beunruhigt über ihr Aussehen. Die Haarspangen hingen im aufgelösten Haar, der Schlips saß schief, die Bluse hing aus dem Rock, ein Kniestrumpf war heruntergerutscht. Die Fünfjährige sah aus, als sei sie im Wäschetrockner geschleudert worden. Evan hielt ihr die Hintertür auf und fragte: »Alles in Ordnung, Regan?«
Mit gesenktem Kopf antwortete sie: »Ja.«
»Wie war's in der Schule?«
Regan schlüpfte ins Auto. »Ich will nicht darüber reden.«
Die gleiche Frage stellte ihr auch die Haushälterin, als sie die Tür öffnete. »Ich will nicht darüber reden«, wiederholte Regan.
Die Haushälterin nahm ihr die Schultasche ab. »Danke«, sagte Regan, rannte die gewundene Treppe hinauf, den Südflügel hinunter zu ihrem Zimmer, warf die Tür hinter sich zu und brach in Tränen aus.
Regan wusste, dass ihre Mutter von ihr enttäuscht war, weil sie ihre Gefühle nicht in den Griff bekam. Wenn Regan stolperte und sich das Knie aufschlug, musste sie einfach weinen, egal, wo sie sich gerade befand oder wer in der Nähe war.
Wenn Regan traurig war, missachtete sie alle Vorschriften, die ihre Mutter ihr mühsam eingetrichtert hatte. Immer wieder wurde Regan ermahnt, sie solle sich wie eine Dame benehmen, doch sie wusste nicht genau, was das bedeutete. Außer dass man beim Sitzen die Knie zusammendrücken musste. Regan konnte einfach nicht still vor sich hin leiden, auch wenn man das bei den Madisons so tat. Sie legte auch keinen gesteigerten Wert auf Tapferkeit – wenn es ihr schlecht ging, dann erfuhr es die ganze Familie.
Leider war im Moment nur Aiden zu Hause. Er hatte nicht viel Verständnis, wollte als Ältester wohl nicht mit den Sorgen einer Fünfjährigen belästigt werden. Er konnte es nicht leiden, wenn Regan weinte. Sie heulte trotzdem.
Regan putzte sich die Nase, wusch sich das Gesicht und zog sich um. Dann legte sie ihre Uniform ordentlich zusammen und warf sie in den Müll. Da sie nie wieder in diese schreckliche Schule gehen würde, brauchte sie die hässlichen Sachen nicht mehr. Sie zog eine kurze Hose mit passendem Oberteil an und missachtete eine weitere Vorschrift, indem sie barfuß den Flur entlang zum Zimmer ihres Bruders lief.
Vorsichtig klopfte sie an. »Kann ich reinkommen?«
Ohne die Antwort abzuwarten, öffnete Regan die Tür, lief quer durch den Raum zu Aidens Bett und sprang auf die weiche Tagesdecke. Im Schneidersitz setzte sie sich hin, zerrte die von der Schule genehmigten Spangen aus dem Haar und legte sie sich in den Schoß.
Aiden wirkte gereizt. Er saß im Rugby-Trikot am Schreibtisch, vor sich seine Schulbücher. Regan merkte nicht, dass er telefonierte, bis er sich verabschiedete und auflegte.
»Du darfst erst reinkommen, wenn ich es dir sage!«, erklärte er. »Man platzt nicht einfach so herein!« Als Regan nicht antwortete, lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück, betrachtete ihr Gesicht und fragte: »Hast du geweint?«
Sie überlegte und beschloss, noch eine Regel zu brechen: Sie log. »Nein«, sagte sie, den Blick fest auf den Boden gerichtet.
Er wusste, dass sie nicht die Wahrheit sagte, entschied sich aber, ihr keinen Vortrag über Ehrlichkeit zu halten. Seine kleine Schwester schien ziemlich durcheinander zu sein. »Ist alles okay?«, fragte er, obwohl er genau wusste, dass etwas passiert war.
Sie wollte ihn nicht ansehen. »Doch ...«, antwortete sie gedehnt.
Aiden seufzte laut. »Ich habe jetzt keine Zeit, um zu raten, was das Problem sein könnte, Regan. Ich muss gleich zum Training. Du musst mir schon sagen, was los ist.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Alles okay. Wirklich.«
Mit dem Finger malte sie Kreise auf die Tagesdecke. Aiden gab auf. Er beugte sich vor und zog die Schuhe an. Plötzlich fiel ihm ein, dass heute Regans erster Schultag in Briarwood gewesen war. Beiläufig fragte er: »Wie war's denn in der Schule?«
Ihre Reaktion traf ihn völlig unvorbereitet. Sie brach in Tränen aus und warf sich aufs Bett, vergrub das Gesicht in der Bettdecke und wischte sich Augen und Nase daran ab. Dann erzählte sie, was sich in ihr angestaut hatte. Leider ergab ihre Schilderung überhaupt keinen Sinn.
Ohne Punkt und Komma sprudelte es aus ihr heraus: »Ich hasse die Schule und gehe da nie wieder hin, nie wieder, weil, wir durften nichts essen, und ich musste die ganze Zeit still sitzen, und das eine Mädchen hat geweint, weil das andere große Mädchen es geärgert hat, das große Mädchen hat gesagt, wenn wir das den Lehrern petzen, macht sie uns fertig, und ich wusste nicht, was ich machen sollte, deshalb bin ich in der Pause mit dem Mädchen an dem Haus vorbeigegangen und bin bei ihr geblieben, aber ich geh da nie wieder hin, weil das große Mädchen morgen die andere wieder fertigmachen will.«
Aiden war sprachlos. Regan war völlig in Tränen aufgelöst. Wenn sie nicht so unglücklich gewesen wäre, hätte er gelacht. Was für ein Drama! Das hatte seine Schwester von der Hamilton-Seite der Familie. Alle Hamiltons waren nah am Wasser gebaut. Er, Spencer und Walker kamen zum Glück eher nach den Madisons, waren viel zurückhaltender.
Regan heulte so laut, dass Aiden das Klopfen an der Tür überhörte. Spencer und Walker kamen hereingestürmt. Beide Brüder sahen aus wie Aiden: groß, schlaksig, schwarzhaarig. Spencer war fünfzehn und hatte von den dreien das weichste Herz. Walker war gerade vierzehn geworden. Er war ein Draufgänger – unbekümmert und wagemutig. Er sah aus, als käme er vom Schlachtfeld: Seine Arme und sein Gesicht waren voll blauer Flecken. Vor zwei Tagen war er aufs Dach geklettert, um einen Football herunterzuholen, hatte den Halt verloren und hätte sich sicher das Genick gebrochen, wenn nicht ein Ast seinen Fall gebremst hätte. Sein Freund Ryan hatte weniger Glück gehabt: Walker war auf ihm gelandet und hatte ihm den Arm gebrochen. Ryan war der Quarterback im Juniorteam seiner Schulmannschaft und musste jetzt eine Saison lang aussetzen. Walker plagten keine Gewissensbisse. Seiner Ansicht nach war der Ast schuld an dem Vorfall gewesen.
Walker prüfte, ob Regan verletzt war. Er konnte nichts entdecken. Wieso weinte seine Schwester dann? »Was hast du mit ihr angestellt?«, fragte er Aiden.
»Gar nichts«, gab Aiden zurück.
»Aber was hat sie denn?«, fragte Walker. Er beugte sich vor und betrachtete seine kleine Schwester, unsicher, wie er reagieren sollte. Spencer stieß ihn zur Seite, setzte sich neben Regan und streichelte ihr linkisch die Schultern.
Schließlich beruhigte sie sich. Erneut seufzte Aiden laut. Vielleicht hatte sich der Sturm jetzt gelegt. Er band seine Schuhe zu und sagte: »Seht ihr, es geht schon wieder besser. Fragt sie nur nicht nach ...«
»Wie war's eigentlich in der Schule?«, unterbrach ihn Walker.
Und wieder heulte Regan los. Aiden senkte den Kopf und drehte sich zum Schreibtisch, damit seine Schwester sein Grinsen nicht sehen konnte. Er wollte sie nicht verletzen, aber ihr Gebrüll war wirklich ohrenbetäubend. In Anbetracht ihrer Größe konnte sie erstaunlich viel Lärm machen.
»Sie hat einen schweren Tag hinter sich«, erklärte er seinen Brüdern.
»Wirklich?«, fragte Spencer.
Regan hörte kurz auf zu weinen und stieß hervor: »Ich gehe da nie wieder hin.«
»Was ist denn passiert?«, wollte Walker wissen.
Unter Schluchzern schilderte Regan ihre Leidensgeschichte noch einmal.
»Du musst aber wieder hin«, sagte Spencer.
Das war das Dümmste, was er sagen konnte.
»Nein, ich gehe nicht!«
»Doch, du musst«, beharrte Spencer.
»Daddy würde mich nicht zwingen.«
»Woher willst du das wissen? Als er starb, warst du noch ein Baby. Du weißt bestimmt nicht mal, wie er ausgesehen hat.«
»Doch, das weiß ich. Ich kann mich noch an ihn erinnern.«
»Du musst erst mal richtig sprechen lernen«, bemerkte Aiden.
»Deswegen gehst du ja auch zur Schule«, stellte Spencer fest. Er musste die Stimme erheben, um sich Gehör zu verschaffen, so laut heulte Regan.
»Mann, ist die laut«, murmelte Aiden. Er schüttelte den Kopf und fügte hinzu: »Also, wenn ich nicht bald gehe, komme ich zu spät zum Training. Wir klären das jetzt. Regan, hör auf, deine Nase an meiner Decke abzuwischen, und setz dich ordentlich hin.«
Weder seine strengen Befehle noch sein Tonfall beeindruckten sie. Sie würde erst Ruhe geben, wenn sie sich ausgeweint hatte.
»Hör zu, Regan! Beruhige dich und erzähl uns dann, was passiert ist«, sagte Walker. »Was genau hat das große Mädchen gemacht?«
Spencer wühlte in seiner Tasche und zog ein zerknittertes Taschentuch hervor. »Hier. Putz dir die Nase und setz dich hin. Na los! Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, was das große Mädchen gemacht hat, ja?«
Aiden schüttelte den Kopf. »Regan wird das alleine schaffen«, meinte er.
Da setzte sie sich kerzengerade auf. »Nein, werde ich nicht, weil ich da nicht mehr hingehe in die blöde Schule.«
»Weglaufen ist keine Lösung«, verkündete Aiden.
»Ist mir egal. Ich bleibe zu Hause.«
»Moment mal, Aiden! Wenn es so eine Zicke auf unsere Schwester abgesehen hat, dann sollten wir echt ...«, begann Walker.
Aiden hob die Hand, damit Ruhe herrschte. »Lasst uns erst mal klären, was los ist, bevor wir etwas unternehmen, Walker. Also, Regan«, fragte er mit sanfter Stimme, »wie alt ist dieses große Mädchen?«
»Weiß ich nicht.«
»Egal. Weißt du, in welche Klasse sie geht?«
»Woher soll sie das wissen?«, fragte Spencer. »Regan ist doch erst in der Vorschule.«
»Aber ich weiß es trotzdem! Sie geht in die zweite Klasse, sie heißt Morgan und ist ganz gemein.«
»Also gut, sie ist gemein«, sagte Aiden ungeduldig. Er warf einen kurzen Blick auf die Uhr. »Das ist doch schon was.«
Walker und Spencer lächelten. Zum Glück merkte Regan es nicht.
»Du hast gesagt, diese Morgan hat ein anderes Mädchen geärgert?«, fragte Aiden.
Regan nickte. »Ja, das andere Mädchen hat geweint.«
»Was hat diese Morgan denn gemacht?«, fragte Walker. »Hat sie die andere geschlagen?«
»Nein.«
»Was dann?« Walker klang genauso frustriert wie Aiden. Wieder stiegen Regan Tränen in die Augen. »Sie musste Morgan ihre Haarspangen geben.«
»Geht das Mädchen auch in die Vorschule?«, fragte Aiden.
»Ja, und sie ist sehr nett. Sie sitzt am runden Tisch neben mir. Sie heißt Cordelia, aber sie hat gesagt, alle nennen sie Cordie, und ich soll sie auch so nennen.«
»Magst du diese Cordelia?«, fragte Spencer.
»Ja«, erwiderte Regan. »Es gibt noch ein anderes nettes Mädchen. Es heißt Sophie und sitzt mit mir und Cordie zusammen am Tisch.«
»Na, siehst du!«, sagte Aiden. »Du warst erst einen Tag in der neuen Schule und hast schon zwei Freundinnen gefunden!«
In der Überzeugung, Regan geholfen zu haben, griff er nach den Autoschlüsseln und eilte zur Tür. Walker hielt ihn zurück. »Warte mal kurz, Aiden! Du kannst nicht weg, bevor wir nicht beschlossen haben, was wir mit diesem gemeinen Mädchen machen.«
Aiden blieb an der Tür stehen. »Soll das ein Witz sein? Die geht in die zweite Klasse!«
»Trotzdem müssen wir Regan irgendwie helfen«, beharrte Walker.
»Und wie?«, fragte Aiden. »Indem wir drei morgen in die Schule gehen und dem Mädchen einen Schreck einjagen?«
Regan wurde wieder munter. »Das wäre gut«, sagte sie, »dann lässt sie Cordie und Sophie und mich bestimmt in Ruhe.«
»Ich fände es besser«, schlug Aiden vor, »wenn du das Problem alleine löst. Geh zu dieser Morgan und sag ihr, dass sie nichts mehr von euch bekommt und dass sie dich und deine Freundinnen in Ruhe lassen soll.«
»Das Erste fand ich besser.«
Aiden blinzelte fragend. »Welches Erste?«
»Dass du und Spencer und Walker mit mir zur Schule kommt und ihr Angst einjagt. Das will ich lieber. Meinetwegen könnt ihr den ganzen Tag dableiben.«
»Das stand überhaupt nicht zur Debatte ...«, begann Aiden.
»Warte mal! Hast du nicht eben gesagt, das gemeine Mädchen ... wie hieß sie noch gleich?«, fragte Walker.
»Morgan.«
»Okay. Hast du nicht gesagt, dass sie morgen Cordie wieder ärgern will?«
Regan schniefte, ihre Augen wurden ganz groß.
»Wieso machst du dir dann überhaupt Gedanken? Die ist doch gar nicht hinter dir her«, sagte Walker.
Regan schaute ernst drein. »Weil Cordie meine Freundin ist.«
Aiden lächelte. »Und was glaubst du, was Cordie denkt, wenn du morgen nicht zur Schule kommst?«
»Cordie geht auch nicht mehr hin. Hat sie mir gesagt.«
»Ihre Eltern werden sie mit Sicherheit wieder hinschicken«, entgegnete Aiden. »Sieh mal, Regan, es gibt auf der Welt zwei Sorten von Menschen: Angsthasen, die vor gemeinen Leuten weglaufen, und Mutige, die sich ihnen in den Weg stellen.«
Regan wischte sich die Tränen ab. »Und zu welcher Sorte gehöre ich?«
»Du bist eine Madison. Du stellst dich den Problemen. Wir laufen vor niemandem weg.«
Das hörte Regan nicht gerne, doch sah sie an der ernsten Miene ihres Bruders, dass er seine Meinung nicht ändern würde, so wenig sie ihr auch gefiel. Es ging ihr schon viel besser, weil sie über ihr Problem gesprochen hatte.
Als Mrs Tyler am nächsten Morgen Regan die Haare kämmte, überlegte das Mädchen, die Spangen zu Hause zu lassen. Dann entschied sie sich doch dafür, sie zu tragen, falls Cordie Ersatz brauchen sollte.
Als Regan in Briarwood eintraf, war ihr übel. Cordie wartete bereits vor der Schultür.
»Ich dachte, du wolltest nicht mehr kommen«, sagte Regan.
»Mein Daddy hat mich hergeschickt«, erwiderte Cordie zaghaft.
»Mich hat mein Bruder geschickt.«
Sophie winkte ihnen von Weitem zu. Sie war gerade aus dem Auto gestiegen und mühte sich ab, den Riemen ihrer Schultasche über die Schulter zu legen. Dann lief sie Cordie und Regan entgegen. Ihr langes blondes Haar wehte im Wind. Regan fand, dass Sophie wie eine Prinzessin aussah. Sie hatte so helles Haar, dass es fast schon weiß wirkte, und ihre Augen waren grün.
»Ich weiß, was wir machen können«, verkündete Sophie, sobald sie die beiden erreicht hatte. »Wir könnten uns in der Pause auf dem Klettergerüst hinter denen aus der Fünften verstecken, und dann kann Regan sich an Morgan ranschleichen und Cordies Spangen zurückholen.«
»Aber wie?«, fragte Regan.
»Wie was?«, fragte Sophie zurück.
»Wie soll ich die Spangen zurückholen?«
»Weiß ich noch nicht, aber vielleicht fällt dir was ein.«
»Mein Daddy hat gesagt, ich soll dem Lehrer das mit Morgan erzählen, aber das mache ich nicht«, verkündete Cordie. Sie strich die dunklen Locken zurück. »Dann wird Morgan noch gemeiner.«
Regan kam sich plötzlich sehr erwachsen vor. »Wir müssen ihr sagen, dass sie uns in Ruhe lassen soll. Das hat Aiden gesagt.«
»Wer ist Aiden?«, fragte Sophie.
»Mein Bruder.«
»Aber Morgan ärgert immer nur mich«, warf Cordie ein. »Nicht dich oder Sophie. Es ist besser, wenn ihr weglauft und euch versteckt.«
»Du kannst doch mit uns weglaufen!«, schlug Sophie vor.
»Der Lehrer schickt uns in der Pause nach draußen«, sagte Cordie. »Und dann findet Morgan mich.«
»Wir drei bleiben zusammen, und wenn sie versucht, dir was wegzunehmen, oder dir Angst macht, dann sagen wir, dass sie dich in Ruhe lassen soll. Vielleicht bekommt sie Angst, weil wir zu dritt sind.«
»Vielleicht«, räumte Cordie ein, doch es klang nicht sehr überzeugt. Regan wusste, dass sie ihr nicht glaubte.
»Bis zur Pause überleg ich mir was«, verkündete Sophie.
Sie klang so selbstsicher, so zuversichtlich, dass sich Regan wünschte, ein wenig mehr wie Sophie zu sein. Ihre neue Freundin schien sich um nichts Sorgen zu machen. Regan hingegen zerbrach sich ständig den Kopf. Cordie offenbar auch. Die beiden grübelten den ganzen Vormittag über Morgan.
Weil es draußen nieselte, blieben sie in der ersten Pause im Klassenzimmer, doch als große Pause war, schien die Sonne, und die Vorschüler mussten zusammen mit den anderen Kindern auf den Spielplatz.
Zu spät wurde Regan klar, dass sie nichts zu Mittag hätte essen sollen. Die Milch war ihr nicht bekommen; sie lag ihr wie ein Stein im Magen.
Morgan stand bei den Schaukeln, die für Vorschüler und Erstklässler reserviert waren. Zum Glück hatte Sophie einen Plan ausgeheckt: »Sobald Morgan Cordie entdeckt und zu ihr geht, laufe ich in die Schule und hole Mrs Grant.«
»Willst du Morgan bei den Lehrern verpetzen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«, fragte Regan.
»Ich will keine Petze sein. Mein Vater meint, Petzen sind das Schlimmste, was es gibt.«
»Aber was willst du dann machen?«, fragte Regan. Aus dem Augenwinkel beobachtete sie Morgan. Bis jetzt hatte das große Mädchen sie noch nicht bemerkt.
»Keine Ahnung, was ich sage, aber ich sorge dafür, dass Mrs Grant mit mir nach draußen kommt und hört, was Morgan zu Cordie sagt. Vielleicht bekommt sie dann mit, dass Cordie ihr die Spangen geben soll.«
»Das ist wirklich schlau, Sophie«, lobte Cordie.
Regan fand den Plan toll. Sophie verschwand genau in dem Augenblick im Schulgebäude, als Morgan auf die Mädchen zugestapft kam. Sie sah aus wie ein Ungeheuer.
Unwillkürlich machten Regan und Cordie einen Schritt nach hinten. Morgan kam näher. Regan blickte sich verzweifelt nach Sophie und Mrs Grant um, konnte aber niemanden entdecken. Sie hatte schreckliche Angst. Gebannt starrte sie auf Morgans Füße. Sie waren so groß wie die von Aiden. Dann blickte sie zaghaft hoch in die aufgerissenen braunen Augen. Regan wurde übel.
Nun musste sie mit Morgan fertig werden und gleichzeitig aufpassen, sich nicht vor der ganzen Schule zu übergeben.
Das große Mädchen streckte fordernd die Hand aus und sah Cordie dabei drohend an.
»Los, gib her!«, brummte Morgan und wackelte mit den Fingern. Cordie wollte ihre Spangen aus dem Haar nehmen, doch Regan hielt sie zurück.
»Nein«, sagte sie und stellte sich vor Cordie. »Lass meine Freundin in Ruhe!«
So etwas Tapferes hatte Regan noch nie im Leben getan. Ihr wurde ganz schwindelig und gleichzeitig übel. Galle stieg ihr in die Kehle, sie konnte nicht schlucken. Es war Regan egal. Wichtig war, dass Aiden stolz auf sie sein würde.
Morgan schubste Regan zurück. Sie stolperte und wäre beinahe gefallen, fing sich jedoch und stellte sich breitbeinig vor das größere Mädchen. »Lass Cordie in Ruhe!«, wiederholte Regan. Vor lauter Galle konnte sie kaum noch sprechen, sie zwang sich zu schlucken und sagte dann ein drittes Mal: »Lass Cordie in Ruhe!«
Ihr Magen begann zu rebellieren. Regan wusste, dass sie es nicht mehr bis zur Mädchentoilette schaffen würde.
»Gut«, meinte Morgan. Sie machte einen Schritt nach vorne und schubste Regan erneut. »Dann gib du mir was!«
Dieser Aufforderung kam Regans Magen mit Vergnügen nach.
1
Der Dämon wollte heraus.
Den Mann erstaunte das nicht, auch machte es ihm keine Angst. Der Dämon regte sich immer erst gegen Abend, wenn der Mann die Arbeit beendet hatte und langsam entspannte.
Eine Zeit lang, fast ein ganzes Jahr, hatte der Dämon ihn in Ruhe gelassen. Der Mann hatte nicht gewusst, dass es ihn überhaupt gab. In seiner Naivität nahm er an, er habe Panikattacken oder »Anfälle«, wie er sie gern nannte, das klang nicht so furchterregend. Die Anfälle kündigten sich immer mit einer großen Unruhe an. Das Gefühl war nicht einmal unangenehm. Es war, als würde er die Arme um einen heißen Stein schlingen, um seinen frierenden Körper zu wärmen, doch im Laufe des Tages wurde der Stein immer heißer, bis er schließlich eine unerträgliche Hitze verströmte. Und dann wurde diese Unruhe übermächtig, prickelte auf der Haut und brannte in der Lunge, sodass er am liebsten laut geschrien hätte. In seiner Verzweiflung überlegte er immer, eine von den Tabletten zu nehmen, die der Arzt ihm verschrieben hatte, tat es dann aber doch nicht, weil er befürchtete, die Medikamente würden ihn schwächen.
Er glaubte, ein guter Mensch zu sein. Er zahlte seine Steuern, ging sonntags in die Kirche und hatte eine anständige Arbeit. Sie war anstrengend, er musste stets voll da sein, sie verlangte seine ganze Konzentration, sodass er keine Zeit hatte, über die schwere Bürde nachzudenken, die zu Hause auf ihn wartete. Überstunden machten ihm nichts aus. Im Gegenteil, manchmal war er sogar froh darüber. Weder in seinem beruflichen noch in seinem privaten Leben lief er vor der Verantwortung davon. Er kümmerte sich um seine Frau Nina, die im Rollstuhl saß. Es war ihre Idee gewesen, nach dem Unfall nach Chicago zu ziehen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Bereits zwei Wochen nach dem Umzug hatte er Arbeit gefunden – ein gutes Omen. Sein Leben war hektisch, aber schön. Nina und er hatten beschlossen, von einem Teil der Entschädigung ein geräumiges Haus am Stadtrand zu kaufen. Kaum dass sie ausgepackt hatten, machte er sich daran, Rampen einzusetzen und das Erdgeschoss umzubauen, damit Nina mit ihrem federleichten Rollstuhl, einem hochmodernen Modell, problemlos überall hingelangte. Ninas Beine waren bei dem Unfall zertrümmert worden, sie würde, das stand fest, nie wieder laufen können. Er fand sich mit dem Schicksal ab und schaute nach vorn. Erleichtert beobachtete er, wie seine Frau langsam ihre alte Stärke zurückgewann und lernte, tagsüber alleine zurechtzukommen.
Wenn er zu Hause war, verwöhnte er sie. Jeden Abend kochte er, wusch anschließend ab und verbrachte den Rest des Abends mit ihr vor dem Fernseher, schaute ihre Lieblingssendungen.
Sie waren seit zehn Jahren verheiratet, doch ihre Liebe war noch so groß wie am ersten Tag. Der Unfall hatte höchstens verhindert, dass sie selbstzufrieden wurden oder nicht mehr zu schätzen wussten, was sie aneinander hatten. Kein Wunder. Seine geliebte Nina war auf dem Operationstisch praktisch tot gewesen und dann auf wundersame Weise zurückgekehrt. Die Chirurgen hatten die ganze Nacht durchoperiert, um sie zu retten. Als er erfuhr, dass Nina durchkommen würde, war er in der Krankenhauskapelle auf die Knie gefallen und hatte geschworen, für den Rest seines Lebens alles zu tun, um sie glücklich zu machen.
Er führte ein reiches, erfülltes Leben ... mit einer kleinen Ausnahme.
Der Dämon hatte sich ihm nicht nach und nach offenbart. Nein, er war ganz plötzlich da gewesen.
Es passierte mitten in der Nacht. Der Mann hatte nicht schlafen können und war in die Küche gegangen, weil er sich nicht im Bett herumwälzen und Nina wecken wollte. Er lief auf und ab. Ein Glas Milch würde das Zittern in seinem Körper beruhigen und ihn müde machen, dachte er, aber es half nicht. Er wollte das leere Glas gerade in die Spüle stellen, als es ihm aus der Hand glitt und im Becken zersprang. Das Geräusch schien durch das ganze Haus zu hallen. Er eilte zur Schlafzimmertür und lauschte. Seine Frau schlief tief und fest. Erleichtert tappte er in die Küche zurück.
Die Unruhe wurde stärker. Verlor er den Verstand? Das konnte nicht sein. Er hatte nur wieder einen Anfall, mehr nicht. So schlimm war es nicht. Er würde schon damit fertig werden.
Auf dem Küchentresen lag die Zeitung, er nahm sie mit zum Tisch. Er wollte sie Seite für Seite lesen, bis ihm vor Müdigkeit die Augen zufielen.
Zuerst las er den Sportteil, jeden einzelnen Bericht, dann widmete er sich dem Regionalteil. Er überflog einen Artikel über die Einweihung eines neuen Parks und einer neuen Joggingstrecke. Gebannt faltete er die Zeitung auseinander. Sein Blick fiel auf das Foto einer schönen, jungen Frau, die zwischen mehreren Männern stand. Sie hielt eine Schere in der Hand, um ein Band durchzuschneiden, das zwischen zwei Pfählen gespannt war. Die Frau lächelte ihn an.
Er konnte den Blick nicht von ihr abwenden.
Als er die Bildunterschrift las, passierte es. In seiner Brust zog sich etwas zusammen, erdrückte ihn fast, er bekam keine Luft. Wie ein Blitz fuhr es ihm ins Herz, es schmerzte unerträglich. Hatte er einen Herzinfarkt oder war es eine neue Panikattacke?
Beruhige dich!, befahl er sich. Beruhige dich! Atme tief durch!
Die Unruhe wurde immer stärker. Ihn ergriff die schreckliche, vertraute Angst. Seine Haut begann zu brennen und zu jucken, er kratzte wie von Sinnen an Armen und Beinen, sprang auf und lief durch die Küche. Was war nur mit ihm los?
Er zwang sich, stehen zu bleiben. An Armen und Beinen hatte er blutige Striemen, manche so tief, dass Blut auf den Fußboden tropfte. Er war kurz davor, den Verstand zu verlieren. Wimmernd zog er sich an den Haaren. Doch seine Angst wurde nur noch größer. Dann kam die Offenbarung, wie ein grelles Licht. Und er begriff, dass er keine Kontrolle mehr über seinen Körper hatte. Er konnte nicht einmal mehr selbstständig atmen.
Plötzlich wurde ihm alles klar. Er begriff. Ein anderer atmete für ihn.
Am nächsten Morgen erwachte er, zusammengerollt auf dem Küchenboden. Hatte er das Bewusstsein verloren? Möglich war es. Schwankend erhob er sich, stützte sich mit den Händen auf der Kücheninsel ab. Er schloss die Augen, atmete tief ein und drückte den Rücken durch. Sein Blick fiel auf die Schere, die zusammengefaltete Zeitung. Hatte er sie dorthin gelegt? Er konnte sich nicht erinnern. Er räumte die Schere in die Schublade und wollte die Zeitung in die Garage zum Altpapier bringen. Da entdeckte er es: Unter der Zeitung lagen der ausgeschnittene Artikel und das Foto mit der lächelnden Frau. Sie warteten auf ihn. Er wusste, wer den Ausschnitt dort hingelegt hatte. Und er wusste auch, warum.
Der Dämon wollte diese Frau.
Schluchzend vergrub der Mann das Gesicht in den Händen. Er musste einen anderen Weg finden, um das Monster in Schach zu halten. Körperliche Betätigung schien zu helfen. Er ging ins Fitness-Studio und trainierte wie ein Besessener. Mit besonderer Vorliebe zog er Boxhandschuhe an und schlug so lange und heftig wie möglich auf den Sandsack ein. So vergaß er die Zeit und hörte erst auf, wenn er die Arme nicht mehr heben konnte.
Tagelang brachte er seinen Körper auf diese Weise an den Rand der Erschöpfung. Dann genügte auch das nicht mehr.
Ihm lief die Zeit davon. Der Dämon machte ihn fertig. Ironischerweise war es schließlich seine Frau, die ihn auf die Idee brachte. Eines Abends, als sie ihm beim Abwaschen Gesellschaft leistete, schlug sie vor, er solle doch einmal ausgehen. Sich einen schönen Abend mit seinen Freunden machen und sich amüsieren.
Er wollte nicht. Er war eh viel zu oft abends fort, wenn er Überstunden machte. Außerdem ging er joggen und ins Fitness-Studio, Nina war wirklich oft genug allein.
Doch sie war sturer als er und sprach ihn immer wieder darauf an. Schließlich war er einverstanden, nur damit sie Ruhe gab.
So kam es, dass er an diesem Abend erstmals ausgehen wollte. Schon spürte er das Adrenalin in seinen Adern. Er war so nervös und aufgeregt wie bei der ersten Verabredung mit einem Mädchen.
Bevor er das Haus verließ, teilte er Nina mit, er treffe sich nach der Arbeit mit Freunden bei Sully, einer beliebten Kneipe, doch sie brauche sich keine Sorgen zu machen. Sollte er mehr als ein Bier trinken, dann würde er ein Taxi nehmen.
Es war gelogen.
Nein, er ging nicht in die Stadt, um sich zu amüsieren. Er ging auf die Jagd.
2
Regan Madison hatte drei furchtbare Tage und Nächte inmitten von Lustmolchen verbracht. Sie schienen einfach überall zu sein – auf den Flughäfen, im Hotel und auf den Straßen Roms. Nach Regans Definition war ein Lustmolch ein lüsterner, reicher alter Mann mit einer Geliebten, die höchstens halb so alt war wie er. Regan hatte sich nie sonderlich für diese Pärchen interessiert, bis ihr Stiefvater Emerson seine jugendliche Braut Cindy ehelichte. Verstehen konnte Regan es schon: Cindy besaß den Körper einer Stripperin und dazu den Intelligenzquotienten eines Holzscheites. Diese Kombination machte sie perfekt für Emerson.
Zu Regans Erleichterung blieb das überglückliche Paar in Rom. Sie selbst flog zurück nach Chicago. Von dem langen Flug erschöpft, ging sie früh zu Bett und schlief ganze acht Stunden durch. Sie hoffte nur, der nächste Tag würde besser werden.
Doch da hatte sie sich getäuscht.
Als sie am nächsten Morgen um sechs Uhr aufwachte, hatte sie das Gefühl, Gummibänder am linken Knie zu haben, die ihr das Blut abschnürten. Regan hatte sich am Vorabend an der Anrichte gestoßen und keine Zeit gehabt, das Knie zu kühlen. Der Schmerz war unerträglich. Sie schlug die Decke zurück, setzte sich auf und massierte das Gelenk, bis der pochende Schmerz nachließ.
Regan hatte sich das Knie bei einem Baseballspiel für wohltätige Zwecke ruiniert. An der ersten Base hatte sie sich gut geschlagen, sich dann jedoch zur falschen Seite gedreht, sodass der Meniskus herausgesprungen war. Der Sportarzt, den sie konsultiert hatte, riet ihr zu einer Operation und versicherte, dass sie bereits nach wenigen Tagen wieder voll einsatzfähig sein würde, aber Regan schob den Eingriff vor sich her.
Sie schwang die Füße aus dem Bett, beugte sich vor und belastete vorsichtig das schmerzende Knie. Als ginge es ihr nicht schon schlecht genug, begann plötzlich ihre Nase zu laufen und ihre Augen zu tränen.
Mit ihrer Heimatstadt verband Regan eine Art Hassliebe. Sie liebte die Galerien und Museen und fand, dass man in Chicago genauso gut einkaufen konnte wie in New York – auch wenn ihre besten Freundinnen, Sophie und Cordie, da entschieden anderer Meinung waren. Außerdem war Regan überzeugt, dass die Bevölkerung zu mindestens achtzig Prozent aus guten, anständigen, gesetzestreuen Bürgern bestand. Die meisten Menschen, die ihr auf der Straße entgegenkamen, lächelten. Manche grüßten sogar. Wie fast jeder im Mittleren Westen waren sie freundlich und höflich, ohne aufdringlich zu sein. Die Chicagoer waren ein zäher Menschenschlag, der sich gerne über das Wetter beklagte, besonders im Winter, wenn der Wind vom Michigan-See wie ein Messer in die Haut schnitt.
Der Frühling hingegen machte Regan zu schaffen. Sie hatte Heuschnupfen. Wenn das Traubenkraut blühte und viele Pollen durch die Luft flogen, wurde sie zu einer wandelnden Apotheke. Doch sie wollte sich davon nicht stören lassen. Wenn die Luft schwer und die Pollenkonzentration besonders hoch war, stopfte sie sich Taschentücher, Aspirin, Allergietabletten, Nasenspray und Augentropfen in die Tasche und versuchte, so weiterzumachen wie bisher.
Vor ihr lag ein Tag voller Termine. Regan wusste, dass sie sofort anfangen musste, auch wenn sie am liebsten wieder zurück unter die weiche Decke ins warme Bett gekrabbelt wäre. Es war so schön, wieder zu Hause zu sein.
Regans Zuhause war eine Suite im Hamilton, einem Fünfsternehotel im Besitz ihrer Familie. Es lag im schicken Water-Tower-Viertel von Chicago und war unglaublich elegant, gediegen und komfortabel. Vorläufig war sie mit ihrer Wohnsituation zufrieden. Im Hotel hatte sie alles, was sie brauchte. Auch die Büros waren dort untergebracht, so dass sie bequem mit dem Aufzug an ihren Arbeitsplatz fahren konnte. Davon abgesehen, kannte sie den Großteil des Personals seit ihrer Kindheit und betrachtete die Menschen als Familienmitglieder.
Sosehr es Regan auch zurück ins Bett zog, sie blieb hart. Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht, humpelte ins Bad, wusch sich und putzte die Zähne, dann zog sie Sportsachen an, band sich einen Pferdeschwanz und fuhr mit dem Aufzug in den siebzehnten Stock, um drei Kilometer auf der neuen Hallenbahn zu absolvieren. Von Heuschnupfen oder Schmerzen im Knie würde sich Regan doch nicht aufhalten lassen! Jeden Tag drei Kilometer, egal, was passierte. Um halb acht war sie zurück in ihrer Suite, hatte geduscht, sich angezogen und gefrühstückt.
Gerade als sich Regan an ihren Schreibtisch im Wohnzimmer gesetzt hatte und die eingegangenen Mitteilungen durchgehen wollte, klingelte das Telefon.
Cordelia war am Apparat. »Wie war's in Rom?«
»Ganz gut.«
»War dein Stiefvater da?«
»Ja.«
»Dann kann es doch nicht gut gewesen sein! Komm schon, Regan. Mir kannst du's doch sagen.«
Regan seufzte. »Es war furchtbar. Einfach schrecklich.«
»Ich nehme an, dein Stiefvater hatte seine neue Frau dabei?«
»Allerdings, die war auch da.«
»Läuft sie immer noch Reklame für Escada?«
Regan musste lächeln. Cordie hatte die Gabe, den schlimmsten Situationen etwas Lustiges abzugewinnen. Sie wusste, dass ihre Freundin sie aufmuntern wollte. Und es funktionierte auch. »Nein, nicht Escada«, berichtigte sie. »Versace. Aber du hast recht, sie trägt nichts anderes.«
Cordie prustete los. »Ich kann's mir lebhaft vorstellen. Waren deine Brüder auch da?«
»Aiden natürlich. Das Hotel in Rom ist sein Steckenpferd. Er war wie immer die Seriosität in Person. Ich glaube, ich habe ihn seit Jahren nicht mehr lächeln sehen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er der Älteste ist.«
»Was ist mit Spencer und Walker?«
»Spencer musste in Melbourne bleiben. In letzter Minute gab es Probleme mit der Ausstattung des neuen Hotels. Walker war da, aber nur auf dem Empfang. Er wollte sich vor dem Rennen noch ausruhen.«
»Dann hast du also mit ihm gesprochen?«
»Ja.«
»Das ist gut. Das heißt, du hast ihm verziehen, ja?«
»Sieht so aus. Er hat ja nur getan, was er für richtig hielt. Mittlerweile sehe ich die Dinge anders, wie du schon sagtest, also Schwamm drüber. Außerdem fände ich es schrecklich, wenn ich ihm nicht mehr sagen könnte, dass ich ihm verziehen habe. Letzten Monat hat er wieder ein Auto zu Schrott gefahren«, fügte Regan hinzu.
»Und mal wieder keinen Kratzer abbekommen, was?«
»Du sagst es.«
»Ich bin froh, dass du ihm nicht mehr böse bist.«
»Mir wäre lieber, er würde es nicht so übertreiben. Er ist zu impulsiv. Da treffe ich mich ein paar Mal mit einem Mann und schon beauftragt er jemanden, der ihn ausspionieren soll.«
»Entschuldige, aber das war ja wohl etwas mehr mit Dennis als nur ein paar Treffen.«
»Ja, aber ...«
»Wenigstens hat er dir nicht das Herz gebrochen. Ich weiß ganz genau, dass du ihn nicht geliebt hast.«
»Wieso?«
»Als ihr euch getrennt habt, hast du keine einzige Träne vergossen. Mensch, Regan, du heulst sogar, wenn im Fernsehen Werbung für Hundefutter läuft! Du hast Dennis nicht geliebt. Und nur fürs Protokoll, ich bin froh, dass du ihn abgeschossen hast. Er war überhaupt nichts für dich.«
»Eigentlich fand ich, dass er sehr gut zu mir passte. Fast schon zu gut. Wir hatten so viel gemeinsam. Er ging gerne ins Theater, ins Ballett, in die Oper, es machte ihm nichts aus, mich zu diesen Benefizveranstaltungen zu begleiten. Ich dachte, wir hätten dieselben Ansichten –«
»Aber das war ja nicht sein wahres Gesicht! Er war hinter deinem Geld her, Regan, und du hast einfach zu viel drauf, um dir so was gefallen zu lassen.«
»Du willst mir jetzt doch nicht wieder erzählen, wie hübsch und klug ich bin, um mein Selbstbewusstsein zu stärken, oder?«
»Nein, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss zurück ins Labor, bevor es von einem Studenten in die Luft gejagt wird. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht und ob wir heute Abend zusammen essen gehen wollen. Morgen fange ich mit meiner Grapefruit-Diät an.«
»Das würde ich gerne, aber ich ertrinke in Arbeit. Ich habe einiges zu erledigen«, erwiderte Regan.
»Na gut, dann treffen wir uns halt am Freitag, und ich fange am Samstag mit meiner Diät an. Wir könnten beide mal wieder ein bisschen Spaß gebrauchen«, fand Cordie. »Die letzte Woche war schrecklich. Ein Student hat einen Karton mit Material fallen lassen und alle neuen Gläser zerbrochen. Dienstag habe ich erfahren, dass mein Budget fürs nächste Jahr halbiert wird. Halbiert!«, wiederholte sie. »Ach ja, und Mittwoch hat Sophie angerufen und mich gebeten, etwas für sie zu erledigen, was auch ziemlich unangenehm war.«
»Was denn?«
»Ich musste zur Polizei gehen und dort etwas fragen.«
»Was denn?«
»Noch ein bisschen Geduld, dann erfährst du die blutigen Details. Ich musste Sophie versprechen, dir nichts zu verraten. Sie will es dir selbst erzählen.«
»Sie heckt schon wieder was aus, stimmt's?«
»Kann sein«, erwiderte Cordie. »Oje. Einer von den Studenten winkt ganz verzweifelt herüber. Ich muss aufhören.«
Sie legte auf, bevor Regan sich verabschieden konnte. Fünf Minuten später rief Sophie an. Sie verschwendete keine Zeit mit Höflichkeiten.
»Du musst mir einen Gefallen tun. Einen großen.«
»In Rom war's gut, danke der Nachfrage. Was für einen Gefallen?«
»Sag erst Ja.«
Regan lachte. »Auf diesen Trick bin ich seit der Schule nicht mehr reingefallen.«
»Dann lass uns zusammen Mittag essen. Nicht heute«, fügte Sophie schnell hinzu. »Ich kann mir vorstellen, dass du in Arbeit ertrinkst, und ich habe zwei Konferenzen direkt hintereinander, da kann ich auf keinen Fall fehlen. Vielleicht schaffen wir es morgen oder übermorgen. Zwei Stunden werden wir wohl brauchen.«
»Zwei Stunden fürs Mittagessen?«
»Fürs Mittagessen und einen Gefallen«, berichtigte Sophie. »Wir können uns am Freitag um halb eins im Palms treffen. Cordie ist mittags fertig, dann kann sie dazukommen. Passt dir Freitag?«
»Ich weiß nicht genau, ob –«
»Ich brauche deine Hilfe wirklich«, flehte Sophie.
Regan wusste, dass es ein abgekartetes Spiel war, beschloss jedoch, es Sophie durchgehen zu lassen.
»Wenn es so wichtig ist ...«, setzte sie an.
»Ja, ist es.«
»Okay, dann werde ich es einrichten.«
»Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ach ja, ich habe übrigens Henry gefragt, ob du am Wochenende zur Verfügung stehst. Er hat mich eingetragen.«
»Für das ganze Wochenende? Was ist denn los, Sophie?«
»Ich erklär's dir beim Essen. Dann hast du die ganze Woche Zeit, es dir zu überlegen.«
»Ich kann nicht –«
»Das Foto in der Zeitung hat mir gut gefallen. Dein Haar sieht super aus.«
»Sophie, ich will wissen –«
»Ich muss los. Wir sehen uns Freitag um halb eins im Palms.«
Regan wollte protestieren, doch es war sinnlos, Sophie hatte bereits aufgelegt. Sie sah auf die Uhr, nahm ihren Minicomputer und verließ das Zimmer. In der Lobby wartete Paul Greenfield, ihr langjähriger Mitarbeiter und guter Freund. Regan kannte Paul schon seit der Schulzeit. In den Sommerferien ihres ersten Highschool-Jahres war sie seine Praktikantin und drei Monate lang schrecklich verliebt in ihn gewesen. Paul war ihre Schwärmerei nicht verborgen geblieben – jeder hatte ihr an der Nasenspitze angesehen, wie »verknallt« sie war (so hatte sich ihre Mutter ausgedrückt) –, doch er war äußerst anständig damit umgegangen. Jetzt war er verheiratet, hatte vier Kinder, die ihn fix und fertig machten, und immer ein Lächeln für Regan. Er hatte bereits graue Schläfen, und seine Brillengläser waren so dick wie Glasbausteine, doch Regan fand ihn immer noch unwiderstehlich. Er hielt etwas in der Hand, das wie ein fünfhundert Seiten dickes Dossier aussah.
»Guten Morgen, Paul. Sieht aus, als hättest du alle Hände voll zu tun.«
»Guten Morgen. Eigentlich ist das für dich.«
»Echt?« Regan machte einen Schritt zurück.
Er grinste. »Tut mir leid, aber vor etwa einer Stunde habe ich eine E-Mail von Aiden bekommen.«
»Und?«, fragte Regan, als Paul schwieg.
»Er hat gefragt, warum er nichts von dir gehört hat.«
Paul versuchte, ihr den Papierstapel in die Arme zu drücken. Lächelnd wich Regan noch einen Schritt zurück.
»Was genau möchte Aiden denn von mir hören?«
»Deine Meinung zu diesem Bericht.«
»Das hat alles er geschrieben? Wann hatte er denn Zeit, fünfhundert Seiten zu verfassen?«
»Zweihundertzehn Seiten«, berichtigte Paul.
»Egal. Wann hatte er Zeit, einen Bericht von zweihundertzehn Seiten zu schreiben?«
»Du weißt doch, dein Bruder schläft nicht.«
Und hat kein Privatleben, dachte Regan, wagte aber nicht, es auszusprechen. Das wäre respektlos gewesen. »Offensichtlich nicht«, meinte sie. »Was ist das denn für ein Bericht?«
Paul lächelte. Sie starrte den Papierwust an, als erwartete sie, dass jeden Moment ein Kastenteufel herausspringen würde.
»Es geht um Aidens Expansionspläne«, antwortete Paul. »Er braucht dein Okay, sonst kann er nicht weitermachen. Alle Zahlen stehen hier drin. Spencer und Walker haben bereits zugestimmt.«
»Die haben das Ding bestimmt nicht gelesen.«
»Nein, da hast du recht.«
Mit schuldbewusster Miene übergab Paul ihr den Stapel. Regan legte den Minicomputer obendrauf.
»Aiden hat nichts davon gesagt, als wir uns in Rom gesehen haben. Und jetzt meint er, ich müsste das alles schon gelesen haben?«
»Da ist anscheinend etwas schiefgelaufen. Ich habe die Datei schon zum zweiten Mal für dich ausdrucken lassen. Der erste Ausdruck ist offenbar verschwunden. Ich hatte ihn Emily gegeben«, erklärte Paul. Emily war Aidens Assistentin. »Sie behauptet, sie hätte ihn Henry gegeben, der ihn an dich weiterleiten sollte.«
»Wenn sie ihn Henry gegeben hätte, dann wäre er auch bei mir angekommen.«
Paul war wie immer diplomatisch. »Es ist ein Rätsel, aber ich finde, wir sollten keine Zeit und Energie darauf verschwenden, es zu lösen.«
»Stimmt, es ist ein Rätsel.« Es wollte Regan nicht gelingen, ihren Ärger zu verbergen. »Wir wissen beide, dass Emily –«
Paul ließ sie nicht ausreden. »Wir behalten unsere Meinung besser für uns. Wie auch immer, dein Bruder wartet auf deine Antwort, am besten bis heute Mittag.«
»Bis heute Mittag?«
»Er sagt, du sollst dir wegen der Zeitverschiebung keine Sorgen machen.«
Regan knirschte mit den Zähnen. »Na gut. Ich lese es gleich.«
Pauls Lächeln verriet, dass er sich über ihr Einlenken freute. »Falls du irgendwelche Fragen hast, ich bin bis elf im Büro. Dann bin ich unterwegs nach Miami.«
Er ging. Sie rief ihm hinterher: »Du wusstest, dass ich klein beigeben würde, stimmt's?«
Als Antwort lachte er nur. Regan sah auf die Uhr, seufzte, straffte die Schultern und ging in ihr Büro.
3
Der Mord war ein Irrtum.
Der Mann stand im Schatten eines Gebäudes im Water-Tower-Viertel und beobachtete den Eingang. Er wartete auf eine ganz bestimmte Person. Die feuchte Kälte des Abends zog ihm bis in die Knochen. Es war ungemütlich, aber er wollte nicht aufgeben, und so harrte er noch zwei weitere Stunden in seinem Versteck aus, wartete und hoffte. Dann erst gestand er sich ein, dass es umsonst gewesen war.
Resigniert stieg er in seinen Jeep und machte sich auf den Heimweg. Vor Enttäuschung traten ihm Tränen in die Augen. Unwillkürlich seufzte er auf. Peinlich berührt wischte er sich die Tränen weg.
Er zitterte unkontrolliert. Wie würde der Dämon auf sein Versagen reagieren? Der Mann begann zu schluchzen.
Doch am tiefsten Punkt der Verzweiflung kam die Antwort: Vor ihm lag der Eingang zum Conrad Park. Der Mann erkannte, dass der Dämon ihn an seinen Bestimmungsort geführt hatte. Die Joggingstrecke zog sich in Form einer Acht durch den Park und um die Universität herum. Der Mann erinnerte sich an die Zeichnung in der Zeitung, eine Illustration zu einem langen Artikel über ein Festival. Der Erlös sollte irgendeiner Stiftung zugutekommen, aber er wusste nicht mehr, welcher.
Hier wirst du sie finden, flüsterte der Dämon.
Der Mann war erleichtert. In einer Nebenstraße entdeckte er einen perfekten Parkplatz. Er hielt vor einer Telefonsäule. Ein Plakat warb für einen Wohltätigkeitslauf im Norden der Stadt. Es zeigte eine hübsche junge Frau beim Zieleinlauf.
Der Mann wollte die Autotür öffnen, hielt dann aber inne. Er war nicht passend angezogen. Er trug seinen billigen, aber praktischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Nadelstreifenkrawatte, weil er geglaubt hatte, sie im Water-Tower-Viertel zu finden, wo er sich unter die Geschäftsleute hatte mischen wollen. Eine Baseballkappe hatte er ebenfalls mitgenommen. Er wollte sie aufsetzen, wenn er ihr folgte, damit ihn niemand auf der Straße nach der Tat wiedererkannte.
Was sollte er jetzt tun?
Mach das Beste draus, zischte der Dämon.
Der Mann griff nach der Aktentasche und beschloss, so zu tun, als sei er ein schwer beschäftigter Professor der Universität, die nicht weit entfernt war. Ja, das könnte klappen.
Das Wetter war erneut umgeschlagen. In den letzten vier Tagen hatte es unablässig geregnet, doch am Abend sollte es aufklaren. Der Meteorologe vom Wetterdienst hatte sich aber offensichtlich geirrt. Mist, er hätte seinen Schirm mitnehmen sollen. Jetzt war es zu spät, sich noch einen zu besorgen. Der Mann nahm die Aktentasche und machte sich eilig auf den Weg. Er versuchte, einen zielstrebigen Eindruck zu erwecken. So lief er anderthalb Kilometer weit, und ein feiner nasser Film legte sich auf seine Kleidung. Mit wachsender Nervosität suchte er nach der perfekten Stelle. Es gab nicht viele baumbestandene Ecken. Dort würde das Opfer besonders vorsichtig und aufmerksam sein.
Er machte sich nicht allzu viele Gedanken über den Nieselregen. Jogger gingen bei jedem Wetter vor die Tür. Schließlich musste die Frau für einen wichtigen Lauf in Form sein, dachte er. Natürlich würde sie trainieren.
Doch wo sollte er sich verstecken? Noch immer suchte er nach einer geeigneten Stelle. Alle sechs Meter stand eine Laterne, die wie eine alte Gasleuchte aussah. An der Rückseite des Gebäudes waren sie sogar noch dichter platziert. Ein Schild mit einem Pfeil wies das Gebäude als Hörsaal aus. »Hier nicht, hier nicht«, murmelte der Mann. Zu hell für sein Vorhaben.
Sein Anzug war durchnässt, trotzdem ging der Mann weiter. Was lehnte da an der Mauer? Eine Schaufel? Ja, genau.
Entlang des Gebäudes waren drei tiefe Löcher. Dort waren Sträucher ausgegraben worden, um neue zu pflanzen. Ein Arbeiter hatte offensichtlich seine Schaufel vergessen. Und noch mehr lag herum: eine orangefarbene Plane, lose zusammengelegt, darin ein rostiger Hammer, noch gut zu gebrauchen. Der Mann hob ihn auf und wog ihn in der Hand. Er hatte keine Waffe mitgenommen, denn er war stark, unglaublich stark. Er war überzeugt, jede Frau mit bloßen Händen überwältigen zu können. Mit dem Hammer könnte er ihr noch zusätzlich Angst einjagen. Besser auf Nummer sicher gehen.
Der Mann folgte dem Weg und bog um die Kurve. Vor Freude blieb ihm fast die Luft weg. Hier war gearbeitet worden: Abgestorbene Sträucher und Bäume lagen auf einem Haufen, ihre Wurzeln ragten wie Tentakel bis auf den Weg. Der Gartenabfall wurde hier gesammelt und abgeholt. Der Mann sah sich nach eventuellen Augen- und Ohrenzeugen um, las einen Stein auf und warf ihn gegen die Laterne. Das Glas zersplitterte. Weil es immer noch zu hell war, schleuderte er auch einen Stein gegen die nächste.
»Super«, flüsterte er. Jetzt hatte er eine unübersichtliche dunkle Ecke.
Unablässig musste er an die großen, tiefen Löcher denken, die jemand extra für ihn gegraben zu haben schien. Weitere befanden sich an der Südseite des Gebäudes, aber zwei grenzten an den Weg, vor ihnen standen neonbunte Warnkegel. Obwohl der Mann Handschuhe trug, rieb er sich die Handflächen an der Hose ab, als er sich hinter den stinkenden, verrottenden Gartenabfall kauerte. Seine Schuhe versanken im Boden. Vorsichtig legte er seine Aktentasche neben sich und atmete tief durch, um sich zu beruhigen.
Das Adrenalin schärfte seine Sinne, er reagierte sensibler auf die Umgebung, vernahm das kleinste Geräusch, roch den Moder.
Er hörte Schritte auf dem Pflaster, da kam jemand näher. Der Mann lächelte zufrieden. Jogger gehen bei jedem Wetter vor die Tür.
Er machte sich noch kleiner und spähte zwischen den Zweigen hindurch. Dann richtete er den Blick auf den hellen Lichtkegel unter der Laterne, den der Läufer passieren würde.
Genau. Es war tatsächlich eine Frau. Doch war sie die Richtige? War sie die eine, die Auserwählte? Er konnte ihr Gesicht nicht erkennen – sie hielt den Kopf gesenkt. Er sah ihren schlanken, athletischen Körper und ihr dichtes schwarzes Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Sie musste es sein. Er starrte auf ihre langen, straffen, wunderbaren Beine.
Der Mann schwang den Hammer wie einen Baseballschläger und setzte zum Sprung an.
Er wollte sie nicht töten. Er wollte sie nur betäuben. Zu spät merkte er, dass er etwas falsch gemacht hatte. Er hätte sie vorbeilaufen lassen und ihr dann von hinten auf den Kopf schlagen sollen. Stattdessen hatte er sich ihr übereifrig und unerfahren von vorn genähert. Sie wehrte sich heftig und zerkratzte ihm mit den Fingernägeln das Gesicht, als er versuchte, sie zu Boden zu werfen.
Er befreite sich, doch als er sie endlich anschaute, wurde ihm klar, dass sie ihn nun auch gesehen hatte. Er geriet in Panik, dann wurde er wütend.
Die Frau zog Pfefferspray aus der Tasche und schrie nach Leibeskräften. Er schlug mit dem Hammer zu, sie brach zusammen. Doch das war dem Dämon nicht genug. Wieder und wieder hieb der Mann auf sie ein, auf ihre Beine, ihre Knie, ihre Schenkel, ihre Knöchel.
Alles war voller Blut.
Er hatte Glück, weil der Regen stärker wurde. Der Mann reckte das Gesicht zum Himmel und ließ sich das Blut vom kalten Regen abwaschen. Dunkelrot lief es ihm in den Hemdkragen. Er bekam eine Gänsehaut und schloss die Augen, versuchte, zur Ruhe zu kommen.
Plötzlich fuhr er zusammen. Wie lange hatte er hier neben der Leiche gehockt und in den schwarzen Himmel gestarrt? Unzählige Menschen hätten vorbeikommen können!
Er schüttelte den Kopf. Er musste die Leiche verscharren.
Die Löcher, die tiefen Löcher neben dem Gebäude! Konnte er riskieren, die Tote dorthin zu tragen? Oder sollte er mit der Schaufel ein Loch unter dem Gartenabfall graben? Ja, das war besser. Aber nicht sofort. Behände schob er die Leiche unter das Geflecht aus Zweigen und Ästen und hockte sich neben die Schaufel, wartete. Als er nach Mitternacht sicher war, dass ihn niemand überraschen würde, bog er die Zweige zur Seite und hob eine Grube aus, so tief, dass die Leiche hineinpasste. Beim Transport verlor die Tote beide Schuhe und einen Strumpf. Er sammelte alles auf und warf es in das Loch. Dann drückte er die Tote hinein, schaufelte Erde darüber, klopfte alles fest und zog die verfaulten Zweige und die abgestorbenen Sträucher über die Beweise seiner Tat.
Nachdem er seine Fußspuren so gut wie möglich verwischt hatte, trat er ein paar Schritte zurück, um seine Arbeit zu begutachten. Erleichtert stellte er fest, dass der Regen das Blut bereits fortgespült hatte.
Als er wieder im Jeep saß, begann er zu zittern. Es gelang ihm kaum, den Schlüssel ins Zündschloss zu stecken, so erschöpft war er nach allem, was gerade geschehen war. Er beruhigte sich allmählich. Ein überwältigendes Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit durchströmte ihn. Er fühlte sich so wie früher nach dem Sex: glücklich, entspannt.
Und unschuldig. Das überraschte ihn ein wenig. Er hatte tatsächlich nicht die geringsten Schuldgefühle. Andererseits, warum sollte er auch? Die Frau hatte ihn ausgetrickst, und allein aus diesem Grund hatte sie den Tod verdient.
Bevor er in seine Straße einbog, schaltete er die Scheinwerfer aus, damit die aufdringliche, neugierige Nachbarin ihn nicht sah. Vor ein paar Wochen hatte er absichtlich die Garagenbeleuchtung abmontiert. Nun näherte er sich seinem Haus im Schneckentempo. Da war sie wieder, die Nachbarin, sie stand am Küchenfenster. Wie immer spionierte sie ihm nach.
Genau in dem Moment, als das Garagentor sich öffnete, verschwand sie. Diese Carolyn wurde langsam lästig. Zu blöd, dass sie nicht alleine lebte. Sie pflegte ihre Mutter. Man hätte meinen sollen, dass die alte Frau die Tochter auf Trab hielt, aber offenbar blieb ihr noch genug Zeit zum Naseplattdrücken. Carolyn war eine aufdringliche Wichtigtuerin. Ständig wollte sie vorbeikommen und Nina besuchen. Wenn das so weiterging, würde er sich etwas einfallen lassen müssen.
Nachdem er den Wagen in der Garage abgestellt hatte, nahm er eine Holzkiste vom Regal und packte den Hammer hinein. Dann leerte er seine Taschen aus. Das Pfefferspray und den Führerschein der Frau hatte er, ohne nachzudenken, eingesteckt. Beides legte er in die Kiste, dann schob er sie mit seiner Aktentasche in eine Ecke. Anschließend zog er sich aus und stopfte seine verdreckten Klamotten und Schuhe in die Mülltüte.
Er bemühte sich, leise zu ein. Um Nina nicht zu wecken, beschloss er, im Gästezimmer zu schlafen. Auf Zehenspitzen schlich er durchs Haus und die Treppe hinauf. Als er sein Gesicht im Badezimmerspiegel erblickte, stockte ihm der Atem. Vor Schreck wich er zurück. Was hatte diese Frau bloß mit ihm gemacht? Sein Gesicht sah aus, als sei er in einen Fleischwolf geraten. Hastig drehte er den Wasserhahn auf und tupfte das Blut vorsichtig mit einem kleinen Handtuch fort. Ihre Fingernägel hatten blutige Striemen auf seinen Wangen hinterlassen. Am Hals hatte er sogar einen langen Kratzer. Er fluchte und stellte sich unter die Dusche. Auch seine Arme waren arg lädiert.
Verdammt! Was war, wenn ihn jemand auf dem Rückweg gesehen hatte? Wie oft hatte er an roten Ampeln gehalten und nach rechts und links geschaut? Vielleicht hatte längst ein Autofahrer die Polizei angerufen und sein Kennzeichen durchgegeben.
Er begann, seinen Kopf gegen die Fliesen zu schlagen. Sie kriegen mich, sie kriegen mich. Was soll ich nur tun? Was wird aus Nina? Wer wird sich um sie kümmern? Muss sie zusehen, wie ich in Handschellen abgeführt werde? Der Gedanke war so demütigend, dass er ihn schnell wieder loswerden wollte. Und so tat er das, was er sich angewöhnt hatte, als Nina auf der Intensivstation lag: Er zwang sich, das Bild zu verdrängen, bis es verschwunden war.
Das ganze Wochenende verbrachte er zu Hause, saß wie angewurzelt vor dem Fernseher und wartete darauf, dass der Mord gemeldet wurde. Je länger nichts passierte, desto gelassener wurde er. Als die Tote am Dienstag immer noch nicht entdeckt worden war, betrachtete er sich als Glückspilz und fühlte sich ziemlich sicher.
Nicht schlecht, fand er. Für eine Generalprobe wirklich nicht übel.
Er hatte sich sogar eine einleuchtende Erklärung für die Kratzer ausgedacht: Er arbeitete immer viel im Garten. Der Boden sei vom Regen glitschig geworden; er sei ausgerutscht und in dornige Sträucher gefallen.
Am Mittwoch um vier Uhr rief ihn sein Abteilungsleiter, ein dämlicher Klugscheißer, zu sich ins Büro und sagte ihm, dass allen aufgefallen sei, wie hart er arbeite und wie fröhlich er in den letzten drei Tagen gewesen sei. Einer seiner Kollegen habe sogar erzählt, dass er einen Witz gemacht hätte! Er, sein Vorgesetzter, hoffe, dass er so weitermache mit dieser positiven, erfrischenden Einstellung.
Gerade wollte er das Büro verlassen, als sein Chef wissen wollte, wodurch diese Veränderung hervorgerufen worden sei. Der Frühling, erwiderte er. Er erzählte, dass er das schlechte Wetter ignoriere und gerade seinen gesamten Garten umgestalte. Es mache ihm viel Freude, mit dem Pflanzen würde er allerdings noch warten. Der Boden habe sich ja inzwischen aufgewärmt, er reiße alles heraus. Öfter mal was Neues! Er überlege sogar, eine Gartenlaube zu bauen.
»Passen Sie auf, wenn Sie die Sträucher rausreißen«, warnte der Klugscheißer. »Sie wollen doch nicht noch mal in die Dornen fallen und sich verletzen. Sie können von Glück sagen, dass die Kratzer sich nicht entzündet haben.«
Richtig. Er wollte auf keinen Fall neue Kratzer. Er hatte wirklich unheimlich Glück gehabt.
4
Die Woche verging wie im Fluge. Am Freitag hatte sich Regans Laune erheblich gebessert. Sie hatte die Papierberge abgearbeitet und konnte wieder das tun, was sie gern machte.
Nicht einmal die Begegnung mit Aidens Assistentin konnte ihr die Laune verderben. Regan eilte gerade durch den Flur zu ihrem Büro, als sie von Emily Milan gerufen wurde. Regan drehte sich um und wartete, bis Emily sie eingeholt hatte. Emily war ungefähr einen Kopf größer als Regan. Wenn sie hohe Absätze trug, überragte sie Regan um einiges. Sie hatte blondes, kurz geschnittenes Haar; fransige Strähnen umrahmten ihr hübsches Gesicht. Emily war stets nach der neuesten Mode gekleidet, vom engen Minirock bis zum grellbunten Schmuck.
Regan konnte Emily nicht leiden, doch sie bemühte sich, es sich nicht anmerken zu lassen und Privates von Beruflichem zu trennen. Aus irgendeinem Grund hatte Emily Regan gegenüber ebenfalls eine starke Abneigung entwickelt. In den vergangenen Monaten war ihre Feindseligkeit immer größer geworden; inzwischen trug sie sie öffentlich zur Schau.
»Aiden möchte, dass ich die Leitung der Konferenz heute Vormittag übernehme, für die ursprünglich Sie vorgesehen waren. Er will bestimmt sichergehen, dass alles glattläuft.«
Das war eine Beleidigung, eine ganz unverblümte. Regan rief sich in Erinnerung, warum es so wichtig war, mit dieser Frau auszukommen. So unangenehm Emily auch war, sie nahm Aiden einen Teil seiner vielen Pflichten ab, und das allein zählte.
»Ist gut«, antwortete Regan.
»Ich brauche die Notizen, die Aiden per E-Mail geschickt hat. Drucken Sie sie aus und schicken Sie Ihren Assistenten damit zu mir.«
Kein bitte oder danke, kein verbindliches Wort. Emily machte auf dem Absatz kehrt und stolzierte davon. Regan holte tief Luft und beschloss, sich den Tag nicht verderben zu lassen. Denk an etwas Schönes, befahl sie sich. Es dauerte eine Weile, doch schließlich fiel ihr etwas ein: Sie musste nicht mit Emily zusammenarbeiten. Das war besser als nichts.