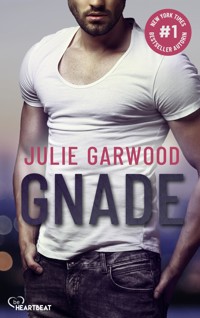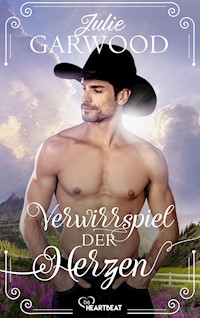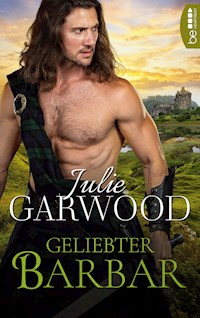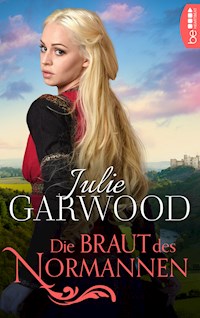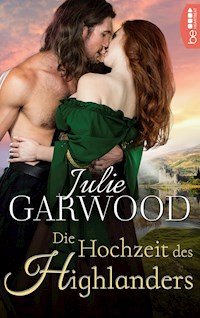4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nick Buchanan Family & Friends
- Sprache: Deutsch
Ein Moment der Unaufmerksamkeit kann sie alles kosten ...
Im stillen Dunkel des Beichtstuhls kniet der Mann nieder und schildert langsam seine mörderische Vergangenheit - wie er seine Opfer verfolgte, sich in ihre Leben schlich und sie dann in lodernder Wut bestialisch tötete. »Ich bin ein Herzensbrecher«, schließt er sanft, »und ich werde weiter sündigen.« Und dieses Mal verrät er den Namen seines nächsten Opfers: Laurant Madden.
FBI-Agent Nick Buchanan hat während seiner Laufbahn schon alles gesehen, aber dieser Fall erschüttert selbst ihn. Denn das auserkorene Opfer des psychopathischen Killers ist die Schwester seines besten Freundes. Die attraktive Laurant stellt sich zögernd unter den Schutz des FBI-Agenten. Für Nick beginnt eine komplizierte Verfolgungsjagd mit einem der hinterhältigsten Psychopathen seiner Laufbahn. Doch mit der wachsenden Gefahr wächst auch die Anziehungskraft zwischen Nick und Laurant und die beiden merken kaum, wie eng die Maschen des Grauens schon um sie gewoben sind ...
Spannung pur - die prickelnde Romantic Suspense Reihe um die Familie Buchanan und ihre Freunde von New York Times Bestsellerautorin Julie Garwood:
Band 1: Zum Sterben schön
Band 2: Gnade
Band 3: Ein mörderisches Geschäft
Band 4: Mord nach Liste
Band 5: Sanft sollst du brennen
Band 6: Schattentanz
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Im stillen Dunkel des Beichtstuhls kniet der Mann nieder und schildert langsam seine mörderische Vergangenheit – wie er seine Opfer verfolgte, sich in ihre Leben schlich und sie dann in lodernder Wut bestialisch tötete. »Ich bin ein Herzensbrecher«, schließt er sanft, »und ich werde weiter sündigen.« Und dieses Mal verrät er den Namen seines nächsten Opfers: Laurant Madden.
FBI-Agent Nick Buchanan hat während seiner Laufbahn schon alles gesehen, aber dieser Fall erschüttert selbst ihn. Denn das auserkorene Opfer des psychopathischen Killers ist die Schwester seines besten Freundes. Die attraktive Laurant stellt sich zögernd unter den Schutz des FBI-Agenten. Für Nick beginnt eine komplizierte Verfolgungsjagd mit einem der hinterhältigsten Psychopathen seiner Laufbahn. Doch mit der wachsenden Gefahr wächst auch die Anziehungskraft zwischen Nick und Laurant und die beiden merken kaum, wie eng die Maschen des Grauens schon um sie gewoben sind ...
Julie Garwood
Zum Sterben schön
Aus dem amerikanischen Englisch von Susanne Althoetmar-Smarczyk
1
Im Beichtstuhl war es heißer als in der Hölle. Ein dicker schwarzer Vorhang, staubig durch Alter und Vernachlässigung, bedeckte die schmale Öffnung von der Decke bis zum verschrammten Holzboden und sperrte gleichermaßen Tageslicht und Luft aus.
Es war wie in einem Sarg, den jemand gedankenlos gegen eine Wand gelehnt hatte. Pater Thomas Madden dankte Gott, dass er nicht unter Klaustrophobie litt. Er fühlte sich jedoch rasch elend. Die Luft war schwer und modrig, dass ihm das Atmen so schwer fiel wie damals auf der Penn State, als er beim Football den letzten Meter zu den Torpfosten lief, den Ball fest unter den Arm geklemmt. Damals hatte ihm der Schmerz in den Lungen nichts ausgemacht, und jetzt machte er ihm auch nichts aus. Das gehörte einfach zum Job.
Die alten Priester hätten ihm empfohlen, Gott sein Unbehagen als Gabe für die armen Seelen im Fegefeuer darzubieten. Tom sah darin nichts Schlimmes, fragte sich allerdings, wie sein eigenes Elend einen anderen von seinem erlösen konnte.
Zappelig wie ein Chorknabe in der Sonntagsmesse rutschte er auf dem harten Eichenstuhl hin und her. Er spürte, wie ihm der Schweiß über das Gesicht und den Hals in die Soutane tropfte. Die lange schwarze Robe war schweißdurchtränkt, und er bezweifelte ernsthaft, dass er auch nur ansatzweise nach Irischer Frühling roch, der Seife, mit der er sich heute Morgen geduscht hatte.
Die Außentemperatur schwankte zwischen vierunddreißig und fünfunddreißig Grad im Schatten des überdachten Portals des Pfarrhauses, wo ein Thermometer an die weiß getünchte Wand genagelt war. Die hohe Luftfeuchtigkeit machte die Hitze so drückend. Die unglücklichen Seelen, die gezwungen waren, ihre klimatisierten Häuser zu verlassen und sich nach draußen zu wagen, schlurften in gereizter Stimmung langsam umher.
Es war ein lausiger Tag zum Verrecken des Kompressors. Natürlich gab es Fenster in der Kirche, aber diejenigen, die man hätte öffnen können, waren vor langer Zeit in dem vergeblichen Bemühen, Vandalen draußen zu halten, fest vernagelt worden. Die beiden anderen befanden sich hoch oben in der vergoldeten Deckenwölbung. In Buntglasdarstellungen hielten die Erzengel Gabriel und Michael blitzende Schwerter in den Fäusten. Gabriel schaute mit glückseligem Gesichtsausdruck gen Himmel, während Michael finster auf die Schlangen hinabblickte, die er vor seinen nackten Füßen zu Boden presste. Die farbigen Fenster galten bei der Gemeinde als kostbare Kunstwerke, die zum Gebet inspirierten, aber bei der Bekämpfung der Hitze erwiesen sie sich als nutzlos. Man hatte sie zur Dekoration eingefügt, nicht zur Ventilation.
Tom war ein großer, kraftstrotzender Mann mit einem fünfundvierzig Zentimeter dicken Hals, eine Reminiszenz an seine glorreichen Tage als Sportler, aber er war mit einer Haut geschlagen, die empfindlich war wie die eines Babys. Die Hitze verursachte bei ihm einen juckenden Ausschlag. Er zog die Soutane hoch bis auf die Oberschenkel und enthüllte die gelben Boxershorts mit den Smileys darauf, die seine Schwester Laurant ihm geschenkt hatte, schleuderte die farbbespritzten Gummilatschen von Wal-Mart von den Füßen und steckte sich einen Kaugummi in den Mund.
Durch einen Akt der Freundlichkeit war er in diesem Schwitzkasten gelandet. Während er auf die Testergebnisse wartete, die entscheiden würden, ob er eine weitere Chemotherapie am Kansas University Medical Center benötigte, war er Gast von Monsignore McKindry, dem Pastor der Kirche »Our Lady of the Mercy«. Die Pfarrei lag in einem vergessenen Bezirk von Kansas City, etliche hundert Kilometer südlich von Holy Oaks, Iowa, wo Tom bei seinem Orden lebte. Die Gegend war von einer Spezialeinheit eines früheren Bürgermeisters zu einem Bezirk erklärt worden, der unter der Kontrolle von Streetgangs stand. Monsignore nahm immer samstagnachmittags die Beichte ab, aber wegen der glühenden Hitze, seines fortgeschrittenen Alters, der defekten Klimaanlage und kollidierender Termine – der Pastor bereitete sich gerade eifrig auf eine Wiedersehensfeier mit zwei Freunden aus dem Priesterseminar in Assumption Abbey vor – hatte Tom sich angeboten, diesen Dienst zu übernehmen. Er hatte angenommen, er würde dem reuigen Sünder von Angesicht zu Angesicht in einem Raum mit geöffneten Fenstern gegenübersitzen. McKindry beugte sich jedoch den Vorlieben seiner treuen Gemeindemitglieder, die sich stur an die altmodische Art des Beichtens klammerten – eine Tatsache, die Tom erst erfuhr, nachdem er seine Dienste bereits angeboten hatte. Lewis, der Küster der Gemeinde, hatte ihm den Weg gewiesen zu dem Glutofen, in dem er während der nächsten neunzig Minuten sitzen würde.
In Einschätzung der Lage hatte Monsignore ihm einen völlig unzulänglichen, batteriebetriebenen Ventilator geliehen, den einer aus seiner Herde in den Kollektenkorb gelegt hatte. Das Ding war nicht größer als die Handfläche eines Mannes. Tom stellte den Winkel des Ventilators so ein, dass die Luft ihm direkt ins Gesicht blies, lehnte sich zurück gegen die Wand und begann, die Holy-Oaks-Gazette zu lesen, die er nach Kansas City mitgebracht hatte.
Als Erstes wandte er sich den Gesellschaftsnachrichten auf der Rückseite zu, weil ihm das so viel Spaß machte. Er überflog die üblichen Clubneuigkeiten und die paar Anzeigen – zwei Geburten, drei Verlobungen, eine Hochzeit –, dann fand er seine Lieblingskolumne »About Town« – »Neues aus der Stadt«. Die Schlagzeile betraf immer das gleiche Thema: das Bingospiel. Die Anzahl der Leute, die am Bingoabend im Gemeindezentrum teilgenommen hatten, wurde ebenso angegeben wie die Gewinner der Fünfundzwanzig-Dollar-Jackpots. Interviews mit den glücklichen Empfängern folgten, in denen jeder von ihnen verriet, was er mit dem unverhofften Geldsegen zu tun gedachte. Nie fehlte ein Kommentar von Rabbi David Spears, der dieses wöchentliche Ereignis organisierte, wie gut sich alle amüsiert hatten. Tom hegte den Verdacht, dass die Redakteurin Lorna Hamburg insgeheim für Rabbi Dave, einen Witwer, schwärmte und deshalb das Bingospiel in der Zeitung so groß herausbrachte. Der Rabbi veranstaltete jede Woche das Gleiche, und Tom zog ihn unweigerlich deswegen auf, wenn sie mittwochnachmittags gemeinsam Golf spielten. Da Dave ihn gewöhnlich haushoch schlug, machte es ihm nichts aus, gehänselt zu werden, aber er beschuldigte Tom, seine Aufmerksamkeit von dessen entsetzlichem Spiel abzulenken.
Die restliche Kolumne widmete sich der Verbreitung von Informationen darüber, wer Gäste empfing und womit er sie fütterte. Sollten in einer Woche einmal nur schwer Informationen zu ergattern sein, füllte Lorna den Platz mit beliebten Rezepten.
In Holy Oaks gab es keine Geheimnisse. Die erste Seite widmete sich Marktplatz-Nachrichten über die vorgeschlagene Gestaltung des Stadtplatzes und die bevorstehende Hundertjahrfeier der Assumption Abbey. Und es wurde positiv erwähnt, wie engagiert seine Schwester in der Abtei aushalf. Der Reporter nannte sie eine unermüdliche und fröhliche Helferin und beschrieb in allen Einzelheiten, welche Projekte sie alle übernommen hatte. Sie plante nicht nur, das Durcheinander auf dem Dachboden zu lichten und aus diesen Beständen einen Flohmarkt zu organisieren, sie hatte auch vor, alle Informationen aus den staubigen alten Akten in einen neu gespendeten Computer zu übertragen. Und wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit blieben, übersetzte sie die französischen Tagebücher von Pater Henri VanKirk, einem kürzlich verstorbenen Priester. Tom lachte sich ins Fäustchen, als er dieses glühende Empfehlungsschreiben für seine Schwester zu Ende gelesen hatte. Tatsächlich hatte sich Laurant für keine dieser Aufgaben freiwillig gemeldet. Sie lief nur gerade zufällig in der Abtei herum, als er auf diese Ideen kam, und sie hatte auf Grund ihrer übertriebenen Gefälligkeit nicht abgelehnt.
Als Tom die restliche Gazette ausgelesen hatte, klebte sein durchweichter Kragen am Hals. Er legte die Zeitung auf den Sitz neben sich, wischte sich wieder über die Stirn und zog in Erwägung, fünfzehn Minuten früher Schluss zu machen.
Diesen Gedanken ließ er jedoch, sobald er ihm gekommen war, wieder fallen. Er wusste, dass er von Monsignore eins aufs Dach kriegen würde, wenn er den Beichtstuhl zu früh verließ. Und nach dem Tag harter körperlicher Arbeit, den er eingelegt hatte, fühlte er sich einer Gardinenpredigt einfach nicht gewachsen. Am ersten Mittwoch jedes dritten Monats – Aschermittwoch nannte er ihn insgeheim – zog Tom bei Monsignore McKindry ein, einem alten Iren mit gebrochener Nase und rissiger Haut, der nie eine Gelegenheit ausließ, so viel körperliche Arbeit wie möglich in sieben Tagen aus seinem Hausgast herauszupressen. McKindry war barsch und mürrisch, hatte aber ein goldenes Herz und eine mitfühlende Natur, der Sentimentalität jedoch fremd war. Er glaubte fest daran, dass Müßiggang aller Laster Anfang war, besonders wenn das Pfarrhaus dringend einen frischen Anstrich benötigte. Harte Arbeit könne alles heilen, selbst Krebs, lautete sein Dogma.
Manchmal fiel es Tom richtig schwer, sich daran zu erinnern, warum er den Monsignore so sehr mochte oder eine Art Verwandtschaft mit ihm empfand. Vielleicht lag es daran, dass sie beide etwas Irisches in sich hatten. Oder daran, dass die Philosophie des alten Mannes, einem Missgeschick keine Träne mehr hinterherzuweinen, ihn mehr Schicksalsschläge als Hiob hatte ertragen lassen. Toms Kampf war im Vergleich zu McKindrys Leben ein Kinderspiel.
Er würde tun, was immer er konnte, um McKindry seine Last zu erleichtern. Monsignore freute sich darauf, seine alten Freunde wiederzusehen. Einer von ihnen war Abt James Rockhill, Toms Ordensoberer in der Assumption Abbey, der andere, Vincent Moreno, ein Priester, den Tom nie kennen gelernt hatte. Weder Rockhill noch Moreno würden bei McKindry und Tom im Mercy House übernachten, weil sie die Annehmlichkeiten der Holy-Trinity-Gemeinde bei weitem bevorzugten – Luxusartikel, wie heißes Wasser, das länger als fünf Minuten vorhielt, und eine zentrale Klimaanlage. Die Dreifaltigkeitsgemeinde befand sich im Herzen einer Wohngegend, die auf der anderen Seite der Staatsgrenze zwischen Missouri und Kansas lag. McKindry nannte sie scherzend »Heilige Muttergottes des Luxus«, und nach der Anzahl der Designerautos zu urteilen, die jeden Sonntagmorgen auf dem Parkplatz der Kirche standen, traf diese Bezeichnung den Kern der Sache. Die meisten Gemeindemitglieder von Mercy besaßen überhaupt kein Auto und gingen zu Fuß zur Kirche.
Toms Magen begann zu knurren. Ihm war heiß, er fühlte sich klebrig und hatte Durst. Er sehnte sich nach einer Dusche und einem kalten Bud Light. Während der ganzen Zeit, in der er jetzt hier saß und wie ein Truthahn grillte, war kein Einziger zur Beichte gekommen. Vermutlich war jetzt außer Lewis, der sich gerne in der Garderobe hinter dem Vestibül versteckte und heimlich aus der Flasche in seinem Werkzeugkasten einen Schluck Whiskey kippte, überhaupt niemand in der Kirche. Tom warf einen prüfenden Blick auf seine Armbanduhr, sah, dass nur noch wenige Minuten verblieben waren, und entschied, dass er genug hatte. Er knipste das Licht über dem Beichtstuhl aus und griff gerade nach dem Vorhang, als er hörte, wie zischend die Luft aus der lederbezogenen Kniebank entwich, weil ein Gewicht darauf platziert wurde. Auf dieses Geräusch folgte ein diskretes Hüsteln aus der Kammer des Beichtenden neben ihm.
Sofort richtete Tom sich auf seinem Sitz auf, nahm den Kaugummi aus dem Mund, tat ihn in das Papierchen zurück, beugte den Kopf im Gebet und schob das Holzpaneel auf.
»Im Namen des Vaters und des Sohnes ...«, begann er leise, während er das Kreuzzeichen machte.
Etliche Sekunden verrannen in tiefem Schweigen. Entweder sammelte der Sünder sich oder nahm all seinen Mut zusammen, bevor er seine Missetaten beichtete. Tom rückte die Stola um seinen Hals zurecht und wartete weiter geduldig.
Der Duft von Calvin Kleins Obsession drang durch das Gitter, das sie trennte. Es war ein charakteristischer, schwerer, süßlicher Geruch. Tom erkannte ihn, weil seine Haushälterin in Rom ihm zu seinem letzten Geburtstag eine Flasche dieses Eau de Cologne geschenkt hatte. Ein wenig von dem Zeug reichte sehr lange, und der Sünder hatte es stark übertrieben. Der Beichtstuhl stank jetzt danach. Dieser Geruch in Verbindung mit Moder und Schweiß gab Tom das Gefühl, durch eine Plastiktüte zu atmen. Sein Magen machte einen Satz, und er zwang sich, nicht zu würgen.
»Sind Sie da, Pater?«
»Ich bin da«, flüsterte Tom. »Wenn Sie bereit sind, Ihre Sünden zu bekennen, können Sie anfangen.«
»Das ... fällt mir schwer. Meine letzte Beichte war vor einem Jahr. Mir wurde damals keine Absolution erteilt. Werden Sie mir jetzt die Absolution erteilen?«
Die Stimme erklang in einem seltsamen Singsang und hatte einen spöttischen Unterton, der Tom warnte. War dieser Fremde bloß nervös, weil so viel Zeit seit seiner letzten Beichte vergangen war, oder war er absichtlich respektlos?
»Ihnen wurde keine Absolution erteilt?«
»Nein, Pater. Ich erzürnte den Priester. Ich werde auch Sie erzürnen. Was ich Ihnen beichten werde, wird ... Sie schockieren. Dann werden Sie wütend werden wie der andere Priester.«
»Nichts, was Sie mir sagen werden, wird mich schockieren oder erzürnen«, versicherte Tom ihm.
»Haben Sie das alles schon einmal gehört? Ist es das, Pater?«
Bevor Tom antworten konnte, flüsterte der Beichtende: »Hasse die Sünde, aber nicht den Sünder.«
Der Spott hatte sich verstärkt. Tom erstarrte. »Möchten Sie gerne anfangen?«
»Ja«, erwiderte der Fremde. »Segnen Sie mich, Pater, denn ich werde sündigen.«
Verwirrt über das, was er gehört hatte, lehnte Tom sich dichter an das Gitter und bat den Mann, noch einmal zu beginnen.
»Segnen Sie mich, Pater, denn ich werde sündigen.«
»Sie möchten eine Sünde beichten, die Sie erst begehen wollen?«
»Ja.«
»Ist das ein Spiel oder –«
»Nein, nein«, entgegnete der Mann. »Mir ist es todernst. Werden Sie schon wütend?«
Ein Schwall von Gelächter, so misstönend wie eine Gewehrsalve mitten in der Nacht, drang durch das Gitter.
Tom bemühte sich, mit so neutraler Stimme wie möglich zu antworten: »Nein, ich bin nicht wütend, aber ich bin verwirrt. Bestimmt ist Ihnen klar, dass Ihnen keine Absolution erteilt werden kann für Sünden, die Sie erst noch planen. Vergebung wird denjenigen erteilt, die ihre Fehler erkannt haben, sie aufrichtig bereuen und bereit sind, ihre Sünde wieder gutzumachen.«
»Aber Vater, Sie wissen doch noch gar nicht, um welche Sünden es sich handelt. Wie können Sie mir da die Absolution verwehren?«
»Die Sünden zu benennen, ändert gar nichts.«
»Oh doch. Vor einem Jahr erzählte ich einem anderen Priester genau, was ich vorhatte, aber er glaubte mir nicht, bis es zu spät war. Machen Sie nicht den gleichen Fehler.«
»Woher wissen Sie, dass der Priester Ihnen nicht glaubte?«
»Er versuchte nicht, mich aufzuhalten. Daher weiß ich es.«
»Wie lange sind Sie schon katholisch?«
»Mein ganzes Leben lang.«
»Dann wissen Sie, dass ein Priester außerhalb des Beichtstuhls weder über die Sünde noch über den Sünder sprechen darf. Das Beichtgeheimnis ist heilig. Wie hätte dieser andere Priester Sie aufhalten können?«
»Er hätte einen Weg finden können. Ich habe damals noch ... geübt, und ich war vorsichtig. Es wäre einfach gewesen für ihn, mich aufzuhalten, deshalb ist es seine Schuld, nicht meine. Diesmal wird es nicht so einfach sein.«
Tom versuchte verzweifelt zu verstehen, was der Mann ihm sagte. Geübt? Was geübt? Und welche Sünde hätte der Priester verhindern können?
»Ich glaubte, ich könnte es beherrschen.«
»Was beherrschen?«
»Das Verlangen.«
»Welche Sünde haben Sie gebeichtet?«
»Sie hieß Millicent. Ein schöner, altmodischer Name, finden Sie nicht? Ihre Freunde nannten sie Millie, ich nicht. Mir gefiel Millicent viel besser. Natürlich war ich nicht, was man einen Freund nennen würde.«
Ein weiterer Schwall von Gelächter durchschnitt die stickige Luft. Auf Toms Stirn standen Schweißperlen, aber plötzlich wurde ihm kalt. Das war kein Witzbold. Er fürchtete sich vor dem, was er hören würde, dennoch war er gezwungen zu fragen.
»Was geschah mit Millicent?«
»Ich brach ihr das Herz.«
»Ich verstehe Sie nicht ...«
»Was glauben Sie, was mit ihr passiert ist?«, wollte der Mann mit deutlichen Anzeichen von Ungeduld wissen. »Ich brachte sie um. Es war eine Sauerei. Überall war Blut, ich war voll davon. Damals war ich noch schrecklich unerfahren. Ich hatte meine Technik noch nicht perfektioniert. Als ich zur Beichte ging, hatte ich sie noch nicht getötet. Ich befand mich noch im Planungsstadium, und der Priester hätte mich aufhalten können, aber er tat es nicht. Ich erzählte ihm, was ich vorhatte.«
»Aber wie hätte er Sie aufhalten können?«
»Durch Gebete«, antwortete er mit einem Achselzucken in der Stimme. »Ich bat ihn, für mich zu beten, aber er betete nicht eindringlich genug, oder? Ich tötete sie trotzdem. Eine Schande, wirklich. Sie war so ein hübsches kleines Ding ... viel hübscher als die anderen.«
Lieber Gott, es gab noch andere Frauen? Wie viele?
»Wie viele Verbrechen haben Sie –«
Der Fremde unterbrach ihn. »Sünden, Pater«, sagte er. »Ich beging Sünden, aber ich hätte vielleicht widerstehen können, wenn der Priester mir geholfen hätte. Er wollte mir nicht geben, was ich brauchte.«
»Was brauchten Sie denn?«
»Absolution und Anerkennung. Beides wurde mir verweigert.«
Plötzlich knallte der Fremde mit der Faust gegen das Gitter. Eine Wut, die direkt unter der Oberfläche geschwelt haben musste, brach sich mit voller Kraft Bahn, als er in allen grotesken Einzelheiten damit herausplatzte, was er der armen unschuldigen Millicent angetan hatte.
Von diesem Horror wurde Tom total überwältigt, ihm wurde schrecklich übel. Lieber Gott, was sollte er tun? Er hatte geprahlt, dass er nicht schockiert oder erzürnt sein würde, aber nichts hätte ihn auf diese Grausamkeiten vorbereiten können, die der Fremde ihm mit solchem Vergnügen beschrieb.
Hasse die Sünde, nicht den Sünder.
»Ich bin richtig auf den Geschmack gekommen«, flüsterte der Wahnsinnige.
»Wie viele andere Frauen haben Sie getötet?«
»Millicent war die erste. Ich schwärmte vorher auch für andere, und als sie mich enttäuschten, musste ich ihnen wehtun, aber ich tötete keine von ihnen. Nachdem ich Millicent kennen gelernt hatte, änderte sich alles. Ich beobachtete sie lange, und alles an ihr war ... perfekt.« Seine Stimme wurde zu einem wütenden Knurren, als er fortfuhr. »Aber sie betrog mich, genau wie die anderen. Sie glaubte, sie könnte mit anderen Männern ihre Spielchen treiben und ich würde es nicht merken. Ich konnte nicht zulassen, dass sie mich so quälte. Ich ließ es nicht zu«, korrigierte er sich. »Ich musste sie bestrafen.«
Er stieß einen lauten, übertriebenen Seufzer aus und gluckste dann in sich hinein. »Ich tötete die kleine Hure vor zwölf Monaten und vergrub sie ganz, ganz tief. Niemand wird sie je finden. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. No, Sir. Ich hatte ja keine Ahnung, wie aufregend es sein würde zu töten. Ich brachte Millicent dazu, mich um Gnade anzuflehen, und das tat sie. Bei Gott, das tat sie.« Er lachte. »Sie schrie wie ein Schwein, und ich liebte dieses Geräusch. Ich wurde so erregt, erregter als ich es mir je hätte vorstellen können, und deshalb musste ich sie dazu bringen, noch mehr zu schreien, nicht wahr? Als ich mit ihr fertig war, schäumte ich vor Freude über. Nun, Pater, werden Sie mich nicht fragen, ob mir meine Sünden leidtun?«, hänselte er ihn.
»Nein, Sie zeigen keine Reue.«
Ein erstickendes Schweigen erfüllte den Beichtstuhl. Und dann kehrte die Stimme, die wie eine Schlange zischte, zurück.
»Das Verlangen ist wiedergekommen.«
Tom bekam eine Gänsehaut. »Es gibt Leute, die –«
»Sie meinen, ich sollte eingesperrt werden? Ich bestrafe nur diejenigen, die mir wehtun. Sie sehen also, ich bin nicht schuldig. Aber Sie glauben, ich sei krank, nicht? Wir sind bei der Beichte, Pater. Sie müssen die Wahrheit sagen.«
»Ja, ich glaube, Sie sind krank.«
»Oh, ich finde nicht. Ich bin nur engagiert.«
»Es gibt Leute, die Ihnen helfen können.«
»Ich bin brillant, wissen Sie. Es wird nicht leicht sein, mich aufzuhalten. Ich studiere meine Klienten, bevor ich sie übernehme. Ich weiß alles über ihre Familien und Freunde. Alles. Ja, es wird sehr viel schwerer sein, mich jetzt aufzuhalten, aber diesmal habe ich beschlossen, es mir noch schwerer zu machen. Verstehen Sie? Ich will nicht sündigen. Ich will es wirklich nicht.« Die Singsangstimme war wieder da.
»Hören Sie zu«, bat Tom. »Verlassen Sie mit mir den Beichtstuhl, und wir setzen uns zusammen hin und sprechen das durch. Ich möchte Ihnen helfen, wenn Sie mich nur lassen.«
»Nein, ich brauchte früher Hilfe, und die wurde mir verweigert, erinnern Sie sich? Erteilen Sie mir Absolution.«
»Das werde ich nicht.«
Der Seufzer war lang. »Also gut«, sagte er. »Ich werde die Regeln diesmal ändern. Sie haben meine Erlaubnis, jedem, dem Sie wollen, davon zu erzählen. Sehen Sie, wie gefällig ich sein kann?«
»Es spielt keine Rolle, ob Sie mir die Erlaubnis geben, darüber zu sprechen oder nicht. Diese Unterhaltung bleibt vertraulich. Das Beichtgeheimnis muss gewahrt bleiben, um die Unbescholtenheit der Beichte zu schützen.«
»Ganz gleich, was ich beichte?«
»Ganz gleich, was Sie beichten.«
»Ich verlange, dass Sie es erzählen.«
»Sie können verlangen, was Sie wollen, das ändert nichts. Ich kann niemandem erzählen, was Sie mir gesagt haben. Ich werde es nicht tun.«
Ein Augenblick des Schweigens verstrich, dann begann der Fremde zu kichern. »Ein Priester mit Skrupeln. Wie außergewöhnlich. Was für ein Dilemma. Hmmm. Aber ärgern Sie sich nicht, Pater. Ich bin Ihnen zehn Schritte voraus. Yes, Sir.«
»Was sagen Sie da?«
»Ich habe eine neue Klientin übernommen.«
»Sie haben bereits Ihr nächstes –«
Der Verrückte schnitt ihm das Wort ab. »Ich habe die Behörden bereits benachrichtigt. Sie werden meinen Brief bald erhalten. Natürlich war das, bevor ich wusste, dass Sie sich so pedantisch an die Regeln halten. Dennoch war es sehr aufmerksam von mir, nicht wahr? Ich schickte Ihnen eine höfliche kleine Notiz, in der ich meine Absichten erklärte. Nur schade, dass ich vergaß, sie zu unterschreiben.«
»Nannten Sie ihnen den Namen der Person, der Sie Schaden zufügen wollen?«
»Schaden? Was für ein merkwürdiges Wort ist das für Mord, ich nannte ihren Namen.«
»Eine weitere Frau also?« Toms Stimme brach bei der Frage.
»Ich übernehme nur Frauen als Klienten.«
»Haben Sie in der Notiz erklärt, aus welchem Grund Sie diese Frau töten wollen?«
»Nein.«
»Haben Sie einen Grund dafür?«
»Ja.«
»Würden Sie ihn mir erklären?«
»Übung, Pater.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Übung macht den Meister«, sagte er. »Diese ist sogar etwas noch Besondereres als Millicent. Ich hülle mich in ihren Duft, ich liebe es, sie im Schlaf zu beobachten. Sie ist so schön. Fragen Sie mich, und nachdem ich Ihnen ihren Namen genannt habe, können Sie mir vergeben.«
»Ich werde Ihnen keine Absolution erteilen.«
»Wie geht es mit der Chemotherapie? Ist Ihnen übel? Haben Sie einen günstigen Befund erhalten?«
Toms Kopf fuhr herum. »Was?«, schrie er beinahe.
Der Verrückte lachte. »Ich sagte Ihnen doch, dass ich meine Klienten genau studiere, bevor ich sie übernehme. Man könnte sagen, ich pirsche mich an sie heran«, flüsterte er.
»Woher wussten Sie –«
»Oh Tommy, Sie sind so ein feiner Kerl. Haben Sie sich nicht gefragt, warum ich Ihnen den ganzen Weg bis hierher gefolgt bin, nur um Ihnen meine Sünden zu bekennen? Denken Sie auf dem Weg zurück in die Abtei darüber nach. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, nicht wahr?«
»Wer sind Sie?«
»Ich bin ein Herzensbrecher. Und ich liebe Herausforderungen so sehr. Machen Sie mir diese Aufgabe schwer. Die Polizei wird bald herkommen, um mit Ihnen zu reden. Und dann können Sie es jedem, dem Sie wollen, erzählen«, neckte er ihn. »Ich weiß auch, wen Sie als Erstes anrufen werden. Ihren Freund, das hohe Tier beim FBI. Sie werden Nick anrufen, nicht wahr? Ich hoffe sehr, das werden Sie tun. Und er wird angerannt kommen, um Ihnen zu helfen. Besser sagen Sie ihm, er soll sie mitnehmen und vor mir verstecken. Vielleicht kann ich ihr nicht folgen, und dann werde ich mich nach einer anderen umschauen. Zumindest werde ich es versuchen.«
»Woher wissen Sie –«
»Fragen Sie mich.«
»Was soll ich Sie fragen?«
»Ihren Namen«, wisperte der Verrückte. »Fragen Sie mich, wer meine Klientin ist.«
»Ich rate Ihnen dringend, sich helfen zu lassen«, begann Tom noch einmal. »Was Sie tun –«
»Fragen Sie mich. Fragen Sie mich. Fragen Sie mich.«
Tom schloss die Augen. »Ja. Wer ist sie?«
»Sie ist entzückend«, antwortete er. »So wunderschöne, volle Brüste und langes, dunkles Haar. Ihr vollkommener Körper hat keinen Makel, und ihr Gesicht ist wie das eines Engels, exquisit in jeder Hinsicht. Sie ist ... atemberaubend ..., aber ich habe vor, ihr den Atem zu rauben.«
»Sagen Sie mir ihren Namen«, verlangte Tom und betete zu Gott, dass genug Zeit blieb, zu der armen Frau zu gelangen, um sie zu beschützen.
»Laurant«, flüsterte die Schlange. »Ihr Name ist Laurant.«
Panik traf Tom wie eine Faust. »Meine Laurant?«
»Genau. Jetzt haben Sie's kapiert. Ich werde Ihre Schwester töten.«
2
Agent Nicholas Benjamin Buchanan wollte gerade einen lange überfälligen Urlaub antreten. In den vergangenen drei Jahren hatte er sich überhaupt nicht freigenommen, und das zeigte sich allmählich in seiner Einstellung – zumindest hatte sein Vorgesetzter, Dr. Peter Morganstern, ihm das gesagt, als er ihm befahl, einen Monat Auszeit zu nehmen. Er hatte Nick auch mitgeteilt, dass er ein wenig zu distanziert und zynisch würde, und tief im Inneren befürchtete Nick, dass er recht haben konnte.
Morganstern nannte die Dinge immer beim Namen. Nick bewunderte und respektierte ihn fast genauso wie seinen eigenen Vater, und deshalb stritt er sich kaum mit ihm. Sein Boss war unerschütterlich wie ein Fels. Er hätte nie mehr als zwei Wochen beim FBI überstanden, wenn er sein Verhalten von seinen Gefühlen hätte beherrschen lassen. Wenn er überhaupt irgendwelche Makel besaß, war das seine unerträgliche Fähigkeit, bis zur Erstarrung ruhig zu bleiben. Nichts brachte den Mann je aus der Fassung.
Die zwölf handverlesenen Agenten unter seiner direkten Aufsicht nannten ihn Valium-Pete – natürlich hinter seinem Rücken –, aber er kannte diesen Spitznamen und war darüber nicht beleidigt. Es ging das Gerücht, dass er tatsächlich gelacht haben soll, als er ihn zum ersten Mal hörte, und das war ein weiterer Grund, aus dem er so gut mit seinen Agenten klarkam. Er hatte es geschafft, sich seinen Sinn für Humor zu bewahren – keine geringe Leistung, wenn man bedachte, welche Abteilung er leitete. Seiner Meinung nach verlor er die Geduld, wenn er sich wiederholen musste, obwohl er seine von jahrelangem Zigarrenrauchen raue Stimme, ehrlich gesagt, nie auch nur um ein Dezibel anhob. Zum Teufel, vielleicht hatten die anderen Agenten recht. Vielleicht hatte Morganstern tatsächlich Valium im Blut.
Eines war gewiss. Seine Vorgesetzten erkannten einen Goldschatz, wenn sie ihn erblickten, und in den vierzehn Jahren seiner Arbeit für das FBI war er sechs Mal befördert worden. Dennoch ruhte er sich nie auf seinen Lorbeeren aus. Als er zum Leiter der »Fundbüro«-Abteilung bestellt wurde, widmete er sich der Aufgabe, ein äußerst effizientes Sonderdezernat zum Aufspüren vermisster Personen aufzubauen. Sobald er das bewerkstelligt hatte, wandte er seine Bemühungen einem spezifischeren Ziel zu. Er wollte eine Spezialeinheit schaffen, die sich mit den schwierigeren Fällen vermisster und entführter Kinder beschäftigte. Diese neue Einheit rechtfertigte er schriftlich und wendete dann beträchtliche Zeit auf, dafür zu werben. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit wedelte er dem Direktor mit seiner 233-seitigen Abhandlung unter der Nase herum.
Seine verbissene Entschlossenheit zahlte sich schließlich aus, und jetzt leitete er diese Eliteeinheit. Er durfte seine eigenen Männer rekrutieren, ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus allen Lebensbereichen. Jeder Mann musste zuerst das Trainingsprogramm der Akademie in Quantico durchlaufen und wurde dann Morganstern zu einem speziellen Test und Training geschickt. Nur sehr wenige standen dieses zermürbende Programm durch, aber diejenigen, die es schafften, waren außergewöhnlich. Man hatte gehört, wie Morganstern dem Direktor erzählte, er sei der festen Überzeugung, dass für ihn nur die Elite arbeite, und binnen eines Jahres überzeugte er alle ungläubigen Thomasse, dass er recht hatte. Zu dem Zeitpunkt überreichte er die Zügel des »Fundbüros« seinem Assistenten Frank O'Leary und widmete fortan seine Zeit und Aufmerksamkeit nur noch dieser hoch spezialisierten Truppe.
Sein Team war einmalig. Jeder Mann verfügte über ungewöhnliche Fähigkeiten, die vermissten Kinder aufzuspüren. Die zwölf Männer waren Jäger, die ständig in einem Rennen gegen die Zeit antraten, aber mit dem einen hehren Ziel, die Kinder zu finden und zu beschützen, bevor es zu spät war. Sie waren die größten Streiter für jedes Kind und die letzte Verteidigungslinie gegen die Mistkerle, die in der Dunkelheit lauerten.
Der Stress dieses Jobs würde bei durchschnittlichen Männern einen Herzstillstand auslösen, aber an diesen Männern war nichts durchschnittlich. Keiner von ihnen entsprach dem Profil eines typischen FBI-Agenten, aber Morganstern war auch kein typischer Führer. Schnell hatte er bewiesen, dass er mehr als fähig war, solch eine handverlesene Gruppe zu leiten. Die anderen Abteilungen nannten seine Agenten die Apostel, zweifelsohne weil es zwölf waren, aber Morganstern mochte den Spitznamen nicht, weil er eine Reihe von Erwartungen über ihn als deren Führer weckte, die er unmöglich erfüllen konnte. Seine Bescheidenheit war ein weiterer Grund, warum er so geachtet war. Seine Agenten wussten auch die Tatsache zu schätzen, dass er kein Boss war, der strikt auf die Dienstvorschriften pochte. Er ermutigte sie, ihren Job zu erledigen, ließ ihnen dabei weitgehend freie Hand und stärkte ihnen immer, wenn es nötig war, den Rücken. In vieler Hinsicht war er ihr größter Fürsprecher.
Ganz gewiss war niemand im FBI engagierter oder qualifizierter, denn Morganstern war ein staatlich geprüfter Psychiater. Vermutlich suchte er deshalb hin und wieder gerne eine offene Aussprache mit jedem seiner Agenten. Sie vor sich hinzusetzen und in ihre Köpfe zu schauen, berechtigte all die Zeit und Kosten seiner Harvard-Ausbildung. Dies war seine einzige seltsame Angewohnheit, mit der sich alle abfinden mussten und die sie alle hassten.
Er war jetzt in der Stimmung, über den Stark-Fall zu reden. Er war von D.C. nach Cincinnati geflogen und hatte Nick gebeten, auf dem Weg zurück von einem Seminar in San Francisco eine Zwischenstation einzulegen. Nick wollte den Stark-Fall nicht diskutieren – er hatte sich vor über einem Monat ereignet, und am liebsten hätte er nicht einmal daran gedacht, aber das zählte nicht. Er wusste, dass er darüber reden musste, ob er wollte oder nicht.
Er wartete im Regionalbüro auf seinen Vorgesetzten, dann setzte er sich ihm gegenüber an den polierten Konferenztisch aus Eiche und hörte zwanzig Minuten zu, während Morganstern einige Einzelheiten des bizarren Falls Revue passieren ließ. Nick blieb ruhig, bis Morganstern ihm mitteilte, dass er eine Belobigung für seinen heroischen Einsatz erhalten werde. Da verlor er beinahe die Beherrschung, aber er war ein Meister darin, seine wahren Gefühle zu verbergen. Selbst sein Boss, der stets ein waches Auge aufhielt nach verräterischen Zeichen eines Burnout- oder Stress-Syndroms, ließ sich täuschen und glaubte, er werde wieder einmal gut mit allem fertig – zumindest dachte Nick das.
Als die Besprechung zu Ende ging, starrte Morganstern eine lange, schweigende Minute in die stahlblauen Augen seines Agenten und fragte ihn dann: »Was empfanden Sie, als Sie sie erschossen?«
»Ist das nötig, Sir? Das passierte vor über einem Monat. Müssen wir das wirklich noch einmal aufwärmen?«
»Das ist keine offizielle Konferenz, Nick. Nur Sie und ich sind hier. Sie müssen mich nicht Sir nennen, und ja, ich finde es notwendig. Jetzt antworten Sie mir bitte. Was empfanden Sie?«
Er wand sich auf seinem Stuhl wie ein kleiner Junge, der gezwungen wird, eine Missetat zu gestehen. »Was zum Teufel meinen Sie mit ›Was empfand ich‹?«
Sein Vorgesetzter ignorierte diesen Wutausbruch einfach und wiederholte die Frage ruhig zum dritten Mal. »Sie wissen, was ich Sie frage? Was empfanden Sie genau in jener Sekunde? Erinnern Sie sich?«
Er bot ihm einen Ausweg. Nick wusste, dass er lügen und sagen konnte, nein, er erinnere sich nicht, dass er in jenem Augenblick zu beschäftigt gewesen sei, um darüber nachzudenken, was er fühlte. Aber er und Morganstern waren stets aufrichtig zueinander gewesen, und das wollte er jetzt nicht aufs Spiel setzen. Außerdem war er sich ziemlich sicher, dass sein Boss merken würde, wenn er log. Als er erkannte, wie vergeblich es war, weiter auszuweichen, gab er auf und entschloss sich, unverblümt mit der Wahrheit herauszurücken. »Ja, ich erinnere mich. Es war ein gutes Gefühl«, flüsterte er. »Ein wirklich gutes Gefühl. Zum Teufel, Pete, ich befand mich in einer Euphorie. Wenn ich mich nicht umgedreht hätte und zurück ins Haus gegangen wäre, wenn ich auch nur dreißig Sekunden länger gezögert hätte, und wenn ich meine Waffe nicht gezogen hätte, wäre alles vorbei gewesen, und dieser kleine Junge wäre tot gewesen. Diesmal stand es zu sehr auf des Messers Schneide.«
»Aber Sie sind rechtzeitig zu dem Kind gekommen.«
»Ich hätte es früher kapieren müssen.«
Morganstern seufzte. Von all seinen Agenten war Nick stets der selbstkritischste gewesen. »Sie waren der Einzige, der es kapiert hat«, erinnerte er ihn. »Seien Sie nicht so hart mit sich selbst.«
»Haben Sie die Zeitungen gelesen? Die Reporter schrieben, sie sei verrückt gewesen, aber sie hatten nicht diesen Ausdruck in ihren Augen gesehen. Ich schon, und ich sage Ihnen, sie war überhaupt nicht verrückt. Sie war abgrundtief böse.«
»Ja, ich habe die Zeitungen gelesen; Sie haben recht, sie bezeichneten sie als verrückt. Das hatte ich erwartet«, fügte er hinzu. »Ich verstehe auch, warum, und das tun Sie, glaube ich, ebenso. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die Öffentlichkeit sich ein so abscheuliches Verbrechen erklären kann. Sie will glauben, dass nur ein geisteskranker Mensch einem anderen Menschen solch obszöne Dinge antun und nur ein Verrückter Vergnügen am Töten Unschuldiger haben kann. Eine Menge von ihnen sind verrückt, aber manche auch nicht. Es gibt das Böse. Wir haben es beide gesehen. Irgendwann traf diese Stark die bewusste Entscheidung, die Linie zu überschreiten.«
»Die Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen.«
»Ja«, stimmte Morganstern ihm zu. »Es gibt aber auch einen großen Prozentsatz von Akademikern, die nicht glauben wollen, dass das Böse existiert. Wenn sie mit ihrem beschränkten Verstand etwas nicht begründen oder erklären können, dann kann es einfach nicht sein. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum unsere Kultur solch einen fruchtbaren Boden für Menschen bildet. Manche meiner Kollegen glauben, sie könnten alles mit einer langatmigen Diagnose und ein paar bewusstseinsverändernden Drogen reparieren.«
»Ich hörte, dass einer Ihrer Kollegen die Ansicht vertritt, Starks Ehemann hätte sie kontrolliert, und sie hätte so panische Angst vor ihm gehabt, dass sie durchknallte. Mit anderen Worten, sie sollte uns leidtun.«
»Ja, das habe ich auch gehört. So ein Blödsinn. Die Stark war genauso verderbt wie ihr Mann. Auf den Pornovideos waren ebenso ihre Fingerabdrücke wie seine. Sie war eine bereitwillige Mittäterin, aber ich glaube, sie war dabei zusammenzubrechen. Sie hatten noch nie vorher Kindern nachgestellt.«
»Ganz ehrlich, Pete, sie hat mich angelächelt. Den Jungen hielt sie im Arm und über ihm schwang sie ein Fleischermesser. Er war bewusstlos, aber ich konnte sehen, dass er noch atmete. Sie wartete auf mich. Sie wusste, dass ich alles herausgefunden hatte, und wollte wohl, dass ich zusah, wie sie ihn umbrachte.« Er machte eine Pause und nickte. »Ja, es war ein gutes Gefühl, sie wegzupusten. Es tut mir nur leid, dass ihr Mann nicht da war. Ihn hätte ich auch gerne erwischt. Gibt es schon irgendwelche Spuren? Ich finde immer noch, Sie sollten unseren Freund Noah auf ihn ansetzen.«
»Genau das habe ich in Erwägung gezogen, aber sie wollen Donald Stark lebend ergreifen, damit sie ihn befragen können, und sie wissen, dass Noah keinen Moment zögern würde, Stark zu erschießen, wenn er ihm irgendwelche Schwierigkeiten macht.«
»Einen Kakerlak tötet man, Pete, man domestiziert ihn nicht. Noah hat genau die richtige Vorstellung davon.« Er ließ seine Schultern kreisen, um die verkrampften Muskeln zu dehnen, rieb sich mit der Hand das Genick und stellte dann fest: »Ich glaube, ich sollte mal wieder Urlaub machen.«
»Warum sagen Sie das?«
»Ich habe das Gefühl, ich bin sonst total ausgebrannt. Stimmt das?«
Morganstern schüttelte den Kopf. »Nein, Sie sind nur ein wenig erschöpft, das ist alles. Von dieser Unterhaltung fließt nichts in meinen Bericht ein. Es war mir ernst damit, als ich sagte, es bliebe zwischen Ihnen und mir. Sie sind schon lange überfällig für einen Urlaub, aber das ist meine Schuld, nicht Ihre. Ich möchte, dass Sie sich jetzt einen Monat freinehmen und wieder zu sich selbst finden.«
Ein Anflug eines Lächelns milderte Nicks düsteren Gesichtsausdruck. »Sich selbst finden?«
»Sich abkühlen«, erklärte er. »Oder es zumindest versuchen. Wann waren Sie zum letzten Mal oben in Nathan's Bay bei Ihrer Riesenfamilie?«
»Ist schon eine Weile her«, gestand Nick. »Ich bleibe über E-Mail mit ihnen in Verbindung. Alle sind genauso beschäftigt wie ich.«
»Fahren Sie nach Hause«, riet er. »Das wird Ihnen guttun. Ihre Familie wird sich freuen, Sie wiederzusehen. Wie geht es dem Richter?«
»Dad geht's gut«, antwortete Nick.
»Und wie geht es Ihrem Freund Pater Madden?«
»Ich unterhalte mich jeden Abend mit Tommy.«
»Per E-Mail?«
»Ja.«
»Vielleicht sollten Sie ihn besuchen und diese Gespräche von Angesicht zu Angesicht führen.«
»Glauben Sie, ich brauche ein wenig geistliche Führung?«, fragte Nick lächelnd.
»Ich glaube, Sie brauchen eine kleine Tochter.«
»Ja, vermutlich«, stimmte er zu. Dann wurde er wieder ernst und sagte: »Pete, was meine Instinkte betrifft. Glauben Sie, ich verliere den Biss?«
Morganstern zog ein spöttisches Gesicht angesichts dieser Vorstellung. »Ihre Instinkte könnten nicht besser sein. Diese Stark hat alle außer Ihnen zum Narren gehalten. Alle«, betonte er noch einmal. »Ihre Verwandten, ihre Freunde und Nachbarn, ihre Kirchengemeinde. Sie hat sie allerdings nicht zum Narren gehalten. Bestimmt hätten die örtlichen Behörden es schließlich herausgefunden, aber dann wäre der kleine Junge längst tot und begraben gewesen. Und sie hätte sich einen anderen geschnappt. Sie wissen genauso gut wie ich, dass sie nicht aufhören, sobald sie einmal angefangen haben.«
Pete klopfte auf den dicken Aktenordner. »In den Befragungen habe ich gelesen, wie sie tagein, tagaus bei der armen Mutter gesessen und sie getröstet hat. Sie war im Trauerkomitee ihrer Kirche«, fügte er kopfschüttelnd hinzu. Er sah aus, als sei sogar er, der so etwas alles schon gesehen und gehört hatte, über die Bosheit dieser Stark schockiert.
»Die Polizei hat mit jedem Einzelnen aus dieser Kirchengemeinde gesprochen, und sie konnte nichts finden«, sagte Nick. »Sie leistete wirklich gründliche Arbeit. Aber es handelt sich um ein winziges Nest, und der Sheriff wusste nicht, was er suchen sollte.«
»Er war clever genug, nicht zu warten. Er rief uns sofort hinzu«, sagte Morganstern. »Er und die anderen Ortsansässigen waren überzeugt, dass ein Durchreisender den Jungen mitgenommen hatte, nicht wahr? Und darauf konzentrierten sich all ihre Bemühungen.«
»Ja«, stimmte Nick zu. »Es fällt schwer zu glauben, dass einer deiner eigenen Leute so etwas tun könnte. Es gab einige Zeugen, die einen Vagabunden gesehen hatten, der vor dem Schulhof herumlungerte, aber ihre Beschreibungen stimmten nicht überein. Das Team aus Cincinnati war unterwegs«, fügte er hinzu. »Und die hätten ihr Spiel schnell durchschaut.«
»Was genau hat Ihnen einen Hinweis gegeben? Woher wussten Sie es?«
»Kleinigkeiten, die unstimmig waren«, erwiderte er. »Ich kann nicht erklären, was mich an ihr gestört hat oder warum ich beschloss, ihr nach Hause zu folgen.«
»Ich kann es erklären. Instinkt.«
»Vermutlich«, stimmte er zu. »Ich wusste, dass ich sie einmal gründlich überprüfen musste. Irgendetwas stimmte nicht, aber ich konnte meinen Finger nicht darauf legen. Ich hatte bei ihr so ein seltsames Gefühl in den Eingeweiden, und das wurde noch stärker, als ich ihr Haus betrat ... wissen Sie, was ich meine?«
»Erklären Sie es. Wie war das Haus?«
»Makellos. Nirgends ein Stäubchen oder ein Schmutzfleck zu sehen. Das Wohnzimmer war klein – ein paar Sessel, Sofa, Fernseher –, aber wissen Sie, was seltsam war, Pete? An den Wänden hingen weder Bilder noch Familienfotos. Ja, ich erinnere mich, dass ich das wirklich seltsam fand. Auf den Möbeln hatte sie Plastikschonbezüge. Vermutlich haben eine Menge Leute das. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war, wie gesagt, alles makellos, aber es roch seltsam.«
»Was für eine Art Geruch war das?«
»Essig ... und Ammoniak. Der Geruch war so stechend, dass mir die Augen brannten. Ich hielt sie einfach für einen zwanghaften Putzteufel ... und dann folgte ich ihr in die Küche. Sie war blitzsauber. Nichts stand auf den Arbeitsplatten herum, kein Küchentuch auf der Spüle, überhaupt nichts. Sie bat mich, Platz zu nehmen, während sie uns eine Tasse Kaffee zurechtmachte. Und dann fiel mir das Zeug auf dem Tisch auf. Dort standen Salz- und Pfefferstreuer, aber dazwischen eine riesige Plastikdose mit rosa Tabletten gegen Magensäure und daneben eine große Flasche Chilisauce. Ich fand das verdammt merkwürdig ... und dann sah ich den Hund. Das Tier gab den Ausschlag. Es war ein schwarzer Cockerspaniel, der in der Ecke neben der Hintertür saß. Er ließ den Blick nie von ihr. Sie stellte einen Teller mit Chocolate-Chip-Keksen auf den Tisch; und als sie mir den Rücken zukehrte, um den Kaffee zu holen, nahm ich einen von den Keksen und legte ihn neben mich hin, um zu sehen, ob der Hund kam und ihn sich holte, aber er schaute mich nicht einmal an. Zum Teufel, er hatte zu viel Angst, um auch nur mit den Wimpern zu zucken, und beobachtete jede Bewegung von ihr. Hätte der Sheriff sie zusammen mit dem Hund gesehen, hätte er gewusst, dass etwas nicht stimmte. Aber als er sie befragte, war der Spaniel draußen.«
»Er ging in ihr Haus, und ihm fiel nichts Ungewöhnliches auf.«
»Ich hatte Glück, denn sie war arrogant und leichtsinnig.
»Was veranlasste Sie, noch einmal hineinzugehen, nachdem Sie ihr Haus verlassen hatten?«
»Ich wollte mir Verstärkung besorgen und abwarten, wohin sie ging, aber sobald ich draußen war, wusste ich, dass ich wieder hineingehen musste, und zwar schnell. Ich hatte so ein Gefühl, dass sie wusste, ich war über sie im Bilde. Und ich wusste auch, der Junge war irgendwo in dem Haus.«
»Ihre Instinkte könnten nicht besser geeicht sein«, sagte Morganstern. »Deshalb war ich hinter Ihnen her, wissen Sie.«
»Ich weiß. Dieses berüchtigte Footballspiel.«
Morganstern lächelte. »Ich habe es erst vor ein paar Wochen bei CNN Sports noch einmal gesehen. Sie wiederholen diesen Ausschnitt mindestens zwei Mal im Jahr.«
»Ich wünschte, sie würden ihm einmal eine Pause gönnen. Das ist doch Schnee von gestern.«
Die beiden Männer erhoben sich. Nick überragte seinen Boss. Morganstern war in seinen mit Bommeln verzierten schwarzen Lederslippers einen Meter zweiundsiebzig groß, Nick dagegen gut zehn Zentimeter größer. Sein Boss war von schlanker Statur mit schütter werdendem blondem Haar, das rasch ergraute. Seine dicke Bifokalbrille rutschte ihm ständig von der schmalen Nase. Er trug immer einen konservativen schwarzen oder marineblauen Anzug mit einem langärmeligen, weißen gestärkten Hemd und einer gedeckten Streifenkrawatte. Auf einen oberflächlichen Beobachter wirkte Morganstern wie ein vertrottelter Universitätsprofessor, aber für die Agenten, die seiner Aufsicht unterstanden, war er in jeder Hinsicht ein Riese, der seinen üblen Job mit ruhiger Gelassenheit erledigte und dem grauenhaften Druck unerschüttert standhielt.
»In einem Monat sehen wir uns wieder, Nick, aber keinen Tag früher. Einverstanden?«
»Einverstanden.«
Sein Vorgesetzter ging zur Tür, hielt dann aber inne. »Wird Ihnen immer noch jedes Mal übel, wenn Sie ein Flugzeug besteigen?«
»Gibt es irgendetwas, das Sie nicht über mich wissen?«
»Ich glaube nicht.«
»Tatsächlich? Wann wurde ich das letzte Mal flachgelegt?«
Morganstern tat so, als schockierte ihn die Frage. »Das ist schon eine ganze Weile her, Agent. Offensichtlich haben Sie gerade eine Durststrecke.«
Nick lachte. »Stimmt das?«
»Bald werden Sie die richtige Frau kennen lernen, Gott steh ihr bei.«
»Ich suche nicht nach der richtigen Frau.«
Morganstern lächelte väterlich. »Das ist genau die richtige Voraussetzung, um sie zu finden. Sie suchen nicht nach ihr, und sie erwischt Sie völlig unerwartet, so wie meine Katie mich erwischt hat. Mir blieb keine Chance, und ich sage Ihnen vorher, dass es Ihnen ebenso ergehen wird. Sie ist irgendwo dort draußen und wartet nur auf Sie.«
»Dann wird sie verdammt lange warten müssen«, erwiderte er. »In unserem Metier ist eine Ehe ausgeschlossen.«
»Katie und ich schaffen es seit über zwanzig Jahren.«
»Katie ist eine Heilige.«
»Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Stimmt es?«
»Dass mir jedes Mal schlecht wird, wenn ich ein Flugzeug besteige? Ja, zum Teufel.«
Morganstern gluckste in sich hinein. »Dann viel Glück auf dem Heimweg.«
»Wissen Sie, Pete, die meisten Psychiater würden versuchen, meiner Phobie auf den Grund zu gehen, aber Ihnen macht das Spaß, nicht?«
Er griente breit. »Bis in einem Monat«, wiederholte er, während er aus dem Büro schlenderte.
Nick raffte seine Akten zusammen, erledigte ein paar notwendige Anrufe bei seinem Büro in Boston und bei Frank O'Leary in Quantico, dann ließ er sich von einem der örtlichen Beamten zum Flughafen bringen. Da es kein Entrinnen von diesem Zwangsurlaub gab, schmiedete er zögerlich einige Pläne. Er wollte wirklich versuchen, kürzerzutreten und sich zu entspannen, vielleicht mit seinem ältesten Bruder Theo segeln gehen, wenn er ihn für einige Tage von seinem Job loseisen konnte, und dann würde er quer durch das Land bis nach Holy Oaks fahren, um seinen besten Freund Tommy zu besuchen und ernsthaft mit ihm fischen zu gehen. Morganstern hatte die Beförderung, die O'Leary ihm vor zwei Wochen auf den Tisch geworfen hatte, nicht erwähnt. Nick plante, in den Ferien die Vor- und Nachteile des neuen Jobs abzuwägen. Er zählte darauf, dass Tommy ihm bei der Entscheidung helfen würde. Er stand ihm näher als seine eigenen fünf Brüder, und ihm vertraute er bedingungslos. Sein Freund würde wie gewohnt die Rolle des Advocatus Diaboli spielen, und wenn Nick an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte, wäre er sich hoffentlich im Klaren darüber, was er tun wollte.
Er wusste, dass Tommy sich Sorgen um ihn machte. Seit sechs Monaten quengelte er per E-Mail, dass er kommen und ihn besuchen sollte. Genau wie Morganstern verstand er, welchen Belastungen und Albträumen Nick in seinem Beruf ausgesetzt war, und er war ebenfalls der Ansicht, dass Nick Zeit zum Ausspannen brauchte.
Tommy focht selbst auch einen Kampf: Alle drei Monate, wenn er im Kansas Medical Center bestimmten Tests unterzogen wurde, hatte Nick ein mulmiges Gefühl in der Magengrube, bis Tommy ihm eine E-Mail mit guten Nachrichten schickte. Bis jetzt hatte sein Freund Glück gehabt. Der Krebs hatte eingedämmt werden können. Aber er lag ständig auf der Lauer, bereit zuzuschlagen. Tommy hatte es gelernt, mit seiner Krankheit fertigzuwerden. Nick nicht. Wenn er seinem Freund die Schmerzen und das Leiden hätte abnehmen können, hätte er bereitwillig dafür seinen rechten Arm geopfert, aber so funktionierte das nicht. Wie Tommy gesagt hatte, war das ein Krieg, den er alleine bestehen musste, und alles, was Nick tun konnte, war, da zu sein, wenn er ihn brauchte.
Plötzlich war Nick begierig darauf, seinen Freund wiederzusehen. Vielleicht konnte er ihn sogar dazu überreden, für einen Abend seinen Priesterkragen abzulegen und sich mit ihm sternhagelvoll laufen zu lassen, wie sie es getan hatten, als sie Zimmergenossen an der Penn State University gewesen waren.
Und er würde endlich Tommys einziges Familienmitglied kennen lernen, seine kleine Schwester Laurant. Sie war acht Jahre jünger als ihr Bruder und bei Nonnen in einem Internat für reiche Mädchen in den Bergen in der Nähe von Genf aufgewachsen. Tommy hatte mehrere Male versucht, sie nach Amerika zu bringen, aber die Bestimmungen ihres Treuhandvermögens und die Anwälte, die dieses Geld verwalteten, überzeugten die Richter, sie so lange weltabgeschieden leben zu lassen, bis sie alt genug war, eigene Entscheidungen zu treffen. Tommy hatte Nick erzählt, dass es nicht so bitter war, wie sich das anhörte, und dass die Anwälte, indem sie die Bestimmungen buchstabengetreu befolgten, ihren Besitz nur schützten.
Laurant, jetzt seit einiger Zeit großjährig, war vor einem Jahr nach Holy Oaks gezogen, um nahe bei ihrem Bruder zu sein. Nick hatte sie nie persönlich gesehen, aber er erinnerte sich an die Fotos von ihr, die Tommy hinter seinen Spiegel gesteckt hatte. Sie sah aus wie eine freche Kröte von der Straße, ein schmuddeliges Kind in einem schwarzen Faltenrock und einer weißen Uniformbluse, die teilweise aus dem Rockbund heraushing. Einer ihrer Kniestrümpfe ringelte sich um ihr Fußgelenk. Sie hatte aufgeschlagene Knie und langes, lockiges braunes Haar, das über ein Auge fiel. Er und Tommy hatten beide darüber gelacht, als sie das Foto betrachteten. Laurant konnte nicht älter als sieben oder acht Jahre gewesen sein, als das Foto gemacht wurde, aber Nick war ihr fröhliches Lachen und das mutwillige Funkeln in ihren Augen im Gedächtnis haften geblieben – ein Hinweis darauf, dass die ständigen Klagen der Nonnen berechtigt waren. Sie sah aus, als hätte sie den Teufel im Leib und eine Lebensfreude, die sie eines Tages bestimmt in Schwierigkeiten bringen würde.
Ja, ein Urlaub war genau, was er brauchte. Entscheidend für all seine Pläne war, an seinen Heimatstützpunkt nach Boston zurückzukehren, und das bedeutete, er musste zuerst dieses verdammte Flugzeug besteigen. Niemand hasste das Fliegen so sehr wie Nick. Es ängstigte ihn zu Tode. Sobald er den Flughafen von Cincinnati betrat, brach ihm der kalte Schweiß aus, und er wusste, dass er im Gesicht ganz grün war, wenn er das Flugzeug bestieg. Die 777 nach London machte einen kurzen Zwischenstopp in Boston, wo Nick Gott sei Dank aussteigen und in sein Stadthaus in Beacon Hill heimkehren würde. Er hatte das Haus vor drei Jahren von seinem Onkel gekauft, aber die meisten Kisten, die die Umzugsleute mitten im Wohnzimmer fallen gelassen hatten, nach wie vor nicht ausgepackt und auch die Hightech-Stereoanlage, die sein jüngster Bruder Zachary für ihn ausgesucht hatte, immer noch nicht aufgebaut.
Er spürte, wie sich ihm der Magen zusammenzog, als er auf den Check-in zusteuerte. Er kannte die Prozedur: Er präsentierte sich, seinen Ausweis und seine Abfertigungspapiere dem Sicherheitsoffizier. Ein pedantischer Mann mittleren Alters namens Johnson kaute auf seiner bleistiftdünnen Oberlippe, bis sein Computer Nicks Namen und die Bestätigung seines Codes ausspuckte. Dann eskortierte er Nick um den Metalldetektor herum, durch den die anderen Passagiere gehen mussten, händigte ihm seine Bordkarte aus und winkte ihn die Rampe hinunter.
Captain James T. Sorensky erwartete ihn in der Bordküche. In den letzten drei Jahren war Nick mindestens sechs Mal mit dem Kapitän geflogen und wusste, dass der Mann ein ausgezeichneter Pilot war und peinlich genau in seinem Job. Nick hatte einen Hintergrundcheck des Kapitäns durchführen lassen, nur um sicherzugehen, dass nichts Verdächtiges in seiner Vergangenheit darauf hinwies, er könne während des Fluges einen Nervenzusammenbruch erleiden. Er wusste sogar, welche Zahnpastamarke der Mann bevorzugte, aber keine dieser Tatsachen ließ seine Nervosität abklingen. Sorensky hatte als Bester seines Ausbildungsjahrgangs die Air Force Academy absolviert und arbeitete seit mittlerweile achtzehn Jahren bei Delta Airlines. Sein Ruf war makellos, aber auch das spielte keine Rolle. Nicks Magen schlug Purzelbäume. Er hasste alles am Fliegen. Alles lief auf eine Frage des Vertrauens hinaus, und obwohl Sorensky kein völlig Fremder war – mittlerweile duzten sie sich –, gefiel es Nick nicht, gezwungen zu sein, ihm zu vertrauen, dass er fast 159 Tonnen Stahl in der Luft hielt.
Sorensky hätte Modell stehen können für ein Werbeplakat der Luftfahrtgesellschaft mit seinem silberdurchwirkten, makellos geschnittenen Haar, der perfekt gebügelten marineblauen Uniform mit den rasiermesserscharfen Bügelfalten und der hochgewachsenen, schlanken Figur. Nick war keineswegs übergewichtig, aber neben ihm fühlte er sich wie ein Elchbulle. Der Kapitän strahlte Selbstbewusstsein aus. Er achtete auch sehr streng auf die Einhaltung seiner Regeln, was Nick zu schätzen wusste. Obwohl Nick eine Genehmigung der Regierung und der nationalen Luftfahrtbehörde hatte, an Bord seine geladene Sig Sauer zu tragen, wusste er, dass das Sorensky nervös machte – und das war das Letzte, was Nick wollte oder brauchte. Deshalb hatte Nick seine Waffe bereits entladen. Als der Kapitän ihn begrüßte, ließ er das Magazin seiner Waffe in dessen Hand fallen.
»Schön, dich wiederzusehen, Nick.«
»Wie geht es dir heute, Jim?«
Sorensky lächelte. »Machst du dir immer noch Sorgen, ich könnte einen Herzinfarkt erleiden, während wir in der Luft sind?«
Nick zuckte die Achseln, um seine Verlegenheit zu kaschieren. »Der Gedanke ist mir schon mal durch den Kopf gegangen«, gab er zu. »Schließlich könnte so etwas passieren.
»Ja, das könnte es, aber ich bin nicht der Einzige an Bord, der diese Maschine fliegen kann.«
»Ich weiß.«
»Aber deshalb fühlst du dich nicht besser, oder?«
»Nein.«
»Man sollte meinen, du würdest dich daran gewöhnen, so viel wie du fliegen musst.«
»Das sollte man meinen, aber bis jetzt ist es noch nicht passiert.«
»Weiß dein Boss eigentlich, dass dir jedes Mal schlecht wird, wenn du ein Flugzeug betrittst?«
»Sicher weiß er das«, antwortete Nick. »Er ist ein Sadist.«
Sorensky lachte. »Ich sorge heute für einen wirklich glatten Flug«, versprach er. »Du kommst nicht mit uns nach London, oder?«
»Über einen Ozean fliegen? Nie im Leben.« Bei dem Gedanken machte sein Magen einen Satz. »Ich fahre nach Hause.«
»Bist du noch nie in Europa gewesen?«
»Nein, noch nicht. Wenn ich mit dem Auto dorthin komme, fahre ich.«
Der Kapitän warf einen Blick auf das Magazin in seiner Hand. »Danke, dass ich mich daran festhalten kann. Ich weiß, dass ich kein recht habe, dich darum zu bitten, es herauszugeben.«
»Aber es macht dich nervös, eine geladene Waffe an Bord zu haben, und ich will nicht, dass ein nervöser Pilot diese Maschine fliegt.«
Nick versuchte, an Sorensky vorbeizukommen, damit er sich auf seinen Platz setzen konnte, aber der Kapitän war zu einem Schwätzchen aufgelegt.
»Übrigens las ich vor etwa einem Monat einen wirklich netten Artikel darüber in der Zeitung, wie du das Leben dieses armen Jungen gerettet hast. Es war interessant, etwas über deinen Hintergrund zu erfahren, dass dein bester Freund ein Priester ist ... dass ihr beide schließlich unterschiedliche Wege eingeschlagen habt. Jetzt trägst du ein Abzeichen und er ein Kreuz. Und dass du dieses Kind gerettet hast, macht mich stolz, dich zu kennen.«
»Ich habe nur meine Arbeit getan.«
»Der Artikel erwähnte auch die Abteilung, bei der du arbeitest. Wie hat er euch zwölf noch mal genannt?« Bevor Nick antworten konnte, erinnerte der Kapitän sich. »Ach ja, die Apostel.«
»Ich habe nicht herausgefunden, wie er an diese Information gelangt ist. Ich dachte, niemand außerhalb der Abteilung würde diesen Spitznamen kennen.«
»Dennoch passt er. Du hast das Leben des kleinen Jungen gerettet.«
»Wir hatten Glück.«
»Der Reporter sagte, du hättest dich geweigert, dich interviewen zu lassen.«
»Das ist kein Traumjob, Jim. Ich tat, was ich tun musste, das ist alles.«
Die Bescheidenheit des Agenten beeindruckte den Kapitän. Mit einem Kopfnicken sagte er: »Das hast du toll gemacht. Der kleine Junge ist jetzt wieder bei seinen Eltern, und das ist die Hauptsache.«
»Wie gesagt, wir hatten Glück.«
Sorensky, der Nicks Unbehagen angesichts seiner Komplimente spürte, wechselte rasch das Thema. »Ein U.S. Marshal Downing ist auch an Bord. Er musste mir seine Waffe geben«, fügte er grinsend hinzu. »Kennst du ihn zufälligerweise?«
»Der Name ist mir nicht geläufig. Er transportiert doch keinen Gefangenen, oder?«
»Doch.«
»Was macht er denn dann in einem Linienflug? Sie haben doch ihre eigenen Maschinen.«
»Laut Downing ist es eine ungewöhnliche Situation. Er bringt den Gefangenen zurück nach Boston, wo er vor Gericht gestellt werden soll, und er hat es eilig«, erklärte er. »Downing erzählte mir, dass sie den Jungen dabei erwischt haben, wie er Drogen verkaufte, und dass es sich um einen klaren Fall handelt. Der Gefangene gilt nicht als gewalttätig. Downing glaubt, seine Anwälte werden ihn heraushauen, noch bevor der Richter zum Hammer greift. Wie du sind sie vor den Passagieren eingestiegen. Der Marshal stammt aus Texas. Das kannst du an seiner Stimme hören. Er scheint ein wirklich netter Kerl zu sein. Du solltest dich ihm vorstellen.«
Nick nickte. »Wo sitzen sie?«, fragte er mit einem raschen Blick in die Hauptkabine des Riesenflugzeuges.
»Von hier aus kannst du sie nicht sehen. Sie sitzen links in der hintersten Reihe. Downing hat dem Jungen Fußfesseln und Handschellen angelegt. Ich sage dir, Nick, dieser Gefangene kann nicht viel älter sein als mein Sohn Andy, und der ist erst vierzehn. Es ist eine verdammte Schande, dass jemand, der noch so jung ist, den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird.«
»Kriminelle werden immer jünger und dümmer«, stellte Nick fest. »Danke, dass du es mir erzählt hast. Ich werde ihnen Hallo sagen. Ist das Flugzeug heute ausgebucht?«
»Nein«, antwortete Sorensky, während er das Magazin in seine Hosentasche steckte. »Wir sind nur halb besetzt, bis wir in Logan landen. Danach sind wir ausgebucht.«
Nachdem er darauf bestanden hatte, dass Nick es ihn wissen lassen sollte, wenn er irgendetwas benötigte, ging Sorensky ins Cockpit zurück, wo ein Mann in der marineblauen Uniform und mit der Identifikationsmarke des Bodenpersonals der Fluggesellschaft ihn mit einem Klemmbrett voller zusammengerollter Papiere erwartete. Er folgte dem Kapitän ins Cockpit und schloss die Tür hinter sich. Nick legte seinen Kleidersack in das Fach über seinem Kopf, ließ die alte, abgenutzte Lederaktentasche auf seinen Sitz fallen, ging zur linken Seite des Flugzeugs hinüber und marschierte den Gang hinunter auf den U.S. Marshal zu. Als er den halben Weg gegangen war, änderte er seine Meinung. Die anderen Passagiere kamen rasch einer nach dem anderen an Bord, und deshalb entschied er sich zu warten, bis sie in der Luft waren, bevor er sich Downing vorstellte. Er erhaschte allerdings einen Blick auf ihn und auch auf den Gefangenen, bevor er sich umdrehte. Downing hatte ein Bein in den Gang ausgestreckt; Nick konnte die modischen Schneckenverzierungen auf seinen Cowboystiefeln erkennen. Hochgewachsen und drahtig, entsprach der Marshal mit seiner wettergegerbten Haut, dem dichten braunen Schnurrbart und der schwarzen Lederweste ganz dem Bild des Cowboys. Nick konnte seinen Gürtel nicht sehen, aber er hätte ein Monatsgehalt verwettet, dass Downing stolz eine dicke Silberschnalle zur Schau trug.
Kapitän Sorensky hatte mit seiner Einschätzung des Gefangenen ins Schwarze getroffen. Auf den ersten Blick sah er aus wie ein Kind. Aber er hatte eine Härte an sich, die Nick schon unzählige Male erlebt hatte. Dieser Junge hier hatte bereits einiges erlebt und vermutlich sein Gewissen schon vor langer Zeit umgebracht. Ja, sie wurden heutzutage immer jünger und dümmer, dachte Nick. Der Gefangene war geschlagen mit einem schlechten Urteilsvermögen und grauenhaften Genen. Sein Gesicht war übersät mit Aknenarben, seine kalten Marmoraugen standen so dicht beieinander, dass er aussah, als schielte er. Jemand hatte an seinem Haar ein regelrechtes Gemetzel verübt, ohne jeden Zweifel absichtlich. Überall an seinem Kopf standen Stacheln hoch, so etwa in der Art der Freiheitsstatue, aber vielleicht wollte er so aussehen. Was machte es auch aus, was für eine Art Punkfrisur er hatte? Wo er hinging, hatte er nach wie vor viele Freunde, die Schlange standen und auf eine Gelegenheit warteten, an ihn heranzukommen.
Nick ging zurück in den Vorderteil des Flugzeugs und setzte sich auf seinem Platz zurecht. Er flog heute erster Klasse, und obwohl der Sitz dort breiter war, fühlte er sich eingezwängt. Seine Beine waren zu lang, um sie richtig auszustrecken. Nachdem er seine Aktentasche unter den Sitz vor sich geschoben hatte, lehnte er sich zurück, schnallte den Sicherheitsgurt zu und schloss die Augen halb. Es wäre schön gewesen, wenn er zumindest hätte versuchen können, es sich bequem zu machen, aber das stand außer Frage, weil er die anderen Passagiere erschrecken würde, wenn er sein Jackett auszog und sie seine Waffe im Halfter sahen. Sie wussten schließlich nicht, dass sie nicht geladen war, und Nick war nicht in der Stimmung, andere zu beruhigen. Zum Teufel, er befand sich am Rand einer Panikattacke, und dieser Zustand würde andauern, bis die Maschine gestartet war. Danach war mit ihm alles in Ordnung, zumindest einigermaßen, bis sie zum Sinkflug auf den Logan Airport ansetzten. Dann würde die Angst wieder beginnen. In seinem gegenwärtigen klaustrophobisch-neurotischen Zustand empfand er es als verdammt ironische Vorstellung, dass O'Leary ihn in seinem Krisenmanagement-Team haben wollte.