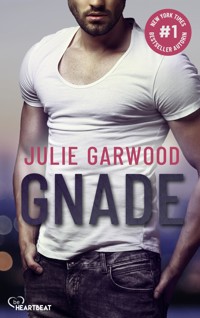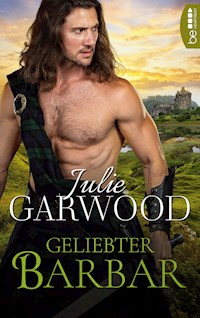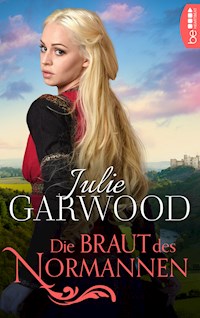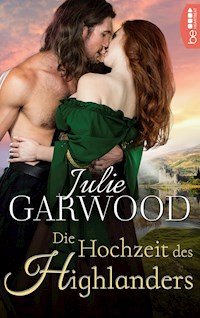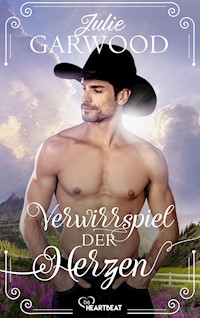
7,99 €
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Romance – Liebe und Leidenschaft in Rose Hill, Montana
- Sprache: Deutsch
Montana, Ende des 19. Jahrhunderts: Rose Clayborne, von allen nur Mama Rose genannt, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ihre Söhne endlich heiraten und eigene Familien gründen. Die verführerische Emily, die schöne Isabel und die unwiderstehliche Geneviève wären auch durchaus bereit, die Clayborne-Brüder von den Vorzügen einer Ehe zu überzeugen. Aber Travis, Douglas und Adam waren vernünftigen Argumenten gegenüber noch nie besonders zugänglich. Und so müssen die drei jungen Damen sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um Mama Roses Herzenswunsch zu erfüllen ...
Liebe und prickelnde Leidenschaft in Rose Hill, Montana - die fesselnd-sinnliche Trilogie der Bestsellerautorin Julie Garwood um die Familie Clayborne:
Band 1: Die Tochter des Lords
Band 2: Verwirrspiel der Herzen
Band 3: Leg dein Herz in meine Hände
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil 2
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Teil 3
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Epilog
Über die Autorin
Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Montana, Ende des 19. Jahrhunderts: Rose Clayborne, von allen nur Mama Rose genannt, wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ihre Söhne endlich heiraten und eigene Familien gründen. Die verführerische Emily, die schöne Isabel und die unwiderstehliche Geneviève wären auch durchaus bereit, die Clayborne-Brüder von den Vorzügen einer Ehe zu überzeugen. Aber Travis, Douglas und Adam waren vernünftigen Argumenten gegenüber noch nie besonders zugänglich. Und so müssen die drei jungen Damen sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um Mama Roses Herzenswunsch zu erfüllen ...
Julie Garwood
Verwirrspiel der Herzen
Aus dem amerikanischen Englisch von Bettina Albrod
Prolog
Vor langer Zeit lebte einmal eine bemerkenswerte Familie. Es handelte sich um die Clayborne-Brüder, und das Band zwischen ihnen war weit fester, als es Blutsbande sein konnten.
Sie hatten sich als Kinder in den Straßen New Yorks kennengelernt. Der entflohene Sklave Adam, der Taschendieb Douglas, der Revolverheld Cole und der Ex-Sträfling Travis überlebten, weil sie einander vor den anderen Banden beschützten, die die Stadt durchstreiften. Als sie eines Tages in ihrem Revier ein ausgesetztes Baby fanden – ein Mädchen – schworen sie, dass dieses Mädchen es einmal besser haben sollte, und zogen mit ihm in Richtung Westen.
Auf einem Stück Land tief im Herzen Montanas, das sie Rosehill tauften, ließen sie sich nieder.
Die einzige Erziehung erfuhren die Heranwachsenden durch die Briefe von Adams Mutter Rose. Rose kannte die Kinder aus deren herzzerreißenden Briefen an sie, in denen sie ihr von ihren Ängsten, ihren Hoffnungen und ihren Träumen erzählten, und im Gegenzug schenkte sie ihnen etwas, was sie noch nie gehabt hatten: die bedingungslose Liebe und Anteilnahme einer Mutter.
Bald sah jeder in ihr seine Mama Rose.
Nach zwanzig langen Jahren kam Rose zu ihnen. Endlich waren ihre Söhne und ihre Tochter zufrieden. Ihre Ankunft war für ihre Kinder ein Anlass zum Feiern, aber sie verwirrte sie auch. Roses Tochter hatte vor kurzem einen guten Mann geheiratet und gerade selbst eine Tochter bekommen. Ihre Söhne waren zu anständigen, starken Männern herangewachsen. Aber Mama Rose war dennoch nicht ganz zufrieden. Sie hatten sich für ihren Geschmack allzu behaglich in ihrem Junggesellendasein eingerichtet. Und da sie daran glaubte, dass Gott denen hilft, die sich selbst helfen, blieb ihr nur eins zu tun übrig: Sie hatte vor, sich einzumischen.
Rosenzeit
Es war nicht im Winter,
als unsere Liebe begann.
Es war die Zeit der Rosen.
Wir pflückten sie im Vorübergehen!
Diese Zeit der Fülle
hat sich den Liebenden noch nie verwehrt:
Im Gegenteil – die Welt hatte sich mit Blumen
geschmückt,
als wir uns das erste Mal trafen!
Im Dämmerlicht bat ich dich zu gehen,
doch du hieltest mich fest.
Es war die Zeit der Rosen.
Wir pflückten sie im Vorübergehen!
Thomas Hood (1798 – 1845)
Teil 1
Kapitel 1
Rosehill Ranch, Montana Valley. 1880
Travis Clayborne war nah daran, einen Mann zu töten. Der jüngste der Brüder war gerade erst von einer Reise in den Süden des Territoriums zurückgekehrt und wollte eine Woche bleiben, ehe er die Jagd wieder aufnahm. Bislang hatte es der Mann, den er verfolgte, geschafft, ihm immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Travis hatte gedacht, er wäre ihm dicht auf den Fersen und hätte ihn in die Enge getrieben, aber dann hatte sich dieser unberechenbare Teufel einfach in Luft aufgelöst. Travis musste widerwillig zugeben, dass er vor diesem Fremden, der ihn so raffiniert ausgetrickst hatte, den Hut ziehen musste. Er musste ihm außerdem ein Kompliment für seine Überlebenskunst machen. Danach würde er ihn erschießen.
Den Gedanken, den Missetäter ins Gefängnis zu bringen, hatte er gleich verworfen. Der Name seines Feindes war Daniel Ryan, und die Sünde, die er begangen hatte, war nach Maßstab eines liebenden Sohnes unverzeihlich. Ryan hatte es gewagt, eine süße, freundliche, gutherzige alte Dame zu übervorteilen, die ein Herz aus Gold hatte – Travis’ Mama Rose, um genau zu sein – und nach Travis’ Auffassung war der Tod in diesem Fall noch eine viel zu milde Strafe. Mittlerweile versuchte er sich einzureden, dass er das Recht auf seiner Seite hatte.
An diesem Abend wartete er, bis seine Mutter zu Bett gegangen war, um sein Vorhaben mit seinen Brüdern zu besprechen. Sie saßen in einer Reihe auf der Veranda, die bestiefelten Füße auf das Geländer gelegt, die Köpfe zurückgelehnt, die Augen geschlossen.
Ihr Schwager Harrison gesellte sich zu ihnen, kurz nachdem Mama Rose nach oben gegangen war. Er dachte bei sich, dass die Brüder zufrieden aussahen, und wollte ihnen das gerade mitteilen, als Travis seine Absichten darlegte. Harrison ließ sich hart in einen Stuhl neben Douglas fallen, streckte seine langen Beine aus und fing dann an, mit Travis zu diskutieren. Er sagte, es sei Sache des Gesetzes, sich mit dem Dieb zu befassen, und dass diese Person, wie jeder Mann und jede Frau in diesem Land, einen fairen Prozess bekommen müsse. Wenn er schuldig gesprochen wurde, würde er als Strafe ins Gefängnis gehen. Er dürfe nicht kaltblütig ermordet werden.
Keiner der Claybornes schenkte Harrisons Ausführungen sonderlich viel Aufmerksamkeit. Er war von Beruf Anwalt, und es lag in seiner Natur, bei jeder Kleinigkeit Schwierigkeiten zu sehen. Insgeheim fanden die Brüder es wirklich niedlich, dass Harrison an eine Gerechtigkeit für alle glaubte. Der Mann ihrer kleinen Schwester war in Ordnung, aber er war Schotte und in ihren Augen naiv, was die Gesetze des Westens anging. In einer perfekten Welt würden vielleicht immer die Unschuldigen beschützt und die Schuldigen bestraft werden, aber sie lebten nun einmal nicht in einer perfekten Welt. Sie lebten in Montana.
Außerdem, welcher Gesetzeshüter würde sich die Mühe machen, eine Kreuzotter zu jagen, wenn es woanders so viele Klapperschlangen gab, die nur darauf warteten, zuzuschlagen?
Harrison weigerte sich, die Ansichten der Claybornes anzunehmen. Travis’ Absicht, dem Schuldigen nachzujagen, der ihre Mutter beraubt hatte, entsetzte ihn. Er ermahnte den Schwager, dass er als künftiger Anwalt die Pflicht habe, sich ehrenhaft zu verhalten. Außerdem schlug er Travis vor, noch einmal Platos ›Republic‹ zu lesen. Aber Travis ließ sich von seiner, wie er es nannte, ›heiligen Mission‹ nicht abbringen. Er beugte sich zu Harrison vor.
»Die erste Pflicht eines Sohnes ist es, seine Mutter zu schützen.«
»Amen«, murmelte Adam.
»Es ist uns allen klar, dass Mama Rose betrogen wurde«, erklärte Travis. »Er hat sie gebeten, ihm den Kompass und die Golddose zu zeigen, stimmt’s?»
»Ich wünschte, sie hätte ihm nichts davon erzählt«, warf Adam ein.
»Aber sie hat«, sagte Douglas. »Und ich wette, sobald sie das Wort Gold erwähnt hat, hat er es sehen wollen.«
»Da wusste er, dass er es stehlen würde«, ergänzte Cole.
»Es war klug von ihm zuzulassen, dass die Menge sie trennte«, sagte Adam.
»Mama Rose hat uns erzählt, dass dieser Ryan gut zwei Meter groß ist. Und stark«, erinnerte Douglas sie. »Stark bedeutet, dass er wahrscheinlich mehr Muskeln hat als die meisten. Es kommt mir doch seltsam vor, dass so ein großer Mann von der Menge herumgeschubst werden sollte. Ganz klar, er wollte ihn stehlen.«
»Um Himmels willen, Douglas, du kannst doch nicht ...« begann Harrison.
Travis schnitt ihm das Wort ab. »Niemand übervorteilt unsere Mama und kommt ungestraft davon. Einer ihrer Söhne muss das Unrecht aus der Welt schaffen. Du kannst doch sicher verstehen, wie wir fühlen, Harrison. Du hattest ja auch mal eine Mutter, oder?«
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, knurrte Cole, um seinen Schwager zu ärgern.
Aber Harrison war nicht in der Stimmung, auf die Bemerkung einzugehen. »Deine Argumentation stimmt nicht«, sagte er. Er wartete, bis das allgemeine Schnauben aufgehört hatte, ehe er verkündete, dass Travis’ Plan, den Dieb zu erschießen, schlicht und einfach Mord sei.
Cole lachte Harrison aus, schlug ihm spöttisch auf den Rücken und meinte dann, Harrison solle lieber darüber nachdenken, wie man Travis aus dem Gefängnis holen könnte, falls er dafür verhaftet würde, dass er seine Sohnespflichten erfüllte. Er schlug außerdem vor, Travis solle den Schuldigen einfach nach Montana zurückbringen, damit die Brüder ihn gemeinsam erschießen konnten.
Harrison war kurz davor, seine Niederlage einzugestehen. Es war unmöglich, mit den Clayborne-Brüdern vernünftig zu reden. Das einzige, was ihn beruhigte, war der Umstand, dass er im Grunde seines Herzens wusste, dass keiner von ihnen zu einem kaltblütigen Mord fähig war. Allerdings genossen sie es sehr, sich das auszumalen.
»Woher willst du wissen, dass der Mann, hinter dem du her bist, wirklich Daniel Ryan ist? Vielleicht hat er sich den Namen nur ausgedacht«, gab er zu bedenken. »Er kann auch gelogen haben, als er sagte, er stamme aus Texas.«
»Nein«, sagte Cole entschieden. »Er hat Mama Rose gesagt, wie er heißt und wo er herkommt, ehe sie über die Geschenke gesprochen haben, die sie uns mitbringt.«
»Ein Glück, dass sie ihm nicht von den anderen Geschenken erzählt hat! Am Ende hätte er meine Taschenuhr auch noch gestohlen«, überlegte Douglas.
»Ich wette, meine Karte hätte er sich dann auch unter den Nagel gerissen«, warf Adam ein.
»Und meine ledergebundene Klassiker-Ausgabe«, ergänzte Travis.
»Der Dieb kommt aus Texas, ganz sicher«, erklärte Adam. »Seine Sprache hat ihn verraten.«
»Das stimmt«, erinnerte sich Douglas. »Sie hat es noch ... wie war doch der Ausdruck, Travis?«
»Charmant – charmant hat sie es gefunden«, ergänzte er mit finsterer Miene.
»Mir haben die Namen Daniel oder Ryan noch nie gefallen«, verkündete Cole düster. »Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich auch nicht besonders scharf auf Texaner. Man kann ihnen einfach nicht trauen.«
Harrison verdrehte die Augen. »Du magst niemanden und nichts«, erinnerte er ihn. »Tu mir einen Gefallen, und sag kein Wort mehr, bis ich nach oben gehe. Sonst vergesse ich noch, dass ich ein logisch denkender Mann bin.«
Cole lachte. »Du bist doch der, der unbedingt mit seiner Frau nach Rosehill zurück ziehen wollte. Ich bin Teil von Rosehill, Harrison, ob es dir gefällt oder nicht.«
»Mary Rose will während der Schwangerschaft bei ihrer Mutter sein. Da werde ich doch nicht mit Richter Burns von Stadt zu Stadt ziehen und sie in Blue Belle alleine lassen. Ach, und wenn du ihr noch einmal sagst, sie würde watscheln wie eine Ente, bekommst du meine Faust zu spüren. Verstanden? Sie ist im Moment gefühlsmäßig etwas labil, da muss sie sich nicht auch noch anhören, dass sie so dick ist wie ...«
Cole ließ ihn nicht ausreden. »Schon gut, wir hören auf, sie zu necken. Sie wird mit jedem Tag hübscher, nicht?«
»Sie war immer hübsch«, korrigierte Adam.
»Ja, aber jetzt, wo sie meinen Neffen erwartet, ist sie noch hübscher. Und wage es nicht, ihr zu erzählen, was ich gerade gesagt habe, sonst lässt sie mir keine Ruhe. Meiner Schwester macht es Spaß, mich zu ärgern, wann immer sie mich sieht, und ich kann mir nicht vorstellen, warum.«
Er sah, wie Harrisons Augen zu funkeln begannen, und wusste, dass der Mann ihn provozieren wollte. Cole war aber heute Abend nicht zu einem Streit aufgelegt, deswegen entschloss er sich, das Gespräch wieder auf wichtigere Themen zurückzubringen. Zum Beispiel darauf, wie man eine verachtenswerte, diebische Kreuzotter fing, die sich den ganzen Weg von Texas bis Montana hochgeschlängelt hatte.
»Travis, reist du morgen ab?«
»Ja.«
»Wie kommt es, dass du derjenige bist, der Daniel Ryan verfolgt?«, fragte Harrison. »Falls der Texaner wirklich den Kompass deines Bruders gestohlen hat – und das steht ja nicht einmal fest –, sollte ihn dann nicht Cole verfolgen? Es ist doch sein Kompass.«
»Cole kann gerade nicht weg«, erklärte Adam.
»Er muss sich ein bisschen zurückhalten, bis Shamus Harrington sich wieder beruhigt hat«, fügte Douglas hinzu.
»Was hast du denn gemacht, Cole?«, fragte Harrison und hatte schon Angst vor der Antwort.
»Er hat sich verteidigt«, warf Adam schnell ein. »Einer von Harringtons Söhnen hat gemeint, er könnte schneller ziehen als Cole und hat ihn zu einem Duell gezwungen.«
»Was ist passiert?«, wollte Harrison wissen.
»Ich habe gewonnen«, grinste Cole.
»Anscheinend«, fuhr ihn Harrison an. »Hast du den anderen getötet?«
»Nicht ganz, aber fast«, gab Cole zu. »Es war schon seltsam, wie er mich immer verfolgt hat«, fügte er hinzu. »Lester hatte sich einer Bande angeschlossen, die durch Blue Belle gekommen ist, und es hieß, dass sie nächsten Samstag die Bank in Hammond ausrauben wollten«, erklärte er.
»Schon komisch, dass er es auf dich abgesehen hatte«, bestätigte Douglas. »Lester hat sich aufgeführt wie der starke Mann, der seinen neuen Freunden imponieren will. Vielleicht wollte er Eindruck bei ihnen schinden.«
»Ich habe gehört, dass sie ihn zu dem Duell mit dir getrieben haben«, meldete Adam sich wieder zu Wort. »Dooley hat mir gesagt, dass sie so aufgetreten sind, als hätten sie gewusst, wer du bist, Cole.«
»Dooley ist schon zu lange mit seinem Freund Ghost zusammen«, sagte Cole. »Du kannst nichts von dem glauben, was einer von ihnen sagt, Adam.«
»Vielleicht haben sie von deinem Ruf gehört«, gab Douglas zu bedenken.
»Ach, die haben einfach Streit gesucht«, meinte Cole.
»Außerdem weiß jeder, dass Harringtons Söhne dumm wie Bohnenstroh sind.«
»Das mag ja sein«, sagte Douglas, »aber das hindert den alten Shamus trotzdem nicht, einen Groll gegen dich zu hegen. Männer aus den Bergen tun so etwas, wenn man ihre Söhne anschießt, und da er noch fünf andere Söhne hat, musst du jetzt eine Zeitlang auf der Hut sein.«
»Das bin ich immer«, brüstete sich Cole. »Wenn ich es recht bedenke, Travis, könnte doch eigentlich ich Ryan verfolgen. Du hast auch ohne das schon genug ...«
Sein Bruder ließ ihn nicht ausreden. »Nein, du bleibst hier«, widersprach er. »Ich habe alles schon genau geplant.«
»Das stimmt«, pflichtete Douglas ihm bei. »Er schlägt drei Fliegen mit einer Klappe.«
Travis nickte. »Ich bringe meine Papiere zu Wellington und Smith, damit alles erledigt ist, wenn ich im September in ihrer Kanzlei anfange. Weil Hammond nur einen Katzensprung von Pritchard entfernt liegt, erledige ich da noch eine Sache, die Mama Rose mir aufgetragen hat, dann reite ich rüber nach Rivers Bend, erschieße Ryan, besorge in Hammond ein Geburtstagsgeschenk und komme dann rechtzeitig zur Feier wieder hierher.«
»Du schuldest uns zehn Dollar für Mama Roses Geburtstagsgeschenk«, erinnerte Cole Harrison.
»Was schenken wir ihr?«, fragte der Schwager.
»Eine Nähmaschine«, sagte Douglas. »Ihre Augen haben so gefunkelt, als sie sie in dem Katalog gesehen hat, den Adam ihr gezeigt hat. Natürlich bekommt sie die teuerste. Sie verdient von allem nur das Beste.«
Harrison nickte. »Liegen Golden Crest und Rivers Bend nicht in entgegengesetzter Richtung?«
»Genau«, nickte Cole. »Das ist auch der Grund, warum ich hinter Ryan herreiten sollte, Travis. Es würde dir viel Zeit und Mühe ...«
Auch diesmal ließ ihn sein Bruder nicht aussprechen, »Du musst dich verstecken«, sagte er.
Harrison nickte und bot Travis dann eine Alternative an, die ihm Zeit und Mühe sparen würde.
»Du kannst doch in Pritchard eine Nähmaschine besorgen und damit ein paar Tage sparen.«
»Ich nehme an, das könnte er«, antwortete Cole. »Aber man hat Ryan nicht in Pritchard gesehen. Gestern wollte er nach Rivers Bend.«
»Und woher weißt du das?«, wollte Harrison wissen.
»Wir haben gebeten, dass man uns Bescheid sagt, falls jemand ihn trifft«, erklärte Adam. »Ein Jammer, Travis, dass diese Sache unbedingt sein muss. Bis du in Rivers Bend bist, ist Ryan vielleicht längst schon wieder weg.«
»Ich habe alles genau geplant«, beruhigte ihn Travis. »Es dauert höchstens einen Tagesritt, diese Emily Finnegan bei ihrem Bräutigam in Golden Crest abzuliefern, und wenn es trocken genug ist, kann ich die Abkürzung durch das Flussbett nehmen und am nächsten Nachmittag in Rivers Bend sein.«
»Das glaubst auch nur du«, schnaubte Adam. »Es regnet schon seit einem Monat. Das Flussbett wird voll sein. Du brauchst mindestens drei Tage für den Ritt.«
»Wer ist Emily Finnegan?«, fragte Harrison.
»Das ist die Erledigung für Mama Rose«, erklärte Travis.
Harrison knirschte mit den Zähnen. Es war ein zähes Unterfangen, den Brüdern irgendwelche Informationen entlocken zu wollen, aber er war hartnäckig genug, um am Ball zu bleiben. Es machte den Claybornes Spaß, ihn mit Teilfakten zu verwirren, die gar nichts zu bedeuten hatten. Natürlich machten sie das mit Absicht. Sie hatten sich verbündet, um ihn daran zu hindern, sie zu ›jagen‹, wie Cole es nannte. Er meinte damit Harrisons Drang, sie nach Motiven und Moral ihrer Handlungen zu befragen. Drei der Brüder glaubten immer noch daran, sie könnten ihn durch ihre Dickköpfigkeit daran hindern. Adam war der einzige, der es besser wusste. Niemand war so dickköpfig wie ein Schotte, was Harrison, der im Hochland geboren und aufgewachsen war, deutlich belegte.
»Was für eine Sache?«, fragte er Travis nun.
»Mama Rose hat letzte Woche mit den Cohens zu Abend gegessen, und sie haben ihr von einer Frau erzählt, die in Pritchard festsitzt. Ihre Begleitung hat sie im Stich gelassen, und sie versucht, jemanden zu finden, der sie nach Golden Crest bringt, hat bislang aber kein Glück gehabt.«
»Warum reitet der Mann, der sie heiraten will, nicht nach Pritchard und holt sie?«
»Genau das habe ich Mama Rose auch gefragt, und sie hat gesagt, das würde sich nicht gehören. Der Priester wartet in Golden Crest, und es ist Emily Finnegans Sache, dorthin zu kommen. Mama Rose hat meine Dienste angeboten.«
»Sie hat sicher gedacht, Hammond läge bei Golden Crest«, überlegte Douglas.
»Warum kann nicht jemand aus Pritchard sie hinbringen?«, fragte Harrison. »Das ist doch eine große Stadt. Dort kann man doch sicher jemanden finden, der dazu bereit wäre?«
»In Pritchard sind die Leute schrecklich abergläubisch«, erklärte Cole.
»Was heißt das?«, hakte sein Schwager nach.
»Es heißt, dass Miss Emily ihnen Angst macht.«
»Es sieht so aus, als habe die arme Miss Emily schon ein paar Begleiter gehabt«, grinste Douglas.
»Wie viele?«, wollte Harrison wissen.
»Zu viele, um sie noch zu zählen«, antwortete Cole, absichtlich übertreibend. »Den Gerüchten zufolge sollen einige von ihnen gestorben sein. Travis, nimm dir lieber einen Glücksbringer mit«, setzte er mit einem Nicken in Richtung seines Bruders hinzu. »Ich würde dir ja meinen Glücks-Kompass geben, aber ich habe ihn nicht, und das alles, weil ein diebischer, verlogener ...«
Harrison schnitt ihm das Wort ab, ehe Cole sich wieder in das Thema hineinsteigerte. »Du kannst nicht wissen, ob der Kompass Glück bringt oder nicht. Du hast das Ding doch noch nie gesehen.«
»Aber Mama Rose hat ihn für mich ausgesucht, oder? Das macht ihn zu einem Glücksbringer.«
»Du bist genauso abergläubisch wie die Leute in Pritchard«, murmelte Harrison. »Travis, glaubst du, dass dir diese Miss Emily Probleme machen wird?«
»Nein«, erwiderte er. »Ich bin nicht abergläubisch, und ich glaube nicht die Hälfte von dem, was über sie erzählt wird. Wie schlimm kann sie schon sein?«
Kapitel 2
Die Frau war eine Plage.
Noch ehe sie aus der Stadt heraus waren, war Travis geboxt, getreten und geschubst worden, und man hatte auf ihn geschossen, aber das war niemand aus Pritchard gewesen. Nein, Miss Emily Finnegan war es, die versuchte, ihm den Rest zu geben, und obwohl sie beim Grab ihrer Mutter schwor, dass alles nur ein grässliches Missverständnis sei, glaubte Travis ihr nicht. Warum sollte er? Er wusste aus sicherer Quelle, nämlich von den Cohens, dass Emilys Mutter noch lebte und wahrscheinlich gerade in Boston mit Mr Finnegan Walzer tanzte, weil es ihr gelungen war, ihre undankbare Tochter einem armen, arglosen Fremden in Golden Crest aufzuhalsen.
Zugegeben, Miss Emily war ein hübsches kleines Ding. Sie hatte kornfarbene Haare, die sich um ihre Ohren lockten, und große, haselnussbraune Augen, die mal samtbraun, mal golden schimmerten. Auch ihr Mund war hübsch, solange sie ihn nicht öffnete, was sie aber, wie Travis schnell klar wurde, fast immer tat. Die Frau hatte zu allem eine eigene Meinung und fühlte sich auch noch berufen, ihm diese mitzuteilen, damit es in Zukunft keine Missverständnisse gab.
Sie war keine Besserwisserin, ähnelte einer solchen aber in vielem. Zu dieser Erkenntnis kam er, nachdem er sie fünf schmerzhafte Minuten kannte.
Olsen, der Eigentümer des Hotels, hatte vorgeschlagen, dass sie sich vor der Postkutschenstation treffen sollten. Travis sah sie schon von weitem. Sie stand mit einem schwarzen Regenschirm in der einen und weißen Handschuhen in der anderen Hand direkt an der Station. Vor ihr waren mindestens sechs Pakete aufgereiht, entschieden zu viele, um sie einen steilen Berghang hinaufzuschleppen.
Miss Finnegan war von Kopf bis Fuß in blütenweißes Leinen gekleidet. Er nahm an, dass sie keine Zeit gehabt hatte, ihr bestes Sonntagskleid auszuziehen. Dann ging ihm auf, dass heute Donnerstag war.
Ihre erste Begegnung war nicht gerade freundschaftlich zu nennen. Sie stand mit gereckten Schultern und erhobenem Kopf da und beobachtete das Leben auf der Straße. Obwohl es noch früh am Morgen war, hatte sich bereits eine Gruppe rauer Kerle in Lous Taverne getroffen, die gehörigen Krach machte. Deshalb hatte Emily Finnegan ihn vielleicht nicht kommen hören, als er von hinten an sie herantrat.
Er beging einen Fehler, als er ihr leicht auf die Schulter tippte, damit sie ihn bemerkte. Doch er wollte sie begrüßen und sich höflich vorstellen. Das war der Moment, als sie auf ihn schoss. Es ging so schnell, dass Travis kaum Zeit hatte, aus der Schusslinie zu springen. Der kleine Derringer, den sie unter ihren Handschuhen verborgen hatte, ging los, als sie herumfuhr. Die Kugel hätte ihn mitten in den Bauch getroffen, wenn Travis nicht den Lauf der Waffe hätte blitzen sehen und sich in Sekundenschnelle zur Seite geworfen hätte.
Er war sich ziemlich sicher, dass nur eine Patrone in der Waffe war, aber er ließ es nicht darauf ankommen. Er ergriff ihr Handgelenk und bog ihr den Arm hoch, sodass die Waffe in den Himmel zielte. Erst dann trat er näher, um seine Beschimpfungen loswerden zu können.
Das war der Moment, in dem sie ihn mit dem Regenschirm stach und ihm hart gegen die Kniescheibe trat. Es war klar, dass sie auf seine empfindlichste Stelle gezielt hatte, und als sie ihr Ziel beim ersten Mal verfehlte, besaß sie die Frechheit, es noch einmal zu versuchen.
Das war der Moment, in dem Travis zu der Erkenntnis kam, dass Miss Emily Finnegan verrückt war.
»Lassen Sie mich los, Sie Unhold!«
»Unhold? Was zum Teufel ist ein Unhold?«
Sie hatte nicht die leiseste Ahnung. Die Frage verblüffte sie so, dass sie fast mit den Achseln gezuckt hätte. Zugegeben, sie wusste nicht, was ein Unhold war, aber sie wusste, dass ihre Schwester Barbara das Wort immer dann benutzte, wenn sie einen übereifrigen Bewunderer entmutigen wollte, und es hatte immer gewirkt. Was bei ihrer Schwester funktioniert hatte, würde auch ihr gute Dienste leisten. Das hatte Emily sich im Zug aus Boston überlegt.
»Das einzige, das Sie wissen müssen, ist, dass es eine Beschimpfung ist«, erklärte sie. »Und jetzt lassen Sie mich los.«
»Ich lasse Sie erst los, wenn Sie mir versprechen, Ihre Mordversuche aufzugeben. Ich bin Ihre Begleitung nach Golden Crest«, setzte er höhnisch hinzu. »Beziehungsweise war ich es, bevor Sie auf mich geschossen haben. Jetzt müssen Sie selbst sehen, wie Sie dahin kommen, Lady, und wenn Sie mich noch einmal treten, schwöre ich, dass ...«
Sie unterbrach ihn, ehe er ihr sagen konnte, dass er sie dann in den Pferdetrog werfen würde.
»Sie sind Mr Clayborne? Das kann nicht sein«, stammelte sie mit entsetztem Gesicht. »Sie sind kein ... alter Mann.«
»Aber jung auch nicht«, brummte er. »Ich heiße Travis Clayborne«, setzte er hinzu, aber weil seine Kniescheibe immer noch schmerzte, machte er sich nicht die Mühe, seinen Hut zu lüften. »Geben Sie mir die Waffe.«
Sie hatte keine Einwände, sondern legte ihm nur seufzend die Waffe in die Handfläche. Sie entschuldigte sich aber auch nicht. Das fiel ihm sofort auf.
»Ich fürchte, dass ich eine Woche lang humpeln muss. Was haben Sie in den Schuhen? Eisen?«
Ihr Lächeln war verwirrend, und Himmel, sie hatte ein niedliches kleines Grübchen in der rechten Wange! Wenn Travis nicht schon beschlossen hätte, dass er sie nicht mochte, hätte er jetzt gedacht, dass sie wesentlich mehr war als nur hübsch. Sie war entzückend. Er rief sich schnell ins Gedächtnis, dass diese verrückte Frau vor ihm ihn gerade hatte töten wollen.
»Was für eine dumme Annahme!«, sagte sie kopfschüttelnd. »Natürlich habe ich kein Eisen in meinen Schuhen. Es tut mir leid, dass ich Sie getreten habe, aber Sie haben sich so an mich herangeschlichen.«
»Nein, habe ich nicht.«
»Wenn Sie es sagen«, erwiderte sie in dem Bestreben, es ihm recht zu machen. »Sie haben mich nur ärgern wollen, als Sie sagten, Sie hätten Ihre Meinung geändert, nicht wahr? Sie würden doch nicht wirklich eine hilflose Dame in der Stunde der Not im Stich lassen?«
Die kleine Frau hatte Humor! Zu der Erkenntnis kam Travis, als Emily ihm sagte, sie sei hilflos. Sie hatte dabei auch noch ein ernstes Gesicht gemacht, und da spielte es keine Rolle, dass sein Schienbein von ihrem Tritt noch höllisch brannte, er hätte am liebsten gelacht. Natürlich konnte er es nicht abwarten, sie loszuwerden, aber seine Stimmung hatte sich gebessert.
Mr Clayborne brauchte entschieden zu lange, um ihre Frage zu beantworten. Der Gedanke, einmal mehr im Niemandsland gestrandet zu sein, sandte Emily kalte Schauer über den Rücken. Sie seufzte leise und entschied, dass es nur noch eines gab, das da half ...
Gott helfe ihr, aber sie musste mit diesem Schuft flirten! Seufzend zog sie den nutzlosen rosa-weißen Fächer hervor, den sie sich für viel zuviel Geld in St. Louis gekauft hatte, klappte ihn mit einer eleganten Bewegung des Handgelenks, die sie stundenlang im Zug geübt hatte, auf, und hielt ihn sich vors Gesicht. Damit bedeckte sie ihre Wangen, damit er ihr Erröten nicht sah, wenn sie jetzt etwas ihrer Ansicht nach völlig Lächerliches tat.
Sie wollte nicht nur versuchen zu flirten, sie wollte außerdem scheu wirken. Sie holte tief Luft, um sich nicht durch ein Stöhnen zu verraten, und schlug dann die Augen so zu ihm auf, wie ihre Schwester Barbara es immer machte. Barbara hatte immer extrem scheu ausgesehen, bei sich hatte Emily das Gefühl, extrem idiotisch auszusehen. Der Himmel wusste, dass sie sich so fühlte.
Sie merkte, dass sich ihr praktisches, erdverbundenes Wesen, das ihr normalerweise eigen war, schon wieder an die Oberfläche drängen wollte, und unterdrückte diesen Impuls rasch. Sie hatte geschworen, alles an sich zu ändern, und sie würde jetzt nicht aufgeben, egal, wie blöd sie sich vorkam.
Travis sah eine lange, stumme Minute zu, wie sie ihn mit ihrem Augenaufschlag anstrahlte. Keine Frage, sie war verrückt, und plötzlich tat sie ihm leid. Sie gehörte eindeutig nicht hierher, angezogen wie für eine Dinnerparty, stand sie mitten im Dreck, der unter dem Namen Pritchard bekannt war, und tat ihr Bestes, um gute Manieren zu zeigen.
Er wusste, dass sie vorhatte, ihn zu manipulieren, und er beschloss, ein bisschen mitzuspielen.
»Vielleicht sollten Sie erst noch Doc Morgenstern konsultieren, ehe Sie irgendwo hingehen, Ma’am. Möglicherweise hat er etwas gegen das Zucken Ihrer Augen. Ich will Ihnen ja nicht wehtun, aber es muss Sie doch stören.«
Sie klappte ihren Fächer zu und seufzte laut auf. »Entweder sind Sie so empfindsam wie ein Baum, Mr Clayborne, oder ich habe die Kunst noch nicht ganz vervollkommnet.«
»Welche Kunst?«, fragte er.
»Die des Flirtens, Mr Clayborne. Ich habe versucht, mit Ihnen zu flirten.«
Ihre Ehrlichkeit machte Eindruck auf ihn. »Warum?«
»Warum? Na, damit Sie machen, was ich will. Aber ich bin nicht sehr gut darin, nicht wahr?«
Diese absurde Frage beantwortete er nicht. »Das Zucken hat aufgehört«, knurrte er.
»Ich habe nicht gezuckt«, murmelte sie. »Meine Augen sind in Ordnung, kein Grund zur Sorge. Ich habe nur meine Technik an Ihnen ausprobiert, das ist alles. Wollen wir gehen und Mrs Clayborne abholen, damit wir uns auf den Weg machen können? Ich hoffe, dass sie ein angenehmerer Umgang ist als Sie, Sir. Hören Sie bitte auf, mich anzugaffen. Ich will noch vor dem Dunkelwerden meinen Bestimmungsort erreichen.«
»Es gibt keine Mrs Clayborne.«
»Oh, das geht nicht!«
Er beugte sich zu ihr herab. »Können Sie bitte etwas sagen, das Sinn macht?«
Sie trat einen Schritt zurück. Der Mann sah für ihren Geschmack entschieden zu gut aus. Er hatte die wunderbarsten grünen Augen, die sie jemals gesehen hatte. Die Farbe war ihr aufgefallen, als er sie so wütend angesehen und ihren Arm nach oben gerissen hatte. Da hatte sie auch bemerkt, wie durchtrainiert und stark er war.
Travis Clayborne war groß und schlank, hatte aber ausgeprägte Arm- und Schultermuskeln. Weiter nach unten wagte sie nicht zu schauen, sonst dachte er am Ende, sie wollte ihn wieder treten, aber sie war sich sicher, dass auch seine Beine genau richtig waren.
Kein Zweifel, er war ein extrem gut aussehender Mann. Wahrscheinlich waren die Frauen pausenlos hinter ihm her. Sie waren sicher gegenüber diesen grünen Augen hilflos. Auch sein Lächeln konnte beträchtlichen Schaden anrichten. Nun, er hatte sie erst einmal – und das nur kurz – angelächelt, aber schon das hatte ausgereicht, ihren Herzschlag zu beschleunigen. Wahrscheinlich hatte er schon unzählige Frauenherzen gebrochen, aber sie hatte nicht vor, mit auf dieser Liste zu erscheinen. Diese schmerzhafte Lektion kannte sie schon, nein, vielen Dank!
Miss Finnegan sah plötzlich zu ihm auf, und er wusste nicht, was ihren plötzlichen Verhaltensumschwung bewirkt hatte. »Ich habe Sie gefragt, warum ich verheiratet sein muss, um Sie nach Golden Crest zu begleiten.«
»Weil es sich ganz und gar nicht für mich schicken würde, mit so einem gut aussehenden Mann in die Wildnis zu reiten. Was würden die Leute denken?«
»Wen interessiert das? Kennen Sie hier jemanden?«
»Nein, aber ich werde sie kennenlernen, wenn ich mit Mr O’Toole verheiratet bin. Wenn Golden Crest nur einen Tagesritt entfernt liegt, gehe ich hier vielleicht einkaufen. Sie können meine Vorbehalte doch sicher verstehen, Sir. Ich muss auf meinen Ruf achten.«
Er zuckte die Achseln. »Wenn Sie nicht mitkommen können, habe ich mein Versprechen, Ihnen meine Hilfe anzubieten, erfüllt. Guten Tag, Ma’am.«
Er wandte sich zum Gehen. Sein Verhalten schien sie vor den Kopf zu stoßen. »Warten Sie«, rief sie und eilte ihm nach. »Sie wollen mich doch nicht hier alleinlassen? Ein Gentleman würde niemals eine Lady in Not ...«
»Wahrscheinlich bin ich kein Gentleman«, warf er über die Schulter, ohne seine Schritte zu verlangsamen. »Und ich bin mir sicher, dass Sie keine Lady in Not sind.«
Sie umklammerte seinen Arm und stemmte die Hacken in den Boden, um ihn aufzuhalten, stattdessen schleifte er sie mit sich.
»Aber ganz sicher bin ich in Not, und es ist gemein von Ihnen, mir zu widersprechen.«
»Eben war ich noch attraktiv, und jetzt bin ich gemein?«
»Sie sind beides«, erklärte sie.
Plötzlich drehte er sich um, um sie anzusehen. Er wusste, dass er sie nicht in Pritchard sich selbst überlassen konnte, nicht, wenn er Mama Rose je wieder in die Augen sehen wollte. Wenn er die Frau jedoch nach Golden Crest führen und dabei einigermaßen bei geistiger Gesundheit bleiben wollte, musste er mit ihr zu einer Übereinkunft kommen.
»Das ist nicht unbedingt ein Kompliment«, erklärte sie und errötete leicht, was ihr sehr gut stand.
»Was ist kein Kompliment?«
»Attraktiv zu sein. Ich fand auch Randolph Smythe attraktiv, aber er hat sich als widerliche Kreatur entpuppt.«
Frag jetzt nicht, befahl er sich.
»Wollen Sie nicht wissen, wer Randolph Smythe ist?«
»Nein.«
Sie erklärte es ihm trotzdem. »Er ist der Mann, den ich heiraten sollte.«
Damit hatte sie seine Aufmerksamkeit geweckt. »Aber Sie haben es nicht getan«, sagte er.
»Nein, doch ich war dazu bereit.«
»Wie bereit?«
Sie errötete noch mehr. »Begleiten Sie mich nach Golden Crest oder nicht?«
Er wollte nicht zulassen, dass sie jetzt, wo es interessant wurde, das Thema wechselte.
»Wie bereit?«, fragte er noch einmal.
»Ich habe am Altar auf ihn gewartet. Aber er ist nicht gekommen«, ergänzte sie mit einem kurzen Nicken.
»Er hat Sie versetzt? Das ist wirklich eine gemeine Sache«, sagte er in dem Versuch, freundlich zu sein. »Ich kann mir nicht vorstellen, warum er in letzter Minute seine Meinung geändert haben sollte.«
Travis sagte nicht die Wahrheit. Er war sich ziemlich sicher, dass er genau wusste, warum der gute, alte Randolph sich anders besonnen hatte. Der Mann war zur Vernunft gekommen. Travis fragte sich kurz, ob Emily je versucht hatte, ihn zu erschießen. Das würde genügen, um jeden auch nur halbwegs verständigen Mann in die Flucht zu jagen.
»Es gab also keine Hochzeit«, bemerkte er, weil ihm sonst nichts dazu einfiel. Sie sah mit einem so ernsten, hoffnungsvollen Ausdruck im Gesicht zu ihm auf, sicher hoffte sie, dass er etwas Mitfühlendes sagte.
Er tat sein Bestes. »Manche Männer mögen es einfach nicht, an nur eine Frau gefesselt zu sein. Wahrscheinlich gehörte Randolph dazu.«
»Nein, tat er nicht.«
»Hören Sie, Lady, ich will nur nett sein.«
»Interessiert es Sie nicht, warum er nicht zur Kirche gekommen ist?«
»Sie haben sicher auf ihn geschossen.«
»Habe ich nicht.«
»Mich interessieren seine Gründe wirklich nicht. Okay? Machen Sie es kurz, und sagen Sie, dass keine Hochzeit stattfand.«
»Oh, aber es gab eine Hochzeit. Habe ich erwähnt, Mr Clayborne, dass meine Schwester auch nicht zur Kirche kam?«
»Sie machen Witze.«
»Es ist mein Ernst.«
»Ihre Schwester und Randolph ...«
»Sind jetzt verheiratet.«
Er war schockiert. »Aus was für einer Familie kommen Sie denn? Ihre eigene Schwester hat Sie verraten?«
»Wir standen uns nie besonders nahe«, versicherte sie ihm.
Er sah sie an. »Ich kann mir nicht helfen, aber Sie machen mir nicht den Eindruck, als seien Sie dadurch allzu erschüttert.«
Travis schüttelte den Kopf. Er wusste nicht, warum die Geschichte ihn so berührte. Er kannte Randolph Smythe nicht einmal, aber dennoch hätte er ihn am liebsten verprügelt, weil er Emily das angetan hatte. Dabei kannte er Emily ja auch nicht. Warum sollte es ihn dann überhaupt berühren?
Sie sah das Mitleid in seinen Augen und blickte ihn wütend an. »Wagen Sie es etwa, mich zu bemitleiden, Mr Clayborne?«
Emily Finnegan sah ganz so aus, als wollte sie ihn wieder treten. Jede Sympathie, die er für sie empfunden hatte, verschwand auf der Stelle.
»Wahrscheinlich war es Ihre eigene Schuld.«
Wenn Blicke töten könnten, müsste man ihm jetzt den Sarg anmessen. Travis steckte nicht zurück, sondern nickte noch kurz, um seine Aussage zu bekräftigen.
»Wie denn?«, wollte sie wissen und schlug ihn versehentlich mit ihrem Regenschirm, als sie die Arme vor der Brust verschränkte. Weil er gerade so eine unhöfliche Bemerkung gemacht hatte, sah sie keinen Grund, sich zu entschuldigen.
Er dachte, sie hätte es mit Absicht getan, ergriff den Regenschirm, warf ihn auf ihr Gepäck und antwortete dann.
»Sie haben sich einen Mann ohne Skrupel ausgesucht, deswegen ist es Ihre Schuld. Außerdem sollten Sie mittlerweile wissen, dass Sie ohne ihn besser dran sind.«
Ihre Empörung war verflogen. Er hatte sie ja nicht aus Grausamkeit beschuldigt, er war nur ehrlich. Außerdem hatte er recht. Sie hatte einen Mann ohne Skrupel gewählt.
»Bringen Sie mich nun nach Golden Crest oder nicht?«
»Was ist mit dem Paar passiert, das in Ihrer Gesellschaft war?«
»Drücken Sie sich bitte etwas deutlicher aus.«
»Deutlicher?«
»Welches Paar meinen Sie?«, fragte sie.
Jetzt war er ganz aufmerksam. »Wie viele waren es denn?«
»Drei.«
»Drei Leute oder drei Paare?«
»Paare«, gab sie zur Antwort.
Ihm fiel auf, dass sie rasch zu Boden sah und etwas unbehaglich dreinschaute. Offenbar war ihr das Thema unangenehm. Dann fiel ihm ein, dass sein Bruder Cole ihm erzählt hatte, dass die abergläubischen Einwohner von Pritchard Angst vor Miss Emily Finnegan hatten. Er hätte bei der Unterhaltung besser aufpassen sollen, dachte er, jetzt war es zu spät. Dennoch wollte er erst die Einzelheiten wissen, ehe er die Frau irgendwohin brachte – nur um sicherzugehen.
»Sie haben schon sechs verschiedene Begleiter gehabt?«
»Es war eine sehr lange Reise, Mr Clayborne.«
»Was ist mit dem ersten Paar passiert?«
»Die Johnsons?«
»Richtig, die Johnsons«, bestätigte er, damit sie weitersprach. »Was ist ihnen geschehen?«
»Es war recht tragisch.«
Er hatte geahnt, dass sie das sagen würde. »Darauf wette ich. Was haben Sie mit ihnen gemacht?«
Sie versteifte sich. »Ich habe gar nichts mit ihnen gemacht. Sie sind im Zug krank geworden, ich glaube, sie hatten etwas Falsches gegessen. Einige von den anderen Mitreisenden waren auch krank«, setzte sie hinzu. »Die Johnsons sind in Chicago geblieben. Ich bin mir sicher, dass sie sich mittlerweile völlig erholt haben.«
»Was ist mit dem zweiten Paar passiert?«
»Meinen Sie die Porters? Das war ebenfalls recht tragisch«, musste sie zugeben. »Sie wurden auch krank. Der Fisch, wissen Sie?«
»Der Fisch?«
»Ja, sie haben auch Fisch gegessen. Ich glaube, dass er schlecht geworden war, und ich habe Mr Porter noch gewarnt, aber er war einer vernünftigen Argumentation nicht zugänglich. Er hat ihn trotzdem gegessen.«
»Und?«
»Seine Frau und er wurden in St. Louis aus dem Zug geholt.«
»An Fischvergiftung kann ein Mann sterben.«
Sie nickte heftig. »Der arme Mr Porter ist daran gestorben.«
»Und Mrs Porter?«
»Sie hat allen anderen die Schuld am Tod ihres Mannes gegeben, sogar mir. Können Sie sich das vorstellen? Ich hatte ihn gewarnt, den Fisch zu essen, aber er war nicht davon abzubringen.«
»Warum hat sie dann Sie beschuldigt?«
»Weil auch die Johnsons krank geworden waren. Sie glaubte nicht, dass es am Essen lag. Sie dachte, ich würde alle krank machen. Gucken Sie nicht so nachdenklich, Sir! Wenn Sie keinen Fisch essen, geht es ihnen sicher gut.«
»Hat das dritte Paar auch Fisch gegessen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, aber es war dennoch recht ...«
»Tragisch?«, vollendete er den Satz für sie.
»Ja, tragisch«, stimmte sie zu. »Woher wissen Sie das? Haben Sie schon gehört, was Mr Hanes zugestoßen ist?«
»Nein, es war nur eine Vermutung. Was ist Hanes zugestoßen?«
»Er wurde angeschossen.«
»Ich wusste doch, dass Sie jemanden angeschossen haben.«
»Ich doch nicht«, schrie sie auf. »Wie kommen Sie darauf, dass ich so etwas Schreckliches tun würde?«
»Sie haben versucht, mich zu erschießen«, erinnerte er sie.
»Das war ein Unfall.«
Er entschied sich, ihr zuzustimmen. »Na gut, haben Sie Mr Hanes versehentlich angeschossen?«
»Nein, habe ich nicht. Ein anderer Mann und er haben Karten gespielt, und plötzlich hat einer von ihnen – ich weiß nicht mehr, wer – den anderen beschuldigt, falsch zu spielen. Ein Kampf brach aus, und Mr Hanes wurde angeschossen. Es war keine tödliche Wunde, und den anderen Mann hätte es genauso gut treffen können, weil sie ihre Kugeln aufeinander abgefeuert haben. Es war alles sehr unzivilisiert. Ich habe mir meinen besten Hut ruiniert, als ich mit Mrs Hanes unter den Stuhl gekrochen bin, damit ich nicht von einem Querschläger getroffen werde.«
»Und was passierte dann?«
»Der Schaffner hat Mr Hanes den Arm verbunden, den Zug vor Emmerson Point anhalten lassen und ihn und seine Frau der Obhut des dortigen Arztes übergeben.«
»Und den Rest des Weges haben Sie allein zurückgelegt?«
»Ja«, bestätigte sie. »Ich würde auch alleine nach Golden Crest gehen, wenn ich den Weg wüsste. Der Hotelbesitzer hat mir gesagt, dass ich einen Führer brauche, deshalb habe ich nach einem gesucht. Dann haben Sie Ihre Dienste angeboten. Sie werden mich doch begleiten, oder?«
»Gut, ich werde es machen.«
»Oh, vielen Dank, Mr Clayborne!«, flüsterte sie. Sie ergriff seine Hand und lächelte. »Sie werden es nicht bereuen.«
»Nennen Sie mich Travis.«
»Sehr gut. Ich weiß Ihre Freundlichkeit zu schätzen, Travis, dass Sie mich begleiten wollen.«
»Ich bin nicht freundlich. So wie ich es sehe, sitze ich hier mit Ihnen fest, und je eher wir aufbrechen, desto eher bin ich Sie auch wieder los.«
Sie ließ seine Hand los und wandte sich ihrem Gepäck zu. »Wenn ich mich nicht gerade daran erinnert hätte, dass ich ja in Zukunft nicht mehr offen und aufrichtig sein will, hätte ich Ihnen jetzt gesagt, dass ich Sie für einen äußerst unhöflichen und feindseligen Mann halte.«
»Sie sind nur aufrichtig und offen gewesen, seit Sie den Mund aufgemacht haben, oder?«
»Ja, aber mir ist auch eben erst wieder eingefallen, dass ich es nicht mehr sein wollte.«
»Diesmal bitte ich Sie nicht, mir das zu erklären«, murmelte er. »Warten Sie hier, während ich die Pferde hole. Ach, Emily, Sie können nur zwei Päckchen mitnehmen. O’Toole wird kommen und die anderen holen müssen. Vorerst können Sie sie im Hotel lassen. Olsen passt auf sie auf.«
»Ich werde nichts Derartiges tun«, rief sie, damit er sie hören konnte. Dieser ungehobelte Mann war nämlich schon halb die Straße hinunter. »Ich nehme jede Tasche mit, und damit basta.«
»Nein, das tun Sie nicht, aber Sie können es ja versuchen.«
Emily knirschte frustriert mit den Zähnen. Sie sah zu, wie er den Bürgersteig entlangschlenderte, wie sich seine Schultern und Hüften bei jedem Schritt wiegten, und fand seine Arroganz höchst anziehend. Keine Frage, er war ein gut aussehender Mann. Ein Jammer, dass er auch unausstehlich war!
Seufzend zwang sie sich, den Blick abzuwenden. Sie sollte in Kürze Mr O’Toole heiraten, ermahnte sie sich, da durfte sie nicht sehen, wie gut andere Männer aussahen.
Nicht sie war die Straßenkatze in der Familie, sondern Barbara. Emily war die Vernünftige, Verlässliche – wie ein Paar ausgetretener, aber bequemer Schuhe, dachte sie. Nein, in der Vergangenheit war sie immer vernünftig und verlässlich gewesen. Das musste jetzt ein Ende haben.
Travis wollte gerade die Straße überqueren, als sie ihm etwas zurief.
»Travis, ich sollte Sie warnen, ich bin kein bisschen verlässlich.«
»Das habe ich auch nicht angenommen«, rief er zurück. »Ihnen fehlt auch jeglicher Verstand.«
Sie lächelte zufrieden. Ihre Reaktion ließ ihn abrupt stehenbleiben.
»Sie glauben nicht, dass ich besonders vernünftig bin?«
Ganz im Ernst, seine Beleidigung schien sie zu entzücken! Merkte die Frau denn nicht, dass er sie gerade beleidigt hatte? Nein, nicht beleidigt, präzisierte er. Er hatte nur die Wahrheit gesagt.
»Emily?«
»Ja?«
»Weiß O’Toole, dass er eine Verrückte heiratet?«
Kapitel 3
Emily grollte. Ihre finsteren Blicke und das eiserne Schweigen waren höchst amüsant, aber Travis wagte es nicht zu lachen oder auch nur ein Lächeln zu zeigen. Dann hätte sie gewusst, dass er ihr Verhalten komisch fand, und dann hätte er keine ruhige Minute mehr.
Sie sprach nicht mehr mit ihm, bis sie am späten Nachmittag anhielten, um ihre Pferde ausruhen zu lassen. Zumindest war das die Begründung, die er ihr gab. Sie schien die Lüge auch zu glauben. In Wirklichkeit machte er Rast, damit sie ihren Allerwertesten ausruhen konnte. Emily war keine geübte Reiterin, und die Art, wie ihr Hinterteil klatschend auf den Sattel prallte, trug zu ihrem schmerzlichen Gesichtsausdruck noch bei.
Als Emily es schließlich schaffte, vom Pferd zu steigen, konnte sie kaum noch aufrecht stehen. Sie ließ aber nicht zu, dass er ihr half, und fand sein übertrieben beleidigtes Gesicht auch nicht im mindesten komisch.
Da sie schon ein ganzes Stück in die Berge geritten waren, war die Luft viel kühler geworden. Er nahm sich die Zeit und die Mühe, ein Lagerfeuer anzuzünden, damit Emily aufhörte zu frieren. Sie aßen schweigend ein karges Mittagsmahl, und als er gerade zu überlegen begann, dass der Ausflug doch nicht ganz so schrecklich würde, kam sie und ruinierte alles.
»Das haben Sie absichtlich getan, Travis. Geben Sie es zu, entschuldigen Sie sich, und dann verzeihe ich Ihnen.«
»Ich habe es nicht absichtlich getan. Sie sollten Ihr rechtes Bein über den Sattelknauf hängen, erinnern Sie sich? Sie waren die, die darauf bestanden hat, im Damensitz zu reiten. Woher sollte ich wissen, dass Sie das noch nie gemacht haben?«
»Im Süden reiten Damen im Damensitz«, verkündete sie.
Er spürte, dass er Kopfschmerzen bekam. »Aber Sie sind nicht aus dem Süden, nicht wahr? Sie sind aus Boston.«
»Na und? Südstaatendamen sind verfeinert in der Lebensart. Das weiß doch jeder, und deshalb habe ich auch beschlossen, mich wie eine Südstaatendame zu benehmen.«
Er spürte den Schmerz in seinen Schläfen klopfen. »Sie können nicht einfach beschließen, eine Südstaatendame zu sein.«
»Aber natürlich kann ich das. Ich kann alles sein, was ich sein will.«
»Warum der Süden?«, fragte er wider besseres Wissen.
»Der leichte Akzent gilt bei einer Dame als sehr feminin und musikalisch. Ich habe das genau untersucht, und ich versichere Ihnen, dass ich weiß, wovon ich rede. Ich glaube außerdem, dass ich den Akzent perfektioniert habe. Wollen Sie mal hören, wie ich sage ...«
»Nein, will ich nicht. Emily, nicht alle Damen aus dem Süden reiten im Damensitz.«
Der Blick, den sie ihm zuwarf, ließ ihn bedauern, das Thema Sattel überhaupt angesprochen zu haben.
»Die meisten Südstaatendamen tun es«, sagte sie. »Und nur, weil ich noch nie im Damensitz geritten bin, heißt das nicht, dass ich es nicht geschafft hätte, wenn Sie sich nicht eingemischt hätten. Sie haben mich absichtlich über dieses Pferd geworfen, stimmt’s? Sie hätten mir den Hals brechen können.«
Er war nicht dazu bereit, die Schuld für ihre Unfähigkeit auf sich zu nehmen. »Ich habe Ihnen doch nur auf den Rücken des Pferdes geholfen. Woher sollte ich wissen, dass Sie weiterrutschen? Ist Ihre Schulter noch wund?«
»Nein, und ich weiß es zu schätzen, dass Sie den Schmerz fortmassiert haben, aber mein Kleid ist wegen Ihnen jetzt voller Dreck. Was wird Clifford O’Toole von mir denken?«
»Sie haben ein Paar Handschuhe mit einem großen Kugelloch darin getragen. Das wird ihm wahrscheinlich zuallererst auffallen. Außerdem ist ihm Ihr Aussehen egal, wenn er Sie liebt.«
Sie biss noch einmal von ihrem Apfel ab, ehe sie sich entschloss, ihm die Wahrheit zu sagen.
»Er liebt mich nicht. Wie sollte er? Wir haben uns noch nie im Leben gesehen.«
Er schloss die Augen. Eine Unterhaltung mit Emily erwies sich als so schwierig wie ein Streit mit Cole. Es war hoffnungslos.
»Sie werden einen Mann heiraten, den Sie nie kennengelernt haben? Ist das nicht ein bisschen seltsam?«
»Eigentlich nicht. Sie haben doch von Brieffreundinnen gehört, oder?«
»Sind Sie eine von Ihnen?«
»Sozusagen«, wich sie aus. Natürlich war sie eine, aber ihr Stolz verbot ihr, das zuzugeben. »Mr O’Toole und ich haben korrespondiert, und ich denke, dass ich ihn mittlerweile sehr gut kenne. Er ist ein sehr beredter Briefeschreiber. Und ein Poet.«
»Er hat Ihnen Gedichte geschrieben?«, fragte er grinsend.
Sie hob das Kinn. »Was ist daran amüsant?«
»Er scheint ein Muttersöhnchen zu sein.«
»Ich versichere Ihnen, dass er das nicht ist. Seine Gedichte sind wundervoll. Hören Sie auf, mich anzugrinsen! Die Verse sind wundervoll, und er ist ein sehr kluger Mann. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie ja seine Briefe lesen. Ich habe alle drei in meinem Gepäck. Soll ich sie für Sie holen?«
»Ich will seine Briefe nicht lesen. Sie haben mir noch immer nicht erklärt, warum Sie einen völlig Fremden heiraten wollen.«
»Ich habe einmal versucht, jemanden zu heiraten, den ich kannte. Sie wissen ja, wie das ausgegangen ist.«
»Sie haben das also beschlossen, nachdem Randolph Smythe sie vor dem Altar hat stehen lassen, ja?«
»Sagen wir so, es war die letzte Enttäuschung, die ich erleben wollte.«
»Tatsächlich?«, bemerkte er und fragte sich, wie sie künftige Enttäuschungen vermeiden wollte.
Sie schien seine Gedanken zu lesen. »Ich bin damals die ganze Nacht aufgewesen ... in meiner Hochzeitsnacht«, sagte sie.
»Haben Sie geweint?«
»Nein, ich habe nicht geweint. Ich habe die ganze Nacht über meine Umstände nachgedacht und bin schließlich zu einem Entschluss gelangt, der meines Erachtens alles ändern würde. Ich bin immer geradeheraus und ehrlich gewesen. Nun nicht mehr, vielen Dank!«
»Wie kommt es, dass Sie mir gegenüber aufrichtig sind?«
Sie zuckte die Achseln. »Ich nehme an, ich sollte es nicht sein. Aber nach heute werde ich Sie nie wiedersehen – zumindest denke ich das – deshalb macht es nichts, wenn Sie wissen, dass ich eine Mogelpackung bin. Keiner sonst wird es wissen.«
»Wenn Sie vorgeben, etwas zu sein, was Sie gar nicht sind, macht das die Dinge nur noch schlimmer.«
Sie sah das anders. »Ich selbst zu sein, hat mir kein bisschen genützt, und als ich das herausgefunden hatte, habe ich beschlossen, mich selbst neu zu erfinden. Ich hatte es satt, hart zu arbeiten und immerzu so schrecklich praktisch zu sein.«
»Sie reagieren über, das ist alles.« Und Sie sind verrückt, setzte er im stillen hinzu. »Ihr Stolz war verletzt, aber das werden Sie überwinden.«
Seine kavaliersmäßige Einstellung verwirrte sie. »Ich weiß genau, was ich tue, und Stolz hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Harte Arbeit hat mich nicht weitergebracht. Soll ich Ihnen ein Beispiel erzählen?«
Sie wartete seine Antwort gar nicht erst ab, sondern legte los:
»Randolph wollte Bankbeamter werden. Er fing gerade sein letztes Jahr an der Universität an, als wir uns offiziell verlobt haben. Das Studium war schwer, und er hatte Angst, dass man ihn wegen seiner Noten nicht mehr zulassen würde. Ich habe ihm gesagt, wenn er keine Einladungen mehr annehmen und stattdessen lernen würde, käme ihm das zugute, aber er wollte nicht auf mich hören. Er bat mich, ihm bei seinen Arbeiten behilflich zu sein, und weil ich ihm helfen wollte, habe ich schließlich ein paar Essays für ihn geschrieben. Er sollte sie als Studienmuster nehmen, aber später habe ich herausgefunden, dass er seinen Namen oben drauf gesetzt und sie dem Professor übergeben hat. Das war gar nicht anständig von ihm. Und wissen Sie, was das Ergebnis war? Er hat mit Auszeichnung bestanden und ist von der besten Bank in Boston angestellt worden! Sein Anfangsgehalt war beeindruckend. Da fing meine Schwester an, sich für ihn zu interessieren. Zu komisch, was? Wenn ich ihm nicht geholfen hätte, hätte er nicht so eine gute Stelle bekommen, und meine Schwester hätte sich dann nie für ihn interessiert.
Aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt, weshalb Mr O’Toole und ich so gut zusammenpassen. Randolph hat alle seine Versprechen, die er mir gegeben hat, gebrochen, aber ich werde nicht zulassen, dass Mr O’Toole sein Wort bricht.«
»Wie wollen Sie ihn daran hindern?«
Sie ignorierte seine Frage. »Er ist vielleicht nicht so reich wie Randolph, aber fast, und er lebt hier draußen in diesem schönen, wilden, ungezähmten Land, was ihn für mich genauso anziehend macht. Ich habe das Leben in der Stadt immer gehasst, ich habe nie richtig dorthin gepasst. Ich weiß, dass Sie das nicht verstehen, weil Sie Ihr ganzes Leben hier verbracht haben, aber ich hatte das Gefühl, ich würde ersticken. Die Luft ist schmutzig, die Straßen sind überfüllt, und wo man hinsieht, stehen Häuser, die so groß sind, dass man den Himmel nicht sehen kann.«
»Wollten Sie nicht mit Randolph in Boston leben?«
»Er hatte mir versprochen, dass er nach einem Jahr Ehe mit mir in den Westen ziehen würde. Vater war entsetzt. Er fand, dass Randolphs schönes Gehalt bei der Bank viel wichtiger sei als meine Atemprobleme.«
»Geld ist nicht wichtiger. Ich weiß noch, wie es war, in New York zu leben.«
Ihre Augen weiteten sich erstaunt. »Sie haben im Osten gelebt?«
»Bis ich zehn oder elf war.«
»Warum sind Sie umgezogen?«
Er wollte nur ihre Frage beantworten und ein bisschen aus seiner Vergangenheit erzählen, aber sie war eine Frau, mit der man so gut reden konnte, dass er ihr am Ende viel mehr erzählte, als er eigentlich vorgehabt hatte. Travis verschwendete eine gute halbe Stunde damit, ihr von seinen Brüdern, seiner Schwester und ihrem Mann und seiner Mama Rose zu erzählen. Sie war von seiner Familie deutlich fasziniert und lächelte, als er erwähnte, dass er Anwalt werden wollte. Er hätte schwören können, dass ihr Tränen in die Augen traten, als er ihr erzählte, dass Mama Rose endlich zu Hause war.
»Sie haben Glück, dass Sie so eine harmonische Familie haben.«
Er nickte. »Und was ist mit Ihnen?«
»Ich habe sieben Schwestern. Ich hoffe, dass eines Tages eine von ihnen zu Mr O’Toole und mir zu Besuch kommt. Er besitzt ein großes Haus mit einer geschwungenen Treppe. Das hat er mir in einem seiner Briefe erzählt.«
Travis war das Haus, in dem sie leben würde, egal. »Sie werden es bereuen, wenn Sie einen Mann heiraten, den Sie nicht lieben.«
Sie reagierte nicht auf seine Bemerkung. Er sah zu, wie sie sich mit den Fingern durchs Haar fuhr. Egal, wie sehr sie darin herumwühlte, ihre Locken fielen immer wieder keck in ihr Gesicht. Wenn sie wollte, konnte sie einen wirklich bezirzen. Sie war außerdem sehr weiblich, und wenn sie es lernte, weniger verrückt zu sein, wäre sie sogar perfekt.
Er entschloss sich, ihr das zu sagen. »Wissen Sie, was Ihr Problem ist?«
»Ja, ich weiß«, erwiderte sie. »Ich hätte von meiner Schwester lernen sollen. Barbara ist kein bisschen praktisch. Und vernünftig ist sie auch nicht. Außerdem gibt sie vor, hilflos zu sein, und kann hervorragend flirten.«
»Kein Mann will eine hilflose Frau, wohingegen eine praktische höchst nützlich ist.«
Travis erhob sich, ehe sie ihm widersprechen konnte, streckte sich, lockerte die Muskeln, indem er seinen Nacken reckte, und fing dann an, Steine zu sammeln, um das Feuer zu löschen.
Sie überraschte ihn, indem sie ihm half. Nach ein paar Minuten war die Arbeit erledigt, und plötzlich hatte er es eilig aufzubrechen. Travis hatte entschieden zuviel Zeit damit verbracht, über sich selbst und seine Familie zu reden. Er verstand nicht, wie es dazu hatte kommen können, denn normalerweise erzählte er Außenstehenden nie so viel Privates.
Obwohl er Emily nicht als Außenstehende betrachtete, Sie war ... anders. Er konnte nicht genau sagen, was es war, was sie ihm so vertraut erscheinen ließ, aber es war so, und das war so ausgeprägt, dass seine Instinkte ihn warnten, auf Distanz zu gehen. Sein Körper dachte anders darüber. Travis hatte sich schon ein paarmal ausgemalt mit ihr zu schlafen. Er hatte versucht, sie sich ohne Kleider vorzustellen, was eine Menge Phantasie voraussetzte, da sie vom Kinn bis zu den Zehen von Stoff verhüllt war.
Er hatte das Gefühl, dass sie umwerfend war. So, wie sie ihr Kleid ausfüllte, wie schmal ihre Taille war, wie schlank ihre Hüften waren, bekam er den Eindruck, dass sie eine sehr gute Figur hatte, die ihn nicht enttäuschen würde. Die Frau hatte die richtigen Kurven – und die an den richtigen Stellen.
Aber es vorzuhaben und es wirklich zu tun, waren zwei verschiedene Paar Schuhe. Travis wollte seiner Lust nicht nachgeben, aber er hatte auch keine Schuldgefühle, sich allerhand auszumalen. Sie war eine sinnliche Frau, und er schätzte eine schöne Frau so sehr wie jeder andere Mann, der in der Wildnis lebte.
Nein, ihre körperliche Anziehungskraft auf ihn machte ihm keinen Kummer. Damit wurde er leicht fertig. Was ihn störte, war der Umstand, dass er tatsächlich anfing, ihre Gesellschaft zu genießen, obwohl es ihm ein Rätsel war, warum ihm der Umgang mit so einer verrückten Frau gefiel. Emily brachte ihn zum Lachen, aber nur, weil sie dauernd so seltsame Sachen sagte.
Es gefiel ihm, sie anzusehen. Daran war nichts falsch, sagte er sich. Im Gegenteil, es wäre unnormal, nicht hinzugucken. Er war ein gesunder Mann mit normalen Bedürfnissen, und Emily wurde mit jeder Minute hübscher. Das hieß ja nicht gleich, dass er von ihr hingerissen war.
Nachdem er seine Gefühle analysiert hatte, fühlte er sich besser. Er hörte auch auf, die Stirn zu runzeln. Travis sah zu, wie sie den Rest ihres Apfels an ihr Pferd verfütterte, fand, dass das süß und vernünftig war, und fragte sich dann, ob sie sich darüber im Klaren war, wie schwer es werden würde, Clifford O’Toole gegenüber die hilflose Frau zu spielen.
Er wartete bei den Pferden, während sie zum Fluss ging, um sich zu waschen. Als sie zu ihm zurückgelaufen kam, hatte er ein seltsames Gefühl in der Magengegend. Ihr Gesicht war vom klaren Bergwasser rosig, und sie lächelte glücklich über den, wie sie es nannte, herrlichen Tag. Er dachte daran, sie auf der Stelle zu küssen, und dann musste er sich sehr beherrschen, um die Hände von ihr zu lassen.
»Ich bin bereit zum Aufbruch, Travis.«
Plötzlich war er sehr geschäftlich. »Es wird höchste Zeit. Wir haben fast zwei Stunden hier verbummelt.«
»Es war keine verbummelte Zeit. Es war ... sehr vergnüglich.«
Er zuckte die Achseln. »Soll ich Ihnen aufs Pferd helfen?«
»Damit ich wieder auf der anderen Seite lande? Nein, danke.«
Ein oder zwei Minuten hüpfte sie herum und versuchte vergeblich, ihren Fuß in den Steigbügel zu bekommen, doch als er schließlich darauf bestehen wollte, dass sie sich helfen ließe, schaffte sie es allein in den Sattel. Sie lächelte ihn triumphierend an. Aber nicht lange.
»Eine hilflose Frau hätte um Beistand gebeten«, sagte er.
Lächelnd schwang er sich in den Sattel. Er musste auch verrückt sein, sagte er sich, weil er anfing, Miss Emily Finnegan wirklich zu mögen.
Kapitel 4
Sie wechselten kein Wort, bis sie an das Flussbett kamen, das er als Abkürzung hatte benutzen wollen. Aber wie Adam es vorhergesagt hatte, war es überflutet.
»Sie wollen den Fluss doch nicht hier überqueren? Es gibt sicher eine Brücke, die wir benutzen können.«
»Hier oben gibt es keine Brücken«, antwortete er. »Und das ist kein Fluss, Emily. Es ist nur ein Flussbett.«
Ihrem Pferd gefiel es offenbar nicht, so nahe am Wasser zu sein, denn es begann herumzutänzeln. Travis griff zu, nahm ihre Zügel und zwang das Tier näher zu sich heran, sodass es sich nicht aufbäumen konnte.
»Der Hengst denkt sicher, er müsste ins Wasser. Das braucht er doch nicht, oder?«
Travis hörte die Besorgnis in ihrer Stimme. »Nein, das braucht er nicht«, versicherte er ihr. »Hier können wir den Fluss nicht überqueren.«
Sein Bein rieb sich an ihrem. Sie merkte es natürlich, aber obwohl sie ihren Schenkel hätte wegziehen können, tat sie es nicht. Es gefiel ihr, so nahe bei ihm zu sein. Travis gab ihr ein Gefühl von Sicherheit – aber da war auch noch etwas anderes. Was war um Himmels willen nur mit ihr los? Sie schien ihre eigenen Gedanken nicht mehr zu kennen.
»Hier können wir den Fluss nicht überqueren«, wiederholte sie seine Worte und tätschelte dabei das Pferd, was wohl, wie er dachte, ein Versuch sein sollte, das Tier zu beruhigen.
»Und was jetzt?«, fragte sie ihn.
»Ihre Reise nach Golden Crest hat sich gerade um zwei, vielleicht auch drei Tage verlängert.«
Fast hätte sie vor Erleichterung gejubelt. Mein Gott, sie war wirklich ganz schwach vor Freude! Sicherlich eine seltsame Reaktion, wenn man bedachte, dass sie soeben erfahren hatte, dass sie Mr O’Toole nun erst zwei Tage später kennenlernen und heiraten konnte. Eigentlich hätte sie doch enttäuscht sein müssen.
Warum war sie dann so erleichtert, als sei ihre Hinrichtung gerade aufgeschoben worden?
»Kalte Füße«, flüsterte sie.
»Was haben Sie gesagt?«, erkundigte sich Travis.
Emily schüttelte den Kopf. »Nichts Wichtiges«, gab sie zur Antwort.
Sie würde ihm nicht die Wahrheit sagen. Sie würde ihn auch nicht ansehen, weil er sicher die Erleichterung in ihren Augen lesen würde. Travis dachte jetzt schon, sie wäre verrückt, weil sie einen völlig Fremden heiraten wollte, und ehrlich gesagt, fing sie an zu glauben, dass er recht hatte.
Vielleicht hatte sie nur Angst vor der Hochzeit. Manche Bräute hatten das, oder nicht? Ja, natürlich hatten sie das! Alles, was sie dagegen nun tun musste, war, Mr O’Tooles Briefe noch einmal zu lesen. Sie war sich sicher, dass sie sich dann besser fühlen würde. Der Mann, den sie heiraten würde, hatte ihr sein Herz ausgeschüttet und ihr ohne Zweifel bewiesen, dass er ein feinfühliger, verständnisvoller Mann war, der sie lieben und ehren würde, bis dass der Tod sie schied. Was mehr konnte sie sich von einem Ehemann wünschen?
Liebe, musste sie mit sinkendem Mut zugeben. Sie wünschte sich, O’Toole so sehr zu lieben, wie er sie bereits liebte – das jedenfalls behauptete er.
»Sie müssen sich hoffentlich nicht übergeben, Emily?«