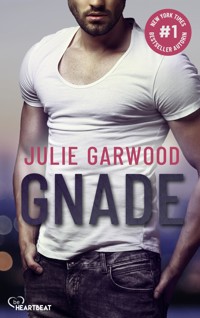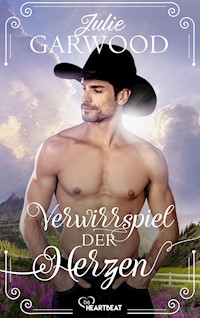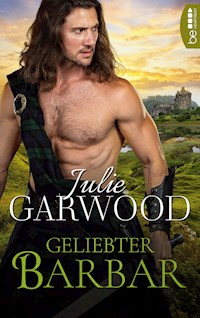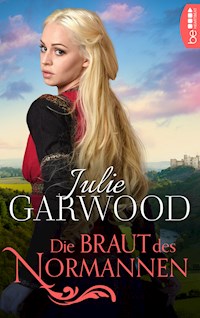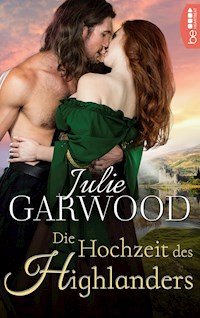4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Romance voller Leidenschaft
- Sprache: Deutsch
England, Ende des 18. Jahrhunderts: Jered Marcus Benton, der Duke of Bradford, ist der reichste und begehrteste Mann weit und breit - aber auch der arroganteste. Sein Interesse beschränkt sich auf eine einzige Dame der Londoner Gesellschaft: die schöne Caroline Richmond aus Boston. Auch sie ist von dem dreisten Herzog angetan und nimmt sich vor, ihn zu zähmen. Doch erst als sich ihre Wege aufgrund einer tödlichen Intrige vereinen, verfällt Jered ihrem unwiderstehlichen Bann. Durch einen gemeinsamen Feind verbunden, entdecken sie eine Welt voll ungestümer Leidenschaft ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
EPILOG
Über die Autorin
Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
England, Ende des 18. Jahrhunderts: Jered Marcus Benton, der Duke of Bradford, ist der reichste und begehrteste Mann weit und breit – aber auch der arroganteste. Sein Interesse beschränkt sich auf eine einzige Dame der Londoner Gesellschaft: die schöne Caroline Richmond aus Boston. Auch sie ist von dem dreisten Herzog angetan und nimmt sich vor, ihn zu zähmen. Doch erst als sich ihre Wege aufgrund einer tödlichen Intrige vereinen, verfällt Jered ihrem unwiderstehlichen Bann. Durch einen gemeinsamen Feind verbunden, entdecken sie eine Welt voll ungestümer Leidenschaft ...
Julie Garwood
Im Taumel der Sehnsucht
Aus dem amerikanischen Englisch von Eva Malsch
Für Gerry – in Liebe
PROLOG
England, 1788
Zornige Stimmen weckten das Kind.
Es setzte sich im Bett auf und rieb sich verschlafen die Augen. »Nanny?«, flüsterte es in die plötzliche Stille hinein. Es sah zu dem Schaukelstuhl neben dem Kamin hinüber und stellte fest, dass er leer war. Zitternd vor Kälte und Angst, schlüpfte es wieder unter seine Daunendecke und zog sie sich bis zur Nasenspitze hinauf. Nanny war nicht da, wo sie sein sollte.
Die ersterbende Glut im Kamin leuchtete orange in der Dunkelheit. Das kleine, vierjährige Mädchen musste an die Augen von Dämonen oder Hexen denken und erschauerte. Es würde einfach gar nicht hinsehen, beschloss es. Es ließ seinen Blick fast trotzig zu den großen Doppelfenstern gleiten, doch die Augen folgten ihm und warfen unheimliche Schatten von Riesen und Ungeheuern an das Fenster, sodass die Zweige, die von außen über das Glas schabten, wie lebendig erschienen. Vor Furcht traten dem Mädchen die Tränen in die Augen. »Nanny?«, flüsterte es noch einmal.
Dann hörte es die Stimme seines Vaters. Obwohl er brüllte und sehr wütend klang, vergaß das Mädchen augenblicklich seine Angst. Es war nicht allein und verlassen. Sein Papa war in der Nähe. Ihm konnte nichts geschehen.
Da es nun nichts mehr zu befürchten hatte, erwachte seine Neugier. Sie lebten nun schon seit über einem Monat in diesem Haus, und in dieser Zeit war niemand zu Besuch gekommen. Doch nun schrie sein Vater jemanden an, und es wollte sehen und hören, was vor sich ging.
Das kleine Mädchen rutschte bis zur Bettkante und drehte sich dann auf den Bauch, um sich hinunterzulassen. An jeder Seite des Bettes lagen dicke Kissen auf dem Hartholzboden, sodass es weich landete. Barfuß tappte es durch das Zimmer, wobei das lange weiße Nachthemd über den Holzboden schleifte. Es strich sich eine schwarze Locke aus der Stirn und drehte behutsam den Türknauf.
Draußen schlich es lautlos zum Treppenabsatz und blieb dort stehen, um zu lauschen. Die Stimme eines anderen Mannes drang zu ihm herauf, und die Worte, die der Fremde brüllte, waren so voller Hass und Boshaftigkeit, dass das Kind vor Staunen und Furcht die Augen weit aufriss. Das Mädchen spähte am Treppengeländer entlang und sah seinen Vater, der dem Fremden gegenüberstand. Eine dritte Gestalt konnte es von seiner erhöhten Position aus nicht richtig erkennen, denn sie war teilweise in den Schatten der Eingangshalle verborgen.
»Sie sind lange genug gewarnt worden, Braxton!«, schrie der Fremde mit einem kehligen Akzent. »Und wir werden gut dafür bezahlt, dass Sie uns nicht noch mehr Ärger bereiten!«
Der Fremde hielt eine Pistole in der Hand, die so ähnlich aussah wie die, die der Vater des Mädchens zu seinem eigenen Schutz bei sich trug. Aber diese Pistole zeigte auf seinen Papa! Das Mädchen setzte sich augenblicklich in Bewegung. Es wollte zu seinem Vater, wollte sich in seine Arme werfen und ihn sagen hören, dass alles in Ordnung war, dass es sich um nichts Sorgen zu machen brauchte. Aber als das Kind am Fuß der Treppe angekommen war, zögerte es. Sein Vater holte aus und schlug dem Fremden die Waffe aus der Hand. Mit einem dumpfen Laut fiel die Pistole dem Mädchen vor die Füße.
Nun trat ein anderer Mann aus den Schatten heraus. »Perkins lässt Ihnen beste Grüße ausrichten«, sagte er heiser. »Außerdem lässt er Ihnen mitteilen, dass Sie sich wegen des Mädchens keine Gedanken zu machen brauchen. Er wird einen guten Preis für sie erzielen.«
Das Mädchen begann zu zittern. Es wagte nicht, den Mann anzusehen, denn es wusste, dass es in Dämonenaugen – orange leuchtende Dämonenaugen – blicken würde, wenn es das tat. Pures Entsetzen überkam die Kleine. Sie konnte das Böse um sich herum spüren, riechen und schmecken. Und sie war davon überzeugt, dass sie blind werden würde, wenn sie es wagen sollte aufzuschauen.
Der Mann, den sie für den Teufel persönlich hielt, wich wieder in die Schatten zurück, als der andere einen Satz auf ihren Vater zu machte und ihm einen festen Stoß versetzte. »Wenn deine Kehle erst mal aufgeschlitzt ist, wirst du keine schönen Reden mehr schwingen können«, zischte er. Ihr Vater taumelte, fiel auf die Knie und wollte sich gerade wieder aufrappeln, als der Angreifer ein Messer zog. Ein hässliches, gemeines Lachen drang durch das Foyer und hallte von den Wänden wider.
Der Mann warf das Messer von einer Hand in die andere, während er, langsam und geduckt, um ihren Vater herumzugehen begann.
Das Mädchen bückte sich und hob die Pistole auf. »Papa, ich helf dir«, wimmerte es. Die Waffe war kalt und schwer, als es sie mit beiden Händen umfasste, und es hörte ein leises Klicken, als sich seine kleinen Finger um den Hahn schlossen.
Mit ausgestreckten, zitternden Armen hob es die Waffe und richtete den Lauf so gut es ging auf die beiden Kämpfenden, während es mit zögernden Schritten auf seinen Vater zuging. Es wollte ihm die Waffe geben, blieb jedoch abrupt stehen, als der Fremde plötzlich sein Messer in die Schulter ihres Vaters stieß. Der Fremde, der in den Schatten gelauert hatte, sprang vor, um seinen Kumpanen zu unterstützen.
»Papa, ich helf dir!«, schrie die Kleine gequält auf. Ihre Schluchzer drangen durch das angestrengte Grunzen der Kämpfenden. Dann, plötzlich, hielten alle drei inne und starrten ungläubig auf das vierjährige Mädchen, das den Lauf der Pistole auf sie gerichtet hatte.
»Nein!«, kreischte der Teufel. Er lachte nun nicht mehr.
»Lauf, Caroline! Lauf weg, Baby, lauf!«
Die Warnung kam zu spät. Das Kind stürzte auf seinen Vater zu, trat dabei jedoch auf den Saum seines langen Nachthemds. Als es stürzte, zogen sich die Finger instinktiv um die Waffe zusammen, und es schloss die Augen, als es auf dem Boden aufschlug. Der Schuss, der durch die Eingangshalle krachte, war ohrenbetäubend.
In der tödlichen Stille, die folgte, öffnete das kleine Mädchen die Augen und sah, was es getan hatte.
Dann wurde alles um es herum schwarz.
KAPITEL 1
England, 1802
Schüsse zerrissen die Stille und störten den Frieden der romantischen englischen Landschaft, durch die die Kutsche fuhr.
Caroline Mary Richmond, ihre Cousine Charity und ihr schwarzer Begleiter Benjamin schauten einander an. Charity, die glaubte, dass es sich um den Donner eines herannahenden Gewitters handelte, blickte aus dem Fenster und runzelte die Stirn, als sie sah, dass der Herbsthimmel klar und blau war. Nicht eine einzige Wolke war in Sicht. Sie wandte sich zu ihrer Cousine um und wollte gerade eine Bemerkung machen, als Caroline sie an den Schultern packte und sie auf den Boden der gemieteten Kutsche zerrte.
Als ihre Cousine flach auf dem Bauch lag, zog Caroline eine kleine silberne Pistole mit Perlmuttgriff aus ihrem Perlentäschchen. Sie stützte sich auf Charitys Rücken ab, als die Kutsche jäh zum Stehen kam.
»Caroline, was in Gottes Namen soll das?«, kam es gedämpft vom Boden her.
»Gewehrschüsse«, zischte Caroline.
Benjamin, der noch auf der Bank gegenüber saß, zog nun seine eigene Waffe, entsicherte sie und spähte vorsichtig aus dem offenen Fenster.
»Da vorne stimmt was nich’!«, rief der Kutscher in seinem breiten irischen Akzent. »Wir warten besser hier ab!« Man hörte, wie er vom Kutschbock kletterte, und Ben sah ihn an dem Wagen vorbeirennen.
»Siehst du etwas?«, fragte Caroline.
»Nur den Fahrer, der sich in den Büschen verkriecht«, antwortete Benjamin verächtlich.
»Ich kann überhaupt nichts sehen«, murmelte Charity missmutig. »Caroline, nimm wenigstens deine Füße von mir. Nachher habe ich überall deine Schuhabdrücke auf meinem Kleid.« Sie kämpfte sich mühsam hoch und blieb auf ihren Fersen sitzen. Ihre Haube war ihr vom Haar gerutscht und hing nur noch an dem Band um ihren Hals. Ihre Haare waren ein einziges Durcheinander aus blonden, wirren Locken und rosafarbenen und gelben Bändern. Die drahtgefasste Brille hing schief auf der Spitze ihrer winzigen Nase, und sie blinzelte angestrengt, während sie versuchte, ihr Äußeres wieder in Ordnung zu bringen.
»Wirklich, Caroline, manchmal wünschte ich, du wärst nicht ganz so eifrig darauf bedacht, mich zu beschützen«, sagte sie mürrisch. »Oh Himmel, mir ist ein Glas aus der Brille gefallen. Es muss irgendwo in den Falten meines Kleids stecken. Oh guter Gott!« Sie stöhnte, während sie hilflos an ihrem Kleid herabblickte, dann fragte sie ängstlich: »Meinst du, es sind irgendwelche Strauchdiebe, die ahnungslosen Reisenden auflauern?«
Caroline blickte konzentriert aus dem Fenster. »Wenn man von der Anzahl der Schüsse und der Reaktion unseres Kutschers ausgeht, sieht es ganz so aus«, antwortete Caroline. Sie verlieh ihrer Stimme absichtlich einen ruhigen, fast heiteren Klang, um Charitys wachsender Nervosität entgegenzuwirken. »Benjamin? Sieh bitte nach den Pferden. Wenn sie ruhig genug sind, dann reiten wir weiter und bieten unsere Hilfe an.«
Benjamin nickte und öffnete die Tür. Als er seine massige Gestalt mit einer Schulter voran durch die Öffnung schob, schwankte die Kutsche bedrohlich. Statt zum Kutschbock zu gehen, vor dem die Zugpferde eingespannt waren, schlenderte Benjamin nach hinten, wo Carolines zwei Araberpferde angeleint waren. Die edlen Tiere waren Geschenke für Carolines Vater, den Earl of Braxton, und hatten mit den dreien die lange Reise von Boston nach England unternommen.
Der Hengst tänzelte unruhig, und auch die Stute war nervös, doch Benjamin beruhigte sie rasch, indem er in seinem melodiösen, mit afrikanischen Brocken durchsetzen Südstaaten-Dialekt, den nur Caroline wirklich verstehen konnte, leise auf sie einsprach. Schließlich band er sie los und führte sie an die Seite der Kutsche.
»Du wartest hier, Charity«, befahl Caroline. »Und halt den Kopf unten!«
»Bitte sei vorsichtig«, erwiderte Charity. Sie kletterte wieder auf den Sitz und steckte, ohne sich um Carolines Anweisungen zu kümmern, augenblicklich den Kopf aus dem Fenster. »Und du auch, Benjamin«, setzte sie hinzu, während der Riese erst Caroline in den Sattel hob und sich dann auf das andere Pferd schwang.
Caroline lenkte den Hengst in die dichten Bäume hinein. Sie hatte vor, das Überraschungselement zu nutzen und sich den Räubern von hinten zu nähern. Die Anzahl der Schüsse, die sie gehört hatten, ließ auf vier, vielleicht fünf Angreifer schließen, und sie hatte keine Lust, bei einem so unausgeglichenen Verhältnis mitten in eine Truppe Halsabschneider zu platzen.
Ein Zweig zerrte an ihrer blauen Haube. Sie band sie mit einer Hand auf und schleuderte sie von sich. Die Nadeln konnten das Gewicht der dicken schwarzen Locken nicht halten, und so fielen sie befreit auf ihre Schultern und ihren Rücken.
Als sie Stimmen hörten, hielten Caroline und Benjamin an. Obwohl das Unterholz dicht genug war, um sie vor Blicken zu schützen, ließ es genug freie Sicht auf die Szene, die sich vor ihnen auf der Straße abspielte.
Vier stämmige Männer, alle zu Pferd, hatten sich im Halbkreis um eine elegante schwarze Kutsche gruppiert. Alle bis auf einen trugen Masken. Ihre Blicke waren auf einen Gentleman gerichtet, der nun langsam aus der Kutsche stieg. Caroline sah hellrotes Blut an der Innenseite seines Beines entlangströmen und hätte beinahe einen empörten Schrei ausgestoßen.
Der verletzte Gentleman hatte blondes Haar und ein attraktives Gesicht, das nun allerdings leichenblass und schmerzverzerrt war. Caroline beobachtete, wie er sich gegen die Kutsche lehnte und seine Angreifer mit verächtlichem Blick musterte. Dann weiteten sich seine Augen plötzlich, und die Arroganz wich purem Entsetzen. Der Grund dafür war offensichtlich: Der Mann ohne Maske, bei dem es sich anscheinend um den Anführer der Banditen handelte, hob langsam seine Pistole und richtete den Lauf auf den Gentleman. Es bestand kein Zweifel daran, dass der Schurke sein Gegenüber kaltblütig ermorden wollte.
»Er hat mein Gesicht gesehen«, sagte der Mann zu seinen Kumpanen. »Er muss sterben.«
Zwei der Räuber nickten augenblicklich, der dritte zögerte jedoch. Caroline wartete nicht ab, wie er sich entscheiden würde. Sie zielte und zog den Hahn ihrer Pistole.
Caroline wusste, wie treffsicher sie war – sie war nicht umsonst mit vier älteren Vettern aufgewachsen, die darauf bedacht gewesen waren, ihr beizubringen, wie man sich selbst verteidigte. Sie hatte auf die Waffenhand des Anführers gezielt und nickte nun befriedigt, als sie sein lautes Schmerzensgeheul vernahm.
Benjamin grunzte anerkennend, als er ihr seine Waffe gab und ihr die leere abnahm. Caroline feuerte einen zweiten Schuss ab, mit dem sie den Mann zur Linken des Anführers an der Schulter traf.
Dann war es schon vorbei. Laut schreiend und fluchend trieben die Banditen ihre Fersen in die Flanken ihrer Pferde und stoben davon.
Caroline wartete, bis das Donnern der Hufe auf der Straße nicht mehr zu hören war, dann trieb sie ihren Hengst vorwärts. Als sie die Kutsche erreicht hatte, ließ sie sich aus dem Sattel gleiten. »Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen«, sagte sie sanft. Sie hatte immer noch ihre Waffe in der Hand, senkte aber rasch den Lauf, als sie sah, wie der Mann zurückzuckte.
Der Gentleman erwachte langsam aus seiner Erstarrung. Blaue Augen, ein wenig dunkler als Carolines, starrten sie ungläubig an, während ihm langsam dämmerte, was geschehen war. »Sie waren es, die geschossen hat? Sie haben ...?«
Der arme Kerl schien es nicht fassen zu können. Offenbar war das eben Erlebte zu viel für ihn.
»Ja, ich habe geschossen. Aber Benjamin«, sie deutete auf den Riesen, der hinter ihr stand, »hat mir geholfen.«
Der Gentleman riss seinen Blick von Caroline los und blickte über ihre Schulter. Seine Reaktion auf den farbigen Mann beunruhigte Caroline – er sah ganz so aus, als würde er jeden Moment in Ohnmacht fallen. Zudem wirkte er vollkommen verwirrt, ja beinahe desorientiert, und Caroline kam zu dem Schluss, dass der Schrecken, den die Banditen ihm eingejagt hatten, und seine Verwundung daran schuld waren, dass sein Verstand im Augenblick ein wenig langsam funktionierte. »Wenn ich meine Waffen nicht benutzt hätte, dann wären Sie jetzt ein toter Mann.«
Sie drehte sich zu Benjamin um und reichte ihm die Zügel ihres Hengstes. »Reite zur Kutsche zurück und erzähl Charity, was passiert ist. Sie rauft sich wahrscheinlich schon die Haare vor Sorge.«
Benjamin nickte und setzte sich in Bewegung. »Bring das Schwarzpulver mit. Nur vorsichtshalber«, rief Caroline ihm hinterher. »Ach, und Charitys Arzneibeutel.«
Nun wandte sie sich wieder an den Fremden. »Schaffen Sie es, in die Kutsche zu klettern?«, fragte sie. »Dort haben Sie es bequemer, wenn ich nach Ihrer Wunde sehe.«
Der Mann nickte und stieg vorsichtig das kleine Treppchen hinauf. Er stolperte und wäre fast hintenübergefallen, doch Caroline konnte ihn noch gerade rechtzeitig stützen.
Als er sich auf dem dicken burgunderroten Polster der Bank niedergelassen hatte, hockte sich Caroline auf den Boden zwischen seine ausgestreckten Beine. Die Wunde befand sich an einer äußerst ungünstigen Stelle, und Caroline spürte, wie ihr die Röte in die Wangen stieg. Peinlich berührt zögerte sie, da sie nicht wusste, wie sie vorgehen sollte, doch als nun wieder frisches Blut an den rehbraunen ledernen Hosen herabsickerte, verwarf sie ihre Bedenken.
»Das ist mir sehr unangenehm«, flüsterte der Mann. Er hörte sich weniger verlegen als gequält an, und Caroline hatte plötzlich nur noch Mitleid mit ihm.
Die Wunde befand sich fast genau im Schritt, an der Innenseite seines linken Schenkels. »Sie haben großes Glück gehabt«, flüsterte Caroline. »Es ist ein glatter Durchschuss. Wenn ich den Stoff ein bisschen zerreiße, dann –«
»Auf keinen Fall ruinieren Sie meine Hose!«, stieß der Mann empört hervor. Caroline setzte sich auf ihre Fersen, um in sein Gesicht zu sehen.
»Und meine Stiefel! Schauen Sie sich nur meine Stiefel an!«
Offenbar hatte ihn der Vorfall noch mehr mitgenommen, als Caroline geglaubt hatte. Der Mann wirkte, als befände er sich am Rande der Hysterie.
»Das kommt schon wieder in Ordnung«, sagte sie ruhig. »Darf ich Ihre Hose ein Stückchen einreißen?«
Der Gentleman holte tief Luft, verdrehte die Augen zum Himmel und nickte. »Wenn es sein muss«, hauchte er resigniert.
Bevor er es sich anders überlegen konnte, zog Caroline rasch einen Dolch aus der Scheide, die um ihren Knöchel befestigt war.
Der Mann beobachtete sie, und zum ersten Mal erschien ein kleines Lächeln auf seinem Gesicht. »Reisen Sie immer so gut ausgestattet, Madam?«
»Dort, wo wir herkommen, lebt man länger, wenn man ausreichend bewaffnet ist«, erklärte Caroline. Es war eine ausgesprochen knifflige Aufgabe, die Klinge unter den enganliegenden Stoff zu schieben. Caroline hatte den Eindruck, als säße die Hose im wahrsten Sinne des Wortes wie angegossen, und fragte sich, wie der Mann überhaupt bequem sitzen konnte. Vorsichtig bohrte und säbelte sie mit der Messerspitze zwischen den Beinen des Mannes herum, bis es ihr schließlich gelang, den Stoff so weit aufzuschlitzen, dass die Wunde offen lag.
Dem Gentleman war der ungewöhnliche Akzent der schönen Frau, die vor ihm kniete, nicht entgangen. »Ah, Sie kommen aus den Kolonien! Dort soll es höchst barbarisch zugehen, wie ich gehört habe.« Er sog scharf die Luft ein, als Caroline die Ränder der Wunde betastete, und fuhr dann ein wenig gepresst fort: »Nun, dann ist es natürlich kein Wunder, dass Sie ein ganzes Arsenal mit sich herumschleppen.«
Caroline sah überrascht auf. »Es ist wahr, ich komme aus den Kolonien, aber das ist nicht der Grund, warum ich Waffen bei mir habe, Sir.« Sie schüttelte vehement den Kopf und setzte hinzu: »Wir kommen gerade aus London!«
»London?«, fragte der Fremde verwirrt.
»Ja, genau. Die Geschichten von den Verbrechen, die täglich in der Stadt begangen werden, sind sogar bis nach Boston gedrungen. Mord, Totschlag, Raub ... unfassbar, was einem dort alles zustoßen kann! London ist korrupt und dekadent, das weiß jeder in Übersee. Meine Cousine und ich haben hoch und heilig versprechen müssen, dass wir alle möglichen Maßnahmen treffen, um uns im Notfall verteidigen zu können. Natürlich sollen wir vor allem aufpassen, dass wir gar nicht erst in Gefahr geraten! Was mir hier gar nicht so einfach erscheint.«
»Ha! Ich habe über die Kolonien dieselben Geschichten gehört«, antwortete der Mann mit einem verächtlichen Schnauben. »London ist weit zivilisierter, meine liebe, unwissende Frau.« Caroline fand, dass er sich entsetzlich herablassend anhörte, nahm jedoch keinen Anstoß daran.
»Sie verteidigen Ihre Heimat, und das ist sicherlich sehr löblich«, erwiderte sie seufzend. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder seinem Bein zu, bevor er sich eine passende Antwort ausdenken konnte, und fügte hinzu: »Würden Sie mir bitte Ihr Halstuch geben?«
»Äh ... wie beliebt?«, fragte der Fremde. Zwischen den mühsam hervorgebrachten Worten biss er sich immer wieder auf die Unterlippe; offenbar hatte er große Schmerzen.
»Ich brauche etwas, um den Blutfluss zu stoppen«, erklärte sie.
»Wenn irgendjemand davon erfährt, dann bin ich das Gespött von ganz London«, stöhnte er. »An so einer unanständigen Stelle eine Schusswunde zu erhalten, eine Lady, die sich darum kümmert, und nun auch noch meine Krawatte ... Mein Gott, das ist einfach zu viel! Diese Schmach!«
»Schon gut, machen Sie sich keine Sorgen. Wir brauchen Ihre Krawatte gar nicht«, besänftigte Caroline ihn in dem Tonfall, in dem sie immer kleine Kinder tröstete. »Ich nehme einen Streifen aus meinem Unterrock.«
Der Gentleman schien noch nicht wirklich beruhigt. Er hielt seine Krawatte mit einer Hand an den Hals gepresst, als wollte er das Stück Stoff mit seinem Leben verteidigen. Caroline kostete es nun schon etwas mehr Mühe, mitfühlend zu klingen, als sie fortfuhr: »Ich verspreche Ihnen, dass ich niemandem von diesem unglücklichen Vorfall erzähle. Ja, ich kenne noch nicht einmal Ihren Namen! Sehen Sie, wie unproblematisch alles ist? Im Augenblick werde ich Sie ... hm, ich nenne Sie Mr. George. Nach Ihrem König. Na, was halten Sie davon?«
Offenbar gar nichts, denn die Augen des Mannes weiteten sich plötzlich entsetzt. Caroline grübelte eine Weile über den Grund nach und glaubte ihn schließlich erkannt zu haben. »Nun, ich vergaß, dass Ihr König ein wenig ... nun, unpässlich ist. Vielleicht ist der Name doch nicht so gut. Wie wäre es mit Smith? Harold Smith?«
Der Mann nickte und stieß erleichtert den Atem aus.
»Fein«, sagte Caroline. Sie tätschelte sein Knie, sprang dann rasch aus der Kutsche und bückte sich, um einen Streifen ihres Unterrocks abzureißen.
Das Geräusch von herangaloppierenden Hufen schreckte sie auf. Sie erstarrte, als sie bemerkte, dass das Pferd von Norden auf sie zukam – Benjamin und die Mietkutsche befanden sich in genau der anderen Richtung. Kehrte einer der Banditen zurück? »Geben Sie mir die Pistole, Mr. Smith«, befahl sie, als sie rasch den Dolch in die Schlinge an ihrem Knöchel zurückschob und den Stofffetzen ihres Unterrocks durchs Fenster warf.
»Aber sie ist leer«, rief der Mann panisch.
Auch Caroline packte nun die Furcht. Sie musste gegen den Drang ankämpfen, ihre Röcke zu raffen und davonzulaufen. Doch das war feige und kam selbstverständlich nicht in Frage. Sie konnte den verletzten Mann hier nicht allein und schutzlos zurücklassen. »Mag sein, dass sie leer ist, aber das wissen nur Sie und ich!«, rief sie ihm tapfer zu. Sie nahm die Pistole, die ihr durchs Fenster gereicht wurde, atmete tief durch und sandte ein stilles Gebet zum Himmel, dass auch Benjamin den Reiter gehört hatte. Oh, warum mussten ausgerechnet jetzt ihre Hände zu beben anfangen?
Endlich kamen Pferd und Reiter um die Biegung der Straße gestoben. Caroline konzentrierte sich zuerst auf das Pferd, ein riesiges schwarzes Tier, das mindestens drei Handbreit größer war als ihre Araber. Sie spürte, wie die Erde unter ihren Füßen erzitterte, und ihr schoss plötzlich durch den Sinn, dass das Ungeheuer sie vermutlich zu Tode trampeln konnte. Sie hielt die Pistole so ruhig wie möglich, wich jedoch unwillkürlich einen Schritt zurück. Als das Pferd abrupt vor ihr zum Stehen kam und dabei eine Fontäne aus Staub und Sand aufwirbelte, kniff sie instinktiv die Augen zu, obwohl sie wusste, wie riskant es war, den Gegner nur einen Moment aus den Augen zu lassen.
Rasch wischte sie sich über die Lider und öffnete die Augen wieder. Vor ihr ragte das riesige schwarze Ungeheuer auf, und neben seinem Hals funkelte eine blankpolierte Pistole, deren Lauf auf sie gerichtet war. Beides zusammen war ausgesprochen beunruhigend, und Caroline widmete ihre Aufmerksamkeit lieber dem Reiter.
Das war ein Fehler. Der riesige Mann, der von oben auf sie herabstarrte, war weit einschüchternder, als zehn Pferde und eine gezogene Waffe es je gekonnt hätten. Selbst das hellbraune Haar, das ihm wirr in die Stirn fiel, konnte seine harten Züge nicht weicher machen. Sein Kinn wirkte kantig, seine Nase war fein geschnitten, und seine goldbraunen Augen, in denen nicht einmal ein Hauch Freundlichkeit lag, schienen sich in sie hineinbohren zu wollen. Allein die steile Falte zwischen seinen Brauen reichte schon aus, jemanden zum Rückzug zu veranlassen.
Caroline war entschlossen, nicht davonzulaufen. Sie reckte ihr Kinn und begegnete, ohne zu blinzeln, seinem arroganten Blick.
Jered Marcus Benton, der vierte Duke of Bradford, konnte kaum glauben, was er da sah. Er versuchte, seinen tänzelnden und schnaubenden Hengst zu beruhigen, während er auf die reizende Vision vor ihm starrte. Ein wunderschönes, blauäugiges Mädchen, dessen Pistole direkt auf sein Herz zielte ... das Bild war nicht leicht zu verarbeiten.
»Was ist denn hier los?«, verlangte er so lautstark zu wissen, dass sein Pferd unruhig mit den Hufen stampfte. Mit Schenkeldruck und geschickter Zügelführung brachte er das Tier wieder unter Kontrolle. »Ruhig, Reliance«, knurrte er, streichelte jedoch dabei den Hals des Pferdes. Diese unbewusste Geste der Zuneigung stand in krassem Gegensatz zu seiner grimmigen Miene.
Er hatte noch nicht ein einziges Mal den Blick von Caroline genommen, und sie gelangte langsam zu der Überzeugung, dass sie es vorgezogen hätte, wenn einer der Räuber zurückgekehrt wäre. Sie hatte das dumpfe Gefühl, dass dieser Mann ihre Täuschung durchschauen könnte.
Wo bleibt Benjamin nur?, überlegte sie voller Unruhe. Er musste die Ankunft des Reiters doch gehört haben. Der Boden bebte ja immer noch! Oder waren es vielleicht ihre Beine, die zitterten? Himmel, sie musste sich zusammenreißen. Und zwar augenblicklich.
»Ich will wissen, was hier passiert ist«, wiederholte der Fremde drohend, doch Caroline zuckte nicht einmal zusammen. Sie gab auch keine Antwort, denn sie befürchtete, dass ihre Stimme verraten würde, wie sehr er sie einschüchterte. So stand sie also nur da, umklammerte die Pistole und versuchte, ihren rasenden Herzschlag zu beruhigen.
Bradford sah sich mit einem raschen Blick um. Seine Lieblingskutsche, die er seinem Freund für zwei Wochen geliehen hatte, stand am Rand der Straße und wies ein paar hässliche Einschusslöcher auf. Plötzlich sah er eine Bewegung im Inneren der Kutsche und erhaschte einen Blick auf einen blonden Wuschelkopf. Bradford hätte fast vor Erleichterung geseufzt. Sein Freund war am Leben.
Er wusste instinktiv, dass die Frau, die dort vor ihm stand und so tapfer um Haltung bemüht war, nicht für den Schaden an der Kutsche verantwortlich war. Plötzlich sah er, wie sie erbebte, und nutzte den Vorteil sofort aus.
»Lassen Sie die Waffe fallen!« Es war kein gutgemeinter Ratschlag oder eine Bitte. Der Duke of Bradford bat so gut wie nie um etwas – er befahl! Und unter normalen Umständen bekam er meist ohne Verzögerung, was er haben wollte.
Doch Bradford musste feststellen, dass diese Situation offenbar nicht in die Kategorie »normale Umstände« einzuordnen war. Das niedliche Ding machte nämlich keinerlei Anstalten, seinem Befehl zu folgen, sondern starrte ihn nur weiterhin an, ohne die Waffe auch nur zu senken.
Caroline konzentrierte sich darauf, das Zittern ihres Körpers zu unterdrücken, während sie den Mann, der drohend vor ihr aufragte, eingehend studierte. Eine Aura von Macht umgab ihn, und Caroline war entsetzt, als sie bemerkte, wie stark sie sich von seiner Ausstrahlung beeinflussen ließ. Er war schließlich auch nur ein Mann! Sie schüttelte leicht den Kopf, um ihre Gedanken zu klären. Der Fremde wirkte arrogant und ziemlich aufgeblasen und war, wie man aus seinen Kleidern ersehen konnte, offenbar ein reicher Mann. Seine Aufmachung ähnelte der des Mannes, den Caroline Mr. Smith genannt hatte: Der burgunderrote Rock und die goldfarbenen Hosen besaßen den gleichen Schnitt, die schwarzen Schuhe waren gleich, und die Krawatte war ebenso gebunden wie die des blonden Mannes in der Kutsche.
Nun fiel Caroline wieder ein, wie besorgt Mr. Smith gewesen war, dass er zum Gespött der Leute werden könnte. Sie hatte ihm versprochen, niemandem etwas zu sagen, und dieses Versprechen würde sie halten. Der Fremde vor ihr sah, wie sie fand, genau wie der Typ Mensch aus, der liebend gerne solche Geschichten herumerzählen würde. Am besten, sie sah zu, dass er sich vom Schauplatz des Geschehens entfernte.
»Madam, haben Sie ein Ohrenleiden? Ich sagte, Sie sollen Ihre Waffe fallen lassen.« Er hatte nicht brüllen wollen, aber er musste sich widerwillig eingestehen, dass er beeindruckt war – sowohl von der Hartnäckigkeit, mit der sie die Pistole auf ihn richtete, als auch von ihrem herausfordernden Blick. Und ihre Augen hatten wirklich eine überaus ungewöhnliche Farbe!
»Tun Sie es doch!«, brachte Caroline endlich heraus. Zufrieden stellte sie fest, dass ihre Stimme kaum bebte, ja, sich stattdessen fast so zornig anhörte wie seine. Es war zwar ein kleiner Sieg, aber nichtsdestoweniger ein Sieg.
Caroline stand mit dem Rücken zur Kutsche, sodass sie nicht sah, wie der verwundete Gentleman nun aus dem Fenster blickte und dem Mann, der vor ihr auf dem riesigen Pferd saß, zur Begrüßung zuwinkte.
Bradford erwiderte den Gruß mit einem knappen Nicken. Immer noch den Blick auf seinen Freund gerichtet, zog er fragend eine Augenbraue hoch. Caroline, die sein Gesicht betrachtete, sah nur, wie auf einmal der zynische Ausdruck verschwand. Staunend fragte sie sich, was diese angenehme Veränderung in seinem Gebaren wohl bewirkt haben mochte, doch bevor sie sich ein wenig entspannen konnte, machte der Fremde ihre Erleichterung mit seinem nächsten Satz wieder zunichte.
»Nun, so kommen wir anscheinend zu keiner Lösung«, sagte er mit tiefer, voller Stimme. »Sollen wir uns duellieren?«
Caroline nahm das Zucken um seine Mundwinkel durchaus wahr und versteifte sich unwillkürlich. Sie fand das überhaupt nicht komisch. Wie konnte er es wagen, eine so gelangweilt amüsierte Haltung anzunehmen, wenn sie so verängstigt war?
»Sie werden die Waffe fallen lassen«, erwiderte sie dickköpfig. »Ich werde Sie schon nicht erschießen!«
Der Mann ignorierte ihren Befehl und fuhr fort, sie anzusehen, während er den Hals seines Pferdes tätschelte. Offenbar bedeutete sein Reittier ihm viel, und Caroline erkannte plötzlich, dass sie sich dies zunutze machen konnte.
Bradford dachte nicht einmal ansatzweise daran nachzugeben. Er würde sich gewiss keiner Frau beugen! Er hatte eben ihr Zittern bemerkt, und es würde bestimmt nicht mehr lange dauern, bis sie ganz zusammenbrach. Gut, er musste zugeben, dass diese Kleine dort vor ihm außergewöhnlich mutig war, und er konnte nicht umhin, diese Tapferkeit zu bewundern. Aber sie war nichtsdestoweniger eine Frau und daher minderwertig. Frauen waren doch alle mehr oder weniger gleich; alle waren ...
»Wenn Sie nicht tun, was ich sage, schieße ich auf Ihr Pferd!«
Die Drohung saß. Der Fremde wäre fast aus dem Sattel gefallen. »Das wagen Sie nicht!«, brüllte er empört.
Caroline senkte als Antwort die Waffe, bis der Lauf auf den Kopf des edlen Tieres gerichtet war. »Direkt zwischen die Augen«, versprach sie ihm.
»Bradford!« Die Stimme aus der Kutsche kam gerade noch rechtzeitig, um den Duke davon abzuhalten, dem plötzlich schier überwältigenden Bedürfnis nachzugeben, vom Pferd zu springen und diese Frau eigenhändig zu erwürgen.
»Mr. Smith? Sie kennen den Mann?«, rief Caroline, ohne den Blick von ihrem Gegner zu nehmen, der nun abstieg und seine Pistole in den Bund seiner Hose steckte. Eine Woge der Erleichterung überspülte sie. Na bitte! Sie hatte es geschafft. Wenn dieser Engländer ein typischer Vertreter der eleganten Oberschicht war, dann hatte ihre Cousine vielleicht recht mit ihrer Behauptung, dass diese Leute alle nur Weichlinge waren.
Bradford unterbrach ihre Gedanken. »Kein Gentleman würde jemals das Pferd eines anderen –« Er verstummte, als ihm auffiel, wie absurd seine Bemerkung war.
»Ich habe nicht behauptet, ein Gentleman zu sein«, erwiderte Caroline achselzuckend.
Mr. Smith steckte den Kopf aus dem Fenster und stöhnte auf, als ihm die rasche Bewegung seine Verletzung nur allzu deutlich bewusst machte. »Ihre Pistole ist leer, Mann. Spar dir deinen Wutanfall. Dein Pferd war nie gefährdet.« Er hatte mit einem amüsierten Unterton gesprochen, und Caroline musste unwillkürlich lächeln.
Bradford war einen Augenblick von ihrem zauberhaften Lächeln aus dem Konzept gebracht. Das vergnügte Funkeln, das in ihren Augen aufblitzte, war wirklich ganz reizend.
»Sie haben sich aber ziemlich leicht überreden lassen«, stellte Caroline fest. Sofort bereute sie, dass sie ihren Gedanken ausgesprochen hatte, denn der Mann kam nun mit alarmierend selbstbewussten Schritten auf sie zu. Er lächelte nicht. Offenbar mangelte es ihm an Humor, und sie ertappte sich dabei, wie sie unwillkürlich zurückwich.
Seine finstere Miene machte sein attraktives Äußeres zunichte, und Caroline kam zu dem Schluss, dass er viel zu groß und zu breit war. Ja, er war fast so massig wie Benjamin, der nun, wie Caroline mit Erleichterung sah, lautlos hinter dem Fremden herangeschlichen kam.
»Hätten Sie mein Pferd erschossen, wenn die Pistole geladen gewesen wäre?«, fragte der Fremde drohend. Der Muskel in seiner rechten Wange zuckte bedenklich, und Caroline beeilte sich, ihm eine Antwort zu geben.
»Natürlich nicht. Das Tier ist viel zu schön, um es zu töten, und außerdem kann es ja nichts dafür. Sie dagegen ...«
Bradford hörte ein Knirschen von Kies hinter sich, wirbelte herum und stand Benjamin Auge in Auge gegenüber. Die beiden betrachteten einander eine lange Weile, und Caroline stellte fest, dass der Fremde von der beeindruckenden Gestalt ihres Freundes keinesfalls eingeschüchtert schien. Er wirkte eher neugierig, was einen deutlichen Unterschied zu Mr. Smith’ Reaktion darstellte.
»Gibst du mir bitte den Beutel mit der Arznei, Benjamin? Über den da musst dir keine Sorgen machen«, fügte sie mit einer Kopfbewegung zu Bradford hinzu. »Er ist offenbar ein Freund von Mr. Smith!«
»Mr. Smith?«, fragte Bradford und wandte sich zu dem Gentleman um, der ihn durchs Fenster der Kutsche angrinste.
»Heute heißt er Harold Smith«, erklärte Caroline. »Er möchte mir seinen wahren Namen nicht sagen, da er sich in einer recht unangenehmen Situation befindet. Ich habe vorgeschlagen, ihn George zu nennen – nach Ihrem König –, aber das wollte er nicht, und so haben wir uns auf Harold geeinigt.«
In diesem Moment kam Charity um die Ecke gehastet. Sie hatte ihren Rock ein gutes Stück über ihre wohlgeformten Fußknöchel gerafft, während sie anmutig auf sie zueilte. Caroline war froh über die Ablenkung, denn dieser Bradford starrte sie immer noch auf eine höchst irritierende Weise an. Diese Engländer waren wirklich ein merkwürdiges Volk.
»Caroline! Der unmögliche Kutscher weigert sich, aus den Büschen zu kommen!«, keuchte Charity, als sie herangekommen war. Sie blieb neben Benjamin stehen und bedachte ihn mit einem kurzen Lächeln, bevor sie erst Bradford und dann den Mann hinter ihm ansah, der aus dem Kutschenfenster blickte. »Ist die Gefahr vorbei? Der Kutscher hat versprochen, auf seinen Posten zurückzukehren, wenn die Luft wieder rein ist.« Erklärend fügte sie hinzu: »Er hat mich geschickt, um herauszufinden, wie die Dinge stehen.« Sie legte ihre zarte Stirn in Falten. »Caroline, wir sollten umdrehen und augenblicklich wieder nach London zurückkehren. Ich weiß, ich bin diejenige gewesen, die unbedingt zum Landhaus deines Vaters reisen wollte, aber ich sehe jetzt ein, wie dumm meine Idee war. Lass uns zum Stadthaus fahren, Cousine. Von dort können wir ihm eine Nachricht schicken.«
Bradford blickte von einer Frau zur anderen, betrachtete die plappernde Blondine, die ihm wie ein Wirbelwind vorkam, sah das Mädchen mit der Waffe an und fragte sich, wie in aller Welt diese beiden verwandt sein konnten. Ihr Verhalten und ihr Aussehen waren so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Charity war zierlich und klein, ihre goldenen Locken tanzten um ihre Schultern, als führten sie ein Eigenleben, und ihre haselnussbraunen Augen funkelten spitzbübisch. Caroline war bestimmt einen halben Kopf größer, hatte schwarzes Haar und erstaunlich klare, blauviolette Augen, die von dichten Wimpern umrahmt waren. Beide waren schlank. Charity war hübsch; ihre Cousine konnte nur als schön bezeichnet werden.
Sie unterschieden sich nicht nur in Äußerlichkeiten. Die kleine Blonde wirkte flatterhaft, ihrem Blick mangelte es an Konzentration und Eindringlichkeit. Sie hatte es noch nicht ein einziges Mal geschafft, ihm in die Augen zu sehen. Offenbar war sie trotz ihres überschäumenden Gehabes ein wenig schüchtern.
Caroline strahlte vor allem Selbstvertrauen aus, und ihr Blick war direkt und offen. Die beiden Mädchen waren echte Gegensätze. Charmante und faszinierende Gegensätze, wie er zugeben musste.
»Mr. Smith, dies ist Charity«, sagte Caroline und lächelte ihre Cousine herzlich an. Sie hatte Bradford absichtlich übergangen und rechtfertigte diese Unhöflichkeit im Stillen mit der Begründung, dass er sie noch immer so unverschämt anstarrte.
Charity huschte zum Kutschenfenster und stellte sich auf Zehenspitzen, um hineinzuspähen. »Benjamin hat gesagt, dass Sie verletzt sind. Sie Armer. Haben Sie Schmerzen? Geht es besser?« Sie wartete lächelnd auf eine Antwort, während der verwundete Gentleman hastig versuchte, sich zu bedecken. »Ich bin Carolines Cousine, aber wir sind praktisch Schwestern, denn wir sind zusammen aufgewachsen. Außerdem sind wir auch fast gleich alt. Ich bin nur sechs Monate älter.« Nach dieser Erklärung drehte Charity sich mit einem breiten Lächeln, durch das zwei reizende Grübchen in ihren Wangen erschienen, zu Caroline um. »Wo ist denn sein Fahrer? Versteckt der sich auch in den Büschen? Also wirklich, diese Engländer! Ich denke, wir sollten uns mal nach diesen beiden tapferen Burschen umsehen!«
»Ja«, sagte Caroline. »Das ist eine wunderbare Idee. Warum versuchst du nicht mit Benjamin den Kutscher zu finden, während ich mich um Mr. Smith’ verletztes Bein kümmere?«
»Oh, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Wir sollten uns alle erst einmal vorstellen, auch wenn die Umstände überaus ungewöhnlich sind. Nun, mal sehen ... wie geht man in solch einer Situation am besten vor?«
»Nein!«, drang es aus der Kutsche. Der Schrei war so vehement hervorgestoßen worden, dass das Gefährt zu schwanken schien.
»Mr. Smith zieht es vor, ein Fremder zu bleiben«, erklärte Caroline freundlich. »Und du musst genau wie ich versprechen, dass wir diesen Vorfall vergessen werden.« Sie zog ihre Cousine ein Stück beiseite und flüsterte: »Die Sache ist diesem Mann entsetzlich peinlich. Du weißt doch, wie diese Engländer sind.«
Bradford stand nah genug, um die letzte Bemerkung zu hören, und wollte gerade entrüstet nachfragen, was Caroline damit meinte, als Charity antwortete: »Es ist ihm peinlich, dass er verwundet worden ist? Sehr seltsam, wirklich. Ist es ernst?«
»Nein«, versicherte Caroline ihr. »Zuerst befürchtete ich es, aber es lag nur daran, dass die Wunde so stark geblutet hat. Nein, der Grund für seine Verlegenheit ist die Stelle, an der er verwundet worden ist. Sehr unangenehm.«
»Oje!«, stieß Charity voller Mitgefühl hervor. Sie warf dem Mann in der Kutsche einen raschen Blick zu und wandte sich dann wieder an ihre Cousine. »Unangenehm, sagst du?«
Caroline nickte. Sie wusste, dass Charity darauf brannte, mehr zu erfahren, aber aus Rücksicht auf Mr. Smith sagte sie nichts weiter. »Je eher wir die Sache hinter uns bringen und wieder weiterfahren, desto besser.«
»Wieso?«
»Weil der Mann ein ziemliches Theater wegen seiner Verletzung macht«, erklärte Caroline mit einem ungeduldigen Seufzer. Im Inneren gestand sie sich allerdings ein, dass das nicht die ganze Wahrheit war. Sie war begierig darauf, wieder in ihrer eigenen Kutsche zu sitzen, weil ihr dieser Freund von Mr. Smith unerträglich war. Je schneller sie von ihm wegkam, desto besser. Dieser Mann jagte ihr irgendwie Angst ein, und das wiederum machte Caroline wütend. Sie konnte es nicht leiden, eingeschüchtert zu werden.
»Ist er ein Dandy?«, fragte Charity flüsternd. Es klang, als fragte sie nach einer entsetzlichen Krankheit.
Caroline sparte sich eine Antwort. Sie winkte Benjamin und nahm ihm den Medizinbeutel ab. Dann kletterte sie wieder in die Kutsche und wandte sich an Mr. Smith. »Machen Sie sich wegen Charity keine Sorgen. Sie kann Sie kaum sehen, denn sie trägt ihre Brille nicht.«
Benjamin, der Carolines Bemerkung gehört hatte, bot Charity seinen Arm. Als sie ihn nicht ergriff, packte er resolut den ihren und führte sie langsam davon. Bradford sah den beiden hinterher und versuchte herauszufinden, was eigentlich vor sich ging.
»Du kannst dir ebenso gut ansehen, in was für einer Patsche ich stecke«, rief Mr. Smith aus der Kutsche seinem Freund zu. Bradford nickte und ging um die Kutsche herum.
»Es gibt nur sehr wenige Männer, bei denen ich sicher bin, dass sie ihren Mund halten«, erklärte Smith an Caroline gewandt. »Bradford ist einer dieser wenigen.«
Caroline sagte nichts darauf. Sie betrachtete die Wunde und stellte fest, dass die Blutung aufgehört hatte. »Haben Sie irgendetwas Alkoholisches dabei?«, fragte sie Mr. Smith, wobei sie absichtlich Bradford ignorierte, der nun eingestiegen war und sich Mr. Smith gegenüber niederließ.
Die Kutsche war weit größer als das gemietete Gefährt, in dem Caroline mit Benjamin und Charity fuhr. Dennoch berührte Bradfords Knie ihre Schulter, als sie sich vor seinen Freund kniete. Es wäre sicher sehr unhöflich gewesen, ihn wieder hinauszuschicken, bis sie die Wunde versorgt hatte; schließlich hatte Mr. Smith ihn ja hereingebeten! Dennoch konnte Caroline nicht anders, als sich zu wünschen, sie hätte den Mut dazu.
»Ich habe etwas Brandy«, antwortete Mr. Smith nun. »Denken Sie, dass ein ordentlicher Schluck helfen würde?« Er zog eine kleine graue Metallflasche aus seiner Brusttasche.
»Vielleicht, wenn noch etwas übrig bleibt«, sagte Caroline. »Ich werde etwas davon auf die Wunde träufeln, bevor ich sie verbinde. Mama sagt, dass Alkohol Entzündungen hemmt.« Sie verschwieg allerdings, dass ihre Mutter sich ganz und gar nicht sicher war, ob das tatsächlich stimmte, aber damit argumentierte, dass es zumindest nicht schaden konnte. »Es wird ziemlich brennen, und wenn Sie schreien wollen, dann tun Sie es ruhig. Ich verachte Sie deswegen gewiss nicht!«
»Ich werde natürlich keinen Laut von mir geben, Madam! Es ist wirklich nicht sehr charmant von Ihnen, auch nur anzudeuten, dass ich mir eine solche Blöße geben würde«, bemerkte der Mann indigniert. Sekunden später drang der Alkohol in die Wunde ein, und Smith kreischte auf. Bradford, der sich vollkommen hilflos fühlte, verzog mitfühlend das Gesicht.
Caroline nahm ein kleines Töpfchen mit gelbem Puder, der nach abgestandenem Wasser und nassen Blättern roch, und streute eine großzügige Menge davon auf die Wunde. Dann nahm sie den Stoffstreifen ihres Unterrocks, um das Bein zu verbinden. »Das Pulver wird den Schmerz betäuben und die Wunde versiegeln«, erklärte sie mit sanfter Stimme.
Bradford war verzaubert von der leicht heiseren, sinnlichen Stimme dieser Frau. Er ertappte sich dabei, wie er sich wünschte, an Stelle seines Freundes sein zu können, und schüttelte verächtlich den Kopf über diesen Gedanken. Was war los mit ihm? Hatte sie ihn verhext? Er hatte noch nie derart auf eine Frau reagiert, und er konnte nicht behaupten, dass ihm diese neue Erfahrung gefiel. Sie stellte seine Selbstbeherrschung auf die Probe! Ja, sie brachte ihn so sehr durcheinander, dass er sich vorkam wie ein kleiner, dummer Schuljunge, der keine Ahnung hatte, wie er mit einer Frau umzugehen hatte!
»Oh, entsetzlich«, flüsterte Mr. Smith. »Ich habe wie ein Feigling geschrien!« Er tupfte sich seine Stirn mit einem Spitzentüchlein ab und senkte den Blick. »Ihre Mutter muss eine Barbarin sein, wenn sie so grausige Methoden anwendet, um einen Verletzten zu versorgen.«
Der Duke wusste, wie schwer es seinem Freund fiel, eine Schwäche einzugestehen, aber wenn Bradford nun versuchte, die Lage zu verharmlosen, würde er ihn nur noch mehr in Verlegenheit bringen. Während er noch überlegte, was für eine Bemerkung er machen sollte, nahm ihm die junge Frau die Entscheidung ab.
»Aber, Mr. Smith! Sie haben kaum einen Mucks von sich gegeben«, behauptete sie fest. Dann tätschelte sie sein Knie und setzte hinzu: »Sie waren ausgesprochen tapfer. Ja, die Art und Weise, wie Sie den Räubern gegenübergetreten sind, hat mich sehr beeindruckt!« Ihr Kompliment hatte die gewünschte Wirkung. Mr. Smith’ Miene entspannte sich, und kurz darauf wirkte er schon fast wieder so blasiert wie zuvor. »Sie haben sich nichts vorzuwerfen«, schloss Caroline mit einem kleinen Lächeln. »Und ich will auch vergessen, dass Sie meine Mutter eine Barbarin genannt haben.«
»Ja, Sie haben recht! Ich bin diesen Schurken wirklich recht forsch gegenübergetreten!«, sagte Mr. Smith würdevoll. »Allerdings war ich zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen.«
»Das ist richtig«, erwiderte Caroline. »Sie können stolz auf sich sein. Nicht wahr, Mr. Bradford, das finden Sie doch auch?«
Bradford war entzückt, dass sie ihn endlich wahrnahm. »Natürlich«, antwortete er augenblicklich.
Mr. Smith grunzte zufrieden.
»Der einzige Feigling hier in der Umgebung ist dieser irische Kutscher, den ich eingestellt habe«, stellte Caroline nüchtern fest, während sie den Verband anlegte. Bradford zog die Augenbrauen hoch. In ihrer Stimme hatte eine Verachtung mitgeklungen, die ihn überraschte.
»Haben Sie etwas gegen Iren?«, fragte er. Caroline blickte zu ihm auf, und er sah den Zorn in ihren Augen. Unwillkürlich fragte er sich, ob ihre Gefühle immer so intensiv waren – liebte sie genauso heftig wie sie hasste? Dann verwarf er verärgert diesen lächerlichen Gedanken.
»Die Iren, denen ich begegnet bin, waren alle Schufte«, antwortete Caroline. »Mama sagt, ich dürfe nicht verallgemeinern, aber ehrlich gesagt fällt mir das manchmal sehr schwer.«
Sie seufzte und wandte sich wieder ihrer Aufgabe zu. »Vor einigen Jahren wurde ich einmal von drei Iren überfallen. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn Benjamin nicht noch rechtzeitig zur Stelle gewesen wäre. Wahrscheinlich würde ich dann jetzt nicht hier sein.«
»Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand Sie überwältigen könnte«, bemerkte Mr. Smith.
Es hatte sich wie ein Kompliment angehört, und Caroline nahm es als solches. »Damals wusste ich noch nicht, wie man sich selbst schützt. Meine Vettern waren schrecklich aufgebracht über den Vorfall, und von diesem Tag an wechselten sie sich damit ab, mir beizubringen, wie ich mich verteidigen kann.«
»Die Frau ist ein wandelndes Waffenlager«, sagte Mr. Smith zu seinem Freund. »Sie meint, sie müsse sich vor London schützen!«
»Möchten Sie schon wieder eine Diskussion über die Unterschiede zwischen den zivilisierten Kolonien und dem Sündenpfuhl London anfangen, Mr. Smith?«, fragte Caroline mit einem vergnügten Funkeln in den Augen. Sie wollte ihn necken, um ihn von den Schmerzen abzulenken, während sie mit sanften, sicheren Bewegungen den Streifen Stoff um seinen Oberschenkel wand.
Mr. Smith’ Gesicht hatte schon wieder eine gesündere Farbe angenommen. »Ich fühle mich schon beträchtlich besser. Ich schulde Ihnen mein Leben, gute Frau.«
Caroline tat, als hätte sie die Bemerkung nicht gehört, und wechselte rasch das Thema. Komplimente und Dankbarkeit machten sie stets verlegen. »In zwei Wochen können Sie wieder mit den Ladys tanzen«, versprach sie. »Sie nehmen doch bestimmt an den großen Ereignissen der Gesellschaft teil, nicht wahr? Gehören Sie vielleicht sogar zu den – wie sagt man? – oberen Zehntausend?«
Ihre unschuldige Frage löste einen Hustenanfall bei Mr. Smith aus. Es hörte sich an, als wäre etwas in seiner Kehle stecken geblieben. Caroline sah ihn stirnrunzelnd an und warf dann Bradford einen Blick zu. Er wirkte amüsiert, und sie fand, dass die kleinen Lachfältchen in seinen Augen ihn fast attraktiv machten.
Während sie ihn betrachtete, kam sie zu dem Schluss, dass Bradford kein Geck war. Diese Feststellung enttäuschte sie fast. Ja, sicher waren er und Mr. Smith in der gleichen Art und Weise gekleidet, aber sie war überzeugt, dass Bradford kein hauchzartes Spitzentüchlein bei sich hatte. Und sie glaubte auch nicht, dass sich sein Schenkel so weich und zart wie ein Babypopo anfühlen würde. Nein, wahrscheinlich würde er rau sein ... und hart! Er wirkte weit muskulöser als Mr. Smith. Er war groß, kräftig und massig, aber alles sah fest aus. Vermutlich konnte er einen Gegner allein mit seinem Gewicht erdrücken. Wie benahm er sich wohl Frauen gegenüber? Caroline spürte, wie ihr bei dem Gedanken das Blut in die Wangen stieg. Was war denn mit ihr los? Wie konnte sie sich nur einen Mann ohne Kleider vorstellen? Und noch schlimmer: Wie konnte sie sich nur vorstellen, wie er eine Frau berührte? Himmel, was für unschickliche Gedanken!
Bradford bemerkte das zarte Erröten und nahm an, dass sie glaubte, sein Freund würde sich über sie lustig machen. Also beantwortete er ihre Frage. »Wir gehören tatsächlich dazu, aber Mr. Smith nimmt häufiger an irgendwelchen gesellschaftlichen Ereignissen teil als ich.« Da er keine Lust hatte, ihr zu erklären, dass er praktisch überhaupt nicht mehr auf Partys ging, weil sie ihn zu Tode langweilten, wechselte er das Thema. »Sie sagten, dass Sie Ihren Vater besuchen wollten. Sie leben also in den Kolonien? Mit Ihrer Mutter, nehme ich an?«
Bradford wollte so viel wie möglich über diese schwarzhaarige Schönheit herausfinden. Warum das so war, wusste er selbst nicht, er weigerte sich jedoch, darüber nachzudenken. Es war einfach ein simples Interesse an einer Zufallsbekanntschaft, nichts weiter, redete er sich ein.
Caroline runzelte die Stirn. Es wäre natürlich sehr unhöflich gewesen, die Frage nicht zu beantworten, aber sie wollte diesen beiden Gentlemen nichts über sich erzählen. Sie würde nur eine kurze Zeit in London bleiben, und sie hatte kein Bedürfnis, in dieser Zeit mit Engländern Freundschaft zu schließen. Dennoch musste sie wohl oder übel irgendetwas sagen, denn die beiden Männer sahen sie erwartungsvoll an. »Meine Mutter starb vor vielen Jahren«, sagte sie also endlich. »Ich zog nach Boston, als ich noch sehr klein war. Meine Tante und mein Onkel zogen mich auf, und ich habe meine Tante immer Mama genannt. Sie war es, die mich erzogen hat. Und es war leichter ... sich anzupassen«, fügte sie mit einem aufgesetzt unbekümmerten Schulterzucken hinzu.
»Bleiben Sie lange in London?«, fragte Bradford. Er beugte sich vor und stützte sich mit der Hand auf seinem Knie ab, als wartete er begierig auf ihre Antwort.
»Charity möchte auf einige Veranstaltungen gehen, während wir in der Stadt sind«, antwortete sie ausweichend.
Bradford entging das Manöver nicht. »Die Saison beginnt bald. Freuen Sie sich nicht auf das Abenteuer?« Es war im Prinzip eine rhetorische Frage, denn er war sich ihrer Antwort sicher. Immerhin war sie eine Frau, und Frauen gierten ja stets nach solcher Art von Vergnügungen.
»Abenteuer? So hatte ich es noch gar nicht betrachtet. Aber ich bin sicher, dass Charity sich gut amüsieren wird.«
Sie sah ihn konzentriert an, und ihn durchfuhr der Gedanke, dass sie mit ihrem direkten, offenen Blick bestimmt in der Lage war, einen Mann zum Stammeln und Stottern zu bringen. Er dagegen, versicherte er sich hastig, während er versuchte, sich daran zu erinnern, worüber sie eben gesprochen hatten, er dagegen besaß natürlich zu viel Erfahrung, hatte schon zu viel erlebt, um sich von irgendeinem Mäuschen einwickeln zu lassen. Dennoch konnte er nicht umhin, sich über seine unvernünftigen Gedanken Sorgen zu machen. Es war ja förmlich Disziplinlosigkeit, die er da an den Tag legte! Gott, er war noch nie von einer Frau so fasziniert gewesen! Was zum Teufel war nur los mit ihm? Es muss die Hitze sein, dachte er schließlich. Trotzdem – er wollte so viel wie möglich über diese Frau erfahren, die vor ihm kniete. Vielleicht war es auch ihre Ausstrahlung, die Herzensgüte, die von ihr ausging. Auf einen Mann wie ihn, der seit so langer Zeit ohne emotionale Wärme lebte, musste es ja anziehend wirken!
Sein Freund, der sich endlich wieder von seinem Hustenanfall erholt hatte, riss ihn aus seinen Gedanken. An Caroline gewandt fragte er ungläubig: »Heißt das, Sie selbst freuen sich nicht auf die Saison?«
»Ich habe noch nicht darüber nachgedacht«, antwortete Caroline. Mit einem Lächeln fügte sie hinzu: »Wir haben ziemlich viele Geschichten gehört. Es heißt zum Beispiel, dass die Oberschicht ein empfindliches, geschlossenes Grüppchen sei und dass man sich immer überaus korrekt benehmen muss. Charity hat jetzt schon Angst, dass sie irgendeinen Fehler begeht, wodurch mein Vater in Verlegenheit gebracht wird. Sie möchte unbedingt alles richtig machen, verstehen Sie?«
Ihre Stimme klang ein wenig angespannt, und Bradford wurde nur noch neugieriger.
Mr. Smith grinste arrogant. »Ich wette, Sie werden das Gesprächsthema von ganz London werden«, prophezeite er.
Er hatte es als Kompliment gemeint und war verwirrt, als Caroline stirnrunzelnd nickte. »Das ist Charitys größte Sorge ... was mich betrifft. Sie befürchtet, dass ich etwas ganz Entsetzliches tun werde. Und dass ganz London davon erfährt«, erklärte sie ernsthaft. »Sehen Sie, ich benehme mich selten so, wie man es von mir erwartet. Meine Mama sagt, ich sei rebellisch, und ich fürchte, sie hat recht.«
»Aber nein, nein, Sie haben mich ganz falsch verstanden«, widersprach Mr. Smith hastig. Er wedelte mit seinem Taschentuch in der Luft herum. »Ich wollte damit nur sagen, dass die Oberen Sie lieben werden!«
»Das ist wirklich sehr nett von Ihnen«, sagte Caroline leise. »Aber ich habe wenig Hoffnung. Nun, wie auch immer, es ist nicht wirklich wichtig, denn ich kehre ja bald wieder nach Boston zurück. Es kann mir egal sein, ob mich Pummer persönlich zur Ausgestoßenen erklärt.«
»Pummer?«, fragten Bradford und Mr. Smith gleichzeitig.
»Ja, oder Plummer oder Brummer«, erwiderte Caroline mit einem Schulterzucken. »Mr. Smith, könnten Sie bitte Ihr Bein ein wenig zur Seite rücken, damit ich weitermachen kann? Ah, danke.«
»Meinen Sie Brummell? Beau Brummell?«, fragte Bradford, der sich bemühte, nicht zu lächeln.
»Ja, ich glaube, so lautet der Name. Mrs. Maybury hat uns erzählt, dass dieser Brummell in dieser Gruppe das Sagen hat, aber das wissen Sie vermutlich selbst. Mrs. Maybury ist gerade erst in den Kolonien angekommen, als wir abreisen wollten, und deswegen sind wir davon ausgegangen, dass es stimmt.«
»Und was hat sie erzählt?«, fragte Bradford.
»Sie meinte, wenn Brummell sich entschließt, eine Lady zu schneiden, dann könnte sie ebenso gut gleich ins Kloster gehen. Die Saison ist für sie erledigt, und sie muss in Schimpf und Schande aufs Land nach Hause reisen. Können Sie sich vorstellen, dass eine Person derart viel Macht hat?« Sie hob den Kopf, um Bradford anzusehen, und wünschte sich augenblicklich, sie hätte es nicht getan. Natürlich konnte er sich so viel Macht vorstellen, dachte sie, über sich selbst verärgert. Der Mann hatte sie wahrscheinlich erfunden. Sie seufzte und senkte den Blick. Bradfords Nähe machte sie langsam nervös. Sie sah zu Mr. Smith auf und entdeckte seine finstere Miene. »Oh, habe ich den Verband zu fest angelegt?«
»N-nein, es ist in Ordnung«, stammelte Mr. Smith.
»Aber wie ich schon sagte«, fuhr Caroline fort, »mir persönlich ist es egal, ob Beau Brummell mich schneidet. London reizt mich in dieser Hinsicht einfach nicht. Dennoch mache ich mir Sorgen, ob ich Charity mit meinem Benehmen in Verlegenheit bringe, denn ich möchte nicht, dass sie gedemütigt wird. Das wäre wirklich nicht schön.«
»Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass Beau Brummell weder Sie noch Ihre Cousine schneiden wird«, sagte Bradford.
»Sie sind viel zu hübsch, um Sie zu übersehen«, setzte Mr. Smith hinzu.
»Hübsch zu sein sollte nichts damit zu tun haben, ob man akzeptiert wird oder nicht«, sagte Caroline tadelnd. »Es ist das Wesen eines Menschen, das zählt.«
»Ganz abgesehen von dieser hehren Einstellung ... wie man hört legt Brummell gesteigerten Wert auf seine Grauen«, bemerkte Bradford trocken.
»Seine Grauen?«, wiederholte Caroline deutlich verwirrt.
»Seine Pferde«, antwortete Bradford. »Ich zweifle nicht daran, dass Sie versuchen würden, sie zu erschießen, wenn der Mann es wagen sollte, Sie oder Ihre Cousine unziemlich zu behandeln.« Seine Miene war ernst, aber in seinen Augen war ein warmes, neckendes Funkeln.
Caroline bemerkte es jedoch nicht. »Das würde ich niemals tun«, widersprach sie entrüstet.
Als er lächelte, schüttelte Caroline den Kopf. »Sie machen sich über mich lustig«, tadelte sie ihn. Dann wandte sie sich wieder an Mr. Smith. »So«, sagte sie. »Ich bin fertig. Behalten Sie den Puder, und wechseln Sie einmal täglich den Verband. Und sehen Sie um Himmels willen zu, dass Sie in nächster Zeit niemand verwundet. Sie haben genug Blut verloren.«
»Ist das Medikament auch von Ihrer Mama?«, fragte Mr. Smith misstrauisch.
Caroline nickte und kletterte aus der Kutsche. Von draußen packte sie Mr. Smith’ Beine und hievte sie auf die gegenüberliegende Sitzbank neben Bradford. »Ich fürchte, Sie hatten recht, Mr. Smith. Ihre schönen Stiefel sind ruiniert. Das feine Leder ... ganz voller Blut. Aber vielleicht bekommen Sie sie wieder sauber, wenn Sie sie mit Champagner waschen, so wie es laut Mrs. Maybury dieser Brummell immer tut.«
»Das ist ein gutgehütetes Geheimnis!«, rief Mr. Smith entrüstet.
»Nun ja, so geheim kann es wohl nicht sein«, erwiderte Caroline. »Mrs. Maybury wusste es und Sie ja offenbar auch.« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sie sich zu Bradford um. »Können Sie sich nun um Ihren Freund kümmern?«
Bradford wollte gerade nicken, als Charitys Stimme zu ihnen herüberdrang. »Wir haben den Kutscher gefunden«, rief sie. »Er hat eine gewaltige Beule auf dem Kopf, aber er wird es überstehen!«
Caroline nickte. »Ich wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Tag. Benjamin, wir können jetzt gehen. Mr. Bradford wird sich um Mr. Smith kümmern.«
In einer Sprache, die Bradford noch nie gehört hatte, sagte der schwarze Mann etwas zu Caroline, und sie lächelte und nickte. Offenbar hatte sie verstanden.
Und dann waren sie fort. Beide Männer schwiegen, während sie dem Dreiergrüppchen hinterhersahen, das sich auf der Straße von ihnen entfernte. Der Duke of Bradford sprang aus dem Wagen, um noch einen letzten Blick auf die schwarzhaarige Nymphe werfen zu können, und Mr. Smith steckte den Kopf aus dem Fenster.
»Meine Güte, ich fürchte, ich leide wie der König unter geistiger Umnachtung«, sagte der verwundete Mann mit einem verächtlichen Unterton in der Stimme. »Das kleine Ding kommt aus den Kolonien, und ich könnte mich dennoch Hals über Kopf in sie verlieben!«
»Dann beherrsch dich«, erwiderte Bradford knapp. »Ich will sie!« Die Bemerkung erlaubte keinen Widerspruch, und sein Freund war klug genug, dies mit einem heftigen Nicken anzuerkennen. »Mir ist es egal, ob sie aus den Kolonien kommt oder nicht«, setzte Bradford hinzu.
»Du wirst aber für gewaltiges Aufsehen sorgen, wenn du ihr nachstellst. Falls ihr Vater keinen Titel hat ... Denk an deine gesellschaftliche Stellung.«
»Das heißt, du würdest dich dagegenstellen?«, fragte Bradford interessiert.
»Nein, im Gegenteil. Sie hat mir mein Leben gerettet.«
Bradford hob fragend eine Augenbraue, und sein Freund setzte zu einer Erklärung an. »Diese Schufte wollten mich umbringen, doch da kam sie und schoss dem Anführer in die Hand.«
Bradford grinste. »Ich kann nicht behaupten, dass mich das erstaunt. Nach dem, was ich von ihr erlebt habe, halte ich sie durchaus für fähig, so etwas zu tun.«
»Einen anderen hat sie in der Schulter getroffen.«
»Ist dir aufgefallen, wie sie meinen Fragen ausgewichen ist?«
Mr. Smith gluckste vergnügt. »Ich hätte nie gedacht, dass ich dich mal lächeln sehe, Bradford, aber heute hast du ja förmlich nichts anderes getan. London wird sich das Maul zerreißen. Und ich glaube, du wirst es mit der Kleinen nicht leicht haben. Ich beneide dich glatt um die Herausforderung.«
Bradford gab keine Antwort, sondern wandte sich um und blickte zu der Wegbiegung, hinter der die Frauen und der Farbige verschwunden waren.
»Ich kann’s kaum erwarten, zu sehen, wie die Ladys der Gesellschaft reagieren, wenn sie sie sehen. Allein diese unfassbar blauen Augen! Du wirst dich mit Unmassen von Gentlemen schlagen müssen, Bradford. Herr im Himmel, sieh dir bloß meine Stiefel an!«
Der Duke of Bradford ignorierte die letzte Bemerkung. Dann begann er plötzlich zu lachen. »Und, Brummell? Würdest du es wagen, sie zu schneiden?«
KAPITEL 2
Die gemietete Kutsche fuhr in stetem Tempo nach London zurück. Benjamin, der dem Verantwortungsbewusstsein des Fahrers nicht mehr traute, hatte sich neben ihn auf den Kutschbock gesetzt.
Caroline und Charity saßen einander gegenüber, und nachdem Charity sich ausgiebig über den Vorfall mit den beiden Gentlemen ausgelassen hatte, versanken sie beide in nachdenklichem Schweigen.
Charity war gewöhnlich nicht so nervös. Caroline nahm an, dass ihre Cousine versuchte, mit ihrem aufgeregten Geschnatter ein wenig von der gewaltigen Anspannung zu kompensieren, unter der sie stand. Während Caroline wenig mitteilsam war, ließ Charity sie stets alles wissen, was ihr im Kopf umherging. Das war keine besondere Ehre, denn ihre Cousine teilte förmlich jedem, der nicht schnell genug weglaufen konnte, mit, was sie dachte. Ihre Mutter sagte immer, dass Charity die neusten Nachrichten schneller verbreitete als der Bostoner Journal.
Caroline war genau das Gegenteil von Charity. Im Allgemeinen wurde sie als ruhig und etwas scheu eingeschätzt, und sie hatte sich längst damit abgefunden. Es lag eben nicht in ihrer Natur, sich jedem anzuvertrauen. Anders als ihre Cousine machte sie auch ihre Probleme mit sich allein aus.
»Ich wünschte, wir hätten einen Plan, an den wir uns halten könnten, jetzt, da wir endlich in England sind«, entfuhr es Charity nun. Sie wrang und zwirbelte ihre rosafarbenen Handschuhe, die sie abgestreift hatte, derart heftig, dass sie schon recht mitgenommen aussahen. »Ich verlasse mich auf dich, Caroline. Du musst mir sagen, wie wir vorgehen sollen.«
»Charity, wir haben das doch schon unzählige Male durchgesprochen. Ich weiß ja, dass es schwer für dich ist, aber bitte versuch wenigstens, dir nicht allzu viele Sorgen zu machen. Wenn du dein Gesicht weiter so in Falten legst, dann siehst du bald aus wie eine alte Frau!« Carolines Stimme war sanft, aber fest. »Du weißt doch, dass ich dir helfen werde. Aber dafür musst du mir auch versprechen, vernünftig zu sein.«
»Vernünftig! Genau! Das werd ich sein! Das ist immer das Beste! Oh, ich wünschte, ich hätte etwas mehr von deinem Selbstvertrauen, Lynnie. Du wirkst immer so ruhig, so beherrscht!« Sie stieß einen in die Länge gezogenen Seufzer aus, der Caroline ein Lächeln entlockte. Ihre Cousine hatte in der Tat einen Hang zur Dramatik. »Aber was, wenn sich herausstellt, dass er verheiratet ist?«