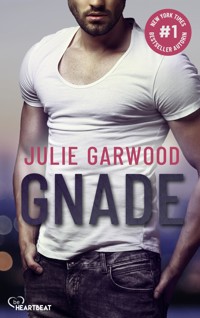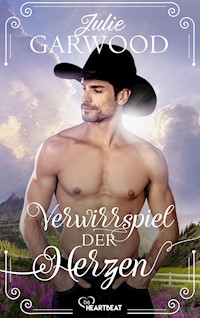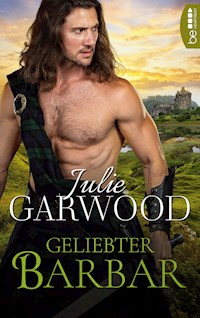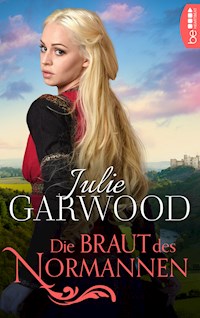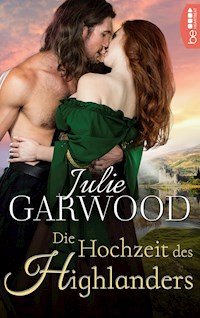4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Romance voller Leidenschaft
- Sprache: Deutsch
England, 1086: Die schöne Elizabeth Montwright entkommt nur knapp einem Massaker, bei dem ihre ganze Familie getötet wird. Von ihrer Burg vertrieben, schwört sie Rache und schmiedet einen Plan: Als Bäuerin verkleidet will sie zurückkehren und Baron Geoffrey Berkley, der die Mörder vertrieben hat, um Hilfe bitten.
Doch der hat anderes im Sinn. Und während Elizabeth sich anfangs noch gegen seine Annäherungsversuche zur Wehr setzt, entbrennt auch sie schon bald in Leidenschaft zu dem Krieger, der ihr Herz erobern will. Aber zuerst fordert sie Gerechtigkeit ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
Über die Autorin
Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
England, 1086: Die schöne Elizabeth Montwright entkommt nur knapp einem Massaker, bei dem ihre ganze Familie getötet wird. Von ihrer Burg vertrieben, schwört sie Rache und schmiedet einen Plan: Als Bäuerin verkleidet will sie zurückkehren und Baron Geoffrey Berkley, der die Mörder vertrieben hat, um Hilfe bitten.
Doch der hat anderes im Sinn. Und während Elizabeth sich anfangs noch gegen seine Annäherungsversuche zur Wehr setzt, entbrennt auch sie schon bald in Leidenschaft zu dem Krieger, der ihr Herz erobern will. Aber zuerst fordert sie Gerechtigkeit ...
Julie Garwood
Wie ein Feuer in dunkler Nacht
Aus dem amerikanischen Englisch von Kerstin Winter
PROLOG
»Die edlen Ritter sind zum Kämpfen geboren, und der Krieg erhöht all jene, die sich ohne Furcht oder Feigheit in den Kampf stürzen.«
Jean Froissart, französischer Chronist
England, 1086
Schweigend bereitete sich der Krieger auf den Kampf vor. Er saß auf einem hölzernen Schemel, hatte seine langen, muskulösen Beine ausgestreckt und wies seinen Diener an, ihm die gepanzerten Beinkleider überzustreifen. Dann stand er auf und ließ sich von einem zweiten Diener den schweren Kettenpanzer über das gesteppte Baumwollhemd legen. Schließlich hob er seine gebräunten Arme, damit man ihm sein Schwert, ein Geschenk von William persönlich, umgürten konnte.
Seine Gedanken weilten weder beim Ankleiden noch bei den Dienern, die um ihn herumscharwenzelten, sondern bei der Schlacht, die bevorstand. Erneut ging er in allen Einzelheiten die Strategie durch, die ihn und seine Männer zum Sieg führen würde. Ein Donnerschlag störte seine Konzentration. Mit zusammengezogenen Brauen schlug der Krieger die Zeltplane, die als Eingang diente, zurück und hob den Kopf, um die finsteren Wolken zu betrachten, die sich am Himmel zusammenballten. Während er eine Weile in den Himmel starrte, strich er sich das dunkle Haar aus dem Kragen, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Hinter ihm kümmerten sich die beiden Diener unbeirrt um ihre Aufgaben. Der eine nahm ein geöltes Tuch und machte sich daran, den Schild des Kriegers zum letzten Mal zu polieren. Der zweite kletterte mit dem offenen Helm des Ritters in den Händen auf den Hocker und hielt ihn abwartend mit ausgestreckten Armen vor seinem Körper. Er musste eine ganze Weile warten, bis der Ritter sich endlich wieder umdrehte und den Diener mit dem Helm wahrnahm. Der Ritter schüttelte abwehrend den Kopf. Lieber würde er das Risiko einer Verletzung eingehen, als die enorme Behinderung durch den Helm in Kauf zu nehmen. Der Diener reagierte mit einem Stirnrunzeln auf die Weigerung seines Herrn, den zusätzlichen Schutz anzulegen, war aber klug genug, die Entscheidung des Ritters nicht infrage zu stellen.
Endlich fertig gerüstet verließ der Ritter das Zelt und ging mit raschen, ausgreifenden Schritten zu seinem Reittier. Er stieg auf und trieb das Pferd aus dem Lager hinaus, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen.
Wie immer vor einer Schlacht suchte der Ritter Stille und Einsamkeit, und so ritt er in raschem Tempo in den dichten Wald hinein, ohne sich um die tiefhängenden Äste zu kümmern, die ihm und seinem Pferd tiefe Schrammen beibrachten. Erst als er oben auf einer kleinen Erhebung angekommen war, zügelte er das schnaubende Tier und blickte auf das unter ihm liegende Anwesen hinab.
Ein heilloser Zorn stieg in ihm auf, als er an all die Untreuen dachte, die sich in der Burg eingenistet hatten, doch er zwang diese Gefühlsregung nieder. Er würde seine Rache bekommen, wenn die Festung erst einmal wieder in seinen Händen war. Erst dann würde er seiner Wut nachgeben. Erst dann.
Der Ritter wandte seine Aufmerksamkeit dem Grundriss der Festung zu und war einmal mehr beeindruckt von der Schlichtheit der Konstruktion. Die dicken, unregelmäßigen Mauern, die fast zwanzig Fuß hoch waren, umgaben die verschiedenartigen Gebäude, die zur Burg gehörten, gänzlich. Die Festung grenzte an drei Seiten ans Ufer des gewundenen Flusses, und dies war einer der Vorzüge, die diese Burg so außergewöhnlich machten, denn ein Zugang vom Wasser aus war so gut wie unmöglich. Das Hauptgebäude bestand hauptsächlich aus Stein und wurde an beiden Seiten von einer Ansammlung kleiner Hütten flankiert, deren Fronten alle zum grasbewachsenen, ausgedehnten Vorplatz der Festung ausgerichtet waren. Wenn all dies wieder sein war, dann würde er die Festung uneinnehmbar machen, schwor er sich feierlich. So etwas durfte niemals wieder geschehen!
Immer noch türmten sich die dunklen, unheilvollen Wolken am Himmel auf und schoben sich langsam vor die aufgehende Sonne. Die ersten Strahlen drangen durch das Bleigrau der Wolkenfetzen und tauchten die Landschaft in ein unheimliches Licht. Der Wind unterstrich die unwirkliche Atmosphäre mit leisem Seufzen und klagendem Heulen, das wie das Flehen verlorener Seelen klang. Das pechschwarze Pferd des Ritters begann unruhig zu stampfen und zu tänzeln, doch er beruhigte es rasch und drückte ihm warnend seine Fersen in die Flanken.
Wieder blickte er zum Himmel, entdeckte, dass die drohenden Wolken jetzt direkt über ihm waren, und hatte das unbehagliche Gefühl, als würde es erneut Nacht, bevor die Sonne überhaupt aufgegangen war. Er konnte die Unruhe, die nun auch ihn überkam, nicht unterdrücken. War dies ein böses Omen? Auch er war nicht gänzlich frei von Aberglaube, obwohl er die verachtete, die sich davon beherrschen ließen. Er gehörte wenigstens nicht zu jenen, die vor jeder Schlacht fast panisch nach Zeichen suchten, die ihnen den Ausgang des Kampfes vorhersagten.
Noch einmal ging der Ritter seine geplante Strategie durch, um eventuelle Schwächen darin zu entdecken, doch obwohl er keine finden konnte, war er noch immer nicht vollkommen beruhigt. Beinahe resigniert nahm er die Zügel auf und wendete seinen Hengst. Er wollte im Lager sein, bevor das drohende Unwetter losbrach.
In diesem Moment explodierte der Himmel. Und als ein Blitz den Wald in grelles Licht tauchte, sah er sie.
Sie stand nicht weit von ihm entfernt auf dem Kamm eines Hügels, der den seinen überragte. Sie schien direkt auf ihn herabzublicken, aber dann erkannte er, dass dies nicht der Fall war. Nein, sie starrte auf die Festung, die unter ihm lag.
Sie saß aufrecht auf einem Schecken, flankiert von zwei gewaltigen Kreaturen, die entfernt Hunden ähnelten. Doch was für eine Rasse das hätte sein sollen, konnte er nicht sagen, denn sie ähnelten mehr Wölfen als den zahmen Haustieren, die er im Allgemeinen kannte. Bewundernd, fast genießerisch nahm der Ritter den Anblick, den sie bot, in sich auf. Sie war von schlanker Gestalt, ihr helles Haar flatterte frei im Wind, und selbst aus dieser Entfernung konnte er die vollen Brüste erkennen, die sich unter dem weißen Stoff ihres Kleides, das der Wind an ihren Körper presste, abzeichneten.
So herrlich der Anblick auch war, der Ritter war vor allem verwirrt. Was hatte sie hier zu suchen? Er konnte keine Erklärung finden, wusste aber, dass sie schöner war als jede Frau, die er je gesehen hatte. Das Licht schwand, doch kurz darauf jagte ein zweiter, noch hellerer Blitz über den Himmel, und die anfängliche Überraschung des Ritters verwandelte sich in ungläubiges Staunen. Er sah, wie ein Falke auf das Mädchen zuflog und sie ohne eine Spur von Furcht die Hand hob, als wollte sie den Raubvogel, der über ihr kreiste, begrüßen.
Der Ritter schloss für einen kurzen Moment die Augen, und als er sie wieder aufschlug, war sie fort. In einem plötzlichen Impuls gab er seinem Pferd die Sporen und stürmte auf die Stelle zu, an der sie ihm erschienen war. Reiter und Pferd stoben geschickt um Bäume und über dicke Wurzeln, aber als sie ihr Ziel erreicht hatten, war keine Spur von dem Mädchen zu sehen.
Nach einer Weile gab der Ritter die Suche auf. Seine Vernunft sagte ihm, dass das, was er gesehen hatte, wirklich gewesen war, doch sein Herz behauptete beharrlich, dass es sich um eine Vision – ein Omen! – gehandelt hatte.
Und was für eine Vision! Er war in Hochstimmung, als er im vollen Galopp in das Lager einritt. Seine Männer waren bereits aufgesessen und bereit. Der Ritter nickte zufrieden und winkte nach seiner Lanze und dem Schild, auf dem sein Wappen prangte.
Zwei Diener, die den schweren, rautenförmigen Schild zwischen sich trugen, hasteten herbei und blieben schweigend neben dem wartenden Ritter stehen, damit er ihn zu sich aufs Pferd heben sollte. Zu ihrer Verwirrung zögerte der Ritter jedoch, während ein kleines Lächeln über seine Lippen huschte. Seine nächste Geste verblüffte nicht nur seine Diener, sondern auch seine Männer, die ihn abwartend beobachteten, denn der Ritter beugte sich langsam vom Pferd, streckte die Hand aus und zeichnete bedächtig die Umrisse des Falken nach, der in das Wappen eingearbeitet war.
Dann warf er den Kopf zurück und stieß ein lautes, tiefes Gelächter aus, bevor er mühelos erst den schweren Schild auf sein Pferd hob und dann mit der Rechten die Lanze ergriff.
Sein wilder Schlachtruf übertönte sogar das Grollen des Donners.
KAPITEL 1
Die ersten langen, dünnen Finger aus Licht drangen durch das Dunkel der Nacht und tauchten den Horizont im Osten langsam aber stetig in ein dunkles Rot, vor dessen Hintergrund die Wolken blass und kraftlos wirkten. Elizabeth lehnte an dem rauen, ungehobelten Türrahmen der Hütte und beobachtete eine Weile, wie die Sonne sich am Himmel erhob. Schließlich streckte sie sich und trat hinaus ins Freie. Ein Falke kreiste in scheinbarer Schwerelosigkeit über den Wipfeln der Bäume. Als er die schlanke Gestalt aus der Hütte treten sah, beschleunigte er sein Tempo, schoss auf sie zu und ließ sich schließlich auf einen mit verkrustetem Schlamm bedeckten Felsbrocken neben dem Mädchen nieder. Wildes Flügelschlagen und ein schrilles Kreischen begleiteten seine Landung.
»Da bist du ja, mein Stolzer«, sagte Elizabeth freundlich. »Du bist früh heute Morgen. Hast du auch keinen Schlaf finden können?« Sie lächelte ihren Falken an und hob dann langsam einen Arm, bis er auf Taillenhöhe ausgestreckt war. »Komm«, befahl sie mit zärtlicher Stimme.
Der Falke bewegte den Kopf hin und her, ohne dass seine durchdringenden Augen ein einziges Mal von ihrem Gesicht abließen. Gurgelnde Laute kamen aus seiner Kehle. Seine goldenen Augen hatten ihre Wildheit nicht verloren, doch Elizabeth hatte keine Angst. Sie begegnete seinem Blick vertrauensvoll und wiederholte ihren Befehl sanft. Und endlich flatterte der Falke von seinem Felsen auf und landete auf ihrem bloßen Arm. Obwohl seine Krallen scharf wie Dolche waren, zuckte sie nicht einmal zusammen, denn der Falke würde ihr nicht einmal einen kleinen Kratzer beibringen. Ihre makellose Haut zeugte von seiner Vorsicht.
»Was soll ich nur mit dir machen?«, fragte Elizabeth. Ihre blauen Augen funkelten vergnügt, als sie ihren zahmen Falken betrachtete. »Du wirst immer fetter und fauler, mein Freund, und obwohl ich dir deine Freiheit geschenkt habe, kommst du immer wieder zu mir zurück. Ach, mein Lieber, wenn die Menschen doch auch nur so treu wären wie du.« Die Fröhlichkeit war aus ihren Augen verschwunden, und an ihre Stelle war eine umfassende Traurigkeit getreten.
In diesem Moment erklang das Trappeln von Pferdehufen, die auf sie zukamen. Elizabeth erstarrte. »Geh«, befahl sie, und der Falke schwang sich augenblicklich in die Luft. Furcht lag in ihrer Stimme, als sie nach ihren beiden Wolfshunden rief und auf den Schutz der dichten Bäume zuhastete. Die Hunde kamen herangestürmt und drängten sich an ihre Seite, als sie sich hinter den dicken Stamm eines Baumes presste. Elizabeth bedeutete den Hunden mit einer Handbewegung, keinen Laut von sich zu geben, während sie sich innerlich verfluchte, weil sie ihren Dolch in der Hütte gelassen hatte. Sie bebte am ganzen Körper und hielt unwillkürlich den Atem an.
Diebe und Plünderer, ganze Banden gesetzloser, vogelfreier Männer durchstreiften das Land, und jeder, der sich nicht innerhalb der schützenden Festungsmauern befand, war leichte Beute für ihre Gier und ihre Grausamkeiten.
»Mylady?«
Die Erleichterung überspülte Elizabeth wie eine Woge, als sie die Stimme ihres treuen Dieners hörte. Sie ließ sich kraftlos an den Baumstamm sinken und versuchte, ihr wild pochendes Herz zu beruhigen.
»Mylady? Ich bin’s, Joseph. Wo seid Ihr?«
Die wachsende Furcht in seiner Stimme veranlasste Elizabeth, endlich ihr Versteck zu verlassen. Sie huschte durch die Bäume, umrundete lautlos einen dicken Stamm und tippte dem Diener von hinten auf die Schulter.
Der alte Mann gab ein erschrecktes Quieken von sich und machte einen Satz nach hinten, wobei er seine junge Herrin beinahe zu Boden stieß. »Bei Gott, müsst Ihr mich so erschrecken?«, schimpfte er, aber als er die Zerknirschung in ihrem Gesicht sah, zwang er sich zu einem Lächeln, wobei er sein lückenhaftes Gebiss entblößte. »Und wenn Ihr Eure Stirn noch so sehr in Falten legt, der Anblick Eures reizenden Gesichts wird mich stets erfreuen.«
»Du sollst mir nicht immer schmeicheln, Joseph«, erwiderte Elizabeth mit einem Grinsen, und der Dienstbote war einmal mehr wie verhext von ihrer rauchigen, doch musikalischen Stimme. Bewundernd sah er ihr hinterher, als sie langsam auf die Hütte zuging und an der Tür anhielt. Es war erstaunlich, dass es ihm beim Anblick ihrer Schönheit immer noch die Sprache verschlug. Er kannte sie immerhin schon seit ihrer Kindheit.
»Komm, trink etwas mit mir und erzähl mir, was dich hergeführt hat«, forderte Elizabeth ihn auf. Ihre eben noch so schelmische Miene drückte plötzlich Besorgnis aus. »Ich habe mich doch nicht im Tag geirrt, nicht wahr? Du bist doch nicht gekommen, um mir wie üblich Nahrungsmittel zu bringen? Oder habe ich jetzt wirklich jedes Zeitgefühl verloren?«
Joseph spürte, dass sie über diese Möglichkeit ernsthaft beunruhigt war. Am liebsten hätte er sie in die Arme genommen und sie getröstet, doch das war natürlich nicht möglich. Sie war die Herrin, er nur der bescheidene Diener.
»Es ist fast einen Monat her, seit meine Familie –«
»Lasst uns nicht davon sprechen, Mylady«, unterbrach Joseph sie. »Und macht Euch keine Sorgen. Ihr habt Euch nicht geirrt, ich war erst vor zwei Tagen hier. Ich bin gekommen, um Euch eine wichtige Nachricht zu überbringen, und ich habe außerdem einen Plan, den ich Euch darlegen möchte.«
»Joseph, wenn du mir wieder vorschlagen willst, dass ich zu meinem Großvater gehen soll, dann bist du umsonst hergekommen. Meine Antwort lautet wie immer Nein. Niemals! Ich werde in der Nähe meiner Festung bleiben, bis ich mich an den Mördern meiner Familie gerächt habe! Das habe ich geschworen, und du wirst mich nicht davon abbringen!« Während sie sprach, schob sie trotzig das Kinn ein wenig vor und verschränkte die Arme vor der Brust. Joseph blickte rasch auf seine Stiefel, um ihrem eisigen Blick zu entgehen.
Schweigend wartete sie eine Weile ab. »Nun?«, fragte sie schließlich. Als er noch immer keine Antwort gab, stieß Elizabeth einen resignierten Seufzer aus und fuhr etwas freundlicher fort: »Hör auf, dich zu grämen, Joseph. Ich habe den kleinen Thomas fortgeschickt, damit er in Sicherheit ist. Das ist doch das Wichtigste, oder?«
Doch anstatt ihr zuzustimmen, sackten die Schultern des alten Mannes noch ein Stück weiter herab. Aber dann straffte er seinen gebeugten Rücken so gut es ging, rieb sich den kahlen Kopf und räusperte sich. »Die Schufte sind fort.«
»Was? Fort? Was soll das heißen, fort? Wie ist das möglich?« Ihre Stimme wurde mit jeder Frage lauter. Ohne sich dessen bewusst zu sein, hatte sie den Mann an seinem Umhang gepackt und schüttelte ihn nun heftig.
Joseph löste sanft ihre Hände von seinem Umhang. »Bitte, Mylady, beruhigt Euch! Gehen wir hinein, dann erzähle ich Euch alles, was ich weiß.«
Elizabeth nickte, drehte sich um und betrat rasch die Hütte. Sie versuchte, ihre Würde zu wahren, wie es ihre Erziehung von ihr verlangte, doch die aufwallenden Gefühle in ihrem Inneren machten es ihr unendlich schwer. Hunderte von Fragen wirbelten in ihrem Kopf herum.
Die Hütte, die aus einem einzigen Raum bestand, war nur spärlich ausgestattet. Elizabeth setzte sich auf einen der beiden Schemel, faltete die Hände im Schoß und gab sich alle Mühe, geduldig zu wirken, während Joseph ein Feuer im Herd entzündete. Obwohl es schon später Frühling war, war es in der Hütte kalt und feucht.
Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, bis Joseph sich endlich ihr gegenüber auf dem anderen Hocker niederließ. »Es geschah kurz nachdem ich Euch das letzte Mal besucht habe, Mylady. An dem Tag, als das fürchterliche Gewitter tobte«, begann er. »Ich war gerade auf dem einen Hügelkamm oberhalb der Festung angekommen, als ich sie sah. Oder besser: Ich sah eine gewaltige Staubwolke, als sie über die Straße zogen. Obwohl es nur etwa zweihundert Mann gewesen sein konnten, wirkten sie dennoch wie eine gewaltige, tödliche Streitmacht. Ja, der Boden zitterte unter den stampfenden Hufen ihrer Pferde, und ich war wie gebannt von dem Anblick. Dann sah ich ihren Anführer, der ganz an der Spitze der Krieger ritt. Er als Einziger trug keinen Helm.«
Er machte eine Pause, und Elizabeth hätte ihn vor Ungeduld am liebsten noch einmal geschüttelt. »Mir war klar, dass das Überraschungselement nicht zu ihrer Strategie gehörte, denn sie rissen einfach die Tore nieder und drangen in die Festung ein. Meine Neugier war so groß, dass ich alle Vorsicht vergaß und näher heranritt. Als ich einen günstigeren Aussichtspunkt gefunden hatte, sah ich, dass die Krieger sich in einem Halbkreis aufgestellt hatten und, die Schilde vor sich, langsam vorrückten. Es war eine unglaubliche Szene, die sich dort vor meinen Augen abspielte, glaubt mir. Immer wieder musste ich zu ihrem Anführer blicken, dessen Größe allein schon außergewöhnlich war. Er schwang sein Schwert mühelos, obwohl es mir so gewaltig vorkam, als könnten es kaum zwei Männer gemeinsam hochheben. Links und rechts fiel der Feind zu Boden und –«
»Waren es Krieger von Lord Geoffrey?« Sie hatte die Frage geflüstert, doch Joseph hatte sie durchaus gehört.
»Aye, es waren Lord Geoffreys Männer. Ihr wusstet doch, dass er Krieger aussenden würde.«
»Natürlich wusste ich es, Joseph«, sagte sie seufzend. »Mein Vater war sein Vasall, und es stand außer Zweifel, dass Lord Geoffrey zurückfordern würde, was er als sein betrachtet. Dennoch, wir haben ihm keine Nachricht geschickt. Wie konnte er so rasch hier eintreffen?«
»Das weiß ich auch nicht.«
»Belwain!« Elizabeth’ zorniger Aufschrei ließ Joseph zusammenzucken. Das Mädchen sprang auf und begann, unruhig hin- und herzulaufen.
»Euer Onkel?«, fragte Joseph. »Aber wieso sollte er –?«
»Natürlich«, unterbrach Elizabeth ihn. »Wir wissen beide, dass er hinter dem Mord an meiner Familie steckt. Er ist zu Geoffrey gegangen. Mein Gott, er hat seine eigenen Männer verraten, um Geoffreys Gunst zu gewinnen. Dieser Schuft! Was muss er ihm für Lügen aufgetischt haben!«
Joseph schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich wusste schon immer, dass er das Böse in sich hat, aber dass er so weit gehen würde, das hätte ich doch nicht gedacht!«
»Das bedeutet, dass wir keine Chance mehr haben, Joseph«, flüsterte Elizabeth gequält. »Lord Geoffrey wird auf die Lügen meines Onkels hören. Thomas und ich werden in Belwains Obhut gegeben werden, und er wird Thomas umbringen. Er muss ihn umbringen, denn nur wenn Thomas tot ist, kann Belwain Herr der Festung werden. Nur dann.«
»Vielleicht durchschaut Lord Geoffrey Euren Onkel«, sagte Joseph zaghaft.
»Ich habe Lord Geoffrey zwar noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe genug über ihn gehört«, sagte Elizabeth. »Es heißt, dass er überaus reizbar ist und die meiste Zeit schlechte Laune hat. Nein, ich glaube nicht, dass er sich die Mühe macht, die Lügen aufzudecken.«
»Mylady«, sagte Joseph flehentlich. »Vielleicht –«
»Joseph, wenn es nur mich allein betreffen würde, dann würde ich zu diesem Lord Geoffrey gehen und ihn anflehen, mir zuzuhören, denn Belwains Verbrechen müssen bekannt gemacht werden. Aber ich muss Thomas beschützen. Zum Glück glaubt Belwain, dass mein Bruder und ich ebenfalls umgekommen sind.«
Elizabeth nahm ihre Wanderung durch die kleine Hütte wieder auf. »Also gut, Joseph. Ich habe mich entschieden. Morgen früh reiten wir nach London, um im Haus meines Großvaters Schutz zu suchen.«
»Und Belwain?«, fragte Joseph zögernd. Er fürchtete sich vor der Antwort seiner Lady, denn er ahnte, was kommen würde. Er kannte seine Herrin gut genug. Niemals würde sie zulassen, dass Belwain mit seiner scheußlichen Tat ungeschoren davonkam.
»Ich werde ihn umbringen!«
Ein Holzscheit knackte in der Stille, die Elizabeth’ zornig hervorgestoßenem Schwur folgte. Der alte Diener spürte, wie sich ein eiskalter Klumpen in seiner Magengrube bildete. Er zweifelte nicht daran, dass seine Herrin tun würde, was sie gesagt hatte. Und leider hatte er ihr auch noch nicht alles berichtet, was er wusste. Er stemmte seine Hände auf die zitternden Knie und holte tief Luft. »Geoffreys Krieger haben Thomas.«
Elizabeth blieb wie angewurzelt stehen. »Das kann nicht sein! Er ist doch bei Großvater in Sicherheit! Du hast doch selbst gesehen, wie er mit Roland davongeritten ist! Joseph, du musst dich irren!«
»Nay, Mylady. Ich habe ihn mit eigenen Augen in der Festung gesehen. Ich weiß es ganz sicher. Er schlief neben einem Feuer, aber es war ganz zweifellos Thomas. Als ich mich vorsichtig erkundigte, erfuhr ich, dass er für stumm gehalten wird.« Joseph hob die Hand, als er sah, dass seine Herrin ihn unterbrechen wollte, und fuhr rasch fort: »Wie es geschehen konnte, dass er dort ist, weiß ich auch nicht. Geoffreys Männer haben nichts darüber gesagt. Aber eines ist ganz sicher: Sie haben keine Ahnung, wer der Junge ist, und sie behandeln ihn gut. Ja, es heißt sogar, dass der, der nun im Sterben liegt, ihm das Leben gerettet hat.«
»Joseph, sprich nicht in Rätseln! Wer liegt im Sterben?« Ungeduldig strich Elizabeth sich eine widerspenstige Locke, die ihr über die Augen fiel, zurück. Joseph stieß einen Seufzer aus und kratzte sich den kahlen Schädel.
»Ihr Anführer hat während der Schlacht einen Schlag auf den Kopf erhalten. Es heißt, dass er im Sterben liegt!«
»Wieso hast du das Risiko auf dich genommen, die Festung zu betreten?«
»Maynard, der Stallmeister, hat mir eine Nachricht zukommen lassen, dass Thomas sich innerhalb der Mauern aufhält. Ich wollte mich vergewissern, dass es stimmt«, erklärte Joseph. »Als ich hörte, dass der Anführer von Geoffreys Kriegern schwer verletzt ist, verlangte ich nach dem nächsten Befehlshaber. Rasch legte ich mir einen Plan zurecht und ...« Joseph räusperte sich wieder, bevor er fortfuhr. »Ich sagte ihnen, dass ich jemanden wüsste, der sich in der Heilkunst gut auskennt. Ich schlug vor, dass ich diesen Heiler unter der Bedingung herbeischaffen würde, dass er die Festung unbehelligt wieder verlassen dürfte, wenn der Anführer erst einmal wieder genesen war. Der Vasall des Lords fing gewaltig an zu zetern und sagte, dass er es nicht nötig habe, Versprechungen zu machen. Ich ließ mich aber nicht davon abbringen, und am Ende willigte er ein.«
Elizabeth hatte aufmerksam zugehört, als Joseph sein Vorhaben erklärte, doch nun begann sie wieder, umherzuwandern. »Und was, wenn er nicht wieder gesund wird?«, fuhr sie ihn zornig an. »Was dann?«
»Mylady, ich dachte, das Wichtigste sei, Euch mit Thomas zusammenzubringen. Vielleicht könnt Ihr ihn befreien, wenn Ihr innerhalb der Mauern seid. Nun schaut nicht wieder so wütend.« Der Diener sah sie flehend an. »Eure Mutter konnte Kranke heilen, und oft genug sah ich, wie Ihr ihr zur Hand gegangen seid. Bestimmt habt Ihr viel von ihr gelernt.«
Elizabeth starrte ins Leere, während sie über Josephs Vorschlag nachdachte. Alles in ihr schien sich zusammenzuziehen, als sie eine Entscheidung zu treffen versuchte. Das Wichtigste war natürlich Thomas: Sie musste ihn in Sicherheit bringen, da gab es nichts zu grübeln. Wenn die Krieger herausfanden, um wen es sich bei dem Jungen handelte, würden sie ihn sofort zu Lord Geoffrey bringen. Nach dem Gesetz war Thomas der Nächste in der Erbfolge – er würde die Festung bekommen. Doch bis er das Alter erreicht hatte, würde man ihn der Obhut seines Onkels übergeben, und genau das durfte nicht geschehen. Belwain würde gewiss nicht zögern, das einzige Hindernis auf seinem Weg zu Macht und Reichtum zu beseitigen. Nach Thomas’ Tod würde die Festung dann in seine Hände fallen ...
Nein, Elizabeth hatte keine Wahl. »Dein Plan ist vernünftig, Joseph. So Gott will, wird ihr Anführer genesen. Wenn nicht, dann haben wir wenigstens alles getan, was in unserer Macht steht.« Elizabeth schlug hastig das Zeichen des Kreuzes, und Joseph tat es ihr ebenso hastig nach.
»So Gott will«, murmelte er wie in einem Gebet. »So Gott will.«
»Joseph, während du meine Stute sattelst, mache ich mich bereit für die Reise.« Sie milderte den Befehl mit einem Lächeln ab, und Joseph verließ augenblicklich die Hütte. Er schloss die Tür hinter sich, umrundete das Häuschen und beeilte sich, das Reittier seiner Herrin zu satteln und aufzuzäumen. Als er kurz darauf wieder zur Tür kam, wartete Elizabeth schon auf ihn. Sie hatte sich umgezogen und trug nun ein blaues Kleid, das zwar schlicht, aber aus edlem Stoff war, und dessen Farbe genau zu ihren Augen passte.
Er nahm Elizabeth den Beutel mit Kräutern ab, den sie ihm hinhielt, und half ihr aufs Pferd. Zweifel an der Durchführbarkeit seines Plans überkamen ihn, und offenbar war ihm seine plötzliche Besorgnis anzusehen, denn Elizabeth beugte sich über den Pferdehals und tätschelte zärtlich seine faltige Hand. »Mach dir keine Sorgen, Joseph. Es wird langsam Zeit, dass wir etwas unternehmen. Alles wird gut, glaub mir.«
Als wollte er sicherstellen, dass die Worte seiner Herrin wahr würden, bekreuzigte Joseph sich noch einmal. Dann stieg er auf den Wallach, den er von Herman dem Kahlen, dem Hilfsburschen des Stallmeisters, ausgeliehen hatte, und ritt voraus in den Wald. Er hielt seinen Dolch in der Hand, bereit, sofort zuzustechen, sollte jemand es wagen, seine Herrin anzugreifen.
In weniger als einer Stunde hatten Elizabeth und Joseph die zerborstenen Tore erreicht, durch die die gewundene Straße zur Burg hinaufführte. Zwei grobschlächtige Wachen traten beiseite, um sie einzulassen, wobei beide einen respektvollen Abstand zu den zwei Wolfshunden einhielten, die Elizabeth’ Pferd flankierten. Erstaunen zeichnete sich auf den Gesichtern der Wachen ab, als Joseph und Elizabeth durch das Tor an ihnen vorbeiritten, doch sie sagten nichts, sondern grinsten einander nur mit hochgezogenen Augenbrauen an, als das Grüppchen aus Tier und Mensch in sicherer Entfernung war.
Als sie den Burghof erreicht hatten, stieg Joseph ab und beeilte sich, seiner Herrin vom Pferd zu helfen. Er spürte ihr Zittern, als sie ihre Hand in seine legte, und wusste, dass sie sich fürchtete. Doch als er ihr ins Gesicht sah, konnte er darin nur Gelassenheit und Würde entdecken, und er empfand Stolz auf dieses tapfere Mädchen, dem er schon so lange diente. »Ihr macht Eurem Vater alle Ehre, Mylady«, flüsterte er, als er sie aus dem Sattel hob. Ja, sie hatte die Tapferkeit von ihrem Vater geerbt, und er wünschte sich sehnlichst, dass Thomas sie nun hätte sehen können. Obwohl doch eigentlich er für ihren Schutz zu sorgen hatte, war sie es, die ihm mit der Ruhe, die sie ausstrahlte, Mut machte. Kopfschüttelnd gestand er sich ein, dass er ohne sie wahrscheinlich in diesem Moment davongelaufen wäre.
Als sie in den Hof eingeritten waren, hatte ein enormer Lärm geherrscht, denn die Männer waren noch immer dabei, Trümmer wegzuräumen und die lädierten Gebäude wieder instand zu setzen. Doch nun legte sich plötzlich eine seltsame Stille über das geschäftige Treiben, und als Elizabeth aufblickte, sah sie ein Meer von fremden Gesichtern, die sich alle ihr zugewandt hatten. Elizabeth blieb einen Augenblick neben ihrem Pferd stehen, dann nahm sie allen Mut zusammen, hob den Kopf und ging aufrecht auf die Menge der gaffenden Männer zu.
Hatte Joseph nicht behauptet, es wären nur zweihundert Mann gewesen? Er muss sich geirrt haben, dachte Elizabeth, denn ihr kam es so vor, als wären es mindestens tausend, die sie nun, teils mit offenen Mündern, teils mit amüsiertem Grinsen, anstarrten. Ihr ungehobeltes Benehmen konnte Elizabeth jedoch nicht einschüchtern. Stolz straffte sie die Schultern, tat, als würde sie nichts bemerken, und trat durch die Gasse, die die zurückweichenden Männer bildeten. Ein Windstoß riss ihr die Kapuze vom Kopf und befreite ihr goldenes Haar, das sich nun wie ein Wasserfall über ihre Schultern ergoss.
Würdevoll wie eine Königin ging Elizabeth durch die Doppeltür, die direkt in die Große Halle führte. Am Eingang hielt sie kurz inne, um ihren Umhang abzulegen, den ihr Joseph abnahm. Nun bemerkte sie, wie nervös er war, denn er hielt ihren Beutel mit Kräutern so fest umklammert, dass die Adern auf seinem Handrücken hervortraten. Um ihn zu beruhigen, schenkte sie ihm ein kleines, zuversichtliches Lächeln.
Die Männer, die sich in der Großen Halle befanden, starrten sie genauso verblüfft an, wie die draußen es getan hatten. Elizabeth nickte Joseph noch einmal zu, wandte sich dann um und ging, gefolgt von ihren Wolfshunden, quer durch den Saal auf den Kamin zu, ohne auch nur einem der Gaffer einen Blick zuzuwerfen. Das Schweigen lastete schwer über dem Raum, als sie ihre Hände am Feuer wärmte. Ihr war nicht wirklich kalt, aber sie brauchte Zeit, sich zu sammeln, bevor sie sich ihrem Publikum stellte. Als sie es nicht länger hinauszögern konnte, drehte sie sich um und begegnete den Blicken der Fremden, während ihre Hunde sich links und rechts von ihr abwartend setzten.
Langsam ließ sie ihren Blick durch den Raum gleiten. Was bis vor Kurzem noch ihr Heim gewesen war, bot nun einen trostlosen Anblick. Die Gobelins und die Banner hingen in Fetzen von den feuchten Steinwänden herab und riefen ihr in aller Schärfe in Erinnerung, was für eine Tragödie sich hier abgespielt hatte. Sie versuchte, an das Lachen zu denken, das so oft durch den Saal gehallt war, hörte jedoch nur die Schreie der Verwundeten und der Sterbenden. Die Halle war einfach nur noch eine Halle – sie konnte sich nicht einmal mehr ihre Eltern vorstellen, wie sie nebeneinander an dem langen Eichentisch gesessen hatten. Sie sah nur wieder und wieder das Schwert, das auf den Hals ihrer Mutter zusauste ...
Ein Hüsteln riss sie aus den Gedanken und zerstörte das drückende Schweigen. Elizabeth löste ihren Blick von den zerfetzten Bannern an den Wänden und sah die wartenden Männer an. Ein schelmisch aussehender Rothaariger, der an dem großen Tisch gesessen hatte, sprang auf, schlenderte heran und blieb direkt vor ihr stehen, sodass er ihr die Sicht auf die anderen versperrte. Es musste sich um einen Knappen handeln, denn er war zu alt, um ein Page zu sein, doch noch zu jung, um bereits zum Ritter geschlagen zu werden. Sein dümmliches Grinsen hätte ihr fast ein Lächeln entlockt, aber sie riss sich zusammen. Es war besser, keinerlei Gefühlsregung zu zeigen.
Der Knappe musterte sie unverhohlen und sagte laut genug, dass es jeder hören konnte: »Du bist aber ein hübsches Ding. Was genau gedenkst du denn für unseren Herrn zu tun?«
Als sie nicht gleich auf seine Frechheit antwortete, brüllte er über die Schulter: »Sie hat Haar wie aus Sonnenstrahlen gesponnen. Ich wette, es fühlt sich an wie feine Seide.« Er hob eine Hand, um nach einer Locke zu grabschen, erstarrte aber mitten in der Bewegung, als ihre Stimme, sanft und doch drohend, erklang.
»Ich nehme doch an, dass du an deinem Leben hängst!«
Das tiefe Grollen der Hunde unterstrich ihre Worte, und das Lächeln auf den Lippen des Knappen schwand. Vorsichtig nahm er die Hand herunter und warf beiden Hunden einen Blick zu. Sie waren aufgesprungen, hatten die Nackenhaare aufgestellt und die Lefzen hochgezogen, sodass ihre dolchspitzen Zähne zu sehen waren.
Bleich und sichtlich verärgert sah der junge Mann wieder Elizabeth an. »Ich tue dir nichts, denn du stehst unter dem Schutz des Falken«, flüsterte er. »Du brauchst keine Angst vor mir zu haben.«
»Dann brauchst auch du keine Angst vor mir zu haben«, erwiderte Elizabeth ebenfalls flüsternd, sodass nur er es hören konnte. Sie lächelte ihn an, und der Zorn des Knappen verpuffte. Niemand hatte ihre Worte mitbekommen, und somit war seine Ehre gerettet. Mit einer Geste bedeutete Elizabeth ihren Hunden, sich wieder zu setzen, und die beiden riesigen Tiere gehorchten schwanzwedelnd.
»Wo ist dein Anführer?«, fragte sie.
»Folge mir, dann bringe ich dich zu ihm«, antwortete der Knappe.
Elizabeth nickte und ließ den Jungen vorgehen. Joseph wartete am Fuß der Treppe, und sie nahm ihm mit einem Lächeln den Beutel mit den Kräutern ab. Dann eilte sie hinter dem Jungen die gewundene Treppe hinauf.
Während sie über die ausgetretenen Stufen lief, kamen die Erinnerungen wieder. Sie dachte daran, wie sie, ihre Schwestern und ihr kleiner Bruder sich auf der Treppe hinterhergejagt waren, wie sie Fangen gespielt hatten, wie sie hinabgehüpft waren ... Nein! Sie durfte jetzt nicht daran denken. Später war noch genug Zeit zum Weinen und zum Trauern. Thomas’ Zukunft hing von ihrem Handeln ab!
Als sie das erste Stockwerk erreicht hatten, kam ihnen ein älterer Ritter entgegen. Sein Stirnrunzeln war bedrohlich, und Elizabeth wappnete sich gegen die nächste Konfrontation.
»Du bist eine Frau! Wenn das eine Falle ist ...«
»Es ist keine Falle«, erwiderte Elizabeth. »Ich verstehe etwas von der Heilkunst und kann Eurem Herrn helfen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihn zu heilen.«
»Und warum solltest du uns so freigebig deine Hilfe anbieten?«, verlangte er barsch zu wissen.
»Braucht Ihr für alles eine Erklärung?«, erwiderte sie. Zorn und unendliche Müdigkeit überkamen sie, aber sie würde sich nichts anmerken lassen. »Wollt Ihr meine Hilfe nun oder nicht?«
Der Ritter starrte sie einen Moment lang nur schweigend an. Es war nicht zu verkennen, dass er ihr nicht über den Weg traute, aber sie dachte nicht daran, sein Misstrauen zu zerstreuen. Stattdessen begegnete sie nur trotzig und schweigend seinem Blick.
»Komm mit. Die Hunde warten hier!«, befahl er ihr schließlich barsch.
»Nay«, erwiderte Elizabeth prompt. »Sie kommen mit mir. Sie werden nichts anstellen, es sei denn, jemand will mir etwas tun!«
Zu ihrer maßlosen Überraschung protestierte er nicht mehr. Stattdessen fuhr er sich mit einer Hand durch sein braunes, mit grauen Strähnen durchzogenes Haar, und Elizabeth hätte schwören können, dass sie einen resignierten Seufzer vernahm.
Noch überraschter war sie, als er sie nicht in den Gang führte, in dem sich die drei größeren Schlafkammern befanden, sondern sich nach rechts wandte, eine Fackel aus der Halterung an der Wand nahm und durch den schmalen Korridor ging, der ausgerechnet zu ihrem ehemaligen Zimmer führte. Zwei Wachposten standen vor der Tür. Sie blickten verdutzt auf, als sie Elizabeth sahen.
Beklommen betrat Elizabeth hinter dem Ritter das Zimmer. Rasch blickte sie sich um und stellte zu ihrem Erstaunen fest, dass alles noch genauso war, wie sie es verlassen hatte. Die Kammer war kleiner als die anderen im Haus, doch Elizabeth hatte nie eine andere haben wollen. Zum einen gefiel es ihr, dass das Zimmer so weit von den anderen entfernt lag, und zum anderen bot das Fenster einen atemberaubenden Blick über den Wald, der jenseits des Flusses begann.
Der Kamin nahm den größten Teil der gegenüberliegenden Wand ein. Links und rechts davon standen zwei hölzerne Stühle mit königsblauen Kissen, die ihre Schwester Margaret für sie genäht hatte.
Ihr Blick wanderte zu dem Teppich, der über der Feuerstelle hing. Das Blau, das die Farbe der Kissen wieder aufnahm, war mit zartgelben Fäden durchwirkt, die die Umrisse ihrer beiden Wolfshunde darstellten. Am oberen Rand des Gobelins konnte man einen Falken erkennen, der in Burgunderrot gehalten war. Während sie auf den Wandteppich starrte, überflutete sie die Erinnerung. Sie und ihre Mutter, die stundenlang über dem Teppich gesessen und gearbeitet hatten ...
Nein! Nicht jetzt! Elizabeth schüttelte den Kopf, um die qualvollen Gedanken loszuwerden. Dem Ritter, der sie aufmerksam beobachtet hatte, entging die Geste nicht. Nachdenklich blickte er von ihr zu dem Gobelin und wieder zurück zu ihrem Gesicht, in dem er den flüchtigen Ausdruck von Schmerz und Trauer wahrnahm. Neugier glomm in seinen Augen auf, doch Elizabeth achtete kaum auf ihn. Sie hatte sich zum Bett umgedreht, dessen blaugelbe Vorhänge zurückgebunden waren und den Blick auf den Anführer von Geoffreys Männern freigaben. Das Erste, was Elizabeth auffiel, war die enorme Größe des Mannes. Wenn er stand, musste er sogar ihren Großvater überragen!
Sein Haar war rabenschwarz und berührte das Kopfende des Bettes, während seine Füße beinahe über das Fußende hinaushingen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund machte ihr sein Anblick Angst, doch sofort schalt sie sich innerlich, dass dies Unsinn war. Er war krank, er lag im Sterben. Sie brauchte sich gewiss nicht vor ihm zu fürchten. Eingehend musterte sie seine harten, wettergegerbten Züge. Er war attraktiv, das war nicht zu übersehen. Attraktiv und ... hart wie Stein.
Während sie ihn noch ansah, begann der Krieger, sich unruhig im Bett hin- und herzuwerfen. Er stöhnte, murmelte mit schwacher, aber tiefer Stimme unverständliche Wörter, und seine Qual löste ihre Erstarrung. Sie trat zum Bett, legte ihm die Hand auf die feuchte Stirn, wobei sie die schweißverklebten Haare sanft zur Seite strich. Ihre milchig weiße zarte Hand bildete einen starken Kontrast zu der gebräunten Haut seines Gesichts.
»Er hat hohes Fieber«, bemerkte sie. »Wie lange ist er schon in diesem Zustand?« Noch während sie sprach, entdeckte sie die Schwellung über seiner rechten Schläfe und betastete sie mit äußerster Vorsicht. Der alte Krieger hatte sich am Fußende des Bettes aufgestellt und beobachtete sie mit gerunzelter Stirn.
»Ich habe gesehen, wie ihn die Keule traf. Er stürzte zu Boden, und seitdem geht es ihm schlecht.«
Elizabeth zog konzentriert die Brauen zusammen. »Das ergibt keinen Sinn«, murmelte sie. »Ein Schlag auf den Kopf erzeugt kein Fieber.« Dann richtete sie sich auf und wandte sich mit einem Ausdruck der Entschlossenheit dem Ritter zu. »Helft mir, ihn auszuziehen.«
Elizabeth ließ ihm keine Zeit zum Protest, sondern begann augenblicklich, die Bänder im Nacken des Kriegers zu lösen. Der alte Ritter zögerte noch einen Moment, schien sich dann aber ein Herz zu fassen und kam ihr zur Hilfe, indem er seinem Anführer die eng anliegenden Hosen abstreifte.
Obwohl sie sich anstrengte, gelang es Elizabeth nicht, das gesteppte Hemd, das inzwischen mit dem Schweiß des Fiebernden vollgesogen war, über dessen Schultern zu ziehen. Mit einem ärgerlichen Seufzen griff sie nach ihrem Dolch an ihrer Taille, um den dicken Stoff damit durchzuschneiden.
Der Ritter sah nur das Aufblitzen von Metall. Ohne zu zögern holte er aus, und schlug Elizabeth den Dolch aus der Hand. Sofort sprangen die Hunde knurrend auf, doch Elizabeth brachte sie mit einer raschen Geste zum Schweigen. Dann wandte sie sich dem grauhaarigen Mann zu und sagte freundlich: »Ich weiß, dass Ihr keinen Grund habt, mir zu trauen. Doch ich will Eurem Anführer nichts Böses. Ich wollte nur sein Hemd aufschneiden.«
»Und wozu?«, verlangte der Mann zu wissen.
Elizabeth ignorierte die Frage und bückte sich, um den Dolch vom Boden aufzuheben. Sie schlitzte das Hemd am Hals ein Stück auf und riss es dann mit beiden Händen auseinander. Ohne ihren wütenden Helfer anzublicken, bat sie ihn freundlich, kaltes Wasser zu holen, damit sie seinem Herrn den Schweiß abwaschen und seinen heißen Körper kühlen konnte.
Zähneknirschend gab der Ritter den Befehl an die Wachposten draußen weiter. Währenddessen untersuchte Elizabeth Arme und Hals des Kranken nach möglichen Verletzungen ab. Mit einiger Überwindung ließ sie ihren Blick abwärtsgleiten und spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Sie hatte noch nie im Leben einen nackten Mann gesehen. Obwohl es Sitte war, dass die Töchter des Hauses den adeligen Gästen beim Baden halfen, hatte ihr Vater es nie erlaubt, sondern stets die Dienerschaft angewiesen, diese Aufgabe zu erledigen. Er hatte seinen Freunden in dieser Hinsicht misstraut und wollte sie nicht erst in Versuchung führen.
Doch die Neugier siegte über ihr Schamgefühl, und Elizabeth wagte einen raschen Blick auf den Unterkörper des Mannes. Sie war ein wenig überrascht, dass dieser Mann hier nicht mit der Furcht einflößenden gewaltigen Waffe ausgestattet war, die, wie sie gehört hatte, alle Männer besaßen. Vielleicht hatten die Dienerinnen, die sie bei solchen Gesprächen belauscht hatte, ja übertrieben, und Männer sahen halt so aus wie dieser hier. Oder aber ihr Patient war schlicht und ergreifend von der Natur benachteiligt.
Aber im Augenblick war diese Frage auch nicht so bedeutend. Elizabeth bekreuzigte sich rasch und konzentrierte sich auf ihre Aufgabe. Sie griff nach sauberen Leinentüchern und riss sie in Streifen. Als das Wasser gebracht wurde, tauchte sie den Stoff hinein und machte sich daran, das Gesicht des Kriegers abzuwischen.
Der Krieger regte sich inzwischen kaum noch, und sein Atem kam stoßweise und viel zu flach. Eine hässliche rote Narbe, gut versteckt durch sein leicht lockiges schwarzes Haar, zog sich vom linken Augenwinkel halbkreisförmig hinter sein Ohr. Seinem attraktiven Äußeren schadet sie allerdings nicht, dachte Elizabeth, während sie mit dem feuchten Tuch vorsichtig den roten Wulst entlangfuhr.
Als sie sich Schultern und Brust widmete, entdeckte sie noch weitere Narben. Zu viele für meinen Geschmack, dachte sie. Schließlich gelangte sie bei seiner Taille an und hielt mit dem Wischen inne. »Helft mir, ihn umzudrehen«, befahl sie dem älteren Ritter.
Dieser war am Ende seiner Geduld angelangt. »Bei allen Heiligen, Frau! Er braucht ein Heilmittel, kein Bad!«, brüllte er seine Verärgerung heraus.
»Ich muss wissen, ob der Schlag auf dem Kopf alles ist, was er abbekommen hat«, erwiderte Elizabeth in gleicher Lautstärke. »Ihr habt Euch ja nicht einmal die Zeit genommen, ihm seine Rüstung auszuziehen!«
Der grauhaarige Krieger schnappte nach Luft, kreuzte die Arme trotzig vor der Brust und funkelte sie wütend an. Elizabeth kam zu dem Schluss, dass sie nicht auf seine Hilfe zählen durfte. Sie warf ihm einen Blick zu, der, wie sie hoffte, mörderisch war, und wandte sich dann wieder dem Kranken zu. Seufzend griff sie quer über das Bett, packte seine schlaffe Hand mit ihren beiden und zog. Sie zog so fest sie konnte, legte all ihre Kraft hinein und stöhnte vor Anstrengung ... doch es half nichts. Der große, schwere Mann bewegte sich nicht. Elizabeth dachte nicht daran, aufzugeben. Ohne zu bemerken, dass sie sich auf die Unterlippe biss, zerrte sie weiter und glaubte schon, endlich Erfolg zu haben, als die Hand des Kranken plötzlich zurückschnellte. Elizabeth wurde mitgerissen und landete quer über der breiten Brust des Mannes. Panisch versuchte sie, ihre Hand aus dem Griff des Kriegers zu lösen, doch dieser hielt eisern fest. Elizabeth wollte lieber nicht wissen, was in seinem fiebrigen Kopf gerade vorging.
Der Vasall beobachtete eine Weile kopfschüttelnd Elizabeth’ vergeblichen Versuche, sich selbst zu befreien. Endlich entschloss er sich zum Handeln. »Aus dem Weg, Weib!«, brüllte er, trat ans Bett, riss ihre Hand aus der des Anführers und zerrte sie grob auf die Füße. Mit einer einzigen, scheinbar mühelosen Bewegung hievte er den Kranken herum, sodass er nun auf seinem Bauch lag. Die Verärgerung wandelte sich in Entsetzen, als der Vasall den blutdurchtränkten Stoff sah, der seinem Anführer am Rücken klebte. Schockiert trat er einen Schritt zurück.
Elizabeth überkam pure Erleichterung, als sie die bösartige Wunde sah. Dies war etwas, mit dem sie umgehen konnte. Sie setzte sich auf die Bettkante und löste den Stoff behutsam von der eiternden Verletzung. Als der Vasall den klaffenden diagonalen Schnitt im Rücken seines Herrn deutlich erkennen konnte, führte er fassungslos eine Hand an seine Stirn. Ohne sich der Tränen zu schämen, die in seine Augen traten, stammelte er flüsternd: »Ich ... ich habe nicht einen Moment daran gedacht ...«
»Macht Euch keine Vorwürfe«, unterbrach Elizabeth ihn. Sie lächelte ihn mitfühlend an, bevor sie fortfuhr: »Jetzt weiß ich wenigstens, was das Fieber erzeugt hat. Wir brauchen mehr Wasser, doch dieses Mal muss es heiß sein. Fast kochend, bitte.«
Der Vasall nickte und stürzte aus der Kammer. Innerhalb kürzester Zeit wurde ein Kessel mit dampfendem Wasser hereingebracht. Obwohl Elizabeth sich äußerlich ruhig gab, fürchtete sie sich entsetzlich vor dem, was sie nun tun musste und wobei sie ihre Mutter schon unzählige Male beobachtet hatte. Sie schickte im Stillen ein Gebet zum Himmel, dann tauchte sie einen frischen Leinenstreifen in das heiße Wasser und verzog das Gesicht. Den Schmerz ignorierend, wrang sie den Lappen aus und holte tief Luft. Zögernd wandte sie sich an den Vasallen. »Ihr werdet ihn festhalten müssen«, flüsterte sie. »Ich fürchte, es wird ihm schreckliche Schmerzen bereiten ...«
Der Vasall nickte und legte seinem Herrn beide Hände auf die breiten Schultern.
Elizabeth zögerte immer noch. »Ich muss das Gift aus seinem Körper holen, denn sonst wird er sterben.« Sie war sich nicht sicher, wen sie davon überzeugen wollte, dass es absolut notwendig war, dem Kranken zusätzliche Schmerzen zuzufügen – dem Vasallen oder sich selbst.
»Aye«, erwiderte der ältere Ritter nur knapp. Hätte Elizabeth in diesem Moment aufgeschaut, so wäre ihr gewiss nicht entgangen, dass er ihr einen mitfühlenden Blick zuwarf, doch sie starrte nur voller Furcht auf die Wunde des Kriegers, die sie nun säubern musste.
Dann holte sie tief Atem und legte das heiße, nasse Tuch auf die klaffende Verletzung. Der Krieger reagierte augenblicklich und heftig. Er bäumte sich auf, griff nach hinten und versuchte, den Lappen von seinem Rücken zu reißen, doch der Vasall drückte ihn mit aller Kraft nieder. Der gequälte Aufschrei verschlug Elizabeth den Atem, und sie schloss entsetzt die Augen.
In diesem Moment wurde die Tür zu der Kammer aufgestoßen, und die zwei Wachposten stürmten mit gezogenen Schwertern herein. Verwirrung und Angst zeichnete sich auf ihren Gesichtern ab. Der Vasall, der noch immer seinen Herrn aufs Bett niederdrückte, schüttelte den Kopf und befahl ihnen, ihre Waffen zu senken.
»Es muss getan werden«, sagte Elizabeth ruhig. Mit einem letzten verunsicherten Blick auf ihren Herrn wandten sich die Wachen um und verließen die Kammer wieder.
»Er würde niemals einen Laut von sich geben, wenn er wach wäre«, murmelte der Vasall. »Er weiß nicht, was er tut.«
Elizabeth zog eine Augenbraue hoch, während sie einen zweiten Lappen auf die Wunde legte. »Glaubt Ihr, es schadet seiner Männlichkeit, wenn er auf die Schmerzen reagiert?«
»Er ist ein mutiger, furchtloser Krieger«, antwortete der Vasall mit einer Spur Entrüstung in seiner Stimme.
»Im Augenblick beherrscht das Fieber sein Tun«, sagte Elizabeth, um ihn zu besänftigen.
Es funktionierte: Der Vasall nickte fast zufrieden. Elizabeth verkniff sich ein Lächeln und wandte sich wieder ihrer Aufgabe zu. Sie zog die Lappen, an denen rotgelber Eiter klebte, von der Wunde, und wiederholte diese Prozedur so lange, bis nur noch hellrotes Blut aus dem klaffenden Schnitt sickerte. Als sie den letzten Stoffstreifen abhob, waren ihre Hände von dem heißen Wasser genauso rot wie die Wunde. Sie rieb sie eine Weile aneinander, um das Brennen zu vertreiben, dann griff sie nach ihrem Beutel. Mehr zu sich selbst als zu dem Vasallen sagte sie: »Ich glaube nicht, dass wir die Verletzung mit einem glühenden Messer schließen müssen. Das Blut scheint mir nun sauber, und es ist nicht so viel, als dass er daran sterben könnte.«
Der Anführer war nun wieder bewusstlos, und Elizabeth dankte Gott dafür, denn sie wusste, dass die Arznei, die sie nun auftragen würde, keinesfalls schmerzlindernd war. Sorgfältig schmierte sie eine dicke Schicht einer übel riechenden Salbe auf die Ränder des Schnittes und legte einen Verband an. Als sie damit fertig war, bat sie den Vasallen, den Kranken wieder umzudrehen und seinen Kopf anzuheben, damit sie ihm eine Mischung aus Wasser, Salbei, Malve und Nachtschatten einflößen konnte.
Mehr konnte sie nicht tun. Elizabeth’ ganzer Körper schmerzte von der Anstrengung, und sie stand auf und trat zum Fenster. Dort schob sie das Fell zur Seite, das den Wind abhielt, und entdeckte überrascht, dass die Nacht bereits hereingebrochen war. Müde lehnte sie sich an die steinerne Mauer und genoss die kühle Brise, die ihre Sinne wiederbelebte und ihren Körper erfrischte. Schließlich drehte sie sich wieder zu dem Vasallen um, der, wie sie jetzt erst bemerkte, erschöpft und ausgezehrt wirkte. »Geht ruhig und schlaft ein wenig. Ich werde über Euren Anführer wachen.«
»Nay«, sagte er. »Ich kann erst wieder schlafen, wenn ich weiß, dass der Falke sich erholt.« Während er sprach, legte er einen weiteren Scheit auf das Feuer.
»Wie heißt Ihr?«, fragte Elizabeth.
»Roger.«
»Roger, warum nennt Ihr Euren Anführer den ›Falken‹?«
Der Vasall, der vor dem Feuer hockte, warf ihr einen kurzen Blick zu, und antwortete dann barsch: »Jeder, der mit ihm in den Kampf zieht, nennt ihn so. Das ist einfach so.«
Elizabeth fand seine nichtssagende Antwort seltsam, aber sie wollte ihn nicht durch weitere Fragen verärgern. Stattdessen wagte sie einen Vorstoß. »Ich habe gehört, dass Ihr einen Jungen bei Euch habt, der nicht spricht. Der Falke soll ihm das Leben gerettet haben. Ist das wahr?«
»Aye.« Das Misstrauen kehrte in die Augen des Vasallen zurück, und Elizabeth erkannte, dass sie überaus behutsam vorgehen musste, wenn sie etwas erreichen wollte.
»Wenn es der Junge ist, für den ich ihn halte, dann weiß ich, wer seine Familie ist, und wäre bereit, ihn mit mir zu nehmen, wenn ich gehe.«
Roger betrachtete sie nachdenklich. Sein Schweigen steigerte Elizabeth’ Anspannung ins Unerträgliche, aber sie zwang sich, nach außen hin ruhig zu bleiben. »Nun, was sagt Ihr, Roger?«
»Ich werde sehen, was ich tun kann. Allerdings ist nur der Baron berechtigt, eine Entscheidung zu treffen.«
»Aber Baron Geoffrey wird sich doch niemals herbequemen«, entfuhr es ihr. »Es würde mindestens einen Monat dauern, bis ich eine Antwort erhalte, ob ich den Jungen mitnehmen kann oder nicht! Er will doch gewiss auch, dass das Kind wieder zu seinen Eltern kommt! Könnt Ihr nicht an seiner Statt einen Entschluss fassen? Ich bin überzeugt, dass der Baron froh sein wird, sich nicht um solche Kleinigkeiten zu kümmern. Schließlich ist Montwright doch nur ein kleines Anwesen verglichen mit anderen.« Fast hätte Elizabeth hinzugefügt, dass dies ihr Vater zu vielen Gelegenheiten gesagt hatte. Und es musste wahr sein, denn Baron Geoffrey hatte sie niemals auf dieser Burg besucht. Nein, wenn es irgendwelche Geschäfte zu erledigen gab, war Lord Thomas stets zum Hauptsitz des Barons gereist, um dort mit ihm zu sprechen.
Der Vasall war sichtlich überrascht von ihrem Ausbruch. »Einen Monat? Unsinn. Du brauchst doch nur darauf zu warten, dass das Fieber zurückgeht und er erwacht. Dann kannst du ihn fragen«, sagte er. »Und im Übrigen irrst du dich, Kind. Keine Burg ist so unbedeutend, dass Baron Geoffrey sich nicht darum kümmern würde. Er beschützt alle, die ihm Treue geschworen haben, ob sie nun reich oder arm, hochrangig oder niedriggestellt sind.«
»Wollt Ihr mir damit sagen, dass der Falke mir die Erlaubnis geben kann? Er darf Entscheidungen für den Baron treffen?«, fragte Elizabeth hoffnungsvoll. »Oh, dann wird er mir sicher meinen Wunsch erfüllen«, setzte sie freudig hinzu. »Ich habe mich schließlich um ihn gekümmert! Er kann ja gar nicht anders!« Erleichtert klatschte sie in die Hände.
»Du weißt nicht, wen du da gerade behandelt hast, nicht wahr?«, fragte Roger, dessen Mund sich zu einem breiten Grinsen verzog.
Elizabeth sah ihn stirnrunzelnd an.
»Der Falke ist Baron Geoffrey, Overlord von Montwright.« Roger setzte sich in einen der Stühle, legte seine Füße auf den anderen und wartete triumphierend auf eine Reaktion.
»Er ist Baron Geoffrey?«, fragte sie ungläubig.
»Aye«, bestätigte Roger ihr. Er legte die Füße übereinander und grinste noch breiter. »Warum überrascht dich das denn so? Sag nicht, du hättest noch nie von ihm gehört.« Mit einem Hauch Arroganz setzte er hinzu: »Sein Ruf ist in ganz England bekannt.«
»Ja, schon, aber ich dachte, er wäre alt ... älter als ...« Sie brach ab und wies mit der Hand in Richtung Bett. Sie musterte den Kranken, den sie eben behandelt hatte, während ihre Gedanken sich überschlugen. Ihr Vater hatte niemals erwähnt, in welchem Alter sein Herr war. Sie hatte einfach angenommen, dass er ein alter Mann war – genau wie die anderen Barone, die sie kennengelernt hatte. Sie lehnte sich wieder an die kühle Mauer und sah Roger stumm an. Er schien sich über ihre Unwissenheit köstlich zu amüsieren.
»Er ist der jüngste Baron Williams«, sagte Roger stolz. »Und der mächtigste!«
»Wenn der Baron wieder gesund wird, dann steht er doch in meiner Schuld, oder nicht?«, fragte Elizabeth zögernd. Sie schickte ein hastiges Gebet zum Himmel, dass sie recht behalten würde und Geoffrey ein Mann von Ehre war. Denn dann würde er ihr vielleicht zuhören, würde sie ihn vielleicht überzeugen können, dass ihr Onkel ein gemeiner Schuft war, dass er ihr helfen musste! Ja, falls er wieder gesund würde ...
Ein Klopfen an der Tür unterbrach ihre Gedanken. Roger bedeutete ihr, dort zu bleiben, wo sie war, und ging zur Tür, um sie zu öffnen. Flüsternd sprach er ein paar Worte mit den Wachposten, dann wandte er sich zu Elizabeth um. »Dein Diener will mit dir sprechen.«
Elizabeth nickte und folgte einer der Wachen hinaus und den langen Flur entlang, an dessen Ende Joseph auf sie wartete. Seine Miene war sorgenvoll. »Joseph, es ist der Baron selbst, um den ich mich gekümmert habe.«
»Aye«, antwortete Joseph. Er wartete, bis die Wache außer Hörweite war, bevor er fortfuhr. »Wird er genesen?«
»Vielleicht«, erwiderte Elizabeth. Nach einem kurzen Moment des Zögerns setzte sie hinzu: »Jetzt hilft nur noch beten. Es ist Thomas’ einzige Chance.«
Josephs Sorgenfalten vertieften sich, aber Elizabeth schüttelte den Kopf. »Sieh es als glückliche Wendung des Schicksals an, Joseph. Verstehst du nicht? Wenn der Baron gesund wird, steht er in meiner Schuld, ob ich nun eine Frau bin oder nicht, ob ich mich nun als Bäuerin ausgebe oder nicht. Er wird mich anhören müssen ...«
»Aber der Mann, der im Augenblick Befehlshaber ist«, begann Joseph mit einer Geste zu ihrer Schlafkammer hinüber. »Dieser Vasall ...«
»Sein Name ist Roger«, klärte Elizabeth ihn auf.
»Er hat nach Belwain geschickt!«
»Was?«, entfuhr es Elizabeth. Sie senkte rasch wieder die Stimme. »Warum? Und woher weißt du das?«
»Herman der Kahle hat es gehört. Der Bote ist vor einer Stunde aufgebrochen. Es ist wahr«, sagte er, als Elizabeth ungläubig den Kopf schüttelte. »Belwain wird spätestens in einer Woche hier eintreffen.«
»Lieber Gott«, flüsterte Elizabeth. »Ich muss um jeden Preis mit Geoffrey sprechen, bevor Belwain hier ankommt.« Voller Furcht packte sie den Ärmel des alten Dienstboten und zerrte, ohne es zu bemerken, an dem groben Stoff. »Wir müssen Thomas verstecken. Wir müssen ihn von hier fortbringen, bis ich sicher sein kann, dass der Baron auf mich hört! Belwain darf auf keinen Fall erfahren, dass wir noch am Leben sind!«
»Das wird uns nicht gelingen, Mylady. Belwain wird Bescheid wissen, sobald er durch diese Tore reitet. Zu viele haben Eure Rückkehr mitangesehen. Er wird es erfahren. Und es ist ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser Roger die Wahrheit herausbekommt.«
»Ich muss nachdenken«, flüsterte Elizabeth. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie an Josephs Ärmel zerrte. Sie ließ los und senkte die Hand. »Rede mit Herman. Er ist ein treuer Diener und wird schweigen. Außerdem ist er ein Freisasse, Joseph. Ihr beide müsst Thomas von hier fortbringen. Versteckt ihn. Irgendwo, wo ihn niemand finden kann. Wirst du das tun, Joseph?«
»Aye«, antwortete der alte Mann und streckte den Rücken. »Verlasst Euch auf mich und Herman. Wir werden einen sicheren Ort für den Jungen finden!«
Elizabeth nickte, während sie spürte, wie ihr ein Stein vom Herzen fiel. Joseph würde sie nicht verraten und nicht enttäuschen. Sie konnte sich auf ihn verlassen. »Es ist ja nur für eine kurze Zeit. Bis Baron Geoffrey wieder erwacht«, sagte sie.
»Aber was wird aus Euch? Wenn der Baron nicht gesund wird oder wenn das Fieber ihn in den Klauen hält, bis Belwain eintrifft ... Oder wenn der Baron sogar stirbt?«
»Ich werde fliehen müssen«, sagte Elizabeth mehr zu sich selbst als zu Joseph. »Wenn Belwain kommt, werde ich nicht mehr hier sein. Hoffen wir, dass der Baron bald erwacht, damit ich mit ihm reden kann, bevor Belwain eine Chance bekommt, sein Lügengespinst zu weben.« Sie erschauerte und fuhr dann fort: »Und wenn nicht, wenn er stirbt, dann musst du Thomas zu mir bringen. Irgendwie werde ich es schon zu Großvater schaffen. Er wird wissen, was zu tun ist.«
»Und Ihr werdet zum Wasserfall zurückkehren?«, fragte Joseph ängstlich. Er würde nicht hier sein, um seine Herrin zu begleiten, nun, da sie ihm den Auftrag gegeben hatte, Thomas zu verstecken. Es war gefährlich, alleine zu reisen, und sie wusste das genauso gut wie er.
»Ich werde nicht in diesen Mauern bleiben. Belwain hat dieses Haus vergewaltigt«, brachte sie gepresst hervor. »Ganz sicher werde ich nicht hier abwarten, um ihn zurückkehren zu sehen. Oh, nein, das werde ich bestimmt nicht tun!«
»Aye, Mylady, beruhigt Euch«, sagte Joseph besänftigend. »Bestimmt wird der Krieger vor Belwains Ankunft erwachen. Und er wird Euch anhören, glaubt mir!« Joseph wusste, dass er redete, als würde er ein Kind mit einem verschrammten Knie zu trösten versuchen, aber es schien zu helfen. Seine Herrin beruhigte sich, ihr Atem wurde wieder ein wenig regelmäßiger und sie straffte die Schultern.
Die Veränderung in Elizabeth’ Verhalten, sobald der Name ihres Onkel erwähnt wurde, erschreckte den alten Diener mehr, als er sich selbst eingestehen wollte. Er wusste, dass das Mädchen hatte zusehen müssen, wie ihre Familie niedergemetzelt wurde, konnte verstehen, dass das Entsetzen und die furchtbaren Bilder ihre Seele quälten, und er glaubte genau wie sie, dass Belwain hinter der Gräueltat steckte. Dennoch wünschte er sich innig, dass sie darüber hätte reden können, dass sie ihren Schmerz und ihre Ängste durch Worte hätte herauslassen können, aber sie machte nicht einmal den Versuch. Sie war so ganz anders als ihre beiden Halbschwestern Margaret und Catherine. Vielleicht lag es daran, dass sie zur Hälfte sächsischer Abstammung war.
Master Thomas war ein harter und unglücklicher Mann gewesen, als er mit seinen zwei kleinen Töchtern nach Montwright gekommen war. Doch dann war die blonde, sächsische Schönheit in sein Leben getreten, und der Mann hatte sich auf wundersame Weise verändert. Diese Frau war ein Wildfang gewesen, doch er hatte um sie gebuhlt wie ein junger Bursche, hatte schließlich ihr Herz gewonnen und sie gebeten, ihn zu heiraten. Ein Jahr später war die kleine Elizabeth geboren worden. Thomas war zu dem Schluss gekommen, dass das Schicksal keinen Sohn für ihn vorgesehen hatte, und hatte dem kleinen blauäugigen Säugling alle Liebe, die er zu geben hatte, geschenkt. Zwischen Vater und Tochter hatte sich ein ganz besonderes Band entwickelt, das auch zehn Jahre später, als der kleine Thomas geboren wurde, bestehen geblieben war.
Obwohl Elizabeth nichts von den männlichen Wesenszügen ihres Vaters geerbt hatte, so hatte sie sich doch seine Reserviertheit, seine Angewohnheit, Gefühle zu verbergen, angeeignet. In Margarets und Catherines Gesichtern hatte man immer lesen können wie in einem Buch: Jedermann konnte sehen, was sie dachten und fühlten. Nicht jedoch bei Elizabeth. Joseph hatte immer geglaubt, dass Elizabeth diejenige war, die die Familie zusammengehalten hatte. Ihre Loyalität kannte keine Grenzen, und die Familie bedeutete ihr mehr als alles andere auf der Welt. Sie war Friedensstifterin und Aufrührerin; der Stolz ihres Vaters, wenn sie an seiner Seite mit auf die Jagd ritt, und die Verzweiflung ihrer Mutter, wenn diese versuchte, dem Mädchen das Sticken beizubringen. Aye, es war eine glückliche, zufriedene Familie gewesen, bis ...
»Habe ich Euch schon gesagt, dass Herman drei Männer zu Belwains Wohnsitz geschickt hat? Vielleicht finden sie den Beweis, den wir benötigen, um ihn anzuklagen, wenn sie sich mit Belwains Dienerschaft unterhalten –«
»Herman ist ein braver Mann«, unterbrach Elizabeth ihn. Ihre Stimme klang nun entspannt, und der alte Mann stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Aber ich kann mir nicht vorstellen, das Belwains Diener die Wahrheit sagen. Sie fürchten ihren Herrn, Joseph, das weißt du. Bitte sag Herman, dass ich ihm sehr dankbar dafür bin, dass er es versuchen will.« Die letzten Worte waren geflüstert.
»Mylady, auch Herman liebte Eure Familie. Thomas hat ihm vor langer Zeit seine Freiheit gegeben. Ihr wart damals noch ein Baby und werdet Euch nicht erinnern können, aber Herman wird niemals vergessen, was er den Montwrights zu verdanken hat.«
»Ja«, erwiderte Elizabeth. »Ich kenne die Geschichte.« Plötzlich lächelte sie und setzte hinzu: »Ich habe nie verstanden, warum alle ihn Herman den Kahlen nannten, da sein Kopf mit dichtem schwarzem Haar bedeckt war, und immer wenn ich meinen Vater danach fragte, wich er mir peinlich berührt aus.«