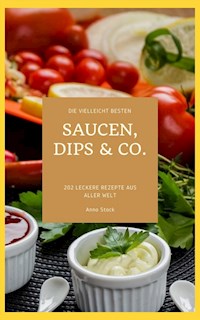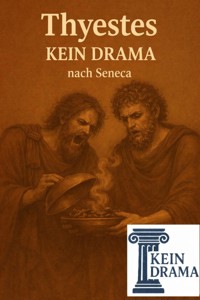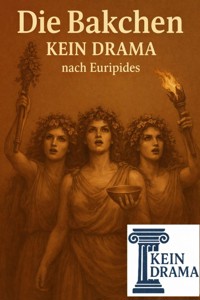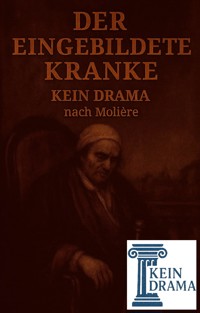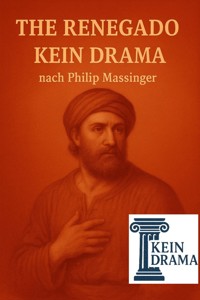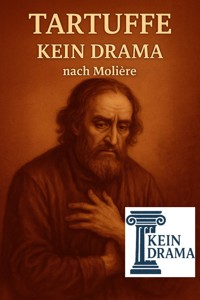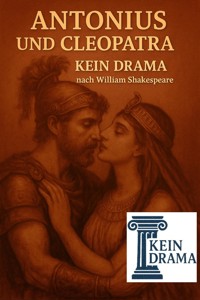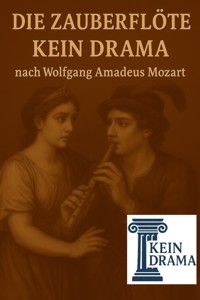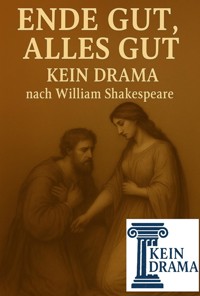
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie heilte den König. Doch kann sie auch das Herz eines Mannes gewinnen? Frankreich, 1595. Helena de Narbon hat alles verloren – ihren Vater, ihre Heimat, ihre Hoffnung. Als mittellose Waise lebt sie am Hof der Gräfin von Roussillon, wo sie den unerreichbaren Bertram liebt, der sie kaum eines Blickes würdigt. Als der König von Frankreich todkrank darniederliegt, ergreift Helena eine verzweifelte Chance: Mit dem medizinischen Wissen ihres verstorbenen Vaters reist sie nach Paris, um das Unmögliche zu wagen. Sie heilt den mächtigen Heinrich IV. – und fordert als Belohnung das Unerhörte: die Hand des Grafen von Roussillon. Doch Bertram fühlt sich gedemütigt, gezwungen, betrogen. In der Hochzeitsnacht flieht er nach Italien und stellt Helena zwei unmögliche Bedingungen: Sie soll seinen Siegelring bekommen und ihm ein Kind gebären – beides scheinbar unerreichbar, da er schwört, ihr nie wieder nahezukommen. Aber Helena gibt nicht auf. In den nächtlichen Gassen von Florenz schmiedet sie einen kühnen Plan, der Mut, List und die Bereitschaft erfordert, alles zu riskieren. Ein Plan, der Standesgrenzen sprengt und die Frage stellt: Wie weit darf Liebe gehen? Eine mitreißende Adaption von Shakespeares "Ende gut, alles gut" – voller Leidenschaft, Intrigen und dem Kampf einer außergewöhnlichen Frau um ihre Liebe und ihre Würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Ende gut, alles gut - Kein Drama nach William Shakespeare
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Ende gut, alles gut - Die Ärztin von Roussillon
Kapitel 1: Das Erbe des Arztes
Kapitel 2: Unmögliche Liebe
Kapitel 3: Der Abschied
Kapitel 4: Studien im Verborgenen
Kapitel 5: Nachrichten aus Paris
Kapitel 6: Am Hof von Paris
Kapitel 7: Die Prüfung
Kapitel 8: Die Heilung
Kapitel 9: Eine erzwungene Hochzeit
Kapitel 10: Abschied von der Gnade
Kapitel 11: Die Wirtin und ihre Tochter
Kapitel 12: Die Nacht der Täuschung
Kapitel 13: Der falsche Tod
Kapitel 14: Die Enthüllung
Kapitel 15: Neue Anfänge
Epilog
Nachwort: Über diese Adaption
Impressum neobooks
Table of Contents
Ende gut, alles gut - Die Ärztin von Roussillon
Ein historischer Roman nach William Shakespeares "Ende gut, alles gut"
Anno Stock
TEIL I: ROUSSILLON
Kapitel 1: Das Erbe des Arztes
Der Herbst hatte sich über die sanften Hügel der Gascogne gelegt, und mit ihm kam der Tod.
Helena stand am offenen Fenster der Kammer ihres Vaters und beobachtete, wie die letzten Sonnenstrahlen die Weinberge von Roussillon in Bronze tauchten. Die Luft roch nach feuchter Erde und verbranntem Laub, nach dem Ende der Dinge. Hinter ihr, im Halbdunkel des Raumes, lag Gerard de Narbon auf seinem Krankenlager und rang um jeden Atemzug.
Sie war dreizehn Jahre alt und würde bald eine Waise sein.
"Helena." Die Stimme ihres Vaters war kaum mehr als ein Flüstern, doch sie fuhr herum, als hätte er gerufen. Mit wenigen Schritten war sie an seiner Seite, kniete neben dem Bett und ergriff seine Hand. Die Finger, einst so geschickt im Umgang mit Skalpell und Mörser, fühlten sich kalt an, papieren, als würde das Leben bereits aus ihnen weichen.
"Ich bin hier, Vater."
Gerard de Narbons Augen, einst scharf und wachsam wie die eines Falken, waren milchig geworden in den letzten Wochen. Dennoch schien er sie zu sehen, wirklich zu sehen, als er sprach. "Das Fieber... es wird mich heute Nacht holen."
"Nein." Helena drückte seine Hand fester. "Die Tinktur, die Ihr gestern eingenommen habt—"
"War ein Trost, mehr nicht." Ein schwaches Lächeln huschte über seine eingefallenen Züge. "Ich bin Arzt genug, um mein eigenes Ende zu erkennen, Kind. Und du bist meine Tochter – du weißt es auch."
Sie wollte widersprechen, aber die Worte blieben ihr im Hals stecken. Natürlich wusste sie es. Sie hatte die letzten drei Monate an seiner Seite verbracht, hatte gesehen, wie die Krankheit – diese tückische, schleichende Schwäche, die keinen Namen trug und sich keiner Behandlung beugte – ihn Stück für Stück verzehrte. Sie hatte jede Arznei gemischt, die er ihr diktiert hatte, jedes Pflaster angelegt, jede Hoffnung genährt. Und sie hatte gewusst, von Anfang an gewusst, dass es vergeblich war.
"Die Gräfin..." begann ihr Vater, und ein Hustenanfall schüttelte seinen Körper. Helena stützte ihn, hielt ihm einen Becher mit Wasser an die Lippen. Als er sich wieder zurücklehnte, fuhr er fort: "Die Gräfin hat versprochen, sich deiner anzunehmen. Du wirst nicht auf der Straße stehen."
"Ich weiß." Die Worte schmeckten bitter. Die Güte der Gräfin von Roussillon war legendär, und Helena war dankbar dafür – wahrhaftig dankbar. Aber dankbar zu sein und eine Bittstellerin zu werden, das waren zwei verschiedene Dinge. Ihr ganzes Leben hatte sie im Schatten ihres Vaters verbracht, geschützt durch seinen Ruf als der berühmteste Arzt Frankreichs. Bald würde sie nur noch die mittellose Tochter eines verstorbenen Gelehrten sein, abhängig von der Gnade anderer.
Gerard schien ihre Gedanken zu lesen. "Unter dem losen Stein links vom Kamin," sagte er mit plötzlicher Dringlichkeit, "dort liegt mein wahres Vermächtnis. Nicht Gold, nicht Titel – sondern Wissen."
Helena blickte zum Kamin hinüber, wo das Feuer träge flackerte. Sie kannte jeden Winkel dieser Kammer, hatte hier unzählige Stunden damit verbracht, ihrem Vater bei seinen Studien zuzusehen, seine Anweisungen zu befolgen, seine Weisheit aufzusaugen wie ein trockener Schwamm das Wasser. "Die Schriften?"
"Fünfzig Jahre Erfahrung," bestätigte er. "Heilmittel, die ich entdeckt, verfeinert, bewahrt habe. Manche stammen von meinem eigenen Vater, andere von griechischen Ärzten, wieder andere von maurischen Gelehrten in Cordoba." Er hustete wieder, und Helena sah mit Schrecken, dass Blut auf seinen Lippen stand. "Besonders ein Rezept... gegen die Fistel des Königs. Ich habe es nie angewendet, nie vollenden können. Aber die Grundlage ist da. Wenn jemand es zu Ende führen kann..."
Er ließ den Satz unvollendet, doch seine Bedeutung hing schwer im Raum. Der König von Frankreich, Heinrich IV., litt seit Jahren an einer schmerzhaften Fistel, die alle Ärzte des Hofes ratlos ließ. Es war ein offenes Geheimnis, dass Seine Majestät demjenigen jeden Wunsch erfüllen würde, der ihn von diesem Leiden erlöste.
"Ich bin kein Arzt, Vater," flüsterte Helena. "Ich bin eine Frau. Man wird mich nicht—"
"Du bist meine Tochter." Seine Stimme gewann an Kraft, getragen von einem letzten Aufbäumen des Willens. "Du hast mehr Wissen in deinem kleinen Finger als die meisten Wundärzte in ihrem ganzen aufgeblasenen Kopf. Ich habe dich gelehrt, Helena, nicht aus Zeitvertreib, sondern weil ich in dir sah, was andere übersehen: einen Geist, scharf wie Toledo-Stahl, und Hände, die heilen können."
Tränen brannten in ihren Augen, doch sie ließ sie nicht fallen. Ihr Vater hatte sie nicht zur Schwäche erzogen. "Was soll ich tun?"
"Studiere die Schriften. Lerne sie auswendig, falls sie dir je genommen werden. Und wenn die Zeit kommt – und sie wird kommen, Helena, dessen bin ich gewiss – dann hab den Mut, sie zu nutzen." Seine Hand umklammerte die ihre mit überraschender Kraft. "Versprich es mir."
"Ich verspreche es."
Gerard de Narbon nickte langsam, und etwas in seinem Gesicht entspannte sich, als hätte er eine schwere Last abgelegt. "Gut. Gut. Dann kann ich..." Seine Augen schlossen sich, und für einen schrecklichen Moment dachte Helena, er sei bereits gegangen. Doch dann hob sich seine Brust noch einmal, noch einmal, in einem langsamen, mühsamen Rhythmus.
Sie blieb die ganze Nacht an seiner Seite. Draußen bewegten sich Schatten – Diener, die respektvoll Abstand hielten, Geistliche, die auf ihren Auftritt warteten. Drinnen herrschte nur Stille und das Knistern des Feuers und das immer schwächer werdende Atmen eines sterbenden Mannes.
Als die Morgendämmerung das Fenster erreichte, war Gerard de Narbon fort.
Die Beerdigung fand drei Tage später statt, an einem windigen Oktobermorgen, der die letzten Blätter von den Ulmen riss. Halb Roussillon schien gekommen zu sein, um dem berühmten Arzt die letzte Ehre zu erweisen. Bauern, die er umsonst behandelt hatte, Bürger, deren Kinder er gerettet hatte, sogar einige Adelige aus der Umgebung, die seine Kunst in Anspruch genommen hatten.
Helena stand in ihrem schwarzen Trauergewand neben dem Grab und hörte dem Priester zu, wie er die vertrauten Worte sprach. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Die Worte schienen von weit her zu kommen, gedämpft durch den Nebel ihrer Trauer.
Neben ihr stand die Gräfin von Roussillon, eine würdevolle Frau in den mittleren Jahren, deren Gesicht von echtem Kummer gezeichnet war. "Er war ein guter Mann," sagte sie leise zu Helena. "Ein wahrer Diener Gottes und der Menschheit. Wir werden seinesgleichen nicht wieder sehen."
"Nein, Madame," antwortete Helena mechanisch.
"Du wirst bei uns im Schloss wohnen, Kind. Ich habe es deinem Vater versprochen, und ich halte meine Versprechen." Die Gräfin legte eine Hand auf Helenas Schulter, eine Geste, die Trost spenden sollte. "Du wirst als Teil unserer Familie behandelt werden, nicht als Dienerin."
Helena neigte den Kopf in Dankbarkeit, doch in ihrem Herzen wusste sie die Wahrheit: Sie würde niemals wirklich zur Familie gehören. Sie würde immer die Waise sein, die mittellose Tochter, die aus Gnade aufgenommen wurde. Und der Sohn der Gräfin, der junge Bertram...
Als hätte der Gedanke ihn herbeigerufen, fiel ihr Blick auf den Jungen, der etwas abseits stand. Bertram de Roussillon, fünfzehn Jahre alt, hochgewachsen und schon jetzt von jener mühelosen Anmut, die dem hohen Adel eigen war. Sein dunkles Haar wehte im Wind, und sein Gesicht zeigte jene Mischung aus Langeweile und Ungeduld, die junge Männer seines Standes oft zur Schau trugen, wenn sie an Zeremonien teilnehmen mussten.
Ihre Blicke trafen sich für einen kurzen Moment. Er nickte ihr höflich zu, ein mechanisches Beileidsbekunden, und wandte sich dann ab, als wäre sie bereits vergessen.
In diesem Moment, während sie am Grab ihres Vaters stand und zusah, wie der Sarg in die Erde gelassen wurde, wusste Helena drei Dinge mit absoluter Gewissheit:
Erstens, dass sie von nun an allein war in der Welt.
Zweitens, dass Bertram de Roussillon – dieser stolze, schöne, unerreichbare Junge – das Herz aus ihrer Brust gerissen hatte, ohne es überhaupt zu bemerken.
Und drittens, dass sie das Vermächtnis ihres Vaters ehren würde, koste es, was es wolle.
Die ersten Wochen im Schloss von Roussillon waren für Helena wie ein Leben zwischen zwei Welten. Sie bewohnte eine kleine Kammer im Ostturm, bescheiden, aber sauber, mit einem Fenster, das auf die Kapelle hinausblickte. Jeden Morgen weckte sie das Läuten der Glocken zur Frühmesse, und jeden Morgen lag sie einen Moment lang still da und vergaß, wo sie war, glaubte ihren Vater im Nebenzimmer zu hören, wie er Kräuter mahlte oder leise lateinische Texte rezitierte.
Dann kehrte die Erinnerung zurück, kalt und scharf wie ein Messer.
Die Gräfin hielt ihr Wort. Helena wurde nicht zu den Dienstboten gezählt, sondern nahm ihre Mahlzeiten mit der Familie ein – zumindest, wenn keine vornehmen Gäste zugegen waren. Sie durfte die Bibliothek nutzen, eine kleine, aber feine Sammlung von Büchern, die der verstorbene Graf über Jahrzehnte zusammengetragen hatte. Sie hatte sogar eine bescheidene Garderobe erhalten, Kleider aus gutem Tuch, wenn auch nicht von der Qualität, die Bertram oder die anderen jungen Adligen trugen.
Und doch war sie nicht eine von ihnen. Das wurde ihr bei jeder Gelegenheit deutlich gemacht, nicht durch Grausamkeit, sondern durch die tausend kleinen Rituale des Hoflebens. Wenn die Gräfin Besucher empfing, zog sich Helena zurück. Wenn Bertram mit seinen Freunden jagte, wurde sie nicht gefragt, ob sie mitkommen wolle. Wenn über Hochzeiten und Bündnisse gesprochen wurde, über die Zukunft junger Adliger, war sie nicht Teil dieser Gespräche.
Sie war ein Schatten im Schloss, geduldet, aber nicht zugehörig.
Bertram behandelte sie mit höflicher Gleichgültigkeit. Er war nicht unfreundlich – das hätte seine Mutter nicht geduldet – aber er bemerkte sie kaum. Sie war für ihn wie ein Möbelstück, das schon immer dagestanden hatte. Wenn sie ihm auf den Korridoren begegnete, nickte er kurz und ging weiter. Bei Tisch sprach er mit seiner Mutter, mit seinem Lehrmeister, mit den jungen Männern seines Standes, die zu Besuch kamen. Aber mit Helena? Ein gelegentliches "Guten Morgen", mehr nicht.
Und doch konnte Helena ihre Augen nicht von ihm wenden.
Es war eine törichte, hoffnungslose Zuneigung, das wusste sie. Bertram war der Graf von Roussillon, wenn auch noch nicht volljährig. Er würde eine Adlige heiraten, eine Frau mit Mitgift und Verbindungen. Nicht die Tochter eines Arztes, so berühmt dieser auch gewesen sein mochte. Aber das Herz, so hatte ihr Vater einmal gesagt, folgt keiner Vernunft. Es ist das unberechenbarste Organ des menschlichen Körpers.
Eines Nachmittags, etwa sechs Wochen nach ihrem Einzug im Schloss, wagte Helena sich zurück in das alte Haus ihres Vaters. Es stand noch immer, am Rande des Dorfes, aber die Fenster waren dunkel, und Staub hatte sich bereits über die Möbel gelegt. Die Gräfin hatte angeboten, das Haus zu verkaufen und den Erlös für Helenas Aussteuer zu verwenden – eine großzügige Geste, aber auch eine endgültige. Sobald das Haus weg war, gab es keinen Ort mehr, der wirklich der ihre war.
Helena schloss die Tür hinter sich und atmete tief ein. Der Geruch von Kräutern hing noch immer in der Luft, schwach, aber unverkennbar. Rosmarin und Wermut, Lavendel und Minze. Der Geruch ihrer Kindheit.
Sie ging direkt in die Kammer ihres Vaters. Das Krankenbett war fort, aber der Kamin stand noch, und der lose Stein links davon...
Mit zitternden Händen kniete sie nieder und schob den Stein beiseite. Dahinter lag eine kleine Nische, und darin, sorgfältig in gewachstes Leinen gewickelt, die Schriften ihres Vaters.
Es waren drei dicke Bände, handgeschrieben in der klaren, präzisen Schrift, die Gerard de Narbon eigen gewesen war. Dazu kamen mehrere lose Pergamentblätter, Notizen und Skizzen, die er offenbar nicht mehr hatte einordnen können. Helena zog die Bände hervor und schlug den ersten auf.
Die Seiten waren gefüllt mit Rezepten, Beobachtungen, Zeichnungen von Pflanzen und menschlichen Organen. Sie erkannte einiges wieder – Mittel gegen Fieber, gegen Wunden, gegen Magenleiden. Aber da waren auch Dinge, von denen sie noch nie gehört hatte. Behandlungen für Krankheiten, deren Namen sie nicht kannte. Chirurgische Verfahren, die ihr Vater bei maurischen Ärzten gelernt hatte.
Und dann, ganz am Ende des dritten Bandes, fand sie es: Über die Behandlung der Fistula Regis.
Die Königsfistel.
Ihre Finger fuhren über die Worte, als könnte sie durch bloße Berührung das Wissen aufnehmen. Ihr Vater hatte Recht gehabt – das Rezept war unvollständig. Es gab verschiedene Ansätze, Überlegungen, Experimente, die er durchgeführt hatte. Aber keine endgültige Lösung. Und doch... und doch war da etwas. Eine Spur, ein Weg, den man zu Ende gehen konnte.
Wenn die Zeit kommt, hatte ihr Vater gesagt, dann hab den Mut.
Helena starrte auf die Seiten und fühlte, wie sich etwas in ihr zusammenzog, eine Mischung aus Angst und Entschlossenheit. Sie war dreizehn Jahre alt. Sie war eine Frau ohne Stand, ohne Vermögen, ohne Zukunft. Aber sie hatte dieses Wissen. Und vielleicht, eines Tages...
Vorsichtig wickelte sie die Bände wieder ein und verbarg sie unter ihrem Mantel. Als sie das Haus verließ und den Hügel hinauf zum Schloss ging, trug sie mehr als nur altes Pergament bei sich. Sie trug eine Möglichkeit, einen Traum, eine unmögliche Hoffnung.
Sie wusste nur noch nicht, dass diese Hoffnung sie eines Tages bis an den Hof des Königs führen würde – und weit darüber hinaus.
In dieser Nacht begann Helena mit ihren Studien. Sie saß bei Kerzenlicht in ihrer Kammer und las die Schriften ihres Vaters, Seite um Seite, Wort um Wort. Sie prägte sich die Rezepte ein, übte, die komplexen lateinischen und griechischen Begriffe auszusprechen, die ihr Vater verwendet hatte. Sie zeichnete die Diagramme ab, bis ihre Hand vom Schreiben schmerzte.
Die Gräfin bemerkte, dass in Helenas Kammer bis spät in die Nacht Licht brannte, und sprach sie darauf an.
"Du solltest mehr schlafen, Kind," sagte sie mit sanfter Sorge. "Deine Augen sind ganz rot."
"Ich lese nur, Madame," antwortete Helena. "Die Bücher meines Vaters."
"Medizinische Texte?" Die Gräfin runzelte die Stirn. "Das ist keine angemessene Lektüre für ein junges Mädchen."
"Es ist alles, was mir von ihm geblieben ist."
Die Gräfin seufzte, aber sie verbot es nicht. Vielleicht verstand sie, dass Trauer seltsame Formen annehmen konnte. Vielleicht war sie einfach zu gütig, um Helena auch diesen letzten Trost zu nehmen.
So vergingen die Monate. Der Herbst wurde zu Winter, der Winter zu Frühling. Helena wuchs, lernte, beobachtete. Sie sah zu, wie Bertram zu einem jungen Mann heranreifte, stolz und strahlend wie ein junger Gott. Sie hörte, wie die Gräfin über seine Zukunft sprach, über den Tag, an dem er an den Hof nach Paris gehen würde, um dem König zu dienen.
Und sie wartete. Worauf, wusste sie selbst nicht genau.
Aber tief in ihrem Herzen, tiefer als Vernunft oder Hoffnung reichten, wusste sie: Eines Tages würde sich alles ändern.
Die Jahre vergingen schneller, als Helena es für möglich gehalten hätte. Sie war nun sechzehn, fast siebzehn, und das Kind, das am Grab ihres Vaters gestanden hatte, war längst verschwunden. An ihrer Stelle stand eine junge Frau mit dunklem Haar und nachdenklichen Augen, die mehr wusste über die Heilkunst als die meisten gelehrten Männer des Königreichs – auch wenn niemand im Schloss davon ahnte.
Bertram war inzwischen neunzehn, und sein Ruf als einer der vielversprechendsten jungen Adligen Frankreichs hatte sich weit über Roussillon hinaus verbreitet. Er war geschickt im Fechten, elegant beim Tanz, gewandt in der Konversation. Die Damen am Hof bewunderten ihn, die Herren respektierten ihn. Und Helena liebte ihn mit einer Intensität, die ihr manchmal den Atem raubte.
Es war eine stille, hoffnungslose Liebe, die sie wie ein Geheimnis hütete. Niemand durfte davon wissen – am allerwenigsten Bertram selbst. Denn was hätte es genützt? Er würde nur lachen oder, schlimmer noch, mit mitleidiger Verachtung reagieren. Sie war für ihn unsichtbar, hatte es immer gewesen und würde es immer bleiben.
Bis zu jenem Frühlingstag, an dem alles sich änderte.
Es geschah während eines Festes, das die Gräfin zu Ehren des Namenstages ihres Sohnes ausrichtete. Das Schloss war voller Gäste – Adlige aus der Umgebung, reiche Kaufleute, sogar ein Gesandter aus Paris. Die große Halle war geschmückt mit Blumen und bunten Tüchern, und Musikanten spielten fröhliche Weisen, während die Gäste tanzten und lachten.
Helena hatte sich in eine Ecke zurückgezogen, halb verborgen hinter einem Wandteppich. Sie trug eines ihrer besseren Kleider, ein einfaches Gewand aus dunkelblauem Damast, das die Gräfin ihr geschenkt hatte. Es war schön, aber nicht prachtvoll. Sie gehörte zu den Gästen, aber nicht wirklich dazu.
Bertram stand in der Mitte der Halle, umringt von jungen Männern und Frauen seines Standes. Er trug Samt und Seide in den Farben seines Hauses, und das Licht der Kerzen ließ sein Haar glänzen wie poliertes Ebenholz. Als er lachte über einen Scherz, den einer seiner Freunde gemacht hatte, fühlte Helena, wie ihr Herz schmerzte.
"Ein prächtiger junger Mann, nicht wahr?"
Helena fuhr herum. Neben ihr stand eine ältere Dame, deren Name ihr entfallen war – eine entfernte Verwandte der Gräfin, die zu Besuch war. Die Frau lächelte wissend und nickte in Bertrams Richtung.
"Ja, Madame," antwortete Helena vorsichtig.
"Die Gräfin wird bald eine passende Partie für ihn finden," fuhr die Dame fort, als spräche sie über das Wetter. "Es gibt bereits Gespräche mit mehreren Familien. Die Tochter des Marquis de Montferrat wäre ideal – zwanzigtausend Livres Mitgift und Ländereien in der Provence."
Helena nickte stumm, obwohl jedes Wort wie ein Dolchstoß war.
"Natürlich," die Dame senkte ihre Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern, "zwischen uns gesagt, der junge Graf könnte etwas mehr Bescheidenheit vertragen. Er ist zu sehr von sich überzeugt, dieser Bertram. Es würde ihm nicht schaden, einmal abgewiesen zu werden."
In diesem Moment drehte sich Bertram um und bemerkte, dass man über ihn sprach. Sein Blick glitt über Helena hinweg, ohne sie wirklich zu sehen, und wandte sich dann einer jungen Frau zu, die gerade eingetreten war – Mademoiselle de Valois, die Tochter eines Herzogs, schön wie ein Gemälde und strahlend in Seide und Perlen.
Helena sah zu, wie Bertram sich vor der jungen Frau verbeugte, wie er ihr die Hand küsste, wie sie lächelte und errötete. Sie sah die selbstverständliche Art, mit der er sich bewegte, die mühelose Anmut des Privilegierten. Und sie verstand mit schmerzhafter Klarheit, dass sie und Bertram in verschiedenen Welten lebten, getrennt durch einen Abgrund, den keine Liebe überbrücken konnte.
Sie verließ die Halle, bevor die Tränen kommen konnten.
Draußen, im kühlen Abendwind, lehnte Helena sich gegen die Schlossmauer und atmete tief durch. Der Lärm des Festes drang gedämpft durch die dicken Steinwände – Musik, Lachen, das Klirren von Gläsern. Die Geräusche einer Welt, zu der sie nicht gehörte.
"Was tue ich hier?" flüsterte sie in die Dunkelheit. "Was soll aus mir werden?"
Keine Antwort kam, nur das Rauschen des Windes in den Ulmen.
Sie dachte an die Schriften ihres Vaters, die versteckt in ihrer Kammer lagen. In den letzten vier Jahren hatte sie jede freie Minute damit verbracht, sie zu studieren, zu verstehen, zu vervollständigen. Sie hatte heimlich Kräuter gesammelt, hatte experimentiert, hatte Lösungen gefunden für Probleme, die ihr Vater offen gelassen hatte. Das Rezept für die Königsfistel war nun vollständig – sie war sicher. Sie hatte es getestet an Tieren, hatte gesehen, wie Wunden heilten, die vorher unheilbar schienen.
Aber was nützte ihr all dieses Wissen? Sie war eine Frau. Niemand würde sie als Ärztin anerkennen. Niemand würde ihr erlauben, den König zu behandeln. Ihr Wissen war wertlos, solange sie in diesem Körper, in dieser Rolle gefangen war.
"Fräulein Helena?"
Sie zuckte zusammen. Aus dem Schatten der Torbögen trat eine Gestalt – Lavatch, der Narr der Gräfin, ein älterer Mann mit scharfem Verstand, der sich hinter Scherzen und Späßen verbarg.