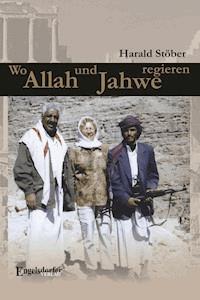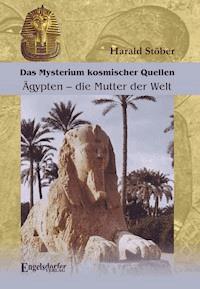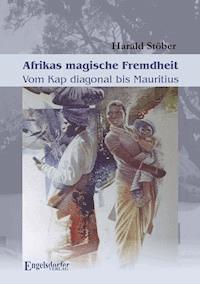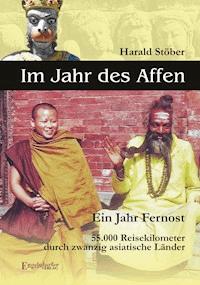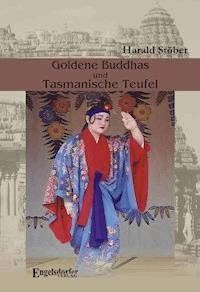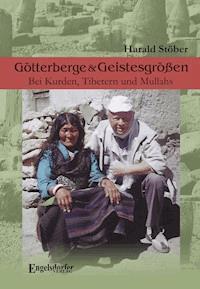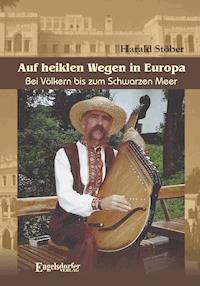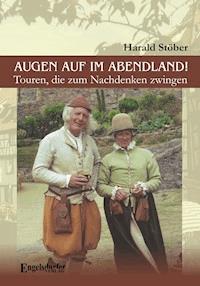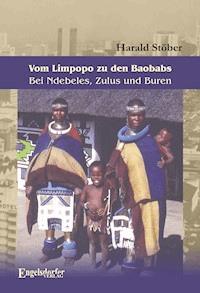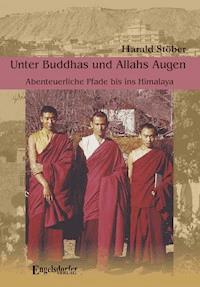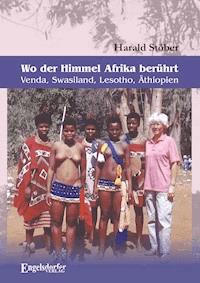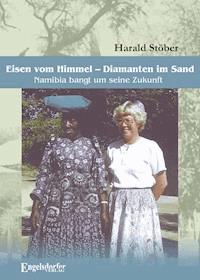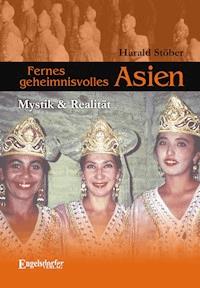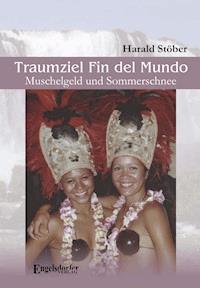Fäuste und Deo am Kap. Südafrikas Politkrimi ohne Ende. Ein südafrikanisches Zeitdokument E-Book
Harald Stöber
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Fanatisierte Massen ziehen mordend durch Townships, tausend Schulen gehen aus ideologischen Gründen in Flammen auf und es werden stereotyp Sanktionen gefordert, obwohl selbst »schwarze Nachbarn« de facto von Sanktionen nichts wissen wollen. Es sind die höchst gefährlichen Widersprüche, die nicht nur Südafrika zur schieren Verzweiflung treiben – bis heute! – Diese afrikanische Zeitdokumentation orientiert sich an der objektiven Wahrheit und wird deshalb zum kritischen Nachdenken zwingen. Sich von 1988 bis 1991 zur Zeit des politischen Umbruchs im südlichen Afrika als freier Journalist betätigt zu haben, grenzte an kamikazeartigen Mut, wie ihn unser Autor wohl hatte. Während dieser gefährlichen Jahre spielte sich »unter dem Kreuz des Südens« ein Politkrimi erster Güte ab, der an Spannung und Dramatik nichts zu wünschen übrig ließ – live erlebt und dokumentiert, so dass dem Leser oft der Atem stocken wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Harald Stöber
FÄUSTE UND DEO AM KAP
Südafrikas Politkrimi ohne Ende
Ein südafrikanisches Zeitdokument
Engelsdorfer Verlag 2012
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag
www.engelsdorfer-verlag.de
eISBN: 978-3-86901-133-2
Inhaltsverzeichnis
Südafrikas Politkrimi wird fortgesetzt
Krieg und Frieden
Blut und eiserne Fäuste
Briefe und Fakten
Gift und Deo für Südafrika
Alte Revolutionäre – neue Sorgen und Hoffnungen
Frohe Weihnacht und Prosit 1991!
Die Masken fallen
ANC am Wendepunkt?
- Als freier Journalist in Afrika -
Zwei Dinge sind
Unendlich: das
Universum und
die Dummheit-
aber beim Universum bin ich
mir nicht sicher …
A. Einstein
Gewidmet meiner
lieben Familie und
allen Freunden
Afrikas.
1. KapitelVon Strawinsky bis Lehár
Wie man sich fühlt, nach monatelanger Afrikatour durch Wüste, Busch und Urwald beinahe übergangslos wieder in gesellschaftsfähiger Theaterkleidung zu stecken, lässt sich so schlecht beschreiben wie Geschmack, wobei hier noch dazukam, dass wir europäische Musik und Ballett nicht etwa im fernen Europa erlebten, sondern live in Afrika. Kaum hatten wir uns den Reisestaub heruntergewaschen, stand bereits „Rubies, Carmen, Theme an Variations“ mit der großartigen Musik von Strawinsky, Bizet und Tschaikowsky auf dem Programm – ein kühner Sprung aus der Tiefe der Dritten mitten in die Erste Welt hinein! Wir schrieben den 23. Juni 1990.
Abermals war das Staatstheater Pretoria bis auf den letzten Platz besetzt, haben doch nicht nur die genannten drei Komponisten hier ihre große Anhängerschaft, sondern auch die Akteure, vor allem die Choreographen George Balanchine und Roland Petit, sowie die Tanzkünstler Catherine Burnett, Dianne Finch, Marion Lindsay und Odette Millner, alles Meister ihres Faches! Im ersten Teil „Rubies“ – von Strawinsky komponiert – glänzte die Burnett mit einer derart perfekt getanzten Ausdrucksweise, dass die Fachwelt spontan von einer „Entdeckung in der Tanzwelt“ sprach, hatte jedoch auch für ihren Partner, Daniel Gwatkin, lobende Worte, der mit diesem Part sein Debüt in einer großen Tanzrolle gab. Es hatte jedoch den Anschein, dass sich das Publikum mit der sehr modernen Choreographie und auch mit Strawinskys „unmelodisch“ scheinender Musik innerlich kaum identifizieren konnte.
Eine völlig andere Atmosphäre vermittelte Bizets „Carmen“, choreographiert von Petit, der es glänzend verstand, das Publikum ins zwielichtige und ziemlich schlüpfrige alte Paris zu versetzen. Da passte alles zusammen: die Hinterhofkulisse mit herumhängender Wäsche, der bunte „Pöbeltanz“, die „saubere Erotik“ und das sehr ausdrucksvoll getanzte Ende der Carmen. Für Jeremy Coles (Don José), Marion Lindsay (Carmen) und nicht zuletzt für den spaßigen Nigel Hannah und seine Kumpanen gab es langanhaltenden Applaus.
Die vom Kaukasier Balanchine gestalteten zwölf „Variationen“ nach der Musik von Tschaikowsky standen in der Gunst des Publikums dem Hauptteil „Carmen“ nicht nach, waren teilweise sogar mit dem kräftigeren Applaus des Abends bedacht worden, nämlich der Paartanz (Millner und Hodges) und Gwatkin, der ein verteufelt schwieriges Solo zu tanzen hatte. Der Ballettabend schloss mit dem begeisterten Applaus (fünf Vorhänge) eines dankbaren Publikums, das die Hauptakteure mit Blumen überschüttete. Das war Erste Welt in Afrika!
Als wir nach unserer „Rückkehr aus dem Busch“ in Sunnyside die Plakate für „La Traviata“ hängen sahen, trauten wir unseren Augen nicht, sollte doch diese Meisteroper Giuseppe Verdis in der italienischen Originalsprache gesungen werden! Natürlich war zunächst keine einzige Karte zu bekommen, denn – so die Presse – sämtliche Vorstellungen waren auf Anhieb restlos ausverkauft. Und so war es wohl Fügung, dass just in dem Moment, als wir an der Kasse abermals Karten begehrten, ein Anruf hereinkam, dass aus Krankheitsgründen zwei Plätze frei würden – natürlich für uns! Zweifellos gehört diese am 6. März 1853 in Venedig uraufgeführte Verdi-Oper zu den ewig jungen und schönsten Musikwerken überhaupt, so dass die interessierte Theaterwelt Südafrikas diesem Top-Ereignis mit großer Spannung entgegensah, zumal die Menschen hier ohnehin dazu neigen, sich für einfach-tragisch-leidenschaftliche Mischungen besonders zu begeistern. Wir waren im Besitz von Karten für den 25. Juni 1990.
Im Mittelpunkt der von schönster Verdi-Musik umrahmten Geschichte stehen Violetta (Denia Mazzola) und Alfredo (Aldo Bertolo), die es glänzend verstanden, sich in die Seelen ihres erwartungsvollen Publikums hineinzusingen. Wer kennt sie nicht, die herzzerreißende Story: Violetta, ein bekanntes Lebemädchen, lernt auf ihrer „Genesungsparty“ Alfredo Germont kennen, sie verlieben sich und ziehen sich aufs Land zurück. Ihr Glück wird jäh gestört, als Vater Giorgio erscheint und Violetta in Kenntnis ihres Rufes darum bittet, von seinem Sohn abzulassen. Sie geht weg, doch Alfredo sucht und findet Violetta in einer Gesellschaft, vor der er sie demütigt. Er erfährt von seinem Vater, dass sie aus Liebe zur Familie weggegangen sei, Alfredo ihr also Unrecht getan habe. Inzwischen wird Violetta abermals krank, und Alfredo will sie um Vergebung bitten – zu spät, denn Violetta stirbt in einem Pariser Armenkrankenhaus.
Ungewöhnlich viel Applaus! Wir hatten den Eindruck, dass das Publikum besonders eifrig auch zwei Akteure feierte, die gar nicht auf der Bühne standen: A. Farmer und N. Hansen, die Designer; denn sie hatten wunderschöne Bühnenbilder und Kostüme entworfen. Sonderbeifall gab es auch für Vater Giorgio (G. Kok), der im zweiten Akt eine Arie sang, die bis auf den Seelengrund zu dringen vermochte. Und nicht zuletzt war es ein Hochgenuss, im dritten Akt die großartige Chormusik und die Liebesarien der Violetta zu hören. Der dramatische vierte Akt, der sich in einem erschreckend kahlen Krankenzimmer abspielt, rührte gar so tief, dass es dem Publikum geradezu schwerzufallen schien, sich nach dem Schlussvorhang wieder mit der Wirklichkeit vertraut zu machen. Wir haben jedenfalls noch nie erlebt, wie unendlich dankbar ein Publikum für dargebotene höchste Kunst sein kann.
Einen Leckerbissen besonderer Art bot am 20. Juli 1990 die „South African International Cultural Association“ (SAICA), in deren Auftrag die Agentur Ingrid Eksteen es fertigbrachte, ein beinahe übervolles Abendprogramm auf die Beine zu stellen. Insgesamt zweiundzwanzig Gesangs- und Tanzblöcke wurden unter dem Dach des Staatstheaters – im Drama – geboten, wobei jeder Block aus mehreren Teilen bestand.
Die Volkstanz- und Gesangsdarbietungen aus der Türkei, der Republik China, Schweden, USA, Portugal, Griechenland, Schottland, Großbritannien, Österreich, Südafrika und Spanien wurden zu Recht mit unterschiedlichem Applaus bedacht, gab es doch ausgesprochene Spitzenleistungen, wie zum Beispiel aus China, Portugal und Griechenland, aber auch fast peinlich wirkende Präsentationen der Schweden, US-Amerikaner und Südafrikaner. Publikumsliebling waren zweifellos die taiwanesischen „Kug Ting Dancers“, eine große Gruppe reizender kleiner Mädchen, die für ihre farbenfreudigen traditionellen Tänze begeisterten Beifall ernteten. Sonderapplaus erhielten auch die „Greek Dancers“, deren ungemein sympathische Soloakteurin Sheila Garitsis mit ihrem „Zorba’s Dance“ alles überragte. Einen geradezu müden Eindruck machten dagegen die Gruppen aus Schweden, Südafrika und aus den USA, während die Österreicherin Christa Lagler (Jodeln) mit ihrem italienischen Akkordeonbegleiter Sergio Zampoli im oberen Drittel lag. Insgesamt gesehen enttäuschte dieser ausschließlich von Laien gestaltete Folkloreabend nicht; er hatte sogar einige professionelle Höhepunkte zu verzeichnen.
Dass bundesdeutsche Gruppen durch Abwesenheit glänzten, überraschte nicht, denn wer wagte schon, trotz suspendiertem Kulturabkommen in Pretoria aufzutreten! Umso erstaunlicher ist, dass Schweden präsent war – nicht gerade ein Freund der politischen Südafrikas! Sehr eindrucksvoll fiel das Finale aus, das alle Gruppen unter der angestrahlten riesigen Flagge des gastgebenden Landes gemeinsam gestalteten: Schwarz und Weiß – a mosaic of people – fand sich zum freundschaftlichen Tanz zusammen. Schade nur, dass Bilder dieser Art, die es – aus der Ferne gesehen – im „Apartheidsstaat Südafrika“ ja eigentlich gar nicht geben darf, europäische Fernsehkanäle nie erreichen.
Als PACT-Opera Beethovens „Fidelio“ in der deutschen Originalsprache ankündigte, ging erstauntes Raunen durch die dichten Reihen der Opernfreunde, und viele dürften befürchtet haben, dass diese Aufführung nicht zuletzt wegen ihres politisch auslegbaren Inhalts unter die Räder geraten könnte; denn „Fidelio“ spielt teils im düsteren Gefängnismilieu – Beethoven als Symbol für Freiheit und Hoffnung! Aufhorchen ließen berühmte Namen, wie Gabor Ötvös, Musikalischer Direktor von PACT und Erster Dirigent des Nationalorchesters, ein Ungar, der bereits mit dreiundzwanzig Jahren in Triest seinen künstlerischen Durchbruch erzielte und dann den großen Opern- und Konzerthäusern in Hamburg, Frankfurt, New York, Los Angeles, Augsburg, Kopenhagen, Berlin und München diente.
In Südafrika dirigierte er „Die Walküre“, „Tristan und Isolde“, „Elektra“ und „Der Rosenkavalier“. – Günther Schneider-Siemssen, ein international hochgeschätzter Bühnendesigner, arbeitete an der Bayerischen Staatsoper, am Salzburger Landestheater, an der Wiener Staatsoper (von Herbert von Karajan berufen), an den Bühnen in Warschau, Berlin, Barcelona, Seattle und Houston. Professor Schneider-Siemssens südafrikanische Bühnenbilder für „Tristan und Isolde“, „Der Fliegende Holländer“, „Die Zauberflöte“ sowie für „Krieg und Frieden“ sind Meisterwerke ihrer Art.
Carla Pohl als Leonore beziehungsweise Fidelio startete als Mezzosopranistin in Johannesburg, bevor sie in Deutschland weiterstudierte und erfolgreich an den Bühnen in Pforzheim, Freiburg, Wiesbaden und Düsseldorf wirkte. Außerdem stand sie in Moskau, Wien, Brüssel, Antwerpen, Paris, Berlin (Ost und West), München und Brisbane vor begeistertem Publikum. In Südafrika kennt sie jeder Opernfreund in Durban, Cape Town und natürlich Johannesburg/Pretoria. – Wolfgang Fassler, ein gebürtiger Wiener, kennt ebenfalls viele europäische Bühnen, an denen er schwierigste Rollen meisterte: „Das Liebesverbot“, „Die Walküre“, „Tristan und Isolde“, „Doktor Faust“ und viele andere. Aber auch Namen wie Peter Meven (Rocco), Sharon Rostorf (Marzelline), Barry Coleman (Jaquina) und andere versprachen einen exzellenten Operngenuss, dem wir uns am 3. August 1990 hingeben durften.
Auffallend an diesem Freitagabend: Es schien, dass Meisterdirigent Ötvös sein Souveränes Orchester fast ausschließlich für die deutsche Kolonie Pretorias spielen ließ, denn niemals zuvor hörten wir in den Wandelgängen und an den Getränketheken so viel heimatliche Sprache. Wir hatten das Gefühl, dass die Meinung des Publikums einhellig war: Ein großer Opernabend, für den man dankbar sein muss! Was die künstlerischen Leistungen anbetrifft, überragte Carla Pohl (Fidelio), während Wolfgang Fassler (Florestan) stellenweise Mühe hatte, Tritt zu fassen; es war, als ob ihn sein eigenes Kettenrasseln irritiert hätte. Unvergesslich bleibt der bis ins Mark gehende Gefangenenchor „Oh welche Lust in freier Brust …“, der so manches Publikumsgemüt zum Überlaufen brachte. Missfallen hat dagegen das „Kostüm“ des Gouverneurs – ein fast bodenlanger Ledermantel, dessen Ähnlichkeit mit jenem „Kleidungsstück“ der Hitlerschen Waffen-SS wohl nicht nur reiner Zufall war.
Einen „Musiknachmittag für Feinschmecker“ erlebten wir am Sonntag, dem 19. August, als wir in der Oper zu Pretoria eines der besten Ensembles für klassische Musik hörten – „I Musici“, das sich aus zwölf großartigen Künstlern zusammensetzt, die ihre historischen Instrumente meisterhaft beherrschen. Die stets ohne Dirigent spielende Gruppe fand sich 1954 in Italien zusammen und gab ihr Debüt in der „Accademia di Santa Cecilia“ in Rom, das seinerzeit als triumphaler Erfolg gefeiert wurde. Seither spielen sich die italienischen Musikkünstler von Höhepunkt zu Höhepunkt und denken nicht daran, etwa aus politischen Gründen den Südafrikanern ihren Vivaldi, Händel oder Mozart vorzuenthalten.
Im Mittelpunkt dieses sonntäglichen Programmes standen Werke von A. Vivaldi, deren Interpretationen allesamt perfekt waren. Am besten gefielen „Die vier Jahreszeiten“ – vom Violinensolisten Federico Agostini ebenso glänzend beherrscht wie vom Rest des Ensembles. Um welchen Musikgenuss es sich handelte, verriet nicht nur der stürmische Applaus, sondern auch die Tatsache, dass es niemand wagte, während der Darbietungen sich auch nur zu räuspern. Wie tief die mittelalterliche Musik Vivaldis (1678 bis 1741) einzudringen vermochte, bewies schließlich auch der langanhaltende Beifall, schienen doch alle Zuhörer „Die vier Jahreszeiten“ regelrecht verspürt zu haben: den sprießenden Frühling, den leisen Wind in den Sommerwäldern, die sich zur Ruhe legende Natur im Herbst und die spielenden Kinder in der hellen Wintersonne.
Mit Recht erwarteten Pretorias Operettenfreunde „viel Herz“ von der Aufführung am 21. September im Staatstheater (Drama), denn auf dem Programm stand Franz Lehárs „Zarewitsch“, ein Klassiker unter den „herzigen“ Bühnenstücken. Und so ist verständlich, dass die wenigen vorgesehenen Aufführungen rasend schnell ausverkauft waren, wir also wieder einmal großes Glück hatten und sogar an einem der begehrten Freitagabende Lehárs Paradestück hören und sehen durften.
Dirigiert wurde das kleine Staatsorchester von Frank Cramer, einem 1954 in Essen geborenen Künstler, der unter Horst Stein (Hamburg) studierte und zunächst in Florenz, Bologna und Bordeaux als assistierender Dirigent arbeitete. 1980 erhielt er in Oldenburg seinen ersten Dirigentenauftrag, dann wirkte er in Würzburg, Nürnberg, Karlsruhe, Mannheim, Essen und Zürich. Cramers Durchbruch kam mit Verdis „Aida“, die er während des „Macerata Summer Festivals“ dirigierte. Außerdem zeigte er sein Können als Dirigent großer Konzerte in Schweden, Bern, Triest und Berlin. Südafrika war Cramers erstes Überseeland.
Ungewohnt für deutsche Ohren: der „Zarewitsch“ in englischer Version (Adam Carstairs). Und so dürfte vor allem das berühmteste Lied dieser Operette „Es steht ein Soldat am Wolgastrand …“ (Wolgalied) bei den auch diesmal auffallend zahlreich vertretenen deutschen Musikfreunden nicht besonders gut angekommen sein, zumal der Interpret Thomas Booth (Tenor) zweitweise Mühe hatte, sein Können voll zur Geltung zu bringen. Auch die übrigen Partien wollten dem „Zarewitsch“ nicht hundertprozentig gelingen, was vielleicht auf seine Partnerin, Eugene Chopin, zurückzuführen ist, die ihre kräftige Sopranstimme kaum zügeln konnte. Duette schien die Eugene immer für sich entscheiden zu wollen!
Sonderapplaus erntete dagegen Dicky Longhurst, ein Künstler, der unsichtbar blieb und dennoch sichtbar war: der Designer. Er zauberte Bühnenbilder, die erfreuten – den Palast zu Peterburg und die neapolitanische Villa mit Garten: beleuchtete Zwiebeltürme und Schneefall, riesige Ikonen, Kronleuchter, wärmender Kamin und flammende Kerzen, säulenverzierte Herrschaftsvilla, Parkanlagen und wogendes Meer. Lustig wirkten Ivan (Georg Kok) und Mascha (Barbara Veenemans), zwei Veteranen der leichten Muse. – Insgesamt gesehen hielt diese Vorstellung leider nicht ganz, was sie zu werden versprach, und so blieb es am Ende auch nur bei zwei mühsamen Vorhängen.
2. KapitelSüdafrikas Politkrimi wird fortgesetzt
Insgeheim hatten wir gehofft, dass uns nach der „Rückkehr aus dem Busch“ ein paar erholsame Wochen vergönnt sein würden, aber diese Hoffnung zerschlug sich bereits bei der Durchsicht eines großen Berges inzwischen eingetroffener Post, unter der sich die Nachricht befand, dass wir vom „Bureau of Information“ als „Buitelandse Korrespondente“ akkreditiert wurden, wir also nun auch offizielle Medienvertreter in Südafrika sind und als solche noch freieren Zugang zu interessanten Quellen haben. Wir ahnten, dass dieser von uns angestrebte Status eher ein Mehr an Arbeit und nicht zuletzt auch Verpflichtungen mit sich bringen würde. Außerdem wurden wir mit einem schönen Foto mit persönlichen Widmungen de Klerks und seiner Gattin Marike überrascht. Auch so etwas verpflichtet.
Öffnete uns jede gewünschte Tür in ganz Südafrika: die Akkreditierung als „Buitenlandse Korrespondente“ beziehungsweise „Foreign Media“.
Wie angedeutet, gab es eine Fortsetzung des südafrikanischen Politkrimis, der uns tagtäglich viel beschäftigen sollte, wobei ich vorausschicken möchte, dass die aus sehr unterschiedlichen Quellen beziehungsweise Ereignissen zusammengetragen Mosaiksteinchen lediglich die wesentlichsten, aber auch typischen Aspekte widerspiegeln, mit denen man es hier vierundzwanzig Stunden am Tag zu tun hat. Es hat zudem den Anschein, als würde die Flut neuer Ereignisse eher ins Uferlose schwappen, was gewiss nicht zur allgemeinen Beruhigung der Leute beiträgt, im Gegenteil. Wir gewannen immer deutlicher den Eindruck, dass die Masse der Bevölkerung – welche Gruppe auch immer – durch die Fülle der täglich auf sie zukommenden Nachrichten immer mehr verunsichert wurde, sogar ratlos zu werden drohte – ein idealer Boden für Radikalismus, denn wenn der Geist nicht mehr reicht, mit politischen Herausforderungen fertigzuwerden, müssen Waffen sprechen!
Im Folgenden soll der Chronist zu Wort kommen, dem die Aufgabe zufällt, die relevanten Ereignisse, die zum Teil wieder dramatische Züge annehmen sollten, nicht nur aufzureihen. Er wird an vielen Stellen seine Meinung äußern, aber auch zwischen den Zeilen abermals viel Platz fürs „freie Mitdenken“ lassen.
Nelson Mandela, der am 11. Februar 1990 freigelassene ANC-Vize, machte auf seinem Weg nach Kanada unter anderem in Amsterdam Station, wo er von 20.000 jubelnden Anhängern gefeiert wurde. Nach seinem Empfang durch Königin Beatrix, Ministerpräsident Lubbers und Außenminister van den Broek rief Mandela seinen niederländischen Freunden zu: „Lasst uns die schrecklichen Ereignisse von 1976 (Soweto-Aufstand) vergessen und uns auf das neue Südafrika konzentrieren!“, eine Forderung, die Mandela durchaus im Geist jener Bedingung erhob, unter der er auf freien Fuß gesetzt wurde: Er hatte noch vor der Freilassung seine Bereitschaft bekundet, auf eine Friedenslösung in Südafrika hinzuarbeiten und wurde daraufhin aus dem Gefängnis entlassen.
Doch militante Rufe aus der Menge zeigten, dass selbst viele Holländer nicht daran denken, einem friedlichen Wandel in Südafrika das Wort zu reden: „Tötet die Buren!“ und Schlimmeres war zu hören. Doch Mandela fuhr unbeirrt fort: „Die südafrikanische Regierung (er sprach nicht von „Regime“) sieht heute ein, dass Apartheid ein Fehler war und versucht zusammen mit dem ANC (und anderen) ein neues Südafrika zu schaffen, dies hat uns bewogen, die Vergangenheit zu vergessen!“, womit Mandela wohl weiterging, als den niederländischen Offiziellen recht war, denn in ihrem Übereifer sagten sie die Fortsetzung ihrer Sanktionspolitik gegen Südafrika zu, noch bevor eine entsprechende abermalige Forderung dieser Art auf dem Tisch lag.
Mandela wird zwischendurch erfahren haben, dass der im Jabulani-Stadion mit Walter Sisulu als Hauptredner abgehaltene „Soweto-Tag“ für den ANC ein voller Erfolg war: 60.000 Anhänger waren erschienen, während es der PAC (der vom ANC abgespaltene militante Pan African Congress) in Orlando auf nur 3.000 Jubelnde brachte, obwohl man nicht weniger als 70.000 erwartet hatte.
Nicht zuletzt ermuntert haben, nun stereotyp nach der Beibehaltung der Sanktionspolitik gegen Südafrika (seinem eigenen Land) zu rufen, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass die Opfer in aller Regel schwarze Arbeitssuchende und deren meist große Familien sind. Seine Hauptargumente: In Südafrika habe sich nicht viel geändert und Apartheid bestehe weiter, womit er in Wirklichkeit aber seine eigene Glaubwürdigkeit zu untergraben begann. Andererseits weiß er, was er tut, denn im Ausland – namentlich in den Niederlanden, gibt es viele Leute, die auf dem Boden der billigen Rhetorik ihre Karrieren absichern. Der offensichtliche Sieg, den Mandela „in Sachen Sanktionen“ errungen zu haben glaubt, wird wohl eines Tages von seinen eigenen hungrigen und arbeitslosen Leuten gegen ihn ins Feld geführt werden!
Die Forderung des ANC, Sanktionen und Boykotte gegen Südafrika vorerst beizubehalten, stieß in EG-Kreisen, die sich auf einen Gipfel am 25. Juni in Dublin vorbereiteten, durchaus auf offene Ohren. Die Iren verstiegen sich sogar zu der unverantwortlichen Auffassung, man solle auf Mandela hören, der verlange, dass der Druck so lange beibehalten bleiben müsse, bis er grünes Licht für eine andere Politik gebe!
Es zeigt sich, dass die Europäische Gemeinschaft jedoch in Bezug auf wirtschaftlichen Druck gegen Südafrika nicht auf einer Linie liegt, doch zeichnete sich schon im Vorfeld des Dubliner Gipfels eine Mehrheit für Mandelas Forderung ab, wobei die Bundesregierung eine peinlich zwiespältige Haltung einnimmt: Einerseits sagt sie, dass wirtschaftliche „Strafmaßnahmen“ erfahrungsgemäß nicht zum gewünschten Erfolg führen und deshalb „schon immer“ gegen Sanktionen war; andererseits beugt sie sich den mit Mehrheit gefassten Sanktionsbeschlüssen und fühlt sich an sie gebunden, obwohl andere EG-Staaten – zum Beispiel Italien – nicht daran denken, diesen politischen Unsinn in der Praxis mitzutragen.
Mittlerweile gibt es nicht einmal mehr ein einziges OAU-Mitgliedsland, das mit der „Burenrepublik“ keinen Handel treiben würde! Im Klartext heißt das, dass sich die meisten EG-Mitgliedsländer – auf Wunsch Mandelas – vorerst noch afrikanischer als die Afrikaländer selbst verhalten, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass der ANC erst am 3. Juni 1990 verkündete: „Die einzige Art von Gewalt, die wir akzeptieren, ist die organisierte Gewalt in Form von bewaffneten Aktionen!“ Außerdem wird geflissentlich übersehen, dass Mandela trotz des freien Falles, in welchem sich der Kommunismus weltweit befindet, noch immer dem stalinistischen Betonkopf Joe Slovo (Vorsitzender der SAKP) salutiert und ihn als „einen unserer bedeutendsten Patrioten“ feiert. Von Südafrikanern ist das alles kaum mehr nachzuvollziehen und zu verdauen.
Die öffentliche Bestätigung seitens des ANC, dass bis auf Weiteres der „bewaffnete Kampf gegen das Regime“ ein Mittel seiner Politik ist, hat natürlich auf der entgegengesetzten Seite – bei den Rechtsextremisten – entsprechende Reaktionen ausgelöst, über die man sich eigentlich nicht zu wundern bräuchte, denn linker Extremismus verursacht rechten und umgekehrt. Ein herausragendes Beispiel ist Piet Rudolf, neben Eugène Terre’Blanche (AWB) ein führender rechter Kopf und Vize der „Burenstaatspartei“, der – seinem Gewissen gehorchend – in den Untergrund gegangen war. Ganz Südafrika rieb sich die Augen, als am 19. Juni 1990 die Tageszeitung „Beeld“ mit einer Riesenschlagzeile aufwartete: „Krieg“. Dieser Zeitung war ein Video zugespielt worden, das Piet „Skiet“ (Schießen), umringt von schwerbewaffneten Maskierten vor der Flagge der „Burenstaatspartei“, den Vier Farben, zeigt. Unverhohlen verkündete Rudolf, dass er der Regierung, dem ANC und der SAKP den Krieg erklärt habe: „Schlagt den Feind mit Blut und Backsteinen!“, so „Skiet“ wörtlich, und er fährt fort: „Es ist besser, in Glorie zu sterben, als in Erniedrigung zu leben. Zeit für Verhandlungen gibt es nicht! Hiermit demonstrieren wir, dass wir mit allen Mitteln die Regierung de Klerks bekämpfen werden, um sie zu stürzen, das hat für uns höchste Priorität. Wir werden die Erde verbrennen und rufen dazu auf: Untergrabt die NP auf jede Art und Weise, legt den Staatsdienst lahm, vernichtet seinen Propagandakanal, überredet Polizei und Wehrmacht, den Krieg der Buren mitzumachen, nehmt Geld von den Geldmächten und finanziert damit unseren Kampf, ignoriert die Gesetze dieser ungesetzlichen Regierung und installiert einen Untergrund-Informationsapparat! Wir haben keine Zeit mehr, eine Gegenrevolution zu planen, sondern jetzt ist offener Krieg! Alles, was wir brauchen, sind 500 Freiwillige, die ihr Leben auf dieser Asche (?) zu opfern bereit sind!“
Dass dieser weitere Akt des südafrikanischen Politkrimis landesweit überwiegend auf völliges Unverständnis stieß, liegt auf der Hand. Es tröstet jedoch kaum, wenn die Polizei versichert, ein weites Netz gespannt zu haben, um dieses offensichtlich Geistesgestörten habhaft zu werden, denn er ist ja nur die berühmte Spitze eines Eisberges. 50.000 Rand hat die Regierung auf Piet „Skiet“ ausgesetzt, nach dem nun wegen Hochverrats gefahndet wird, ein Mann, der für sein Burenvolk den eigenen Staat erkämpfen will. Im Prinzip ist er sich darin mit Dr. A. Treurnicht, dem Vorsitzenden der Konservativen Partei (KP), einig, der allerdings den politischen Kampf favorisiert und sich folgerichtig von Rudolf distanziert hat. Zur „Burenstaatsidee“ Prof. J. Hupkens (UNISA): „Ein eigener Volksstaat mit Apartheidswirtschaft ist wahnsinniges Selbstmordstreben und wäre nicht lebensfähig, weil das Ausland dieses Gebilde isolieren würde und es außerdem von Südafrika abhängig wäre!“
Exakt zu dieser „Sternstunde“ Rudolfs trafen sich de Klerk und die Repräsentanten der sogenannten Homelands zum zweiten Mal, um gemeinsam über „friedliche Wege in Richtung auf ein neues Südafrika“ zu beraten. Dass als einziger Chief Minister Dr. K. Mopeli, QuaQua, an den Beratungen nicht teilnahm, enttäuschte, doch wurde dessen Rechtfertigung akzeptiert: „Ich halte zurzeit ein in die Zukunft weisendes Referendum ab und muss mich deshalb neutral verhalten!“ Nach siebenstündiger Sitzung wurde bekanntgegeben: „Der friedliche Prozess muss weitergeführt werden, um der Gewalt ein Ende zu setzen, die ökonomische Weiterentwicklung hat Priorität, damit zur Armutsbekämpfung mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können, die Verhandlungen über ein neues Grundgesetz müssten schnellstens beginnen.“
Inzwischen setzte Mandela seine höchst aufwendige, angeblich von Anglo American finanzierte politische Weltreise fort, über die die südafrikanischen Medien haarklein berichteten, so dass sich so manche Zeitgenossen fragten, ob ihr Weltbild wohl in Ordnung sei, denn ihnen saß noch in den Knochen, was Mandela erst Mitte Mai in Angolas Hauptstadt Luanda gesagt hatte: „Den Fortschritt, den wir mit unserem Kampf gemacht haben, verdanken wir zum größten Teil Angola, und wir hoffen, dass wir eines Tages ebenso frei sein werden wie ihr!“ Er beschrieb bei dieser Gelegenheit das Castro-Regime, das Angola „befreit“ hätte, zwar als wirtschaftlich armes Land, fügte aber hinzu: „Es gibt jedoch einen Bereich, in welchem dieses Land (Kuba) alle anderen weit überragt: Das ist seine Liebe zu den Menschenrechten und zur Freiheit!“ Und so nebenbei bemerkte Mandela: „Wenn die Regierung (Südafrikas) sich Zeit lässt, Vertreter der schwarzen Bevölkerungsmehrheit zügig an der Macht teilhaben zu lassen, dann kommt für uns nicht einmal die Erwägung eines Waffenstillstandes in Frage!“ Schizophrener kann Politik kaum mehr sein.
Aussagen wie diese werden in den USA offensichtlich schnell wieder vergessen oder gar nicht erst zur Kenntnis genommen, denn wie sonst ließe sich erklären, was sich im Rahmen von Mandelas Amerikabesuch alles abspielte: In New York wurde dem südafrikanischen „Bürgerrechtler“, dessen Jungwerk den Titel trägt „Wie man ein guter Kommunist wird“, ein Empfang nach den Regeln eines Staatsbesuches zuteil, die Sicherheitsmaßnahmen übertrafen die des Gorbatschow-Besuches bei weitem! Helikopter und nicht weniger als vierzig Polizeimotorräder begleiteten Mandelas Konvoi vom Flughafen durch eine Straße in die City, die eigens für diesen „Staatsbesuch“ für kleine 150.000 Dollar saubergemacht wurde. Was viele befürchteten, trat auch ein: Mandelas USA-Besuch wurde zu einem unerhörten „gesellschaftlichen Spektakel“ hochstilisiert, wofür nicht nur die öffentlichen Hände sorgten, sondern auch rund 5.000 Medienvertreter, die das „Ereignis Mandela“ für ihr Publikum zu erfassen hatten – jeder auf seine Art!
Man versetzte sich einmal in die Lage bürgerlicher Südafrikaner, die via Bildschirm zum Teil sogar live miterleben, wie Übersee – in diesem Fall die Massen der sogenannten Führungsmacht der westlichen Welt – einem eingeschworenen Kommunisten huldigt, von dem jeder hier weiß, für welche Ideologie sein Herz schlägt. Und schließlich wird jener Bürgerliche am selben Tag auch noch mit der Hiobsbotschaft überrascht, dass Joe Slovo plane, am 29. Juli 1990 in Soweto die SAKP als öffentliche Partei wiederzugründen, um – wie er sagte – am „demokratischen Prozess“ teilnehmen zu können. Er sei für das Mehrparteiensystem, in dessen Spektrum die SAKP „demokratische Verantwortung“ für die Arbeiterklasse übernehmen müsse, fügte jedoch gleich hinzu, dass sein Partei den Pluralismus nur für eine Übergangsphase Südafrikas auf dem Weg in eine sozialistische Zukunft halte. „Der Sozialismus“, so Slovo wörtlich, „ist in Osteuropa zwar in eine Krise geraten, aber de Klerk und seine Regierungsklasse hoffen vergeblich, dass dadurch der Sozialismus auch in Südafrika in Ungnade fallen wird!“ Mit Dr. C. Crocker, dem langjährigen stellvertretenden Außenminister unter Ronald Reagan und Leiter der Afrikaabteilung, werden viele Beobachter der Auffassung sein: „Es ist skurril, dass jemand, der heute noch unter Hammer und Sichel marschieren will, nach Südafrika gehen muss!“
Crocker ist jedoch nicht die einzige Stimme in den USA, die sich kritisch und nachdenklich zu Wort meldete und sich von den politisch gefährlich naiven Massen distanzierte. Unbeeindruckt vom turbulenten Konfettiumzug Mandelas, der angeblich von einer Million Menschen umrahmt war, wurden in den Medien der USA auch unangenehme Fragen an ihn gestellt: „Wie kommt es, dass Sie Arafat umarmen, während die PLO Terror betreibt? Warum bezeichnen Sie Gaddafi als Ihren ‚Waffenbruder‘, obwohl ihn die ganze Welt als Terroristen kennt? Aus welchen Gründen huldigen Sie Castro, der in Wirklichkeit einer der letzten Stalinisten ist? Warum schwören Sie der Gewalt nicht ab? Herr Mandela, die Welt wartet auf Ihre Antworten!“, so Don Burton, der republikanische Kongressabgeordnete aus Indiana. Mandelas Reaktion kam prompt und präzise: „Die Welt begeht einen Fehler, wenn sie meint, ihre Feinde müssten auch unsere Feinde sein!“
R. Cohen (US State Department) schrieb: „Die USA können die Äußerungen und das Auftreten auch der Winnie Mandela nicht ignorieren und müssen sich vor Augen halten, in welche Affären sie verstrickt ist!“ Cohen erinnerte unter anderem an die Vorgänge um den „Mandela-Fußballclub“ sowie an Winnies unmissverständliche Drohung vom 13. April 1986 in Munsieville bei Krugersdorp: „Mit unseren Strichhölzern und Halskrausen werden wir dieses Land befreien!“ Wenn darüber geschwiegen würde, so Cohen, wären das unheilverkündende Botschaften, denn nicht zuletzt würde Schweigen darauf hinauslaufen, dass am Ende nur die Weißen Südafrikas und nicht die Schwarzen wegen Gewalt- und Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden. Winnie im Fernsehen auf ihre verheerenden Äußerungen angesprochen, meinte eiskalt: „Das ist aus dem Zusammenhang gerissen!“, und schon war das Thema erledigt – nächster Punkt!
Zwischendurch meldete sich Dr. M. Buthelezi zu Wort, Chief Minister von KwaZulu und legitimierter Repräsentant der größten schwarzen Volksgruppe in Südafrika, und forderte an die Adresse des reisenden Mandela gerichtet den ANC auf, auch „andere politische Gruppen und Parteien“ zu akzeptieren und ihnen das Recht auf ihre Eigenständigkeit zuzubilligen. Schließlich wies Buthelezi die Schuld am Nichtzustandekommen des geplanten ersten Treffens aller Chief Minister mit der Regierung und nicht zuletzt die Gewalttaten in Natal seinem Kontrahenten zu, der nicht wolle, dass seine Inkatha-Bewegung am Wandlungsprozess in Südafrika teilnimmt. Damit reagierte der Zuluführer auf die beleidigenden Äußerungen Mandelas in Italien, vergaß jedoch nicht, ihn abermals zur gemeinsamen Suche nach Lösungen aufzufordern. Völlig verwirrt hat die Südafrikaner schließlich die (unbestätigt gebliebene) Meldung, dass Mandela in Kanada gesagt haben soll, es sei durchaus möglich, dass zwischen der NP-geführten südafrikanischen Regierung und dem ANC eine Koalition zustande kommen könnte. – Das ist ein Aspekt, den man im Auge behalten sollte!
Womöglich war dem untergetauchten Piet Rudolf, dem rechtsextreme Kreise in aller Öffentlichkeit längst heldenhaften Mut zubilligen, das alles zu viel, denn „Skiet“ meldete sich via „Beeld“ abermals aus dem Untergrund und veröffentlichte sein „Manifest“, das im Wesentlichen folgendes aussagt:
Weil ich an die unbestreitbare Wahrheit der Bibel glaube, an den Dreieinigen Gott und an das Bestehen eines auserwählten Bündnisvolkes hier am Südpunkt Afrikas (gemeint ist das Burenvolk), deshalb unterzeichne ich heute am 20. Juni 1990 dieses Manifest mit meinem ganzen Herzen, Glauben und Verstand, dies ist mein Bekenntnis, mit dem ich stehe oder falle – Amen! Ich glaube an den Ratgeber unseres auserwählten Volkes, an das Bestehen der Bibel vor 1963 und verwerfe das moderne Geschwätz der neuen Übersetzung, denn die alte Bibelübersetzung basiert auf ursprünglichen Texten, die weltweit als wahre Schriften akzeptiert waren. Ich bin ein stolzer Bure, der hier eine gottgewollte Berufung zu erfüllen hat, um mein Volk dauerhaft zu festigen, damit auch die Zukunft meiner Kinder gesichert ist. Ich lehne die Einheitstheologie der Kirchen, wie sie zurzeit verkündet wird, ab und geringschätze die gleichmachenden Schritte der Regierung von Südafrika, wende mich mit allen Mitteln dagegen. Als Mitglied des auserwählten Volkes und stolzer Bürger meines Landes fordere ich meinen eigenen Staat in seinem Bestehen vor der britischen Eroberung und werde nicht zaudern, dem Ruf meines Gottes, Volkes und Landes zu folgen, werde nicht zögern, Gott wieder als Haupt meines Volkes zu erkennen. Ich glaube an das Recht, als Bürger meines Landes, auch meine Kinder in der Tradition meiner Vorfahren nach dem Worte Gottes zu erziehen und daran, dass mich die weißen Gene überlegen machen und mich deshalb niemand daran hindern wird, an meiner Berufung zu arbeiten. Gott ist das einzige Haupt meines Landes, weshalb ich nicht anerkenne, dass dieses Land von politischen Gruppen ausgebaut werden kann. Ich werde meine Ziele mit Worten und Waffen erreichen. Ich nagle dieses Manifest an Türen und verbreite es, um damit der linksliberalen südafrikanischen Regierung und anderen Feinden meine Ziele bekanntzumachen!“
Piet Rudolf aus dem Untergrund: „Ich glaube an das Recht, auch meine Kinder in der Tradition meiner Vorfahren zu erziehen.
Die Buren sind ein von Gott auserwähltes Volk!“
Hierzu erübrigt sich zwar jeder Kommentar, aber nichtsdestoweniger lösen in Südafrika derartige Dinge natürlich Gegenreaktionen aus. So könnte Winnie, die sich zu dieser Zeit gerade in New York aufhielt, von „Skiets“ markigen Worten gehört haben, die am Kap prompt die Schlagzeile provozierte: „Winnie fordert Munition“, womit sie allerdings nicht zum ersten mal einen Schatten auf die Gespräche zwischen ANC und Regierung geworfen hat. Sie sagte weiter: „Wir haben noch keinen Grund, de Klerk zu vertrauen“, und ihren Anhängern in Harlem rief sie zu: „Harlem ist das Soweto der USA! Wir wissen, ihr werdet zur Stelle sein, wenn wir zurück in den Busch gehen, um gegen die Weißen zu kämpfen! Wir wissen, ihr werdet uns Munition geben! Wir wissen, wir können mit euch rechnen!“ Das sind Äußerungen, die in Südafrika allerdings nur belächelt werden, weiß doch jeder, dass die Lebedame Winnie noch nie im Leben „Busch von innen“ gesehen hat.
Während die Mandelas sich also in Übersee nach Kräften bemühen, gegen ihr Land Stimmung zu machen, ist jene „Burenrepublik“ dabei, ihren schwarzen Nachbarn wieder einmal unter die Arme zu greifen: Ungeachtet aller Sanktions- und Boykottforderungen hat Botswana in Südafrika für 39 Millionen Rand einundvierzig Personenwaggons bestellt, die gegen Entgelt dort geliehene ersetzen sollen. Insgesamt hat Südafrika 12.000 Waggons ins afrikanische Ausland verliehen!
Unterdessen agierte Nelson im US-Fernsehen weiter und stellte auf die Frage von K. Adelman (ehemaliger Direktor der US-Waffenbehörde), warum er Arafat, Gaddafi und Castro als „Modellführer“ ansehe, klar: „Der ANC ist eine unabhängige Organisation, die von diesen Freunden nicht mit Rhetorik, sondern mit Mitteln unterstützt wird, damit wir den Kampf gewinnen!“
Harry Siegman, Genf, hat in derselben Fernseh-Diskussion Mandelas Äußerungen rundheraus als unmoralisch bezeichnet, Siegman ist Jude. Dass Nelsons Bekenntnis ausgerechnet zu Gaddafi in der US-Regierung auf Missfallen stoßen musste, liegt auf der Hand und hatte Folgen: Von den bewilligten zwanzig Millionen US-Dollar „zur Unterstützung pro-demokratischer Gruppen“ in Südafrika floss zunächst kein einziger Dollar an den ANC (den die US-Regierung also für eine pro-demokratische Gruppe hält!), und schließlich dementierte auch das State Department, dass Geldgeschenke dem ANC gemacht würden. Diese und ähnliche geldbezogenen Äußerungen gehen jedoch nicht klar aus vorliegenden Informationen hervor, so dass eher der Eindruck entsteht, dass hier ganz bewusst verschleiert wird, zumal später durchsickerte, Mandela sei mit „Sympathiegeldern“ in Millionenhöhe zurückgekehrt.
Auf Unverständnis stießen in den USA insbesondere Winnies mehrmalige Drohungen, der ANC werde die bewaffnete Gewalt fortsetzen, „wenn es am Verhandlungstisch schiefgehen sollte“. Hierzu meldete sich H. Cohen, stellvertretender US-Außenminister, zu Wort: „Auch Bush will wissen, wo der ANC in Sachen ‚Gewalt und Verhandlungen‘ steht!“ Scharfe Reaktionen auch in Miami, wo der Stadtrat auf Druck der dort lebenden Kubaner und Juden Pläne fallen ließ, Mandela groß zu empfangen.
Besonders drastisch reagierte der britische Konservative T. Dicks, der dem bevorstehenden Besuch Mandelas in London mit Schaudern entgegensah: Mandela ist kein Schutzengel (der Schwarzen), sondern eher ein Racheengel, denn was er in New York sagte, bestätigte, was er denkt. Thatchers Berater wären Idioten, wenn sie ihr raten würden, mit einem verurteilten Terroristen zu sprechen; denn es gibt keinen Sinn, die IRA zu verurteilen und gleichzeitig einem bekannten Terroristen den Hof zu machen. Mandela ist doch alles andere als ein moralischer Führer der Welt!“
Wie zu befürchten war, hat sich der EG-Gipfel in Dublin mit Mehrheit für die „vorläufige“ Beibehaltung der gegen Südafrika verhängten Sanktionen ausgesprochen, so dass Mandela, der am selben Tag noch mit US-Präsident Bush zusammentreffen sollte, zunächst einmal seinen Willen durchgesetzt hatte. Er wird jedoch gespürt haben, dass dieser Beschluss alles andere als eine erneute Kampfansage war, denn noch am Tag zuvor hatte der ANC-Vize die Verhängung „verschärfter“ Sanktionen verlangt. Bundesminister Warnke (BMZ) hielt sich an diesem Tag sicher nicht zufällig ausgerechnet in Pretoria auf, um vor der Presse zu erklären, dass die Aufhebung der Sanktionen nur noch eine Frage der Zeit Wäre, und im Übrigen sei die deutsche Regierung von der Wirksamkeit von Sanktionen „noch nie“ überzeugt gewesen, fühle sich an EG-Mehrheitsbeschlüsse jedoch gebunden. – Kopfschütteln in ganz Südafrika!
Das heikle Sanktionsthema spielte auch im Gespräch mit Bush eine erhebliche Rolle, wobei Mandela zurückstecken musste: Jetzt versicherte dieser dem amerikanischen Präsidenten, nicht (mehr) für verschärfte Sanktionen zu sein, wollte jedoch durchdrücken, dass die US-Regierung erst dann die Sanktionsgesetzgebung von 1986 lockern oder aufheben sollte, wenn sie dafür grünes Licht vom ANC bekommen habe, doch dieses überzogene Ansinnen wurde von der Administration ohne Wenn und Aber verworfen. Dazu Cohen: „Mandela kann nicht vorschreiben, was unsere zuständigen Gremien zu tun oder zu lassen haben. Die Sanktionen werden wir aufheben, sobald die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind!“
Im Mittelpunkt des Mandela-Bush-Gespräches stand jedoch die Gewaltfrage, hatte doch der ANC bisher stur an seiner Linie festgehalten, auf die „gute Gewalt“ (bewaffneter Kampf gegen Unterdrückung) als legitimes Mittel der Politik keinesfalls zu verzichten. Auch in diesem Punkt musste Mandela deutlich zurückstecken, ja sogar eine Kehrtwendung vollziehen: Er versprach Bush, dass der ANC seine Feindseligkeiten gegen die südafrikanische Regierung einstellen werde, sobald „gewisse Stolpersteine“ aus dem Weg geräumt seien. Mandela soll wörtlich geantwortet haben, „dass er sich die Einstellung des bewaffneten Kampfes überlegen werde“. Vor der Presse erklärte er, dass Gespräch mit Bush sei günstig verlaufen und die „Missverständnisse“ seien reduziert worden, wichtig sei, dass Bush eindeutige Sympathien für die Sache des ANC zu erkennen gegeben habe. Auf die Frage, wie er es nach dem Gespräch mit Bush mit seinen „drei großen Freunden“ halte, reagierte Mandela ausgesprochen gereizt: „Ich bin nicht bereit, mich jetzt darüber zu äußern, was Bruder Gaddafi oder Castro getan haben!“ – Kopfschütteln!
Der politische Höhepunkt lag in Mandelas Auftritt vor dem Kongress, denn er war erst der dritte „Bürgerliche“, dem diese hohe Ehre zuteil wurde. Und abermals schien es den Südafrikanern, als würde die politische Welt auf dem Kopf stehen, hatten sie doch erst am Vortag aufatmend zur Kenntnis genommen, dass die Bush-Administration ihrem Besucher wichtige Zugeständnisse abrang, und nun sah man, dass der US-Kongress seinem Gast stehende Ovationen darbrachte, die Mandela wohl dazu ermutigten, „in Sachen Sanktionen“ freihändig glatt eine Kehrtwendung zu vollziehen beziehungsweise entgegen allem Vorausgegangenen zu fordern, die USA müssten es dem ANC überlassen, zu welchem Zeitpunkt die gegen Südafrika verhängten Sanktionsmaßnahmen aufgehoben werden!
Der Kongress war zwar gut besetzt, aber etliche Abgeordnete waren demonstrativ dieser „historischen“ Sitzung ferngeblieben, zum Beispiel der Kalifornier W. Dannemeyer, der seine Kollegen scharf attackierte: „Die Einladung an Mandela, vor dem amerikanischen Kongress zu sprechen, ist opportunistisch und ohne gesunden Menschenverstand ausgesprochen worden. Ich halte das Ganze für eine nationale Schande!“
Tröstlich für die arg gebeutelten Südafrikaner hatte Maggie Thatcher parat, als sie sich in London auf einer Pressekonferenz zum EG-Beschluss äußerte: „Ich sage voraus, dass die Sanktionen gegen Südafrika binnen der nächsten sechs Monate aufgehoben werden. Es tut mir leid, dass es die EG nicht fertigbrachte, öffentlich darüber zu beschließen, die Sanktionen wenigstens zu erleichtern, aber – ich verrate kein Geheimnis – etliche Länder haben das ohnehin schon ‚privat‘ getan!“ Zum selben Thema meldete sich auch Südafrikas Außenminister „Pik“ Botha zu Wort: „De Klerk hat während seiner dreiwöchigen Europareise nicht die Aufhebung der Sanktionen gefordert, denn darüber zu entscheiden, ist ausschließlich Sache der EG selbst. Die von den EG-Mitgliedsländern formulierte Erklärung hierzu legen wir als Anerkennung unserer Reformpolitik aus. Damit können wir leben!“
Inzwischen agierte Mandela in den USA weiter, wobei die Aufmerksamkeit zunächst auf ein Interview mit der „Washington Post“ gelenkt wurde, in welchem der ANC-Veteran eine verblüffende Wende vollzog. Auf eine entsprechende Frage sagte Mandela: „Eigene Schulen sind in Ordnung, denn jede Gruppe (in Südafrika) soll das Recht haben, zur Pflege von Sprache und Kultur eigene Schulen zu unterhalten!“ Diese Aussage unterschied sich eklatant von früheren, wonach es im „neuen Südafrika“ absolut keinen Platz mehr für Gruppenrechte geben sollte. „Im Übrigen“, so hängte Mandela an, „könnte der ANC möglicherweise noch vor dem Inkrafttreten eines neuen Grundgesetzes für die Suspendierung der Sanktionspolitik gegen Südafrika plädieren!“ Inzwischen fragen sich in Südafrika Schwarze wie Weiße, wie berechenbar Mandela eigentlich noch ist.
Kaum hatte Mandela zur Verblüffung der meisten Beobachter von „Gruppenrechten“ gesprochen und damit in Südafrika skeptische Reaktionen ausgelöst (die Weißen glauben ihm das nicht), trat Verfassungsminister Dr. G. Viljoen an die Öffentlichkeit, denn die Regierung schien spätestens jetzt gespürt zu haben, dass sie den arg strapazierten Landsleuten ein paar klärende Worte schuldig war. Die Ratlosigkeit lief im Prinzip auf die Frage hinaus: Wie soll denn das neue Parlament – das neue Südafrika – eigentlich aussehen, etwa nur noch schwarz und rechtlos für die Weißen?
Viljoen, den dreisterweise eine große deutsche Tageszeitung erst kürzlich als „Guru von Pretoria“ bezeichnet hatte, ist das kühle intellektuelle Gewissen hinter de Klerk, ein Mann der Staatsjuristerei, der als „berechnender Architekt“ für eine neue südafrikanische Verfassung angesehen wird. Wie der Minister sagte, wird das Ganze auf ein Zweikammersystem hinauslaufen, in welchem alle ethnischen (und politischen) Gruppen prinzipiell gleichberechtigt vertreten sein werden; dabei sei entscheidend, dass zukünftig keine Minderheit mehr dominierende Macht ausüben könne. Um dies sicherzustellen, werden in der Ersten Kammer (eine Art Unterhaus) die nach dem Prinzip one man – one vote gewählten Abgeordneten sitzen und in der Zweiten Kammer (im sogenannten Oberhaus) die gewählten Vertreter der Minderheiten. Beide Kammern zusammen bilden die Oberste Gesetzgebung, das heißt, Gesetzesvorlagen müssen von beiden Gremien gebilligt werden, womit sichergestellt ist, dass den Minderheiten ein bedeutendes Mitentscheidungsrecht garantiert wäre. Viljoen ließ allerdings offen, ob Beschlussvorlagen mit einfacher oder Zweidrittelmehrheit als angenommen gelten oder ob bei bestimmten Gesetzesinitiativen den Minderheitsgruppen nicht sogar ein Vetorecht zugestanden werden müsste. Wie es scheint, dürften in diesen wichtigen Detailfragen noch so manche Teufel stecken! Auf jeden Fall stimmt optimistisch, dass Viljoen ausdrücklich die Achtung der Menschenrechte hervorhob, zu denen ja auch die Minderheitsgruppen- und Individualrechte gehören. Der Rassendiskriminierung in jeglicher Form erteilte der Minister abermals eine klare Absage, wobei er natürlich nicht nur Schwarz und Weiß vor Augen hatte. Außerdem gab er jetzt schon bekannt, dass drei unabhängige Instanzen grundgesetzlich festgeschrieben werden: Qualifizierte Rechtsprechung (ist bereits Verfassungswirklichkeit) sowie „Verfassungsüberwachung und -durchführung“ in institutioneller Form. Viljoen ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass der Weg bis zur Verabschiedung einer neuen Verfassung noch weit und steinig ist und es der ehrlichen Anstrengung aller politischen Kräfte in Südafrika bedarf, um baldmöglichst dieses hohe Ziel zu erreichen.