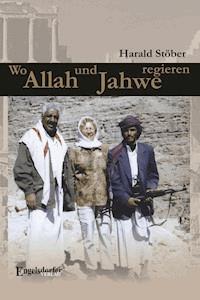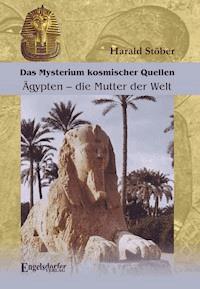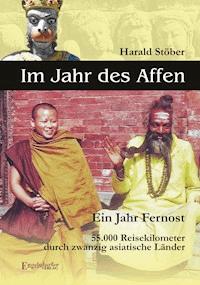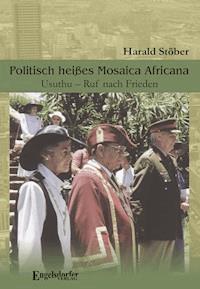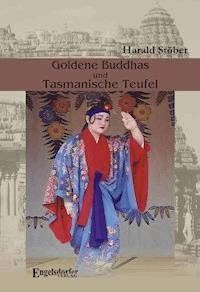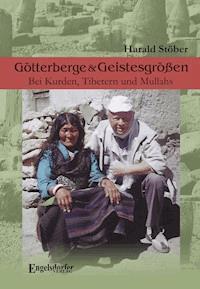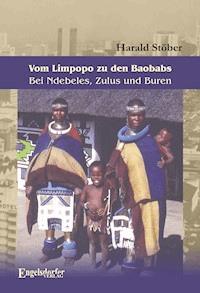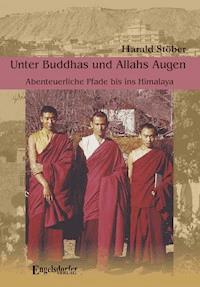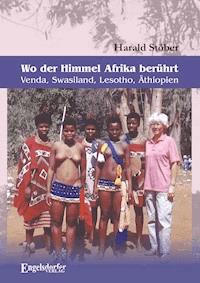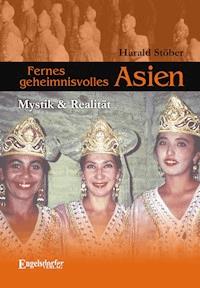6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In der Realität entpuppen sich Reiseparadiese oft als das Gegenteil dessen, was man erwartet. Schnell wird deutlich, dass die Wirklichkeit mehr sagt als tausend Bilder! So wunderschön viele der tropischen Landschaften auch sein mögen, so hässlich kann Erlebtes werden: Vergewaltigungsgefahren auf Tonga, Raubüberfälle auf Kuba, Unausstehliches auf Hispaniola oder Kriminelles auf Jamaica. Wer sich als Hobby-Archäologe betätigen möchte, kann sogar Pyramiden und ein »Stonehenge« in der Südsee oder vorgeschichtliche Petroglyphen in der Karibik entdecken. Wer also Mut und Know-how besitzt, wird auch Freude an diesen »Paradiesen« haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Harald Stöber
Pseudo-Paradiese
Südsee & Karibik
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor
Titelfoto: Zusammentreffen mit einem Volksvertreter
der Eingeborenen in Waigani/Papua-Neuguinea
www.engelsdorfer-verlag.de
eISBN: 978-3-86268-797-8
Gewidmet meiner
lieben Frau Hildegard,
die mich auf allen
Reisen begleitet hat.
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
SÜDSEE
Kapitel 1
Im Zentrum Polynesiens - Ein kurzer Überblick
Musik und verwirrende Geographie – Republik Fidschi
Massige Leiber und „Stonehenge“ – Königreich Tonga
Nur 19.921 Kilometer bis zum Deutschen Kaiser – Unabhängiger Staat Samoa-West
Kapitel 2
Von Melanesien bis Feuerland – Überblick
Und rot glüht der Eyers Rock – Australien
Begegnung mit der Jungsteinzeit – Papua-Neuguinea
Kannibalismus nein – Muschelgeld ja. Solomon Islands
Wo noch Federgeld gültig ist – Vanuatu
Französische „Esel auf dem Eis“ – Neu-Kaledonien
Wo Bounty und Gauguin jeder kennt – Tahiti
Mystische Moais im weiten Pazifik – Osterinsel
Kontraste im Schatten der Anden – Chile
Im monumentalen Buenos Aires – Argentinien I
„Sommerschnee“ nahe der Antarktis – Feuerland
Tango City und Gute Luft – Argentinien II
Teil II
KARIBIK
Kapitel 1
Auf den Spuren von Kolumbus – Ein paar Gedanken vorweg
Fest im Griff der USA – Puerto Rico
Hispaniola (allgemein)
Betrug und Luxus – ganz normal Dominikanische Republik
Chaos-Land des Kaiser Henry – Republik Haiti
Rückreise
Kapitel 2
Fidel, Chè und Zucker – Ein Überblick
Viel Auto- und Hotelnostalgie – Havanna
Politik und Kultur verblassen – Matanzas
Chè mit Handgranate und Gewehr – Santa Clara
In der „Schönen Stadt am Meer“ – Cienfuegos
Hier spukt die Blaue Frau – Perche
Rum und die „Fidel-Spinne“ – Trinidad de Cuba
Ideologie-Export nach Afrika – Sancti Spiritus
Unter einem Hut: Papst und Marx – Camagüey
Dauerrevolution unter Sowjetstern – Holguín
Stadt des „Vaters der Nation“ – Bayamo
Moncada-Fiasko und Revolutionssieg – Santiago de Cuba
Wo sogar Henry Morgan scheiterte – El Morro
Kupfer, Papst und Fidels Mutter – El Cobre
Wieder in Havanna
Die Rückkehr
Kapitel 3
Von Atlantis bis Ariane – Ein kurzer Überblick
Wo Luxusliner und Atlantis protzen – Bahamas
Bob Marley, Drogen und Rastafaris – Jamaica
Bei Admiral Nelson und dem Türkenkopf – Antigua
Mt. Pelée und Kaiserin Joséphine – Guadeloupe und Martinique
Brücken, Gottesacker und Kanonen – Barbados
Kriminalität und Asphaltsee – Trinidad
Ein Land – versunken in Schizophrenie – Guyana
„Babylonische Sprachen und Kulturen“ – Suriname
Fünfzehnmal Europa in Kourou – Guyane Française
Kapitel 4
Windward Islands – Kurzübersicht
„Ivan“, USA und Natur pur – State of Grenada
Eine Insel – einst von Außerirdischen besucht? – St. Vincent
Insel der Preisträger, Segler und Pitous – St. Lucia
Bildnachweise:
Weitere Bücher des Autors:
Teil I
SÜDSEE
Kapitel 1
Im Zentrum PolynesiensEin kurzer Überblick
Die Südsee beziehungsweise die Inselwelt im tropischen Pazifik gilt schlechthin als „Paradies auf Erden“, also brachen wir am 26. Mai 2001 auf, by Air New Zealand bis ins Herz Polynesiens vorzustoßen, um endlich einmal Paradiesisches zu erleben. Wir tourten 46 Tage lang, brachten es auf insgesamt gut 40.000 Reise-Kilometer (inklusive 2.230 Kilometer über Land) sowie auf die bisher zweithöchsten durchschnittlichen Tageskosten; allein die Flüge MUC via London, Los Angeles, Südsee und zurück schlugen mit 71 Prozent der Gesamtausgaben zu Buche, während sich die Aufenthaltskosten durchaus im Rahmen hielten. Dass es aber selbst im Paradies sehr teuer werden kann, haben schon viele Reisende als recht schmerzlich empfunden, doch wer mit genügend Know-how ausgestattet ist, lässt sich so leicht nicht über den Tisch ziehen. Dieses sogenannte Paradies ist also kaum etwas für individuell reisende Anfänger!
In Fidschi bereisten wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Fähre, Taxi) drei Hauptinseln und machten dabei permanent die Erfahrung, dass diese Inselrepublik indisch dominiert ist. Von den gegenwärtigen ethnischen Spannungen war allerdings kaum etwas zu spüren, wenngleich immer wieder zu hören war, dass sich Inder und Fidschianer gegenseitig beschuldigen. Fidschi entpuppte sich für uns als klassisches Beispiel dafür, dass sich Vertreter von Hochkulturen im Grunde nicht in eine ihr fremde Gesellschaft integrieren; es bilden sich Parallelgesellschaften mit allen vor- und nachteiligen Folgen.
Das Königreich Tonga, das sich auf eine Herrschaftstradition von über 1500 Jahren stützt, hat aus den nachbarlichen Problemen die Konsequenzen gezogen: Kein Inder mit Fidschi-Pass darf einreisen, zumal man schon mit ansässigen Chinesen seine Schwierigkeiten hat. So klein auch die Hauptinsel Tongatapu sein mag, so interessant ist sie: Man kann prähistorische, immer noch sehr rätselhafte Bauwerke besichtigen, es begegnen einem allenthalben „menschliche Kleiderschränke“ und die öffentlichen Bekenntnisse, dass Tonga bis aufs Blut ein christliches Land sei, wollen kein Ende nehmen, aber die gelebte Wirklichkeit ist oft eine ganz andere: Trunk- und Fresssucht, Vergewaltigungen und – Faulheit.
Samoa als einstige deutsche Kaiser-Kolonie gilt als das absolute Herz Polynesiens und hält im Prinzip, was die Südsee verspricht. Alle Inseln, von denen wir die wichtigsten drei bereisten, sind prächtige Botanische Gärten, die Dörfer sind romantisch, sauber und von schier unglaublicher natürlicher Farbenpracht. Begibt man sich in die von dichtestem Urwald bewachsenen Berge, glaubt man, plötzlich auf einem anderen Planeten zu sein. Auch Samoa bietet Rätselhaftes, so das angeblich größte prähistorische Bauwerk im Südpazifik – eine vom Urwald umwucherte „Pyramide“. Im Übrigen gilt Samoa als besonders traditionsbewusst, was sich in den Dörfern auch allenthalben zeigt.
Begleitet uns nun auf eine Weltreise, die uns sehr viel gab, aber auch einiges abverlangte. Jedenfalls überwog diesmal das Positive – ein gerechter Ausgleich für das zuvor überlebte Westafrika. Die „würzige Kürze“ möge man dem Autor bitte nachsehen, der sich leider außerstande sieht, sich mehr Zeit zu leisten, als ihm gegeben ist, aber auch zwischen den Zeilen liest man Vieles!
Musik und verwirrende GeographieRepublik Fidschi
Führt man sich in Bezug auf Fidschi ältere und neuere Lexika zu Gemüte, um sich vorab zu informieren, fällt vor allem auf, dass sich frühere Autoren nicht scheuten, gemäß der Wahrheit über den besonders auf den Fidschi-Inseln verbreitet gewesenen Kannibalismus zu berichten, während „moderne“ Schreiber dieses Phänomen mit keinem Wort mehr erwähnen (das es heute natürlich nicht mehr gibt). Noch vor hundert Jahren hieß es wörtlich: „Die Fidschianer sind kriegerisch, wild und grausam. Früher waren sie Götzendiener und Menschenfresser der ärgsten Art. Durch innere Raubzüge sind sie verwildert, und Menschenfleisch war noch bis vor nicht langer Zeit gewöhnliche Nahrung – hauptsächlich verzehrten sie Schiffbrüchige, Greise, Knaben und junge Mädchen, aber stets gekocht, nie roh …“ Wie tröstlich!
Ein Blick in die Geschichte lehrt, dass die wichtigsten südpazifischen Inseln (Fidschi, Tonga und Samoa) bereits um 1000 v. u. Z. von den sogenannten Lapita-Töpfern besiedelt wurden; sie sollen aus Richtung des heutigen Papua-Neuguinea und Malaysia gekommen sein. Der Holländer Abel Tasman entdeckte als erster Europäer am 16. Februar 1643 dieses von ihm Prinz-Wilhelm genannte Archipel, es kreuzte Cpt. Cook zweimal in Fidschi-Gewässern (1774 und 1789) und schließlich kamen 1835 die ersten christlichen Missionare (Wesleyaner) und bekehrten 1854 den namhaften Häuptling Kakobou, dem natürlich viele seiner Untertanen folgten beziehungsweise folgen mussten. Nach nicht enden wollenden inneren Unruhen wurde Fidschi – nach mehrmaligen vergeblichen Anläufen – 1874 britische Kronkolonie. Kakobou wurde als König von Fidschi eingesetzt, der sich nolens volens damit abfinden musste, dass die Briten nun die Tür für indische Vertragsarbeiter (Zuckerindustrie) öffneten. Was 1879 mit kläglichen 498 Indern begann, führte schließlich zur gegenwärtigen indischen Majorität, mit der sich die unterdrückt fühlenden Landeseigentümer, die Fidschianer, auch in Zukunft wohl nicht abfinden werden (auch die Bundesrepublik Deutschland wird sich in fünfzig Jahren dank der orientalischafrikanischen Zuwanderung nicht mehr wieder erkennen).
Die Briten beriefen 1916 erstmals einen Inder in die Gesetzgebende Versammlung, 1946 stieg der indische Bevölkerungsanteil auf deutlich über 50 Prozent, und 1975 kam es schließlich zu den ersten Rassenunruhen, bei denen die Inder – scheinbar – obsiegten, denn zwei Jahre später erlangten sie die Mehrheit auch im fidschianischen Parlament. Nach mehreren Militärputschen wurde 1991 eine neue Verfassung verabschiedet, welche die „politische Vormachtsstellung“ der Fidschianer (Natives) einräumt und festschreibt, dass das Land eine Souveräne Demokratische Republik sei. Das ist politischer Zündstoff für die Zukunft, zumal die einflussreichen Nachbarn Neuseeland und Australien mit Erfolg den vorübergehenden Ausschluss aus dem Commonwealth erreicht hatten und lediglich Fidschi als seit 1970 selbständige Republik, nicht jedoch die Regierungen anerkannten.
Die Zeiten werden vornehm. Zunächst ging es per neuer Super-S-Bahn zum Münchener Flughafen (Transrapid überflüssig!) und dann weiter mit Airbus A 320-200 – ausgestattet mit Ledersitzen – nach London HR, wo dank teurer Auslegware kein Schritt zu hören ist. Hier wartete schon der Boeing-Jumbo 747-400 zum elfeinhalbstündigen non-stop-Flug der Air New Zealand nach Los Angeles. Was zunächst etwas langweilig zu sein schien, steigerte sich, je weiter wir gen Westen flogen: Aus 12.000 Metern Höhe erblickten wir in der späten Nachmittagssonne eine Relief-Berglandschaft von besonderer Schönheit: Schneegipfel und Cañons. Der Landeanflug in LA wollte uns wegen des außergewöhnlich dichten Nebels gar nicht gefallen, doch dies schien für unseren Kapitän kein Problem sein. Weiter ging es non-stop mit einer Boeing 767-300 mit Ziel Nadi, dem internationalen Flughafen von Fidschi auf der Insel Viti Levu, so dass wir es auf nicht weniger als dreißig Reisestunden gebracht hatten, doch laut Kalender waren wir sogar drei Tage unterwegs: Bei Anreise aus Richtung Amerika ging uns glatt der Sonntag „verloren“, weil wir die Datumslinie überquert hatten – Abflug also am Samstag, Ankunft am Montag!
Als wir die Abfertigung problemlos hinter uns hatten (kein Visum erforderlich), war es 3.30 Uhr Ortszeit – kein Hinderungsgrund für die Bank zu dieser unchristlichen Morgenstunde nicht geöffnet zu haben und erst recht kein Anlass für eine Traditions-Band in Wickelröcken und Blumen im Haar uns Neuankömmlinge lauthals zu begrüßen: „Ni sa bula!“ bzw. „Herzlich willkommen!“ Und dies dürfte aufrichtig gewesen sein, wird zur Zeit doch jeder Besucher nach dem verheerenden Einbruch des Tourismus nach dem Coup von 1999 sehr umworben. Und so hatten wir auf Anhieb erreicht, dass der Besitzer des Western Motels seinen offiziellen Tagespreis um ein Drittel reduzierte und die zu Ende gehende Nacht nicht berechnete.
Die Stadt Nadi ist touristisch zwar nicht von großer Bedeutung, aber als Ankunfts- und Abreisepunkt unvermeidlich. Und dennoch gab es für uns einiges festzustellen und zu „entdecken“. Am heutigen Montag, dem 28. Mai, gerieten wir in den Ratu Sri Lala Sunkuna Day, den Nationalfeiertag zum Gedenken an die 1970 erlangte Unabhängigkeit, der natürlich auch in dieser Inder-Hochburg ernst genommen wird. Die relativ saubere City ist praktisch lahmgelegt – eine Wohltat für uns, die wir ohnehin schon Mühe hatten, mit der Zeit- und Klimaumstellung fertig zu werden.
Auf jeden Fall einen ausgiebigen Besuch wert ist der Sri Siva Subramaniya-Tempel am südlichen Stadtrand, ein höchst farbenprächtiges Hindu-Bauwerk zu Ehren der Götter Shiva, Brahma, Durga, Lakshmi und anderer. Zwei mit vielen Figuren ausgestattete Gopurame ragen in den stahlblauen Himmel, und ununterbrochen kommen indische Gläubige, die das Heiligtum betend umrunden und drinnen ihren Gottheiten huldigen. Und dies tun sie teils schon in der sechsten und siebenten Generation, ohne auch nur ein einziges Detail ihrer angestammten Religionskultur aufgegeben zu haben, sei es in Bezug auf Rituale, Sprache oder Bekleidung. Wer Indien gut kennt, der macht hier aber dennoch etwas Unindisches aus: Dieser Tempel ist sehr in Ordnung und die Sauberkeit selbst.
Zugänglich ist auch die blendend weiße Moschee am gegenüberliegenden Ortsende, die ob ihrer Größe jedoch nicht die nur acht Prozent Moslems in Fidschi repräsentiert. Hier wie auch sonst überall in der Stadt entbieten die Menschen ihr freundliches „Bula!“, so dass es dem Besucher nicht schwerfällt, sich als gern gesehener Gast zu fühlen. Und wie „gefährlich“ die Lage zurzeit wirklich ist, sieht man den hilfsbereiten Polizisten an, die ihren Dienst tatsächlich ohne Schusswaffen versehen!
Eine angenehme kleine Wanderung durch Zuckerrohrfelder, vorbei an riesigen Gummibäumen und kleinen Fischmärkten am Wege führte uns eher zufällig ins kleine Dorf Saunaka, das im fernen Nippon als sogenanntes Heirats-Village wohlbekannt ist. Als wir eintrafen, wurde gerade einer japanischen Touristengruppe vorgeführt, wie „echte“ fidschianische Dorftradition aussieht: lustige Schlangentänze, an denen jeder teilnehmen kann (das sind simple Polonaisen); traditionelle Musik auf einheimischen Instrumenten (Xylophone, Trommeln, Rasseln); Kleidung für Mann und Frau wie vor Jahrhunderten (Bast und Grünzeug) und nicht zuletzt ein Kirchgang mit Eintrag ins Gästebuch. Nicht zusammenpassen will, dass sich in diesem Methodistischen Gotteshaus japanische Zen-Buddhisten ihr Ja-Wort geben. Hauptsache ist wohl, dass die Romantik stimmt und der Heirats-Trip teuer genug ist. Was uns wirklich sehr beeindruckt hat, waren die vielstimmigen Südseegesänge des Dorf-Chores, die man sich wegen ihrer melodischen Klangfülle stundenlang anhören könnte.
Tanzen und Singen sind Leidenschaften auf den Fidschi-Inseln
Nachdem wir verdaut hatten, dass die noble Deutsche Mark beziehungsweise der Euro sogar gegenüber der Krisen-Währung Fidschi-Dollar im Vergleich von vor zwei Jahren um 20 Prozent an Wert verloren hat, machten wir uns per Bus in die Zuckermetropole Lautoka auf, die nördlich von Nadi zu finden ist. Bevor man die ersten Zuckerfabriken und Verladeeinrichtungen erreicht, quert der Bus weite Zuckerrohr-, Bananen- und Kokosplantagen, an den Berghängen haben sich dichte Urwaldreste erhalten und immer wieder sieht man, das Fidschi vulkanischen Ursprungs ist: Lavagestein.
Dass wir in dieser Stadt kaum einen Touristen antrafen, mag daran gelegen haben, dass sie keine Besonderheiten bietet und nicht zuletzt die Ferien-Resorts weit außerhalb liegen. Besuchenswert ist jedoch der reichhaltig bestückte Markt, der von Coconut Oil, über Kwai-Knollen bis hin zu getrockneten Waka-Teepflanzen, aus dem Fidschis leicht alkoholhaltiges Nationalgetränk entsteht, alles bietet, was der nicht allzu anspruchsvolle Kunde fürs Tägliche benötigt.
Lautoka ist als Zuckermetropole erst recht indisch geprägt, zu erkennen hauptsächlich an den Tempeln, wie dem Sikh-Tempel von 1933 und dem Sri-Krishna-Tempel von 1977. Im letztgenannten äußerst sauberen Hindu-Heiligtum wird besonders His Divine (Göttlichkeit) Grace A.B.Swami als Gründer der Internationalen Krishna-Gesellschaft hoch verehrt. Platziert wurde seine lebensecht wirkende Statue gegenüber der Hauptgottheit Sri Krishna Kaliya, von der Swami wohl die Gründungs-Idee erhalten hatte.
Welche Bedeutung die indische Bevölkerung Fidschis für Indien hat, wird im Botanischen Garten demonstriert, den die Briten vor zirka 100 Jahren angelegt hatten. Am 27. September 1981 pflanzte Premier-Ministerin Indira Gandhi einen Ficus Religiosa, der heute neben Guavas, Eukalypten, Breadfruit- und Teakwood Trees bewundert werden kann. Der Garten-Manager ist Fidschi-Inder seit drei Generationen und stolz darauf, dass seine Kinder und Enkel dreisprachig sind: Hindi, Englisch und Fidschi, das sei doch ganz normal, meinte er.
Die 180 Kilometer lange Busfahrt von Nadi in die Hauptstadt Suva ging über die an der Südküste entlangführende sehr gut ausgebaute Queens Road, die sich als landschaftlicher Hochgenuss erweisen sollte: Serpentinen oberhalb des blauen Meeres, von Urwald bedeckte Vulkanberge, hohe Kokospalmen, riesige „Farnfamilien“, einsame Buchten und Fischerdörfer sowie ein traumhaft schönes Wetter. Im freundlichen Travel Inn, das ein Australier sein Eigen nennt, fanden wir Unterschlupf und wunderten uns zunächst über das eisengitterverrammelte Office. In Suva müsse man sich vor Dieben und Räubern schützen, die Stadt sei besonders nachts gefährlich. So und ähnlich hörten wir’s immer wieder, wobei betont wurde, dass es praktisch nur die Natives seien, die kriminell wären. Wirklich nur die Fidschianer? Und in der Tat fühlten wir uns hauptsächlich in der Markt- und Hafengegend unsicher, an Orten also, die von den Indern nicht dominiert werden und wo wir das freundliche „Bula!“ kaum zu Gehör bekamen. Nachts und auch am folgenden Tag regnete es fast ununterbrochen; die sogenannte Dry Season ist also auch hier nicht mehr das, was sie vorgibt zu sein.
Unser erstes Ziel war der nahegelegene Regierungskomplex, ein tiefgraues Monstrum mit Clock Tower und kleinem Park, in welchem die lebensgroße Statue des Ratu Sri Lula Sukuno (1888 – 1958) zu bewundern ist. Dieser Mann im Rock und ordensbehangenem Frack wird laut Inschrift als Staatsmann, Soldat, Häuptling und Menschenführer hoch verehrt. Bemerkenswert ist, dass man hier nirgends einen Wachposten zu Gesicht bekommt beziehungsweise sich als Fremder völlig frei bewegen kann.
Ein Muss ist das Fidschi-Nationalmuseum im Thurston Park (T. war britischer Gouverneur von 1888 bis 1897), der jedoch völlig vernachlässigt ist: Wege kaputt, Pflanzungen sind schon seit Jahren sich selbst überlassen und Zivilisationsmüll allenthalben. Umso sehenswerter sind die Exponate, von denen nur die wichtigsten erwähnt werden sollen: Ozeantaugliche Katamarane, von denen die „Waga tabu“ bis zu 100 Besatzungsmannen benötigte, um rund 300 Passagiere und Fracht durch die Hochseegewässer bugsieren zu können. Auffällig auch die lebensgroße Häuptlingsfigur, die um 1875 der deutsche Ethnologe Theodor Kleinschmidt schuf, um zu zeigen, welch prächtige Gewänder sich die Chiefs anlässlich großer Zeremonien anzulegen pflegten. Auch heute noch überall zu sehen sind die typischen Haartrachten, die früher jedoch außerordentlich phantasievoll kreiert wurden, heute ist man da bescheidener, wie Fotos von damals und neuere zeigen. Furchteinflößend sind riesige, teils sehr aufwendig geschnitzte Kriegskeulen, die keinen Getroffenen überleben ließen. Ein dunkles Kapitel ist auch der ab 1820 von Amerika und Britannien betriebene Walfang, gegen den Greenpeace immer noch weitgehend vergeblich ankämpft, vor allem gegen die japanischen Fangunternehmen.
Wie es sich für eine Hauptstadt gehört, hat auch Suva historische Bausubstanz aufzuweisen, wie die City Library, die Old Town Hall, die Secret Heart Cathedral, das Tourist Information Bureau sowie ein paar Kolonialgebäude, die vornehmlich aus Holz bestehen. Kaum fotogen sind dagegen die moderne Reserve Bank (ist das höchste Gebäude Suvas) und das kilometerweit außerhalb der Stadt liegende Neue Parlament, das man zwar schon auf den 20er Scheinen sieht, dessen Inneres aber noch unbelebt ist. Der Coup von 1999 hatte wohl die Fertigstellung verzögert.
Unweit dieses repräsentativen Bauwerkes, das der Architekt dem traditionellen Stil angepasst hat (hohe Dachform), trafen wir zwei Inderinnen, deren Familien bereits in der 6. Generation hier ansässig sind. So wurde uns berichtet, dass nach dem letzten Coup mit zehn Toten schon viele Inder Fidschi verlassen hätten, und dieser Trend werde sich fortsetzen, wenn der indischen Bevölkerungsmehrheit bestimmte politische Rechte nicht wieder eingeräumt werden sollten. Eine befriedigende Lösung ist also nicht in Sicht, zumal die Fidschianer offensichtlich nicht daran denken, den Indern weitere Zugeständnisse zu machen. Kann das ohne künftiges Blutvergießen bleiben? Im Übrigen fällt jedem Fremden besonders hier in Suva auf, dass viele Fidschi-Männer offensichtlich Wert darauf legen, als Gewichtheber- und Seeräubertypen Eindruck zu machen, was den kultivierten Indern naturgemäß zuwider ist.
Die zirka 280 Kilometer lange Kombifahrt Bus – Ferry – Bus by Patterson Brothers nach Labasa auf der Insel Vanua Levu wird uns wohl lange in Erinnerung bleiben, zumal sie 14 Stunden dauerte. – Unsere Nacht war schon um 4 Uhr zu Ende, wir gingen mit ziemlich gemischten Gefühlen zum Bus-Terminal und warteten schließlich zusammen mit anderen Passagieren auf den zum Hafen fahrenden Bus. Nun erlebten wir wieder einmal sogenanntes Dritte-Welt-Chaos: Das Vehikel wurde mit Passagieren (90 Prozent Inder) und viel Gepäck vollgepfercht und startete verspätet erst gegen 5.30 Uhr. Schnell hatte die geteerte Straße aber ein Ende, so dass es nur noch auf schmaler Urwaldpiste bis zur Fähre „Princess Ashika“ weiterging, die kurz vor 8 Uhr ablegte, um direkten Kurs auf die Nachbarinsel zu nehmen.
Der ständige Nieselregen verhinderte bald die Sicht sowohl auf Viti Levu als auch auf Vanua Levu, so dass der Vatu-i-Ra-Channel wie die hohe See wirkte. Übrigens hatten wir uns einem in Japan ausgemusterten Seelentröster anvertraut, der jedoch seine Sache gut machte. Drüben gegen 11.30 Uhr angekommen war sofort zu sehen, dass diese Insel nicht nur in ihrer infrastrukturellen Entwicklung bei weitem noch nicht das Niveau von Viti Levu erreicht hat. Wir wateten im Matsch und hatten Mühe unseren Bus zur Weiterfahrt zu finden, wollten wir doch zunächst nicht glauben, bei diesem Nieselwetter in einem Vehikel ohne Fensterscheiben und auf blankem Holz sitzen zu müssen, aber so war’s!
Weiter ging es auf glitschiger Matschpiste durch eine bergige Urwaldgegend, bis an einer der Steigungen passierte, was passieren musste: Unser Bus blieb im tiefen Matsch stecken, und zig Versuche des Fahrers scheiterten, das Fahrzeug wenigstens ohne Passagiere wieder flott zu machen. Wir gingen zu Fuß bis zu einem hinter der Steigung postierten Bus weiter, und nicht nur wir fragten uns, was wohl geschehen wäre, wenn dieser „Anschluss“ nicht rein zufällig zur Verfügung gestanden hätte. Ziemlich verdreckt waren wir alle, aber es ging jetzt wenigstens bis zum nächsten Problem weiter. Plötzlich drohte nämlich der kochende Kühler zu explodieren, so dass wegen des dichten Wasserdampfes kaum die Sitznachbarn zu sehen waren. Nach langer Kühlarbeit (Wasser wurde aus einer Quelle geschöpft) erreichten wir dann den sogenannten Highway, der diese hochtrabende Bezeichnung jedoch völlig zu Unrecht trägt, ist die viel zu schmale Bergstraße doch nur teilweise geteert, größtenteils also wiederum Piste. Gegen 18.30 Uhr hatten wir endlich Labasa erreicht und uns ins freundliche Centerpoint Hotel einquartiert, dessen indischer Besitzer sogar mit sich handeln ließ. Unsere Welt war wieder in Ordnung.
Labasa ist ebenfalls eine indische Hochburg und zugleich die zweitgrößte Stadt Fidschis. Wenn man hier auch keine touristischen Besonderheiten zu Gesicht bekommt, so lohnt sich auf jeden Fall der Besuch des Sangam-Tempels, in welchem just am heutigen Pfingstsonntag die Schluss-Zeremonie des Tisi-Brahmatsaram-Tirunaat-Festes, das Final Arati, abgehalten wurde. Als man uns Fremdlinge entdeckte, lud man uns spontan zur Teilnahme ein, auch das Fotografieren wurde ohne Umschweife erlaubt.
So erlebten wir eine Festlichkeit, die uns gedanklich wieder ins ferne Indien versetzte: Die lebensgroßen Götterfiguren von Vishnu, Lakshmi und anderen wurden von Priestern mit heiligem Wasser, mit Öl und Milch gewaschen – stets begleitet von lauter, eintöniger Tempelmusik und Gebeten. Schließlich kreisten Ölfeuer um die Götterfiguren, bis die Priester ihre Hochheiligen wieder einkleideten. Einschließlich der Feuer-Zeremonien in einem benachbarten Opferraum und der Tempel-Prozession dauert ein solches Final Arati stundenlang! Am Rande erfuhren wir, dass diese Hindugemeinschaft einen der Ihren für sechs Monate zur Ausbildung nach Indien geschickt hatte, der heute der Oberpriester hier ist. – Wer die „fremden Inder“ in Fidschi erlebt und sieht, wie intensiv und unbeirrt sie ihrer Religion huldigen, wird jeden deutschen Integrationsgedanken verwerfen, zumindest bezogen auf Hindus und Moslems.
Wer den kulturellen Kontrast liebt, kommt auch in Labasa auf seine Kosten. Am Stadtrand residiert in der Jane-Moschee das Muslim Head Quarter, und in einem Kino predigten in Begleitung leichter Musik christliche Sektierer, die sich freuen, wenn sie von ihren Anhängern mit lebhaftem Beifall bedacht werden. Wir waren mitten drin! Draußen patrouillieren Polizisten in weißen Spitzenröckchen, und Spaziergänger vergleichen Kaufkonditionen: 3,18 Fidschi-Dollar wöchentliche Rate beim Erwerb einer Esszimmer-Garnitur, 8,68 Fidschi-Dollar Wochenrate für einen Sony-TV.
Wie verwurzelt der Hinduismus in Fidschi ist, erlebten wir im zehn Kilometer von Labasa entfernten Cobra Rock-Tempel Naag Mandir, einem Schlangenheiligtum, dessen religiöse Bedeutung weit über die Inselrepublik hinausreicht. Bevor wir uns aufmachten, diesem Heiligtum einen Besuch zu machen, trafen wir mit einer Inderin zusammen, die Stein und Bein schwor, dass das „Cobra-Rock-Phänomen“ der absoluten Wahrheit entspreche. Als sie noch Kind gewesen sei, habe die Höhe des aus dem vulkanischen Boden wachsenden Felsens in der Form eines Schlangenkopfes nur einen halben Meter betragen, und heute messe dieser „göttliche Felsen“ fast drei Meter. Für die Hindus steht daher fest: Hier zeigt sich eine lebende Gottheit! Als wir – völlig ungehindert – dieses bizarre Felsheiligtum umrundeten und die Gläubigen bei ihren symbolischen Handlungen beobachteten, wurde uns die große Bedeutung des Hinduismus in Fidschi vollends bewusst. Und so überraschte nicht, dass sogar Inder aus Übersee, auch aus Indien selbst, bis hierher reisen, um der „lebenden Cobra-Gottheit“ die gebührende Ehre zu erweisen.
Abfahrt unseres Direktbusses morgens gegen acht Uhr nach Savusavu, der wichtigsten Hafenstadt an der Südküste von Vanua Levu. Mit uns viele Kinder, die auf dem Weg zu ihren Schulen waren – ausnahmslos sauber und sich ordentlich benehmender Nachwuchs. Geradezu dramatisch schön sind die weiten Landschaften, die man auf seiner Fahrt quer über die zentralen Bergketten erlebt: kurvenreiche schmale Straße, deren Zustand oft aber zu wünschen übrig lässt, wolkenverhangene, urwaldbewachsene und kaum zugängliche Täler und Berge, deren Gipfel bis über tausend Meter hoch sind (Nasorolevu, 1.032 Meter); große Kiefernwälder, hohe Bambusbüsche und Riesenfarne.
Während die Stadt Savusavu selbst kaum etwas Sehenswertes bietet, ist sie dennoch ein touristischer Anziehungspunkt, vor allem für Segler und Sportfischer. Eine wahre Augenweide ist der Anblick der Hafenbuchten, die von gegenüberliegenden bergigen Inseln umfasst sind und den vielen Booten hervorragenden Schutz bieten. Weniger erbaulich sind die zahlreichen windigen Typen – ob alt oder jung –, denen man hier aus dem Weg gehen sollte.
Nach einem zunächst vergeblichen Anlauf für die Garteninsel Taveuni Bus-Fähr-Tickets zu bekommen (ausgebucht), gelang dies schließlich bei der Konkurrenz „Beachcomber“, doch da mussten wir eine mitternächtliche Abfahrt akzeptieren. Es war gegen 1 Uhr, als unsere „Adi Savusavu“ gen Waiyevo in See stach. Dabei handelt es sich um ein ausgemustertes dänisches Fährschiff der Scarlett Line, das aber immer noch einen zuverlässigen Eindruck macht. Nach fest durchschlafener Nacht erreichten wir den Zielhafen morgens gegen 6.30 Uhr und quartierten uns im Kaba’s Motel ein, das sich in Somosomo befindet. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass wir Taveuni wegen der angeblich exorbitant hohen Unterkunftspreise eigentlich meiden wollten, doch da wären wir beinahe unserem Lonley auf den Leim gegangen!
Das Örtchen Waiyevo ist die sogenannte Hauptstadt dieser Insel, bietet zwar nichts Sehenswertes, aber dennoch etwas ganz Besonderes, weshalb nicht zuletzt viele Touristen ihren Weg nach Taveuni nehmen. Wir machten uns zu Fuß auf, um weit oberhalb der Küstenstraße zu erleben, was Höhere Geographie in der Praxis bedeutet. Die kleine Insel wird von Nord nach Süd nicht nur von der internationalen Datumslinie durchzogen, sondern gleichzeitig auch vom 180. Längengrad, was es tatsächlich nur hier gibt. Das bedeutet Folgendes: Steht man auf dieser „Doppellinie“ mit Blick nach Norden, befindet sich das rechte Bein im Westen bzw. im Gestern und das linke im Osten bzw. im Heute, die Uhrzeiten und Daten sind auf dieser Insel jedoch gleich(gemacht). Alles klar?
Nur auf Waiyevo steht man gleichzeitig im Gestern und Heute, in Ost und West!
Der größere Nachbarort von Waiyevo ist Somosomo, ein Ziel, das man über eine schmale Staubstraße erreichen kann, doch dieser Staub hatte sich aufgrund unangenehmen Nieselregens in eine Schlammpiste verwandelt. Auch hier gibt es kaum Sehenswertes, da sich selbst die historische kleine Dorfkirche in unwürdigem Zustand befindet. Stattdessen kann man einen neuen, sehr großzügigen hölzernen Kirchenkomplex bewundern, der sich in einem gepflegten Park befindet. Die beiden Schulen machen einen intakten sauberen Eindruck, wie auch die Kinder und Lehrkräfte selbst: Schulkleidung ist obligatorisch, Freundlichkeit selbstverständlich und Offenheit normal. Weit weniger erfreulich war unser Besuch bei der einzigen Bank auf dieser Insel: Deutsche Mark (sprich Euro) wird mit der offiziellen Begründung nicht akzeptiert, bei ihr handele es sich um eine weiche Währung! Diese Enttäuschung, die sich bei uns bis zur blanken Wut steigern kann, erlebten wir hier in Somosomo übrigens nicht zum ersten Mal auf Reisen. Irgendwie passt dazu, dass die hiesigen Inselbewohner das ferne Mitteleuropa als das Ende der Welt ansehen (bei Null beziehungsweise Greenwich hört alles auf) und sich selbst als den Mittelpunkt derselben betrachten …
Die Busfahrt nach Bouma an der Südküste Taveunis gelegen verlief alles andere als reibungslos, denn schon nach fünf Kilometern gab der überalterte Motor seinen Geist auf, warten auf Ersatz. Doch auch dieses Vehikel gab mittendrin auf, der Fahrer klemmte sich seine Holzschatulle unter den Arm und verschwand wortlos – ließ seine Passagiere einfach auf der Urwaldpiste im Stich. Wir hatten Glück im Unglück und wurden von einem Kombi mitgenommen, dessen einziger Passagier sich als Schulbeamter auf Dienstreise vorstellte.
Bouma zeichnet sich lediglich dadurch aus, dass sich hier der wohl schönste Nationalpark Fidschis befindet, der vor dem Coup von jährlich rund 4.000 Touristen aufgesucht wurde, jetzt liegt der Durchschnitt weit darunter. Das bekommen vor allem jene vier Dörfer zu spüren, die sich die relativ hohen Eintrittsgebühren teilen.
Nun erlebten wir tropischen Urwald pur, das ist eine einzige Natur-Orgie, in der alle wie in einem Konzert mitspielen: Palmen, Farne, Sträucher, Orchideen, Lianen, Wasserfälle, Vögel, Lurche, Spinnen und angeblich ungefährliche Schlangen. Besonders reizvoll sind die Wasserfälle, von denen wir den größten und schönsten erreichten. Die Wassermassen stürzen dreißig Meter in einen tiefen Pool – inmitten dichtesten Urwaldes! Der zweite Wasserfall, der sich weiter oben in den Bergen befindet, blieb leider unerreichbar, weil barfüßig und auf glitschigen Steinen ein reißender Gebirgsbach zu meistern gewesen wäre, was wegen der derzeitigen Wassermengen (viel Regen!) nicht möglich war. Doch es gab Entlohnung, sind doch die Blicke in Richtung bewaldeter Berge einerseits und hinunter auf die Gewässer der Nanuku-Passage anderseits traumhaft schön.
Hocherfreut, dass es uns wider Erwarten möglich war die Garteninsel Taveuni zu besuchen, traten wir die lange Rückreise via Savusavu per „dänischer Fähre“ namens „Adi Savusavu“ an. Wir ergatterten zwar die selben Sitze, die wir auf der Hinfahrt schon einmal hatten, aber ansonsten wurde es ungemütlich, weil vollgepfercht mit ziemlich primitiven Leuten (Arbeitern, Fischern etc.), die übers Wochenende zu ihren Familien fuhren, und außerdem spielte das Wetter verrückt: Viel Regen, steifer Wind und hoher Wellengang, das war nichts für schwache Nerven und Mägen! Regelrecht verärgert reagierten wir auf primitive US-Videos, deren kulturelles Niveau zwar bei weit unter Null liegt, doch das stört weder große noch kleine Fidschianer, im Gegenteil. – Bis Savusavu benötigte die Fähre fünf Stunden, und nach einer langen Anlegepause noch einmal elf Stunden bis Suva.
Da sich das Wetter gottlob sehr gebessert hatte, verbrachten wir noch einmal zwei Tage in Suva, war doch Fidschis Hauptstadt bei unserem ersten Aufenthalt etwas zu kurz gekommen. Viel Neues gab es zwar nicht mehr zu entdecken, und dennoch kam keine Langeweile auf. Wir bummelten über den riesigen Markt zum Hafen, wo unsere Gedanken wieder einmal Anlass hatten nach Asien zu schweifen. Es ankerten gerade zwei kleine Frachter aus Kao Hsiung/Taiwan, aus jener Stadt also, von der wir im Herbst 1992 per „MacMao“ nach Macao ausgelaufen waren. China ereilte uns auch im modernen Harbour Center, wo gerade eine eindrucksvolle Fotoausstellung über Chinas kulturelle Highlights in den westlichen Provinzen gezeigt wurde. Schließlich trafen wir im Garten des Holiday Inn-Hotels auch noch eine 72-jährige chinesische Oma, deren Fitness bewunderungswert ist: Sie lehre immer noch Musik und radele täglich bis zu zwei Stunden. Und als Hildegard auf dem Markt einkaufen ging, staunte sie über das angebotene Gemüse (sogar Radi gibt’s!) – angebaut und verkauft von Chinesen. Fidschi und China – ein interessantes Kapitel für sich! – Eine ganz andere Welt ist der 1924 gegründete Bowling Club, der im pazifischen Raum, insbesondere in Neuseeland und Australien, schon viele Pokale eingeheimst hat, beispielsweise eine silberne Riesen-Ananas in den 30er Jahren. Derzeitiger Club-Präsident ist natürlich ein Inder, während die übrigen „Sportler“ überwiegend old british sind oder sich nur so geben, wie einigen neureichen Fidschianern anzusehen ist.
Von unserem nächsten und letzten Reiseziel Vunidawa hatten wir uns etwas mehr versprochen, handelt es sich doch um das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Distriktes. Was sich wirklich gelohnt hat, war die lange Busfahrt auf kurvenreichen Pisten durch eine immergrüne, meist urwaldbedeckte Berglandschaft. Als uns bedeutet wurde, hier sei Vunidawa, stiegen wir aus und wunderten uns, vom Ort praktisch nichts zu sehen. Tatsächlich machten wir nur eine Schule, eine kleine Poststation und einen Polizeiposten aus, bis wir erfuhren, dass sich Vunidawa aus mehreren winzigen Villages zusammensetzt, die weit verstreut im Distrikt liegen.
Nachdem wir die Schule besucht und erfahren hatten, dass die 200 SchüleriInnen zweimal wöchentlich und eigenhändig ihr weites Terrain im Schweiße ihrer Angesichter säubern müssen (sogar Macheten gegen Unkraut kommen zum Einsatz!), machten wir uns auf, zwei der sogenannten Streusiedlungen per pedes zu erreichen, die zwar etwas enttäuschten, weil außer primitiven hölzernen Wohnhütten es nichts zu sehen gibt, aber wir trafen auf freundliche Landmenschen, die bass erstaunt waren, „Besuch vom anderen Stern“ bekommen zu haben. Doch bis vor zwei Jahren dürften sich diese Bewohner selbst noch außerhalb unserer Welt gefühlt haben, gibt es die Urwaldstraße und Strom doch erst seit zwei Jahren. Zuvor war eine Zweitagesreise per Bambusboot auf dem Wainimala River erforderlich, um den nächsten größeren Ort Nausori bzw. das Meer zu erreichen.
Abermals hatten wir das Vergnügen, per Express-Bus via Queens Road von Suva nach Nadi zu fahren – ein landschaftlicher Hochgenuss: tiefblaues Meer, üppig grüne Berge, Kokospalmen an weiten Stränden und in der Ferne kleine Inseln. Zu diesem Vergnügen gehörte auch, dass es auf Fidschis Straßen ein nationales Speed Limit gibt, das bei 80 Kilometern pro Stunde liegt und besonders von Busfahrern streng eingehalten wird. Kein Wunder, dass wir nicht einen einzigen Verkehrsunfall zu Gesicht bekamen.
Die Abfertigung für unseren Flug nach Tongatapu verlief diesmal nicht ganz unbeanstandet, entdeckten die Röntgenaugen doch unser unentbehrliches Kitchen Knife, das ob seiner Länge von angeblich 12 Inch beziehungsweise 30,5 Zentimetern als Gepäckinhalt nicht zugelassen wurde und versiegelt dem Kapitän übergeben werden musste. In Wirklichkeit ist dieses Küchenmesser nur 7 Inch beziehungsweise 18 Zentimeter lang, so dass wir Zweifel haben, ob die fidschianischen Sicherheitskräfte mit dem englischen Inch-Maß umgehen können, doch auf Protest haben wir lächelnd verzichtet.
Massige Leiber und „Stonehenge“Königreich Tonga
Und wieder sollten sich alte Jugendträume erfüllen, denn nun lag als Reiseziel Tongatapu – das Heilige Tonga – vor uns, das heutzutage nicht nur für heilig gehalten wird; denn immer noch spielen geheimnisvolle mystische Geschichten eine bedeutende Rolle, die von altersher erzählt oder auch neu erfunden werden – ungeachtet der Tatsache, dass zumindest offiziell die Christianisierung längst abgeschlossen ist. Schriftsteller und Maler, wie Stevenson, Conrads und Gouguin, haben dies künstlerisch zu gestalten gewusst und dafür gesorgt, dass die „alte Südsee“ quasi unsterblich wurde.
Wie bei Fidschi geht die Historie auf die sogenannten Lapita-Töpfer zurück, deren Ankunft im Jahr 1140 v. u. Z. passiert sein soll. Bis 950 n. Chr., also rund 2.000 Jahre lang, dämmerte das Inselreich zwischen Fidschi und Samoa gelegen nur so dahin, bis es der Gottheit Tangaloa gefiel einen Sohn zu zeugen, der als erster Tu’i Tonga bzw. Priesterkönig den Beginn des heute noch herrschenden Königshauses markierte.
Als sich im 17. Jahrhundert der Holländer Abel Tasman aufmachte und 1643 den südlichen Teil des Archipels entdeckte und Amsterdam nannte, verfügte er bereits über ein paar Seefahrer-Informationen aus dem Jahr 1616. Ihm folgte Cpt. James Cook, der zwei Reisen nach Tonga unternahm (1773 und 1777) und wegen der Freundlichkeit der Tonganer den Namen „Freundschaftsinseln“ vergab. – Ein für Tonga epochales Ereignis war die Ankunft der ersten Missionare, ausgesandt von der London Missionary Society im Jahr 1797, denen es gelang, 1834 die erste Taufe eines Hochadeligen, Taufa´ahau, zu vollziehen, dem teils freiwillig, teils unter Zwang die meisten Tonganer folgten. Seitdem ist Tonga „hochchristlich“, wovon später noch die Rede sein wird.
Politisch folgte 1876 ein Freundschaftsvertrag mit Deutschland (Sicherung eines Kohlenhafens zur Versorgung der Handelsschiffe) und drei Jahre später ein ähnlicher Vertrag mit England, doch es geriet Sand ins Getriebe, so dass es König Tupou I. vorzog, 1885 die von der englischen Mutterkirche unabhängige Free Wesleyan Church of Tonga zu gründen. Doch England erwies sich als stärker (oder politisch geschickter) und erlangte 1899 einen Protektionsvertrag, der Tonga praktisch zur Kolonie machte, nachdem Deutschland zugunsten von Samoa verzichtet hatte. 1918 bis zu ihrem zutiefst betrauerten Tod 1965 hatte Königin Salote III. das königliche Zepter in ihren Händen, eine intelligente, umsichtige und allseits beliebte Frau, die zahlreiche Reformen bewirkte (unter anderem 1960 das Wahlrecht für Frauen einführte) und Söhne gebar, wovon der älteste bis dato regiert: Taufa´ahau Tupou IV., der weltweit als Vierzentner-Monarch wohlbekannt ist. 1970 erlangte Tonga die völlige Unabhängigkeit.
Auf Tonga sind massige Leiber allgegenwärtig
Wäre das Lesen alter Lexika nicht eines meiner Hobbys, wüsste ich beispielsweise nicht, dass man noch um 1880 die Tonganer für herzlich, offen, aber doch kriegslustig und streitbar gehalten hat (zur Strafe wurden sie deshalb von siegreichen Fidschianern mit großem Appetit verspeist!). Außerdem wusste man damals schon, dass deren Bildung bereits vor der Missionierung höher war als bei Völkern umliegender Inseln, dass Vielweiberei erlaubt war und die Kinder sorgfältig erzogen werden. Und zu guter Letzt zählte man die Tonganer zu den schönsten polynesischen Stämmen, die Menschen seien groß und stark. Und wir waren gespannt, inwieweit sich die kleine Tongawelt inzwischen verändert hatte.
Unsere Boeing 737-800, die zum Flug nach Tongatapu bereit war, machte zwar einen geräumigen Eindruck, und dennoch kamen uns angesichts der tonganischen Riesenmänner (das sind Kleiderschränke!), überfetten Frauen und Kindern erhebliche Bedenken, ob sie von der Startbahn würde abheben können. Sie schaffte es, allerdings erst nach sehr langem Anlauf! Um es vorweg zu nehmen: Nirgends auf der Welt hatten wir bisher derart massige Menschen zu Gesicht bekommen, wie in Tonga, und von besonderer Schönheit sind sie auch nicht, denn die Regel sind wuchtig-fette Typen. Mit ihnen konkurrieren können nur noch die überfütterten Schwarzen in Puerto Rico.
Als unser Flug nach etwa einer Stunde zu Ende war beziehungsweise wir sicher auf der Piste des internationalen Flughafens Fua´amotu auf Tongatapu aufgesetzt hatten, wäre uns beinahe hörbar ein Stein vom Herzen gefallen. – Da auch Tonga von deutschen Touristen keine Visa verlangt, war die abendliche Abfertigung schnell erledigt, und im Nu saßen wir in einem Kombi mit Ziel Toni’s Guest House, wo wir uns für ein paar Tage einzuquartieren gedachten. Toni ist übrigens ein 7-jähriger sehr cleverer Knirps, der für seine geschäftstüchtigen Eltern die Vorarbeit leistet, nämlich das Abfangen ankommender Touristen.
Wir sind ja allerhand gewöhnt, doch diese Bleibe mit stinkender Toilette nebenan konnte nur die Notlösung für die erste Nacht sein. Also machte sich meine tapfere Hildegard auf, um noch am selben Abend und bei strömendem Regen nach einer Alternative zu suchen – mit Erfolg, so dass wir am Tag darauf ins wesentlich angenehmere und auch freundlichere Sela´s Guest House umziehen konnten, wo wir uns acht Tage lang wohlfühlten. Dank der gütig gestimmten Chefin war es sogar möglich, den Übernachtungspreis um ein Drittel zu reduzieren, so dass für beide Seiten die Welt wieder in Ordnung war. – Toni´s Guest House war jedoch insofern nützlich, als wir dort erfuhren, dass Tonga nicht ungefährlich ist: Weiße Frauen sollten keinesfalls alleine durch Tonga touren, da die Vergewaltigungsgefahr sehr hoch sei und man praktisch keine Chance habe, den männlichen Kleiderschränken zu entkommen. Wir hörten Beispiele, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen. Tonga „hochchristlich“?
Die Hauptstadt des Königreiches ist Nuku’alofa, deren Name wohl nur im Südpazifik geläufig ist. Sie ist durchaus von touristischem Interesse, sofern man sich die Zeit nimmt etwas genauer hinzusehen. – Auf unseren Erkundungsgängen „entdeckten“ wir zunächst die Queen Salote Memorial Hall, einen modernen Veranstaltungskomplex, der natürlich, wie alles halbwegs Bedeutende, von HM Taufa`ahau Tupou IV., dem gewichtigsten Monarchen der Welt, 1995 eröffnet wurde. Eine Tafel lehrt, das Salote, die Mutter des amtierenden Königs, von 1918 bis 1965 regierte und dass die Republik China bzw. Taiwan zusammen mit der Regierung von Tonga dieses aufwendige Bauwerk finanziert haben.
Weiter Richtung Hafen gehend kommt man an der hochmodernen Basilica of St. Anthony of Padua von 1980 vorbei, deren Mittelteil den Eindruck einer mehrstufigen Weltraumrakete (der Zukunft) macht. Gegenüber befindet sich das weite Gelände neuerer Königsgräber ab zirka 1850 (tabu für Fremde) sowie die schmutzig-graue natursteinverkleidete Free Wesleyan Church, die mit ihren klobigen Türmen zwar einen historischen Eindruck macht, aber erst 1985 ihrer Bestimmung übergeben wurde. Eine Tafel erinnert daran, dass es König Siaosi Tupou I. war, der am 6. Januar 1895 die Free Wesleyan Church of Tonga ins Leben gerufen hatte. Leider macht dieses Gotteshaus einen ziemlich vernachlässigten Eindruck – warum?
Dagegen kann sich die Bevölkerung über ihr bestens restauriertes Rathaus freuen, das wohl noch aus der englischen Kolonialzeit stammt. Ein Schild am Eingang weist mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass dieses öffentliche Gebäude nur mit einem Ta´ovala, der traditionellen Hüftbekleidung, betreten werden darf. Das sind in der Regel geflochtene Bastmatten, die von Generation zu Generation vererbt werden (je älter und kaputter, desto wertvoller!), aber man sieht bei Frauen auch schon stilisierte Ta´ovalas, die eigentlich nur noch dezenter Hüftschmuck sind, zum Beispiel bei weiblichen Angestellten der Staatsbank. Weltweites Aufsehen hatte 1953 Königin Salote III. auf sich gezogen, als sie sich zur Krönungsfeierlichkeit für Elisabeth II. mit einem 600 Jahre alten Ta´ovala in der Öffentlichkeit gezeigt hatte.
Der Hafen Nuku’alofas ist auffallend geschäftig, wohl mit ein Grund dafür, dass es sich auch ausländische Kriegsflotten nicht nehmen lassen, hier besuchsweise vor Anker zu gehen. So erlebten wir zufällig den Besuch eines kanadischen Zerstörers mit Heimathafen Vancouver, dem auch der australische Botschafter nebst Gattin die Ehre erwies. – Apropos Botschaft: Die chinesische Botschaft liegt an der Hafenpromenade und strotzt vor Großzügigkeit, Solidität, Modernität und Sauberkeit, obwohl es im Königreich Tonga vermutlich weniger Rot-Chinesen als Diplomaten aus Peking gibt, dafür aber zahlreiche Taiwan-Chinesen, die sich wohl beschützt und vor allem von Festland-China vertreten fühlen sollen. Wahrscheinlich ist dies auch notwendig, haben sich doch alle chinesischen Geschäftsleute, die an fast jeder Ecke ihre Läden betreiben, hinter einbruch- und diebstahlsicheren Eisengittern zurückgezogen.
Dagegen wirkt das deutsche Honorarkonsulat, das in einer schäbigen Bretterbude untergebracht ist, recht erbärmlich. Betritt man die ziemlich chaotisch wirkenden Amtsräume, wird es geradezu heimisch, denn es grüßen die weiß-blauen bayrischen Rauten und natürlich auch der schöne König Ludwig II. Dass die Sekretärin keines einzigen deutschen Wortes mächtig ist und uns danach fragte, ob Bayern ebenfalls ein Königreich wie Tonga sei, haben wir ihr angesichts der Liebe ihres Chefs zu Bayern gern nachgesehen.
Dass in Tonga auch die Katholische Kirche vertreten ist, versteht sich von selbst, und zwar bereits seit 160 Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums hatte es sich der König nicht nehmen lassen, am 8. Dezember 1992 die etwas außerhalb liegende Marien-Kathedrale ihrer Bestimmung zu übergeben.
Auf dem Weg zurück in die Stadt gab es noch eine kleine Überraschung, denn am Kai hatte ein einheimisches Ausflugsschiff festgemacht, das wir ohneweiteres besichtigen durften. Das ist zwar nichts Besonderes, aber diesmal gab es etwas Sehenswertes, denn des Königs beleibter Sohn gehörte mit zu den erlauchten Ausflugsgästen, der sich offensichtlich unbewacht bzw. als „normaler Passagier“ bewegte und natürlich die ganze Gangway benötigte, strebt er doch das Lebendgewicht seines Vaters an. Nicht so ungehindert ist der Zugang zum fotogenen Königspalast möglich. Man kann dieses relativ kleine Domizil zwar aus einer gewissen Entfernung gut sehen und auch fotografieren, aber für Fremde ist der vorgelagerte Park als auch der Palast selbst tabu.
Die althistorische Stätte Heketa im äußersten Osten Tongatapus per Bus zu erreichen, ist kein Problem, wie überhaupt das Busfahren hier ein Leichtes ist, sofern man in Kauf zu nehmen bereit ist auf Holz zu sitzen, also auf jeden Fahrkomfort zu verzichten. Landschaften wie erwartet: Kokospalmen, Bananenstauden, Lagunen, Meer, Inseln und Dörfchen, deren Wohlstand eher ein sehr bescheidener ist: Viel Wellblech, aber eine unverhältnismäßig große Anzahl teils nagelneuer Kirchen und kleiner Friedhöfe stets in Dorfnähe, da es keinen großen Zentralfriedhof auf Tongatapu gibt.
Heketa gilt als zweite historische Hauptstadt Tongas, während sich die erste in der Nähe des heutigen internationalen Flughafens Fua´amotu befunden haben soll. Optischer Mittelpunkt ist der sogenannte Trilithon, ein mächtiges, aus dreißig Tonnen schweren Coral Lime Stones bestehendes freistehendes „Tor“, das man gern mit dem englischen Stonehenge vergleicht.
Das rätselhafte Heketa ist „Stonehenge“ auf Tonga
Weder das Alter von Stonehenge (zirka 12.000 Jahre) noch das von Heketa (zirka 3.000 Jahre) lässt sich genau bestimmen, und vor allem liegt der tatsächliche Sinn und Zweck dieser steinernen Monumente noch völlig im Dunkeln, doch wird beiden Stätten große mystische Bedeutung zugesprochen.
Heketa wurde als Hauptstadt vom 12. Tui`Tonga angeblich deshalb aufgegeben, weil die äußerst raue Vulkanküste keinen Seehandel zuließ. Aber warum wurde denn Heketa an dieser ungünstigen Stelle errichtet? Zu sehen ist außerdem noch ein sogenannter Sitzstein, ebenfalls tonnenschwer und als solcher zwar nicht erkennbar, aber die steinerne „Ummauerung“ lässt zumindest die Spekulation zu, dass es sich hier um einen Versammlungsort gehandelt haben könnte. Geht man den Urwaldweg zur Küste, sind niedrige, meist überwucherte Mauerreste auszumachen, deren einstige Bedeutung ebenfalls nicht geklärt ist.
Den nahen Nachbarort Niutoua erreichten wir zu Fuß. Es handelt sich hierbei um ein unbedeutendes Dorf – bespickt mit meist primitiven Behausungen, mehreren kleinen Kirchen, die auch wochentags belebt sind und einem noch nicht bezogenen Schulkomplex, auf dessen Baustil man in ganz Polynesien trifft – vermutlich eine großzügige ausländische Spende. Wir querten mehrmals dieses „Schweine-Village“ und gelangten so zum kleinen Ortsfriedhof, auf dem wir eine aufschlussreiche Entdeckung machten: Ein üppig gestaltetes frisches Christengrab (zu erkennen an Blumenkreuzen) war mit einem großen gewebten Bild geschmückt, das „Heketa-Stonehenge“ mit dahinter aufgehender Sonne zeigt. Eine Hand weist durch das Tor hin zum Ewigen Leben, ein Beweis dafür, dass Heketas mystische Bedeutung immer noch lebendig ist und mit dem tonganischen Christentum offensichtlich in Einklang steht.
Nicht weniger geheimnisvoll sind die steinernen Plattformen von Lapaha; das sind in Küstennähe errichtete stufenpyramidenähnliche Bauwerke wohl ebenfalls aus prähistorischer Zeit. Keine Information weist auf deren Alter oder auf die Baumeister hin! Wir trauten unseren Augen kaum, als wir gleich drei dieser rätselhaften Ancient Monuments zu Gesicht bekamen, deren Basis mit zirka 35 mal 25 Meter erstaunlich groß ist (abgeschritten) und deren Höhe bei insgesamt etwa drei Metern liegen dürfte. Die am besten erhaltene „Stufenpyramide“ weist drei sich nach oben verjüngende Plattformen auf, die nächste zwei und die dritte schlummert noch unter Erdmassen und tropischem Bewuchs, kann aber erklommen werden. Außerordentlich eindrucksvoll sind die Ausmaße der zig Tonnen schweren Ecksteine an der Basis: Wir maßen grob eine Länge von sechs Metern, sowie eine Tiefe und Höhe von knapp einem Meter. Welchen Sinn und Zweck diese Bauwerke hatten, wer sie errichtete und ob ihr Inneres bereits zur Gänze erforscht wurde – hierüber darf spekuliert werden. – Der Ort Lapaha, dessen christlicher Mittelpunkt die 1894 errichtete eindrucksvolle St. Michael-Kirche ist, macht insgesamt gesehen einen recht verschlafenen Eindruck.
Der zu Fuß zu erreichende Nachbarort Mu`a ist insofern einen Besuch wert, als hier im Jahr 1777 kein Geringerer als Cpt. James Cook auf seiner dritten pazifischen Erkundungsfahrt vor Anker gegangen war. Heute erinnert eine Plakette an dieses historische Ereignis und daran, dass an dieser Stelle einst Cpt. Cook’s Tree, ein Maluma-Lu-ó-Fulilang (ein Banyan-Baum) gestanden hat. Als wir von hier oben die gut überschaubare Bucht sahen, meinten wir, dass Cook wohl keinen idealeren natürlichen Hafen hätte finden können.
Diese ersten Touren ins Inselinnere Tongatapus waren also nicht nur von ein paar handfesten Überraschungen gekennzeichnet, sondern bestätigten, dass diese Insel sehr flach, äußerst üppig bewachsen und von zahllosen, überall frei herumlaufenden Schweinen bevölkert ist. Irgendwelche Probleme mit den Menschen hier hatte es während unseres ganzen Aufenthalts nicht gegeben, zumal es auch keine Bettler gibt und man sonntags sowieso kaum einen Menschen auf der Straße sieht – alles tot, bis auf die Kirchen, die oft den Eindruck von Discos machen und ausnahmslos gut besucht werden.
Besonders bei Gottesdiensten wird deutlich, dass sich die Tonganer auf zwei Hauptebenen bewegen: Auf einer stark emotionalen, sowie auf einer eher geschäftsmäßigen, was sich insbesondere sprachlich bemerkbar mache, wie uns ein junger Amerikaner sagte, der mit einer Tonganerin verheiratet ist. Als wir zu einem Gottesdienst eingeladen wurden, fanden wir dieses Phänomen bestätigt: Sehr emotionale Gesänge und Gebete einerseits und recht sachliche Predigten andererseits. Wir glauben, dass man wohl Jahre in Tonga leben müsste, um diese Lebens- und Verhaltensweisen wirklich verstehen zu können (wie übrigens viele Deutsche, die sich ihren tonganischen Pass für teures Geld gekauft haben und zum Teil schon seit Jahrzehnten hier ihr Zuhause haben).
Der geographische Norden Tongatapus ist durch den Niu´aunofo Point markiert, wo wir das intakte saubere Örtchen Ha´atafu als Reiseziel ansteuerten – ein Muss auf Tongatapu! Hier gibt es nicht nur eine typische Südsee-Beach mit – leider überteuerten – Strandhütten im Land-Stil (nur Bast, Bambus und Trockenblätter), sondern auch Historisches von Rang, jedenfalls für Tonga. Ein schwarzer Marmor-Obelisk hoch über dem tiefblauen Meer erinnert an die Landung der ersten Missionare (Methodisten) am 28. Juni 1826. Am anderen Ende des Dorfes wurde eine zweisprachige Tafel aufgestellt, deren Text auf die Erteilung der ersten Heiligen Kommunion durch Rev. John Thomas am 1. Oktober 1826 hinweist. Dass besonders auch Ha´atafu mit Kirchen reichlich ausgestattet ist, versteht sich also von selbst.
Nun freuten wir uns auf ein Naturschauspiel besonderer Art, auf die berühmten Blow Holes von Houma. Der Ort selbst zeichnet sich durch recht phantasievollen und dennoch sehr einfachen Dorfschmuck aus: Kokosschalen und zurechtgeschnittene Autoreifen sind bunt bemalt und verschönern somit die triste Optik. Der eigentliche Anziehungspunkt ist jedoch die naheglegene, äußerst schroffe Vulkanküste, an der es auf einer Länge von mindestens zwei Kilometern zischt und brodelt. Hier tobt sich der Pazifische Ozean aus, der – ohne je zu ermüden – ununterbrochen an die Küste schwappt und in Jahrtausenden von unten her das Vulkangestein zigfach durchlöchert hat. Folglich werden bei jeder größeren Brandung und unter grollendem Getöse zehn bis fünfzehn Meter hohe Fontänen gen Himmel gepustet – ein außerordentlich eindrucksvolles Schauspiel, das wir zwei Stunden lang bewunderten.
Unser letztes Ausflugsziel auf Tongatapu war das Village Fua´amotu unweit des gleichnamigen internationalen Flughafens. Hier herrscht beinahe ländliche Beschaulichkeit, der Flugbetrieb ist äußerst bescheiden. Weniger bescheiden ist dagegen das Flughafengebäude mit allen erforderlichen Nebeneinrichtungen selbst, denn hier wollte Japan protzen: Der Airport wurde 1991 von der japanischen Regierung gespendet! – Der naheglegene Ort Fua´amotu ist absolut kein touristisches Ziel, wenngleich gesagt wird, in dessen Nähe habe sich einst die erste Hauptstadt Tongas befunden. Auffallend sind die netten Schulkinder, und optisch fällt eine sehr moderne Kirche ins Auge, deren blendend weißes Dach in Form eines riesigen Schirmes unübersehbar ist. Hier wird am Tag des Herrn – sonntags – natürlich besonders innbrünstig gesungen und gebetet, zumal – aus biblischen Gründen – sogar dem benachbarten Flughafen absolute Sonntagsruhe verordnet wurde.
Per gemütlichem local bus ging’s am Tag unserer Weiterreise nach Samoa wieder bis zu diesem Airport, allerdings an einem Donnerstag, wir schrieben den 21. Juni. Abfertigung kein Problem, sogar unser geliebtes Kitchen Knife wurde zwar gesichtet, habe jedoch, so die Sicherheitsfrauen, längst nicht das verbotene Maß: „Klinge zu kurz, um das Herz des Kapitäns zu treffen!“ Es stimmt wohl doch, was die Autoren alter Lexika schon vor hundert Jahren konstatierten: Die Bildung der Tonganer übertreffe die der benachbarten Stämme, die heute offensichtlich wissen, dass ein Inch 2,54 Zentimeter hat, unser Messer nach fidschianischer Rechenkunst also gut 30 Zentimeter lang sein müsste, aber mitnichten!
Nur 19.921 Kilometer bis zum Deutschen KaiserUnabhängiger Staat Samoa-West
Diesmal hatten wir keine Bedenken, dass unsere Boeing wegen menschlicher Doppel- und Dreifachgewichte nicht von der Piste würde abheben können, sind doch die Samoaner vergleichsweise weniger beleibt als ihre tonganischen Nachbarn. Und doch erblickt man auch auf den Samoa-Inseln viel mehr Übergewichtige, als es aus der Sicht Gesundheitsbewusster eigentlich geben dürfte. Start zum Flug PH 746 (Polynesien Airline) nach Apia, der Hauptstadt unseres dritten Ziellandes im Südpazifik, also mitten ins Herz Polynesiens. Unter uns glitt eine wegen ihrer Farbenpracht kaum zu beschreibende tonganische Inselwelt hinweg: Kreisrunde, bogen- und ovalförmige Islande, umgeben von blauen, grünen und roten Gewässern in jeder nur denkbaren Farbabstufung, umfasst von Korallenriffen und hellen Sandstränden – unglaublich!
Beinahe hätten wir ja einen inneren Ruck verspürt, als unsere Maschine – übrigens mit besonders charmanter Crew – gen Osten die internationale Datumslinie überflog. Wir erlebten sozusagen eine Zeitreise in die Vergangenheit, hier die Fakten: Abflug in Tonga am Donnerstag, dem 21. Juni, Ankunft in Samoa am Mittwoch, dem 20. Juni. Wir hatten damit also den auf der Hinreise nach Fidschi „verlorenen“ Tag wieder in der Tasche und kamen so in den Genuss, den Mittwoch nun zweimal erleben zu dürfen. Ziemlich verrückt, meinten wir, aber wahr! – „Talofa Lava!“ und „Afia Mai!“, das sind die aufrichtig gemeinten Willkommensgrüße der Samoaner, die oft zu hören und zu lesen sind.
Und wieder waren es die sogenannten Lapita-Töpfer, die aus Richtung Südost-Asien kommend um 1000 v. u. Z. auch die samoanischen Inseln als erste besiedelten. Ab dem 13. bis zum 16. Jahrhundert musste Samoa die tonganische Herrschaft erdulden, es folgte die Zeit der europäischen Walfänger, Missionare und Siedler, bis schließlich deutsche, englische und amerikanische Interessen aufeinanderprallten, die darin gipfelten, dass die Engländer 1876 den US-Konsul Steinberger deportierten und Apia (also nicht ganz Samoa) von Konsuln dieser drei Mächte regiert wurde. Deren Seeflotten lagen sich im Hafen gegenüber! Dass die Zerstörung der europäischen Kriegsschiffe ein verheerender Hurrikan besorgte, mag so manches Militaristenherz arg geschmerzt haben.
1899 wurde Samoa dann zwischen Deutschland und Amerika aufgeteilt, nachdem der englische Anspruch auf Tonga gesichert war. Offiziell avancierte Samoa-West aber erst am 1. März 1900 zur deutschen