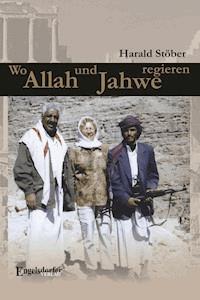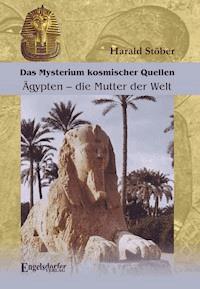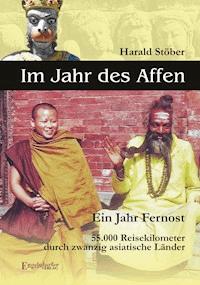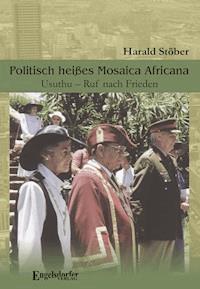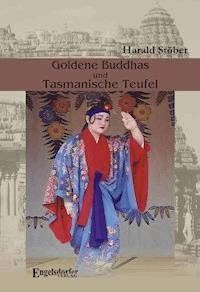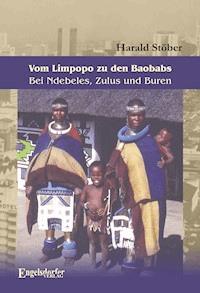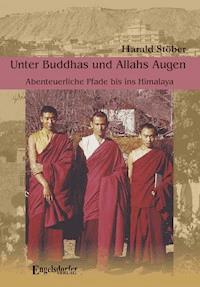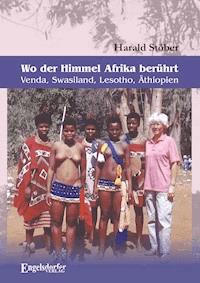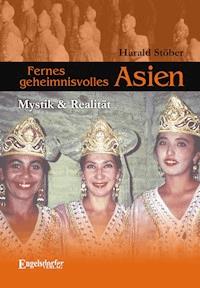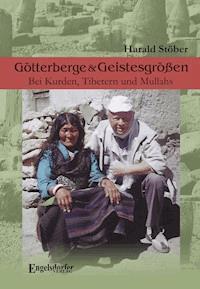
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Selbst in der heutigen sogenannten modernen Zeit kann es ein Wagnis sein durch Länder mit der Absicht zu touren, sich jenseits ausgetretener Touristenpfade zu bewegen. Dabei entdeckt man fast täglich Dinge, die verblüffen oder unwirklich erscheinen. Diese Erfahrungen vermittelt unser Autor seiner Leserschaft fern wirklichkeitsentstellender Schreibtischromantik. Im vorliegenden Band wird die riskante Tour durch Pakistan bis ins westliche Kaschmir geschildert. Es schließt sich das Abenteuer des östlichen Kaschmirs beziehungsweise Klein-Tibets und die Tour durch die nördlichen Himalayagebiete Indiens zurück nach Bombay an, aber nicht ohne auch im »sexy Khajuraho« Station gemacht zu haben. Voller Unwägbarkeiten steckten die Reisen von Istanbul bis ins wilde Kurdistan und durch die Kaukasusländer Georgien und Armenien. Nach einer kräftezehrenden Tour durch Tibet gab es Neues im russischen Tatarstan, im sibirischen Jakutien und im jüdischen Birobid_an zu entdecken. Im Lande der Mullahs verblüffte alles: die Gastfreundlichkeit, die Geistigkeit, die Historie. Ein facettenreiches Reisebuch, das den Leser »mit auf Tour nimmt«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Harald Stöber
Götterberge & Geistesgrößen
Bei Kurden, Tibetern und Mullahs
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor
Titelfoto: Treffen mit einer typischen tibetanischen Landfrau nahe dem »Pfad zur Hölle«
Coverrückseite: Der im 7. Jahrhundert von König Songtsan Gampo errichtete Potala über Lhasa, der Hauptstadt Tibets.
www.engelsdorfer-verlag.de
eISBN: 978-3-86268-791-6
Wer fremde Ufer spürt
und hat Mut sich alsbald
zu recken, der wird sich
selbst dabei entdecken.
Gewidmet meiner
lieben Familie und
guten Freunden.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel Von Indien nach Pakistan
Übersicht und Anreise
Mega-Bombay
Mega-Karatschi
Von Thatta nach Gilgit, Kaschmir
2. Kapitel Abenteuerliches Nordindien
Amritsar – das heilige Sikh-Zentrum
Srinagar – Stadt am kalten See
Leh – Stadt mit Potala
Wieder in Srinagar
3. Kapitel Weite Wege nach Bombay
Jammu – die Stinkige
Simla – Old England adieu?
Lucknow – Stadt der Oudh-Fürsten
Khajuraho – sexy city
Jabalpur – kommunistisch?
Nagpur – Stadt für Hindus und Christen
Bombay – Ende der Tour
4. Kapitel Halbmond mit Stern
Allgemeines zur Tour
Istanbul – das Tor zum Orient
Von Büyükada bis Pamukkale
Bis zum »Götterberg« Nemrut Dağ
Im Land der Kurden
Vom Nordosten nach Istanbul
5. Kapitel Fernziel Transkaukasien
Im Land des Kemal Atatürk
Goldenes Vlies und verehrter Stalin
Heidentempel und Katolikos
Kurdenland und Anatolien
6. Kapitel Der Himalaya ist voller Mystik
Allgemeines zur Tour
Im königlichen Nepal
Tibet – Land der Lebenden Buddhas
Zurück nach Nepal
7. Kapitel Gezähmtes Tatarstan & Sibirien
Ein kurzer Überblick
Kreml mit Kathedrale und Moschee
In Tyumen und Jekaterinburg
8. Kapitel Sibirien – ein modernes Abenteuer
Übersicht
Jakutien im »Herzen der Stille«
Birobidžan ist »Israel in Sibirien«
9. Kapitel Im Land der Mullahs
Überblick
Mega-City Teheran
Via Hamadān nach Persepolis
Heiliges Mashhād und Toos
Teheran – München
1. Kapitel
Von Indien nach Pakistan
Übersicht und Anreise
Die Leser meiner früheren Reisebeschreibungen über Indien werden sich fragen: Was, schon wieder dort gewesen? Ja, ich war Ende 1979 abermals in Asien, aber diesmal stand im Mittelpunkt der Reise Pakistan, Kashmir, Ladakh und Zentralindien, Gegenden, die ich noch nicht kannte, die es meiner Meinung aber unbedingt wert sind, ebenfalls individuell bereist zu werden.
Individuell – dieser Reisestil hat sich für mich längst bewährt, denn mittlerweile weiß ich, dass sich dadurch dem Reisenden Dinge erschließen, die ihm als Gruppenmitglied in der Regel verborgen bleiben, vor allem findet man eher unmittelbaren Kontakt zur Bevölkerung und fühlt sich freier. Dass damit jedoch eine ganze Reihe teils nur schwer verkraftbarer Unannehmlichkeiten einhergehen, ist normal und gibt einem solchen Unternehmen erst das Salz.
Die Reise war auch diesmal wieder gut vorbereitet, zumal ich dabei ja auf reiche Erfahrungen zurückgreifen konnte, die ich 1965 und zuletzt 1977/78 in Indien und auch in anderen Ländern habe sammeln können. Die Route führte mich per Flugzeug, Bahn und Bus von Bombay nach Karatschi, Hyderabad, Sukkur, Multan, Lahore, Rawalpindi, Gilgit, Srinagar, Leh, Amritsar, Shimla, Lucknow, Allahabad und Napur zurück nach Bombay. Auch diese etwa 10.000 Kilometer lange Tour war wieder recht anstrengend und manchmal auch gefährlich, begleitet von großer Hitze und bitterer Kälte, doch abermals sehr ergiebig und insgesamt erfreulich. Diesmal wurde ich gottseidank nicht von Krankheit geplagt, obwohl ich harten Extremen ausgesetzt war – ich hatte Glück und danke Gott für seinen Reisesegen!
In diesem Bericht beschäftige ich mich nicht mehr so sehr mit Details, wie ich es im Erlebnis Reisebericht »Saris, Dreck und Tempel« getan habe, denn zu viele Dinge müsste ich bei einer nochmaligen Reisebeschreibung wiederholen. So halte ich mich diesmal prägnanter und hoffe, dass darunter der Informationsgehalt keinen Schaden nimmt.
Natürlich war für mich die Nacht auf Dienstag, dem 25. September 1979, wieder denkbar unruhig, denn ich glaube, so oft ich auch noch Reisen antreten werde, wird das Reisefieber kaum schwächer werden. Nachts ein Uhr lag ich noch hellwach im Bett! Der heutige Tag war für mich zwar Abreisetag, doch blieb es mir nicht erspart, auch noch Dienst zu verrichten, weil ich diesmal mit Urlaubstagen knapp bei Kasse war. Im Büro gefiel es mir heute sogar, denn die Kollegen waren ausgesprochen lockerer Stimmung und außerdem gab es ein Mittagessen, das mir vor Antritt einer Asienreise gerade recht war: Es gab ein wohlschmeckendes Ripperl, Erbsenbrei und Sauerkraut! Eine Kollegin spendierte nach dem Essen auch noch einen ausgezeichneten Pflaumenschnaps, der mir ja beinahe den Abschied schwer gemacht hätte.
Ein Kollege, der erst vor ein paar Tagen von einer dienstlichen Asienreise zurückgekehrt war, hatte mich bei der Verabschiedung noch darüber informiert, dass der Tower des Bombayer Flughafens abgebrannt und dass deshalb durchaus die Möglichkeit einer Totalsperre gegeben sei. Mich traf das natürlich, denn dadurch könnte ja mein ganzer Reiseplan völlig durcheinander geraten. Mir blieb zunächst nichts anderes übrig, als die Dinge auf mich zukommen zu lassen. Das Büro verließ ich heute dienstwidrig schon um 15 Uhr, weil ich mich in der letzten Stunde vor dem offiziellen Dienstende einfach auf nichts mehr konzentrieren konnte. Ist doch verständlich – oder?
Als ich zusammen mit Hilde, meiner Frau, und Rainer, meinem Sohn, per Bus und S-Bahn nach Riem zum Münchener Flughafen fuhr, hatten wir ruhiges, frisches Herbstwetter. Auf der Fahrt überdachte ich noch einmal die getroffenen Vorbereitungen, klopfte auf die Seitentasche meiner Khakihose, um Reisepass, Geld, Tagebuch und Tickets zu fühlen, ging den spärlichen Inhalt meiner ledernen Schultertasche durch und kam zu dem Schluss, dass ich nichts vergessen hatte. Es konnte also losgehen – das auch diesmal hoffentlich wieder große Abenteuer einer Reise in einen faszinierenden Teil unserer Welt. Ich bedaure nur immer wieder, dass ich Touren dieser Art unter ziemlichem Zeitdruck und ohne Hilde absolvieren muss, tröste mich aber mit sicherlich nicht weniger interessanten Vorhaben in späteren Jahren. Außerdem drängt es mich, allmählich von sogenannten sightseeing tours abzukommen – so packend sie auch sein mögen – und an diese Stelle Überseeaufenthalte treten zu lassen, die genug Zeit lassen, die Dinge tiefer zu betrachten, Fragen zu stellen, in mich einwirken zu lassen.
Nach herzlicher Verabschiedung von Frau und Kind glaubte ich, binnen der nächsten Stunde bereits in der Luft zu sein, aber da kam die allseits enttäuschende Durchsage, dass sich der Abflug der Syrian Air nach Damaskus um mindestens zwei Stunden auf 21.30 Uhr verzögern würde. Ich fasste das als normal auf, denn bei Linien dieser Art muss man ja leider immer mit solchen und ähnlichen Unannehmlichkeiten rechnen. Auch die inzwischen eingetroffenen Phavan-Anhänger mit Ziel Poona, die Syrer und Inder nahmen die Verspätung ebenfalls mit Haltung in Kauf.
Doch so arg wurde die Verspätung nicht, denn plötzlich hatte man es sehr eilig und fertigte im Handumdrehen ab. Wiederum ergatterte ich einen Fensterplatz und saß wenig später im blau-weißen Jumbo »Arab Solidarity« der Syrian Air nach Damaskus. Nachdem alle Passagiere dieses nicht ganz vollbesetzte Fluges auf ihren Plätzen saßen und die Stewardessen ein paar nervöse Kleinkinder beruhigt hatten, erfolgte der Start um 20.40 Uhr, also eine gute Dreiviertelstunde eher als soeben angesagt worden war. Nach dem ungemein wuchtigen Abheben, bei dem ich wie immer Schweißperlen in den Geheimratsecken stehen und feuchte Handinnenflächen hatte, war es sofort schwarz um uns, denn der Herbst hatte ja längst die Dauer des Tageslichts verkürzt.
Der Kapitän meldete sich nicht, so dass keiner der Passagiere wusste, welche Route er nach Damaskus nehmen würde. Schade, denn ich möchte eigentlich immer gern wissen, wo ich mich ungefähr befinde. Nun, das könnte eventuell mit irgendwelchen Sicherheitsbestimmungen zusammenhängen, oder auch mit der Bequemlichkeit des Personals. Die umgangssprachlich auch als »Arafat-Airline« bezeichnete Syrian Air hat ohnedies keinen guten Ruf, aber sie ist nun einmal mit Abstand die billigste Linie von München nach Bombay.
Längst hatte ich mich wieder an die Umgebung in einem Flugzeug gewöhnt, so dass schnell innere Ruhe eingekehrt war und ich nach einem guten Abendessen tatsächlich einnickte und erst wieder wach wurde, als nach etwa dreieinhalb Stunden die bevorstehende Landung auf dem internationalen Flughafen zu Damaskus, der Hauptstadt Syriens, angekündigt wurde. Die Landung erfolgte kurz vor 24 Uhr (1 Uhr Ortszeit), sie war verdammt hart und ließ so manchen unaufgeräumten Pappbecher in der Küche durch die Luft fliegen.
Zur Halle ging’s zu Fuß. Die Transitpassagiere, zu denen auch ich gehörte, konnten sich nach kurzem Check der Weiterflug-Tickets in einen Aufenthaltsraum begeben und durften hier der Dinge harren. Ich hoffe natürlich, dass der Stopp nicht zu lange dauern würde, denn ich fand diese reichlich primitive Halle mit meist unangenehmen Mitwartenden nicht für einen zig-Stunden-Aufenthalt geeignet. Da lümmelten auffallend arrogante junge Männer unverkennbar arabischer Herkunft herum, pakistanische und indische Gastarbeiter – die modernen Sklaven der Ölscheichs – hockten teils mit Kind und Kegel und mit viel Handgepäck auf dem Boden, und ein paar eifrige Moslems beteten lauthals zu ihrem Allah, ohne dabei auch nur im Geringsten gestört zu werden.
Der Weiterflug war für 4 Uhr morgens angekündigt worden. Auf der einzigen hier befindlichen Uhr war das nicht zu verfolgen, denn sie ging geschlagene drei Stunden vor. Nun endlich erfolgte das Boarding. Die Passagiere wurden per Bus bis zu jenem Jumbo gefahren, der uns bis hierher gebracht hatte und noch immer exakt an der gleichen Stelle stand. Warum also bei Ankunft zu Fuß und bei Abflug per Bus?
Das Riesenflugzeug war jetzt fast bis auf den letzten Platz gefüllt und hatte Mühe, sich nach einem unendlich langen Anlauf in die Luft zu hieven. Wiederum nur pechschwarze Nacht um uns, als der Vogel seine Flughöhe erreicht hatte und nach Abu Dhabi am Persischen Golf donnerte, wo wir den nächsten Zwischenstopp in Kauf nehmen mussten. Hier verließen viele Passagiere die »Arab Solidarity« und viele stiegen zu – alles Menschen aus diesen Gegenden hier, keine »weißhäutigen Ungläubigen«. Als die Maschine abermals startete, hatten wir bereits hellen Tag – es war aber erst 8.45 Uhr.
Heiß ging’s her in Abu Dhabi, denn bei den zugestiegenen Passagieren handelte es sich ausnahmslos um indische Gastarbeiter und solche aus Pakistan, die – vollgepackt mit Zigarettenstangen, Transistorradios und vielen Plastikwaren für den Haushalt – sich aufgeregt – typisch! – nach ihren Plätzen umsahen und dadurch eine ziemliche Unruhe hineinbrachten.
Nach dem Start die bekannten Fernsehbilder: riesige Öltanks, züngelnde Fackeln, hypermoderne Neubauten, Pipelines zu Ölterminals, Supertanker, gelbe Wüste und das Blau des Arabischen Golfes. Kurze Zeit später durften wir zum Frühstück greifen und uns für die restlichen Stunden bis Bombay ausruhen. Unter uns das wolkenfreie Arabische Meer, über uns ein prächtiger Vormittagshimmel, der verhieß, dass das Wetter noch lange schön bleiben würde.
Aber etwa eine halbe Stunde vor der für 11 Uhr geplanten Ankunft in Bombay zog sich der Himmel unter uns allmählich zu und die Wolkendecke wurde immer dichter, je näher wir der indischen Küste kamen. Also doch noch Monsunzeit, von der ich so sehr gehofft hatte, dass sie Ende September vorüber sein würde. Nun, in Indien muss man auch mal diese »Jahreszeit« mitgemacht haben, denn sie gehört ja zum Lande wie der Sari, das Indische Grabmal und der Sadhu.
Der Landeanflug auf Bombay war entsprechend wacklig, denn die schwere Maschine musste sich lange Zeit durch dichteste Monsunwolken hindurchschaukeln, die erst etwa 50 Meter über der Erdoberfläche dünner wurden und den Blick auf Bombay freigaben. Abermals lag sie nun linker Hand unter mir – die Riesenstadt Bombay mit ihren verdammten Slumbuden an den Stadträndern und der unübersehbaren Masse trost- und farbloser Häuser. Da die Sonne nicht schien, kam mir heute alles noch deprimierender als früher vor.
Mega-Bombay
Als die Türen geöffnet wurden, drang sofort feucht-heiße Luft ein und prompt begann der Schweiß zu rinnen. Und auf dem Weg zu Fuß hinüber zur Halle wurde mir endgültig klar, dass ich hier noch einige Liter salzigen Schweißes würde lassen müssen. Dass ich der Erste beim kontrollierenden Passbeamten war, fasste ich als glücklichen Zufall auf, legte ich doch Wert darauf, möglichst schnell nach Andheri zu kommen, wo man mich für heute erwartete. Doch hier auf dem Flughafen lief noch längst nicht alles wieder normal, da der große Brand von vor einigen Tagen überall sichtbare Spuren hinterlassen hatte. So dauerte es geraume Zeit, bis ich endlich im Besitze des aufgegebenen kleinen Reisegepäcks war.
Nun ging es um einige Ecken herum, vorbei an abgerissenen Wandverkleidungen, über kaputte Fußböden und um große Mengen Handwerkermaterial, es drehte sich kein einziger Deckenpropeller, und die Menschen hier liefen ziemlich kopflos durcheinander, zumal niemand zu sehen war, der nach Autorität ausgesehen hätte, an den man sich mit Fragen hätte wenden können. Inzwischen klebte mir längst das Reisehemd am Leib und mein Taschentuch war patschnass.
Was mir nun bevorstand, war die verhasste Tauscherei und das hartnäckige Aushandeln des Preises. Wer meine Bombayer Taxistories kennt, weiß, dass ich der nächsten halben Stunde wieder mit Bangen entgegensah. Doch diesmal nahm ich mir vor, sehr darauf zu achten, nicht einmal den Ansatz zu einem Betrug zu dulden. Aber, was war denn hier draußen auf einmal los? Keine verrückten, sich um mich reißende Taxifahrer? Ich war perplex, denn da hatte ich hier ja schon andere schlimme Erfahrungen machen müssen. Aber, dort drüben standen ja welche! Ich ging zur anderen Straßenseite und sprach ein paar faul herumhängende Fahrer an, keiner ließ Eifer erkennen, keiner wollte mich unter 30 Rupien nach Andheri kurven, bis sich schließlich doch einer bequemte, mich für 20 bis zum St. Catherine’s Home zu bringen. Ich ließ mir die 20 per Handschlag bestätigen und hob beschwörend den Finger, dass mir am Ziel ja nicht etwa 30 abverlangt würden. Diese Pappenheimer kenne ich!
Vorbei an Slumbuden, die in der Monsunzeit noch grausamer als sonst aussehen, durch knatternden Straßenverkehr und durch die üblichen Menschenmassen in den Straßen Andheris gelangten wir nach halbstündiger Fahrt zwar wohlbehalten, aber total durchschwitzt beim Heim an. Der Fahrer strich sich ohne Dank den Zwanziger ein und holte mir die Tasche hinten raus – alles verlief diesmal glatt, ohne Streit, ohne Betrugsversuch, aber unfreundlich.
Wiederum wurde ich herzlich von vielen Schwestern begrüßt, die mich alle noch bestens in Erinnerung hatten. Nicht zuletzt begrüßte mich freudig auch die Liebe alte Schwester Priscilla, die sich sogleich entschuldigte, weil sie auf meinen Ankündigungsbrief nicht geantwortet hatte. Sie sei bis vor ein paar Tagen in Deutschland gewesen und hätte erst gestern meinen Brief in die Hand bekommen. Ich wurde sogleich in den mir vertrauten Aufenthaltsraum im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes geführt, traf dort mit der neuen Leiterin, Schwester Beatrice und anderen mir schon bekannten Schwestern zusammen und durfte mich an Tee, Säften und frischen Plätzchen laben.
Liebevolle Betreuung indischer Waisenkinder im St. Catherine’s Home
Kurze Zeit später machte ich die angenehme Bekanntschaft mit einem halben Dutzend aus Kerala (Südindien) kommender junger Schwestern, die sich anschickten, noch heute Abend nach Deutschland zu fliegen, um sich drei Jahre lang in einem Freiburger Krankenhaus ausbilden zu lassen. Auf Bitten einer Bombayer Schwester trugen die ausgesprochen zierlichen dunkelhäutigen Schwestern aus dem äußersten Südwesten Indiens ein paar Lieder in einheimischer Sprache vor, die hier oben kein Mensch verstehen kann. Auch die in ihrer Sprache an mich gerichteten Gruß- und Abschiedsworte blieben zunächst unverständlich, sie wurden jedoch von der älteren Schwester aus Kerala sogleich ins Englische übersetzt.
Darauf besuchte ich die mit bösen Kreislaufbeschwerden im Bett liegende Schwester Josepha, die sich sichtlich freute mich wiederzusehen. Sie wünschte mir von Herzen für die bevorstehende große Reise Gesundheit und Gottes Segen. Nebenan sangen vor brennenden Kerzen ein paar Kinder, so dass der lieben Josepha die Tränen kamen.
Nun nahm mich Schwester Priscilla wieder in Besitz und führte mich zu ihrem Neffen Andreas, der aus Münster gekommen war, um seine alte Tante zurück nach Deutschland zu begleiten. Er bereitete gerade das Reisegepäck vor: ein paar riesige Koffer mit Handarbeiten der Heimkinder für einen Weihnachtsbasar in Westfalen. Außerdem oblag es ihm, ein indisches Waisenbaby mitzunehmen – eine sicherlich schwierige Aufgabe. Er versprach mir, nach der Heimkehr Hilde anzurufen und ihr meine herzlichen Grüße aus Bombay zu übermitteln, woran ihn wohl »sein Baby« gehindert hatte.
Kein Aufenthalt in diesem Heim ohne Kirchgang. Als ich die Maries hörte, wie sie hell, sauber und mehrstimmig ihre Lieder anstimmten, ging ich hinüber und setzte mich in die letzte Reihe auf meinen »Stammplatz« links. Den Gesängen, Gebeten und Instrumentaldarbietungen hörte ich gern zu, auch diesmal gaben sie mir wieder so etwas wie Mut und inneren Frieden. Bevor ich mich entschließen konnte, den heutigen Tag für mich zu beenden, machte ich noch einen kleinen Rundgang, sah dabei den für das leibliche Wohl der Heimbewohner bemühten älteren Kindern zu, ging bis zur »Villa«, dem heutigen Hühnerstall, und besuchte das liebevoll gepflegte Grab von Schwester Roggendorf, die dieses Heim vor Jahrzehnten gegründet hatte und leider viel zu früh verstorben war. Es war 1965, als ich sie hier kennengelernt hatte.
In der Nacht auf den 27. September waren wieder schwere Monsunregen auf Bombay niedergegangen, die mich mehrmals wachwerden ließen, doch insgesamt konnte ich so viele Stunden schlafen, wie ich benötigte. Die lieben Schwestern sorgten für ein ausgezeichnetes Frühstück mit gekochten Eiern, Brot, Butter, Marmelade, Porridge und indischem Kaffee, bevor ich zusammen mit Richard, dem alten Jungen von damals, im Ambulanzwagen nach Bombay fuhr.
Richard, ein inzwischen gezeichneter Mann mit sechs Kindern, betete bei der Abfahrt laut vor, die mitfahrenden jungen Schwestern beteten nach. Seine Aufgabe bestand heute Morgen darin, einige Kisten frischer Eier aus der Heimproduktion zu festen Abnehmern in wohlhabende Bombayer Stadtgebiete zu bringen. Die Flats, die ich dabei zu Gesicht bekam, entsprechen fast unseren Vorstellungen von Wohnblocks, die von Sozialmietern bewohnt werden. Sie sind sauber und intakt. Auch fehlten in den Garagen nicht die Statussymbole: noble Autos!
Um halb elf setzte mich Richard vor dem imposanten Gebäude der »Air India« ab, in welchem auch die »Indian Airline«, die für den Inlands- und Nachbarschaftsflugverkehr zuständige indische Gesellschaft, untergebracht ist. Hier saß man wegen der großen Hitze vor und unter riesigen Luftschrauben und bewegte sich so wenig wie möglich. Dass ich dennoch erfreulich schnell meine fünf Flugtermine bestätigt bekam und reibungslos die dafür erforderlichen 1.830 Rs bezahlen konnte, wundert mich noch heute. Auch der morgige Flug nach Karatschi, den ich schon in Deutschland über die Syrian Air gebucht hatte, war okay. Binnen einer Stunde konnte ich das Airline-Gebäude wieder verlassen.
Draußen war’s regennass und unglaublich schwül, es schien keine Sonne, der Hafen lag im Dunst. Ich ging bis zum »Gateway of India«, jenem Wahrzeichen Bombays, wo sich normalerweise immer Touristen aufhalten und von dem aus die Besucher die Tuckerboote hinüber nach Elephanta besteigen. Heute sah ich hier nicht einen einzigen europäischen Besucher, sondern nur indisches Fußvolk, das so gar nicht zu begreifen schien, was zu dieser Unzeit hier ein Bleichgesicht zu suchen hat. Was es bedeutet, während der feucht-heißen Regenzeit in Bombay zu sein, verdeutlichten nicht zuletzt die vielen Dunsttropfen, die ständig aus der grauen Suppe des Himmels herabfielen und beinahe den Eindruck erweckten, als würde es regnen, doch das war nichts weiter als der Beweis für eine extreme Luftfeuchtigkeit – bei über 40 Grad Celsius!
Bei der »Syrian Air« im Ritz-Hotel konnte ich das Reconfirming für den Rückflug gottseidank auch ohne Ticket erledigen (ich hatte es im Heim liegen lassen) und durfte sogar wählen zwischen Diät- und Normalkost, dies in Bombay, wo auch heute noch Menschen verhungern! Geradezu »klassisch« die obdachlosen Bettelkinder direkt vor dem Aeroflot-Büro, deren Kopfkissen verrostete Blechbüchsen waren – mitten in Bombay! Ich besuchte den Marine-Drive, Bombays prachtvolle Uferstraße, und stellte auch hier fest, dass diese Jahreszeit nicht touristenfreundlich ist. Ich sah selbst hier weit und breit keinen einzigen Europäer.
Bevor ich nach Andheri zurückfuhr, hielt ich noch Einkehr in ein »Restaurant Grade II«, das von Europäern normalerweise nicht aufgesucht wird, doch die Leute hier nahmen mich seltenen Fremdling angesichts meiner luftigen und legeren Khakikleidung gar nicht so recht zur Kenntnis. Ich aß für fünf Rupien mit Appetit »Special Plate« mit zwei Sorten Fleisch, etwas Reis, Zwiebeln und Weißbrot, ging dann zum Bahnhof, wo ich für 85 Paisa ein local-train-ticket erstand und fuhr – ich weiß nicht, zum wievielten Mal – anstrengende 40 Kilometer bis Andheri. Vom Zug aus sahen die Slumbuden, die hier einfach nicht weniger werden wollen, zu dieser Regenzeit natürlich noch trostloser als sonst aus.
Bahnhof Andheri. Abermals das nervöse Herumgerangel Tausender Menschen, die weder Rücksicht auf Kinder noch Alte nehmen, sondern nur das Recht des Stärkeren und Frecheren kennen. Draußen vor dem Bahnhof vermatschter Straßenstaub, große Löcher in Fußwegen und auf dem Vorplatz, unfreundliche Busfahrer, die sich prompt herumdrehten, als ich sie nach der Andheri-Linie fragte und missmutige Taxifahrer, die sich einfach weigerten, mich die kurze Strecke bis zum Kinderheim zu fahren. Dass sich schließlich doch einer für 4 Rupien zur Fahrt erbarmte, war mein Glück, denn aus dem Monsunhimmel schüttete es kräftig.
Mutter Rose, die gute alte Seele für durstige und hungrige Besucher, reichte mir ihren wohlschmeckenden Lemonsaft und richtete mir aus, ich solle zu Schwester Priscilla gehen, die jetzt etwas Zeit für mich habe. Ich erhielt von ihr zwei für Schwester Xavia Anna Roggendorf, der heute noch in Karatschi tätigen Schwester der »hiesigen« Sr. Roggendorf, bestimmte Briefe und nahm die Gelegenheit wahr, mit der leider sehr schnell alternden Sr. Priscilla länger zu sprechen. Sie berichtete mir mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dass heutzutage die Einweisungen der kleinen Waisenkinder von Amtswegen geregelt werden, dass aber der Staat keine einzige Rupie weder zum Unterhalt des Heimes, noch zur Schule beisteuere, im Gegenteil, das Heim müsse auch heute noch jenen Kindern alles zahlen, die außerhalb von St. Catherine’s Home eine weiterführende Schule besuchen.
Inzwischen war es wieder Abend geworden und ich ziemlich geschafft. Ich trank bei Rose noch einen guten Lemonsaft und musste besorgten Schwestern klarmachen, dass es mir mein Magen heute Abend verbiete, noch etwas zu essen. Nachdem ich mir die schönen Mary-Gesänge, die fehlerfreien Harmonium- und seichten Schlagzeugklänge zu Gemüte geführt hatte, entschloss ich mich beizeiten, mein moskitogeschütztes Bett aufzusuchen, denn morgen stand mir ja die Reise nach Pakistan, in ein mir noch unbekanntes Land, bevor.
Die Nacht auf den 28. September war so, wie ich sie mir gewünscht hatte: ruhig, erholsam und frei von Moskitos. Da das Flugzeug erst am späten Nachmittag nach Karatschi starten sollte, hatte ich also noch viel Zeit, die ich gern nutzte, um mich im Heim und in dessen Umgebung noch etwas umzusehen. Am Grab von Schwester Roggendorf traf ich zufällig mit Richard zusammen, der sich ziemlich deprimiert über das Heim äußerte. Er nahm mir gegenüber kein Blatt vor den Mund und beklagte unmissverständlich die derzeitige Heimleitung, die er schlicht für herzlos hielt. Früher, als hier noch zwei Dutzend europäische meist deutsche Schwestern die Verantwortung getragen hätten, habe noch die christliche Nächstenliebe dominiert. Heute dagegen verwalte man nur noch und tue nichts für die Weiterentwicklung. Wie sehr mir Richard – immerhin ein Inder – aus dem Herzen gesprochen hatte, wusste er nicht.
Es reizte mich, den neu errichteten Flats in der Nähe des Heimes einen Besuch zu machen, denn sie entstanden schließlich anstelle früherer Slumgebiete. Aber was heißt das schon in Bombay, wo die Slums offensichtlich nicht auszurotten sind; denn es entstehen unkontrolliert immer wieder weitere. Auch die neuen Gebäude sind eigentlich nur einbetonierte Slums und längst wieder abbruchreif! Jedermann kann sich davon überzeugen, wie heruntergekommen die Fassaden sind, die verrostet und kaputt alles Drum und Dran ist, dass in den Anlagen meterhoch das Unkraut steht, dass die Wege zwischen den Häusern kaum mehr passierbar sind und dass man die Bewohner hier beinahe schlimmer als in Slumbuden zusammengepfercht hat. Es ist einfach hoffnungslos! Mich wundert es immer wieder, dass man sich hier als wohlgenährter Europäer so ungehindert bewegen kann.
Wieder zurück im Heim – durchgeschwitzt und nachdenklich – reichten mir die Schwestern ein eigens für mich hergerichtetes leichtes Essen (Kartoffelbrei und geschlagene Eier), wussten sie doch, dass ich gestern Abend kleine Magenprobleme hatte. Dann packte ich wieder meinen Koffer mit Reiseanzug und frischer Wäsche, nahm Abschied von allen, die ich zur Mittagszeit erreichen konnte und bestieg das per Telefon bestellte Taxi, das mich zum Flughafen bringen sollte. Nun erst begann für mich die Reise ins Unbekannte – bis hoch zum »Dach der Welt«. Vor mir lagen nicht weniger als etwa 10.000 Kilometer durch Indien und Pakistan!
Im Flughafengebäude herrschte immer noch Chaos, denn nach wie vor mussten provisorische Schalter benutzt werden, regelten denkbar unfähige Posten die Passagierströme in verschiedene meist falsche Richtungen, und noch immer lief trotz unerträglicher feuchter Hitze kein einziger Decken- oder Standpropeller. Mich schickte man gleich zweimal in die falsche Richtung, bis ich endlich den Karatschi-Schalter erwischt hatte und ich sah, dass hier die Hölle los war. Ich mogelte mich einfach vor, überkletterte Gepäckstücke und achtete nicht auf schimpfende Passagiere – ich brauchte sie als Fremder ja nicht zu verstehen. Als ich weit genug vorn war sah ich, wie verbissen und jähzornig die Leute darum kämpften abgefertigt zu werden, als ob sie Angst hätten, trotz okay-Tickets nicht mitgenommen zu werden.
Schweißüberströmt und alles andere als guter Stimmung ließ ich diesen Zirkus geschlagene zwei Stunden lang über mich ergehen, erkämpfte mir die Zahlung von happigen 50 Rupien airport tax sowie die Sitzbuchung und setzte mich erst einmal wieder von dieser Horde unzivilisierter Pakistani ab. Mein Gott, wenn das für Pakistan typisch sein sollte, so ging’s mir ständig durch den Kopf, dann fürchte ich ernsthaft um Gut, Geld und Gesundheit. Nur gut, dass ich außer meiner kleinen Schultertasche kein Gepäck bei mir hatte und zudem in strapazierfähiger Khakikleidung steckte!
Endlich im Warteraum sitzend sah ich, dass neben den Pakistani, die etwa 90 Prozent der Passagiere ausmachten, auch viele über Karatschi zurückreisende Araber dabei waren, uhrenbehangen, dickbäuchig und bequem – Frauen, Männer, Kinder. Sie befanden sich offensichtlich auf der Rückreise in die Golfstaaten, vollgepackt mit in Bombay eingekauften Stoffen, Spielzeugwaren und radiotechnischen Geräten. Ich war tatsächlich der einzige Europäer, der an diesem abenteuerlichen Flug mit einer Boeing 737 der »Indian Airline« von Bombay nach Karatschi teilnahm.
Der Start war flugplanmäßig für 17.40 Uhr vorgesehen, doch erfolgte er erst um 20 Uhr, also mit großer Verspätung, die mir wieder einmal zu schaffen machte, denn ich hatte ja keine Ahnung, was mir im völlig unbekannten Karatschi abends noch blühen würde. Die Maschine war bis auf den letzten Platz besetzt, und außerdem hatte jeder mindestens die doppelte, wenn nicht dreifache Menge des zulässigen Handgepäcks bei sich. Sicher befand sich auch im Gepäckraum mehr Gewicht, als hätte sein dürfen. Entsprechend lang war dann der Anlauf und sehr schwerfällig auch das Abheben der randvollen Maschine, ein Vorgang, der mir diesmal mehr Schweiß in die Hände drückte als sonst.
Auch während des Fluges durch die pechschwarze Nacht kehrte kaum Ruhe ein, denn die Pakistani versuchten alles aufzukaufen, was die Stewardessen zu bieten hatten und handelten dabei wie im Basar. Man wurde sogar böse, wenn mit Handeln nichts zu machen war. Sie kauften Duftstoffe, Zigarettenstangen und, ich traute meinen Augen nicht, jede Menge Alkohol – das von Allah und seinem Propheten streng verbotene Teufelswasser. Zu essen gab es Brot und Käse, »Frikadelle« mit kalten Kartoffeln und etwas Gemüse, sowie einen kleinen fruchtgefüllten Kuchen, dazu wohlschmeckenden Tee. Danach machte ich mir meine obligatorischen Notizen und versuchte, mich mental auf das moslemische Pakistan einzustellen.
Mega-Karatschi
Die Landung erfolgte 15 Minuten nach 21 Uhr – Karatschi, Pakistans Handels- und Wirtschaftsmetropole, war erreicht. Abermals aufgeregtes Gezänk beim Aussteigen und dann hastiges Rennen zum Abfertigungsgebäude. Natürlich erwartete ich hier drinnen wieder Chaos, Gedränge und Geplärr, doch in der Halle war’s erstaunlich ruhig und sogar sauber. Nanu! Der Grund dafür war augenscheinlich, denn hier sorgten gestrenge Polizisten für Ordnung, achteten sehr auf eine saubere Schlangenbildung vor den verschiedenen Schaltern und riefen jeden unmissverständlich zur Ordnung, der auch nur den Anschein erweckte ein Unwilliger oder gar Ungehorsamer zu sein. Aha, Militärstaat!
Da die pakistanischen Abfertigungsbeamten ihre Aufgabe offenbar ernst nahmen und dementsprechend sorgfältig Pässe und Personen prüften, kam ich erst nach geschlagenen zwei Stunden an die Reihe, wurde dann aber binnen zwei Minuten mit anstandslos eingestempeltem Visum und ohne weitere Kontrolle nach Pakistan entlassen.
Erster Eindruck: großzügig angelegte, saubere Hallen, anständiges Verhalten der Passagiere, kein ungebührliches Gerangel um Taxis und Busse, keine Hotelschlepper und Bettler, keine kaputten Fußwege und Straßen vor dem Gebäude. Ich wurde weder von eifrigen Taxifahrern angesprochen noch von zwielichtigen Hotelburschen aufgefordert mitzukommen, nein, ich stand unbehelligt, ja beinahe etwas hilflos vor dem Flughafengebäude und bemühte mich selbst herauszufinden, wie ich nun am besten und billigsten in die Stadt kommen würde.
Ich wurde von zwei wartenden englischen Schwestern angesprochen, die nach indischen Mitschwestern fragten, die sie eigentlich mit dieser Maschine aus Bombay erwartet hatten, doch ich musste sie enttäuschen: In Bombay auf dem Flughafen vor dem Karatschi-Schalter hatte ich tatsächlich wartende indische Schwestern gesehen, später aber nicht in der Maschine; sie hatten wohl Pech und waren aus mir nicht bekannten Gründen nicht mitgenommen worden. Bei den beiden englischen Schwestern wurde ich jedoch die mitgegebenen Briefe los, die ich ihnen gab, nachdem ich gehört hatte, auf welch kompliziertem Weg ihre beziehungsweise Schwester Roggendorfs Station zu erreichen ist.
Nach einigem Herumfragen wurde mir schließlich ein alter Bus gezeigt, der als letzter in die Stadt fahren würde. Ich befreundete mich mit dem Fahrer und bat ihn, mich vor einem preiswerten Stadthotel abzusetzen, denn ich sei zum ersten Mal in Karatschi und müsse mich deshalb ihm anvertrauen. Er nickte zustimmend, knöpfte mir reguläre 10 Rupien ab, und als der Bus voll genug war, startete dieser in Richtung des nächtlichen Karatschi. Wiederum hatte ich Grund angenehm überrascht zu sein, denn die befahrene Strecke war relativ gut in Schuss, die Beschilderung beinahe optimal, die Beleuchtung ausreichend und intakt. Im Vergleich zu Bombay oder Kalkutta herrschen hier also mit Abstand bessere Straßenverhältnisse. Das beruhigte mich, denn ich hatte ja mit ziemlicher Sorge diesem ersten Abend im fremden Karatschi entgegengesehen.
Der Bus hielt oft entweder an regulären Haltestellen oder vor Hotels, die mir allerdings alle etwas zu komfortabel vorkamen. Dieser Meinung war übrigens auch der Busfahrer, der sich längst darüber im Klaren war, dass er’s nicht mit einem Wohlstandstouristen zu tun hatte.
Ich war einer der letzten Passagiere im Bus, als der Fahrer schließlich meinte, jenes Hotel dort drüben sei das richtige für mich. Brav mit Handschlag dankend verließ ich dieses Vehikel und fragte im Minnoo-Hotel nach einem billigen Zimmer – jawohl, für 36 Rupien pro Nacht könne ich hierbleiben. Ich deponierte verlangte 200 Rupien, füllte die auch hier unerlässlichen Formulare aus und erhielt sofort den Schlüssel für ein im zweiten Stockwerk liegendes Zimmer. Donnerwetter! Es war sauber, besaß einen funktionierenden Deckenpropeller und verfügte über eine separate Toilette mit Waschgelegenheit. Auch die Flure und das Treppenhaus waren sauber, touristische Bilder verschönerten die kahlen Wände, und in Steinkrügen befand sich frisches Trinkwasser. Als ich mich um 24 Uhr müde aufs Bett legte, wusste ich, wieder einmal einen schwierigen, mit vielen Unbekannten gespickten Tag gut hinter mich gebracht zu haben.
Karatschi – orientalischer Alptraum oder der Inbegriff ungestümen Wirtschaftslebens? Ich glaube, weder – noch. Karatschi, das wurde mir bereits am Flughafen klar (und das fand ich später auch bestätigt), ist für uns kein Albtraum. Wer das behauptet, kennt Bombay, Madras, Kalkutta oder andere Städte Indiens und Pakistans nicht. Und ungestümes Wirtschaftsleben findet ebenso wenig statt, wenn es auch für pakistanische Verhältnisse respektabel ist. Auf jeden Fall ist Karatschi eine Fünfmillionenstadt mit dem größten Hafen des Landes, wo jährlich viele Tonnen Baumwolle, Weizen und Häute ausgeführt werden. Karatschi ist auch eines der geistigen Zentren des Landes mit Universität, Technischer Hochschule und Behörden, und außerdem hat hier ein katholischer Erzbischof seinen Sitz. Es gibt nicht wenige Pakistani, für die Karatschi die eigentliche Hauptstadt des Landes ist. Auf jeden Fall gibt es kaum einen Einheimischen, der diese Stadt allein schon wegen ihrer eher westlichen Lebensgewohnheiten nicht bevorzugen würde.
Karatschi, ein unübersehbares Häusermeer mit nur wenigen Hochbauten im Zentrum, liegt an der Arabischen See nahe der Mündung des Indus und ist Hauptstadt der südpakistanischen Provinz Sind. Karatschi hat sich aus einem bescheidenen Fischerdorf – allerdings erst unter britischer Herrschaft – zu einer bedeutenden Handelsstadt entwickelt, wobei vom alten Teil nur noch wenig erhalten geblieben ist. Heute dominieren die wuchtigen roten Sandsteinbauten, wie zum Beispiel das Karatschi Municipal – das Rathaus – oder der Sind High Court – das Gericht. Seit der Unabhängigkeit 1948 erlebt Karatschi einen zweiten großen Aufschwung, dessen Ende noch nicht abzusehen ist.
Da ich vor allem wegen der Hitze erst weit nach Mitternacht einschlafen konnte, fühlte ich mich heute Morgen nicht besonders gut, so dass ich danach trachten musste, baldmöglichst zu einem guten Tee zu kommen, doch den gab es im Hotel leider nicht. So verließ ich bereits um halb acht das Haus ohne zu wissen, in welcher Ecke Karatschis ich mich eigentlich befand. Draußen begegnete ich zunächst nicht dem erwarteten »indischen Treiben«, ich sah keine Ochsenkarren, keine Bettler, keine Müllhaufen und keine ärmlichen Menschenmassen. Als ich endlich eine Motorrikscha entdeckte (Fahrradrikschas gibt es in Karatschi nicht), war ich erleichtert, denn ich kam mir zunächst reichlich verlassen vor. Ich heuerte sie für ausgehandelte fünf Rupien an und ließ mich erst einmal zur Chundrigar Road fahren, zu jener großen Geschäftsstraße, in der auch der hiesige Stützpunkt meines Arbeitgebers liegt.
Ich war für heute 10 Uhr mit einem Kollegen in dessen Büro verabredet und war mir ganz sicher, dass dieser schon in München vereinbarte Treff auch klappen würde, denn wir hatten vor, eventuell zusammen in den Norden zu fahren oder zu fliegen; dieses Unternehmen sollte sich hier konkretisieren beziehungsweise entscheiden. Natürlich war ich deshalb darauf bedacht, ihn nicht zu verpassen, weshalb ich zeitig genug in der genannten Straße ankam und bald herausgefunden hatte, wo sich die State Life Buildings befinden. Hier residiert also mein Arbeitgeber!
Dieser Komplex ist jedoch riesenhaft, so dass mir selbst der Pförtner nicht sofort sagen konnte, wo ich das gesuchte Büro würde finden können. Man schickte mich zunächst einmal zur Versicherungsgesellschaft »State Life Overseas«, wo ich natürlich in die Rückversicherungsabteilung lanciert wurde. Hier nun endlich kannte man unser Büro, das sich allerdings nicht in diesem Gebäude befand. Ein Angestellter wurde schließlich damit beauftragt, mich zum Firmen-Büro zu bringen, das sich im Frontgebäude befindet – dort, wo ich bereits den Pförtner befragt hatte. Wie sich später herausstellte, war das neue Firmen-Schild hier noch nicht angebracht worden.
Endlich im gesuchten Firmen-Office – aber leider war kein Kollege zur Stelle! Die einzige Büroangestellte war sehr freundlich und bedauerte, dass ihr Chef noch nicht da sei, konnte sich aber nicht erklären, warum. Aber zunächst einmal servierte sie mir den ersehnten guten Tee, reichte mir Gebäck und bemühte sich, mir mit belanglosen Unterhaltungen die Wartezeit zu verkürzen. Fast konnte ich mich hier wie zu Hause fühlen: dort prangte ein farbiges Firmen-Emblem, an der Wand hinter dem Stuhl des Chefs hing unsere »Weltkarte der Naturgefahren« und auch die Büroausstattung war Firmen-like, also alles andere als typisch indisch oder pakistanisch. Wer aber nicht kam, war der Kollege. Und weil er um elf immer noch nicht eingetroffen war – also schon eine Stunde Verspätung hatte –, entschied ich mich, das Büro wieder zu verlassen. Ich hinterließ die Anschrift und die Telefonnummern meines Hotels und bat darum, er möge mir dort eine Nachricht zukommen lassen. Auch mein Wunsch, von hier aus zu Hause anrufen zu dürfen, konnte mir leider nicht erfüllt werden, da Überseegespräche mindestens acht Stunden vorher angemeldet werden müssten. Mittelalter!
Mein erstes Ziel war das Municipal Building, eines der markantesten Gebäude Karatschis an der Jinnah Road, der Hauptschlagader der Stadt. Anhand meines kleinen Stadtplanes konnte ich mich gut orientieren und wusste daher, dass ich von der Chundrigar Road aus nur durch eine Seitenstraße musste, um automatisch zur parallel verlaufenden Jinnah Road zu gelangen.
In dieser Seitenstraße wurde es etwas orientalischer, denn hier gab es zig kleine Krämerläden mit Obst, Gemüse, Geflügel und Dingen des täglichen Bedarfs, waren die Menschen überwiegend pakistanisch gekleidet und war es auch den überladenen Lastkarren und Zugtieren anzusehen, dass Karatschi eine Stadt des Orients ist. Dagegen vermisst man den Orient in den beiden großen Geschäftsstraßen fast völlig.
So plötzlich dieser Orient zwischen den Straßengiganten begonnen hatte, so plötzlich hörte er auch wieder auf, nämlich in dem Moment, als ich in die Jinnah Road einbog. Hier wieder äußerst motorisierter Straßenverkehr – sechsspurig –, sehr laut, stinkend und ziemlich ungeordnet, seltene Ochsenkarren, viele überfüllte Busse, eine ungeheure Anzahl Pkw und Fahrräder, die Bürgersteige voller Menschen, aber nur ganz selten Elendsgestalten oder Bettler, auffallend viele, sich anständig benehmende Jugendliche, auch relative Sauberkeit auf den Fußwegen und an der Straße. Bereits hier war mir klar, dass sich Bombay und die meisten anderen indischen Großstädte von Karatschi mehr als nur eine Scheibe abschneiden können. Dieser erste Eindruck zog sich dann auch wie ein roter Faden durch meinen gesamten Aufenthalt in Karatschi. Hier fiel es mir wie Schuppen von den Augen, warum sich seinerzeit mein Arbeitgeber für Karatschi als Stützpunkt für Pakistan, Indien, Ceylon und Nepal entschieden hatte und nicht für Bombay oder Delhi.
Schnell hatte ich das prächtige rosarote Sandsteingebäude der Stadtverwaltung erreicht und somit den ersten Besichtigungspunkt in Karatschi. Es ist dies ein solider dreistöckiger Bau mit seitlich aufgesetzten, sehr dekorativen großen Zwiebelkuppeln und einem alles überragenden Mittelturm, dem eine etwas kleinere Zwiebelkuppel aufgesetzt ist. Prächtig auch das vorstehende Eingangstor, dessen oben abschließende Kuppeln ebenfalls sehr harmonisch ins Gesamtbild passen. Da es sich bei diesem Rathaus um ein noch mit Leben erfülltes Gebäude handelt, war eine Besichtigung des Innern leider nicht möglich.
Ich musste mir angesichts des hier sehr dichten Straßenverkehrs ab und zu das Taschentuch vor die Nase drücken und war deshalb froh, mich etwas später in ein kleines Restaurant zurückgezogen zu haben, denn hier konnte ich wieder richtig atmen. Zudem war es brütend heiß, ich schätzte mindestens 40 Grad Celsius im Schatten. Es war ein sehr einfaches Restaurant, wo jeder seine Chapatties und die Zutaten mit Fingern aß – ich nolens volens auch. Für 5,50 Rupien erhielt ich zuviel ungesalzene Chapatties, drei kleine Stückchen Fleisch in extrem scharfer Sauce, einen Gemüseteller mit Zwiebeln und Tomaten, eine richtige Coca Cola und zum Abschluss eine Tasse Tee – alles zusammen für etwa eine Mark.
Nur gut, dass der weite Fußmarsch zum nächsten Ziel, dem Mausoleum Quaid-e-Azam, nicht mehr so unangenehm war, denn der Verkehr wurde etwas dünner, und große alte Straßenbäume gaben viel Schatten. Als ich nach anderthalb Meilen vom Municipal Building aus den Tomb erreicht hatte, war mir klar, dass ich den Rückweg in die Stadt wohl nicht zu Fuß machen würde.
Der Tomb liegt inmitten eines großzügig angelegten Parks, um den in weitem Abstand die verkehrsreichen Ausfallstraßen herumgeleitet werden. Der Besucher kann sich hier also voll seinen Gedanken widmen – es herrscht absolute Ruhe. Es hat durchaus seine Berechtigung, dass man diesen Park mit dem zentral gelegenen blendend weißen Marmortomb als den schönsten Park Karatschis bezeichnet; es ist auch der am meisten verehrte Ort dieser Stadt.
Bestattet liegt unter mächtiger Marmorkuppel der Gründer der pakistanischen Nation Quaid-e-Azam Ali Jinnah. Das Grabmal steht auf einem weitflächigen Sockel, zu dem breite Marmortreppen führen. Auch das viereckige Gebäude selbst ist mit purem Marmor verkleidet, dessen weiße Außenfläche nur durch das Braun der nach oben spitz zulaufenden mehrbögigen Eingänge unterbrochen wird. Innen befindet sich der reich ornamentierte eigentliche Grabaufbau, überwölbt von einer kunstvoll gestalteten blauen Kuppel, in deren Zentrum ein riesiger Kronleuchter aus wertvollem Kristall chinesischen Ursprungs hängt. Weißgekleidete Wachen patrouillieren gemessenen Schrittes ständig um den Tomb herum, und pakistanische Besucher stehen vor den Eingängen, um in Richtung Mekka ihre Gebete zu sprechen. Von hier oben geht der Blick weit über ganz Karatschi, einem unübersehbaren Häusermeer bis zum Horizont und lässt erkennen, dass die Innenstadt unter einer bedrohlich aussehenden gelbbraunen Dunstglocke liegt. Auch diese Stadt wird irgendwann einmal einen Kollaps bekommen, wenn nicht beizeiten harte Umweltmaßnahmen ergriffen werden.
Ich ging gemächlich durch den ständig von Gärtnern bearbeiteten Park zurück zum Eingang, dies mit dem festen Vorsatz, mir jetzt eine Rikscha oder ein Taxi zu nehmen, doch zu meiner Verblüffung hielt nicht ein einziges Fahrzeug, obwohl ich unmissverständlich zu erkennen gegeben hatte, was ich wollte. Also blieb mir tatsächlich nichts anderes übrig, als den weiten Weg bis zu meinem dritten Ziel, der Frere Hall, zu Fuß zurückzulegen.
Bis zur Zaibun Nisa Street blieb ich auf der Jinnah Road und ging jetzt in südliche Richtung, nachdem man mir bestätigt hatte, dass ich so auf die Frere Hall stoßen würde. Der Weg war gottseidank meist schattig, aber sehr weit, so dass ich ziemlich kaputt nach über einer Stunde dort ankam. Unterwegs traf ich auf eine ganze Reihe obdachloser Leute, auch auf Bettler und Bettelkinder, die sich offenbar von den Hauptstraßen Karatschis hatten zurückziehen müssen. Erst hier konnte ich sehen, dass Karatschi nicht nur eine quirlige und wohlhabende Metropole ist, doch lässt sich dieses »bescheidene Elend« mit dem der großen Städte Indiens überhaupt nicht vergleichen.
Der Frere-Hall-Park gehört ebenfalls zu den gut unterhaltenen grünen Inseln Karatschis, doch war es mir nicht möglich, hinter die frühere Bedeutung des in der Parkmitte stehenden gelb-braunen Sandsteinbaues zu kommen, der mir im orientalischen Karatschi eher deplaziert vorkam. Es hat den Anschein, als hätte es sich früher einmal um eine christliche Kirche gehandelt, die aufwendig im gotischen Stil errichtet wurde. Die Seitenfenster, der wuchtige sechseckige Vorderturm und der sehr schlanke Mittelturm auf dem grünen Dach erinnern jedenfalls an alte englische Kirchenbauten. Heute ist hier eine große Bibliothek untergebracht, die vermutlich zur Universität gehört.
Nachdem ich mich unter schattigen alten Laubbäumen etwas ausgeruht hatte, ging ich durch die Club Road weiter in Richtung Chundrigar Road und kehrte in einem alten Café ein, das mich in angenehmer Weise an die Zeit um 1920 erinnerte, die ich allerdings nur von alten Filmen her kenne. Es handelte sich um das Café Victoria, dessen Seitenwände bis zur Hälfte holzgetäfelt und dessen übrige Wandflächen, Decken und Säulen noch mit altem bemaltem Glas verkleidet sind. Das überwiegend junge Publikum war sauber, recht ruhig und auch hier mir Fremdling gegenüber neutral. Das teuerste Essen in diesem guten Haus kostet 10,10 Rupien, dafür gibt es Chicken Birjani.
Auf dem Weg zur Chundrigar Road kam ich am Superhotel »Intercontinental« vorbei, einem exklusiven Haus mit sicher hervorragenden Angeboten an Zimmern und Service. Der Park war bestens gepflegt, die Dienerschaft kümmerte sich emsig um ihre weißhäutigen Luxusgäste und die schwarzen Limousinen wurden unentwegt von Jugendlichen gewienert.
Links neben diesem 10-stöckigen, mit weißem Marmor verkleideten Prunkbau befindet sich eine weitläufige Parkanlage, die jedoch nicht zum Hotel »Intercontinental« zu gehören scheint. Auch hier sorgten viele Gärtner für Sauberkeit und stets gestutzten Rasen, für exakte Hecken und Zierbäume, es wurden Zierlampen repariert und Phantasietore bepinselt. So wichtig, wie es den Anschein hatte, schien dieser Park aber nicht zu sein, denn kein einziges Hinweisschild wies den Fremden auf die Bedeutung dieser Anlage hin.
Dieser schöne Park wäre eigentlich kaum erwähnenswert gewesen, wenn sich nicht unmittelbar daneben tiefer Orient abgespielt hätte: Vorbei trotteten Kamele, die hochbeladene Karren zogen, geleitet von Treibern, die an Figuren aus 1001 Nacht erinnerten. Und kaum 50 Meter vom Park entfernt, der offensichtlich vom kleinen Mann nicht betreten werden darf, sah ich Bettler, die mit Stöcken im Abfall herumstocherten und nach etwas Essbarem suchten. Selten habe ich den Gegensatz von steifem Reichtum und bitterer Armut so direkt vor Augen gehabt wie hier.
Gegen 16.30 Uhr hatte ich die State Life Buildings wieder erreicht, doch das Firmen-Büro war verschlossen. Enttäuscht darüber, dass der Treff mit dem Kollegen nicht geklappt hat, ergatterte ich mir eine Motorrikscha und ließ mich bis zu meinem Hotel in die Garden Road bringen. Ich war jetzt ziemlich erledigt, denn das viele Herumlaufen in dieser Hitze war ich ja längst nicht mehr gewöhnt, doch spürte ich, dass es mir gut bekam. Irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden, zum Beispiel mit dem Kreislauf, hatte ich gottseidank nicht. – Bevor ich mich schon gegen 21 Uhr aufs Ohr legte, hatte ich mir vom Rezeptions-Boy noch sagen lassen, dass die Busse nach Thatta, meinem Ziel morgen Vormittag, vom Impress Market abfahren, einem bekannten Punkt in Karatschi, den ich ohneweiteres würde finden können.
Karatschi hatte ich also gesehen. Ich ereichte die wichtigsten Dinge per pedes und verschaffte mir so einen guten Überblick. Fazit: Diese ungeheuer große Stadt ist im September sehr heiß, in den Hauptstraßen übermäßig laut und verpesstet, teilweise hypermodern aber teils auch ärmlich, verfügt über erholsame gepflegte Parkanlagen und hat mit indischen Städten so gut wie nichts gemeinsam, wenn man einmal von den schönen Saris wohlhabender Damen und von den wenigen Basarstraßen absieht.
Von Thatta nach Gilgit, Kaschmir
Ich hatte in der Nacht auf den heutigen Sonntag zwar recht gut geschlafen, doch fühlte ich mich trotzdem alles andere als ausgeruht; offensichtlich waren die beiden letzten Tage etwas zu anstrengend gewesen. Nun kam auch noch Ärger an der Rezeption, denn der Dandy verlangte statt der angekündigten 36 Rupien pro Nacht heute Morgen auf einmal 69 Rupien und behauptete glatt, ich hätte mich verhört. Nur wusste ich zu gut, dass ich mich eben nicht verhört hatte und weigerte mich zunächst zu zahlen. Mir wurde dann grinsend eine Preisliste vorgehalten, auf der tatsächlich 69 Rupien für ein Doppelzimmer standen. Man hatte mir also den Preis für ein Einzelzimmer genannt, mich aber in ein teureres Doppelzimmer einquartiert. Sehr verärgert wegen dieses verdammten Tricks zahlte ich schließlich und verließ grußlos das Hotel, was den Leuten hier natürlich egal gewesen sein wird.
Im Stehen verputzte ich in Hotelnähe zwei frische Bananen und schüttete mir eine Coca Cola in den Magen, bevor ich mich per Motorrikscha bis zum Impress Market fahren ließ. Bei diesem Markt handelt es sich in der Tat um ein markantes Zentrum, denn hier war nicht nur mit Dutzenden Gemüse-, Obst- und Fleischbuden der Platz zu dieser frühen Stunde schon belebt, sondern hier standen auch die erwarteten vielen Busse auf einem Endbahnhof. Ich erkundigte mich nach dem Thatta-Bus, erhielt aber keinen gezeigt, bis mich endlich einer darüber aufklärte, dass von hier nur Stadtbusse abfahren, also keine Überlandbusse beispielsweise nach Thatta. Ich wurde dann zu einem Bus gebracht, dessen Schaffner mir sagen wollte, wo ich aussteigen müsste, um einen Überlandbus zu bekommen.
Morgendliche Busfahrt durch Außenbezirke Karatschis. Es war diesig und noch ziemlich frisch, als ich schließlich an einem großen Rondell aussteigen musste und man mir die Haltestelle des Thatta-Busses zeigte. Mein Gott, wie sah das hier aus! Überall lagen Obdachlose herum, stöberten Bettler in Abfällen und suchten abgemagerte Köter nach Fressbarem. Ich war schockiert, denn diese elende Ecke weit vor Karatschi stand im krassen Gegensatz zu dem, was ich bisher von dieser Stadt gesehen hatte.
Endlich saß ich im Bus nach Thatta. Auch diesen musste man mir zeigen, denn sämtliche Aufschriften sind hier in Urdu geschrieben. Ich bekam sogar noch Platz, doch dauerte es keine fünf Minuten, und der Bus wurde brechend voll. Die Leute – alles sehr einfache, derbe Menschen – verhielten sich ziemlich hektisch, sie zankten sich um irgendwelche Vorteile, wobei auffiel, dass da die Frauen besonders eifrig waren. Alles war sehr bunt, die kleinen Kinder bestaunten mich einzigen Fremdling, und die Alten riskierten auch recht häufig einen misstrauischen Blick zu mir. Ich hatte jedoch keinesfalls den Eindruck, dass man feindselig war. Als mich jemand danach fragte, woher ich käme und er in Urdu meine Antwort weitergegeben hatte, dass ich Deutscher sei, brach das Eis plötzlich. Wie ich dann hörte, freute man sich, wenn Deutsche herumreisen, doch hasse man die Amerikaner, denen man das Leben hier so schwer wie möglich machen würde. Das war für mich das Zeichen für erhöhte Vorsicht, weil ich keine Lust hatte, hier zufällig das unschuldige Opfer antiamerikanischer Stimmungen zu werden.
Die Tour durch eine ebene, überwiegend trockene wüstenähnliche Landschaft auf relativ guter Straße endete für mich nach unzähligen Stopps und dreistündigen Durchschüttelns kurz vor 10 Uhr in Thatta-Makli – genau vor dem uralten Eingangstor zu den berühmten Makli-Ruinen, obwohl sich die offizielle Haltestelle zirka 200 Meter weiter befand. Dieser individuelle Service wäre einem Ami hier mit Sicherheit nicht zuteil geworden! Ich deponierte meine Tasche in einem kleinen Restaurant in der Nähe des Einganges, dessen Besitzer mich beinahe peinlich herzlich begrüßte und der selbstverständlich gern auf mein kleines, aber wertvolles Gepäckstück aufpassen wollte. Ich vertraute ihm.
Inzwischen war es wieder brütend heiß geworden. Kein einziger Baum hier spendete etwas Schatten. Ich schützte meinen Kopf mit einem Tuch, biss die Zähne zusammen und begann mit der Besichtigung dieser einige Quadratkilometer großen Ruinenlandschaft. So weit meine Augen reichten – Ruinen. Doch bei diesen Ruinen handelt es sich natürlich nicht um irgendwelche, sondern hier liegen in ewigem Schlaf Könige, Heilige, Gelehrte und Philosophen einer längst vergangenen Epoche – einer Epoche voll geistiger Entwicklung und Kultur. Ich ging trotz großer Hitze aufmerksam von Grabbau zu Grabbau und erkannte ohneweiteres unterschiedliche Stilarten, die auf verschiedene Entwicklungsphasen hinweisen.
Die Legende erzählt, dass der Makli-Hügel (abgeleitet von Mekka) von Jam Tamachi auf Bitten eines Religionsgelehrten der damaligen Zeit errichtet wurde. Die Mausoleen teilen sich in drei Gruppen: Die älteste Gruppe wird der Summa-Dynastie aus dem Sind, die ab der Mitte des 14. bis Anfang des 16. Jahrhunderts herrschte, zugeschrieben. Dem bedeutendsten Herrscher dieser Zeit, Nizamuddin, wurde eine Steingruft mit schön geschnitzten geometrischen Mustern errichtet. Es folgten die Turkhan- und die Arghun-Herrscher, deren achteckige Grabstätten ein prächtiges Beispiel für die Kombination von Ziegeln mit Emaille sowie Kacheln mit Glasuren dargestellt. Zur dritten Gruppe gehören die Monumente der Moghul-Stadthalter, deren herausragendstes Bauwerk die Familiengruft des Nawab Amir Khan ist. Während die genannten Bauwerke zum größten Teil leider in schlechtem Zustand sind (es wird jedoch fleißig restauriert), ist das Grabmal des Nawab Mirza Essa Khan, das 1644 vollendet wurde, am besten erhalten. Sehr schön ist die typische Steinmusterung, wobei so gut wie kein Quadratzentimeter nicht behauen wurde. Prächtig das reich verzierte, aus rotem Sandstein bestehende Hauptportal, eines der schönsten Steintore aus jener Zeit.
Fast am Ende dieses Ruinenfeldes angelangt, stieß ich auf eine überaus bunt bemalte Moschee jüngeren Datums, wo sich in überdachten Nebenräumen ein paar Dutzend Pilgerfamilien aufhielten, die mich – barfuß natürlich – ohneweiteres überall hinließen. Auffallend die Farbkombinationen schwarz-rot-gold (!) und die vielen Holzschnitzereien. Sehr familiär ging es hier zu: Die Kinder spielten ungezwungen, plärrten nach ihren Müttern oder weil sie Hunger und Durst hatten, Frauen kochten über offenen Feuern ihre Mahlzeiten, es lag viel Gepäck herum, was auf weite Anreisen schließen ließ. Schließlich sah ich viele ärmliche alte Leute, die im Schatten der Mauern ihre dünnen Bastmatten ausgerollt hatten und schliefen.
Behutsam betrat ich auch das Innere dieser offenbar sehr heiligen Stätte, bewunderte die marmornen Wände und Säulen, die reich verzierten Decken, die Marmorfußböden und nicht zuletzt die vielen roten Blumen auf und an der Grabstätte im Zentrum. Draußen wälzte sich eine herzzerreißend laut weinende junge Frau am Boden, schlug ständig mit ihren Handflächen auf den harten Marmor und ließ sich selbst von ihren Verwandten nicht beruhigen. Ich vermute, dass sie den schmerzlichen Tod eines nahen Angehörigen beklagte.
Mittlerweile war es halb zwölf geworden und derart heiß, dass ich fast glaubte nicht durchhalten zu können. Ich konnte zu meinem Trost jedoch beobachten, dass selbst die Einheimischen sehr unter dieser extremen Mittagshitze litten. So gehörte ich mit zu den dankbarsten Menschen dieses Landes, als ich nach meiner Rückkehr im Restaurant eine gekühlte Coca Cola trinken konnte. Übrigens habe ich niemals im Leben mit so viel Genuss solche Mengen Coca Cola in mich hineingeschüttet, wie in Pakistan.
Mit einer Motorrikscha, die ich auf der Straße in Richtung Thatta-Ort anhielt, ging’s dann bis zu einem kleinen Busbahnhof, von dem aus es eine Weiterfahrtmöglichkeit nach Hyderabad geben sollte. Doch kam ich mir zunächst einmal verlassen vor, denn ich sah hier weder Busse noch Fahrgäste. Schließlich wies mich jemand darauf hin, dass in einer Querstraße zu dieser Hauptstraße die Busse nach Hyderabad stehen würden. O Gott! War ich doch bisher der Meinung, in Indien und Nepal die unmöglichsten Vehikel erlebt zu haben; es gibt also noch eine Steigerung, nämlich »local buses« mitten in Pakistan!
Ich ergatterte noch einen Platz. Alle starrten auf mich, als ob ich soeben vom Mars gekommen wäre. Alles reine Nervensache! Vorne keiften sich ungemein heftig ein paar alte Weiber an. Sämtliche Eisenteile des Busses waren verrostet, die seitlichen Scheiben wurden schon vor Jahren durch fast undurchsichtiges Plexiglas ersetzt, nur der Fahrer hatte noch ein intaktes Fenster. Neben mir hockte am Boden ein an schweren Eisenketten gefesselter Gefangener, dessen Aufseher mit einer uralten Knarre bewaffnet war. Und im Übrigen wurde dieser Bus brechend voll. Abfahrt nach Hyderabad 10 Minuten vor 13 Uhr.
Heiße Fahrt durch Wüsten- und Steppenlandschaft, viel Staub und erbarmungsloses Durchschütteln der Fahrgäste. Irgendwo unterwegs kleine Teepause. Auch ich verließ den Bus, um mir draußen die Gelenke zu ordnen und um an einer Bude einen guten Tee zu trinken. Das Dorf schien namenlos zu sein, bestand nur aus vielleicht dreißig ärmlichen Lehmhütten, wurde von einer schmalen, tiefzerfurchten Straße durchzogen und verfügt offensichtlich weder über Strom, noch Wasser; denn ich sah nirgends eine Leitung, ein Radio oder eine Fernsehantenne. Ein Nest, wie vor tausend Jahren – aber friedlich.
Die eigentlich selbst für Einheimische unzumutbare Fahrt endete um 15.30 Uhr in Hyderabad, einer der wichtigsten Städte im Süden Pakistans am Indus. Ich verließ den Bus rein gefühlsmäßig und hockte mich zunächst erst einmal ins nächste kleine Restaurant, einen dunklen unsauberen Schuppen. Hier holte ich wieder Luft und kühlte mich mit einer Coca Cola. Es wäre schlimm gewesen, wenn es dieses Monopolgetränk hier nicht gegeben hätte!
Nun begann eine lange, beschwerliche Hotelsuche. Zunächst schickte man mich zum »Fanah«-Hotel, wo man mir für 135 Rupien einen Raum anbot, doch ich lehnte dankend ab, denn schließlich zählte ich nicht zu den Nobelreisenden. Im »Ritz«-Hotel war alles belegt. Wurde zum »Gultschtan«-Hotel geschickt, aber das existierte gar nicht mehr. Ich war sauer, schwitzte enorm und wäre beinahe zurück zum »Fanah« gegangen, wenn ich nicht zufällig das »Starlight« entdeckt hätte, einen alten Hotelschuppen in einer Seitenstraße, wo ich für 20 Rupien einen fensterlosen Raum bekam. Das Bett war knochenhart, die Wände beschmiert, der Spiegel nur noch zu einem Drittel vorhanden und der Stuhl hätte mich nicht mehr ausgehalten. Eigentlich für jedermann unzumutbar, aber billig.
Schweiß und Straßenstaub klebte an mir. So musste ich mich erst einmal gründlich waschen, bevor ich mich abermals ins Stadtgewühl wagte, um meinen übergroßen Durst zu löschen und um mich etwas zu orientieren. Mein Gott, was für eine Stadt ist dieses Hyderabad! Motor-Rikschas, Fahrräder, Schuhputzer und -flicker, Kamele, Dreckhaufen, stinkende Lkw und Busse, kreischende Musik, Bettler, Pferde-Rikschas. Tees werden über offenem Feuer am Straßenrand gekocht. Biblisch aussehende Männer mit langen weißen Bärten in Pumphosen und einem Käppi auf dem Kopf. Frauen tief verschleiert. Weiße Kuh trottet herum und sucht im Müllhaufen. Lasten werden auf Köpfen balanciert. Ein Wurzelmann erklärt weitschweifig seine Wunderdrogen und verkauft an gutgläubige Ahnungslose. Dazu ein unglaubliches Menschengewühl, sehr viel Staub und stickige Luft – so meine Tagebuchnotizen im Original.
In der Nähe des Forts hockte ich mich in ein mickriges Restaurant und sah aus sicherer Entfernung diesem wahnwitzigen Treiben zu, das ich in dieser extremen Form bisher nie erlebt hatte. Wie kann eine Stadt nur so dreckig, vollgestopft und kaputt sein! – Wieder im Hotel, setzte ich mich erst einmal eine halbe Stunde vor den Fernsehschirm im untersten Aufenthaltsraum. Was ich sah? Wirbelnde Reklame für Wäscheweiß und Saubermannpulver, für Transistorradios und Kühlschränke und im Anschluss daran den Anfang eines Ami-Streifens »Starsky and Hutch«. Das war nun abermals ein Schock für mich, denn welche Schizophrenie in diesem Land! – Schließlich legte ich mich todmüde auf die harte Pritsche.
Hitze und ein nebenan unablässig fließender Wasserkran verhinderten leider einen erholsamen Schlaf, und als ich am nächsten frühen Morgen aufstand, fühlte ich mich wie gerädert. Ich bekam im Hotel zum Frühstück eine Coca Cola, Tee und vertrockneten Kuchen – sonst war nichts vorhanden – und verließ alsbald das Haus, um gezielt zum Makai-Fort zu gehen, dessen Außenmauern ich ja bereits gestern Abend entdeckt hatte.
Wieder schlängelte ich mich bis vor zum Verkehrsrondell und entschloss mich hier, das riesige Fort erst einmal zu umrunden, denn irgendwo müsste es ja auch einen Eingang geben. Ich ging durch fürchterliche Dreckgassen, hatte Mühe, die vielen Pfützen und tiefen Löcher zu umgehen, überall Schlamm, Dreckberge, Ochsenfahrzeuge und äußerst ärmliche Menschen. Ich hätte nie geglaubt, dass es so etwas überhaupt gibt. Im Regen kann man sich das Chaos hier einfach nicht vorstellen. Die Leute hier hausen schlimmer, als unser Vieh. Unsere Müllabfuhr wäre für sie ein wahrer Traum!
Stets die etwa zehn Meter hohen mächtigen Mauern des Forts vor Augen, kämpfte ich mich weiter ins absolute Chaos hinein, so weit, bis es mir allmählich zu unheimlich wurde und ich im Übrigen auch die Mauer plötzlich nicht mehr sah. Ich musste mich deshalb zur Umkehr entschließen und gestand ein, diese Umrundung einfach nicht geschafft zu haben. Heraus kam ich am Bahnhof, wo mich eine Horde neugieriger Kinder bestaunte, als hätten sie niemals zuvor einen Menschen mit weißer Haut gesehen. Dass ich in Hyderabad keinen einzigen Europäer zu Gesicht bekam, sei nur am Rande erwähnt.
Hier am Bahnhof heuerte ich mir eine Fahrrad-Rikscha an, die mich für fünf Rupien quer durch ganz Hyderabad kurvte bis hin zum Central Jail, einem heiligen Ort, den man hier gesehen haben sollte. Dieser Jail liegt am äußersten Nordende der Stadt und ist von erbärmlichsten Lehmhütten umgeben. Als ich hier abgesetzt wurde und der keuchende Rikschafahrer – ein ziemlich unfreundlicher Bursche – die fünf Rupien in der Hand hatte, kam ich mir wie ausgesetzt vor. Ich wurde aber bald von munteren, ungeheuer schmutzigen Kindern umringt, die mir auf Anhieb zeigten, wo sich der Tomb of Ghulam Shah Kalhora befindet.
Zu diesem Tomb führt ein Staubpfad. Umgeben ist das Grabmal mit einer respektabel hohen Lehmmauer, die durch die Witterungseinflüsse schon sehr gelitten hat. Der Tomb des im Jahre 1771 verstorbenen Shah ist jedoch noch gut erhalten, es ist aber augenscheinlich, dass er nicht gepflegt wird, auch die Anlagen sind in einem beklagenswerten Zustand. Ein freundlicher Wächter und ein paar Kinder begleiteten mich. Innen steht in der Mitte ein großer, mit glitzerndem Tuch überdeckter Steinsarkophag, daneben befindet sich der kleinere Sarg, vermutlich jener der Gattin des Shahs. Der Marmor an den Wänden und auf dem Boden ist alt und brüchig. Als ich schließlich meinte, genug gesehen zu haben, gab ich dem Wächter ein anständiges Bakschisch, worauf sich dieser mit »brüderlicher Umarmung« von mir verabschiedete.
Gleich daneben befindet sich der Tomb des Ghulam Nabi Kalhora, der 1780 verstarb und hier seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Dieser Tomb wurde mir von einem anderen Wächter aufgeschlossen, der mir sagte, dass ich mich hier frei bewegen könne. In der Mitte des Grabmals steht ebenfalls ein großer steinerner Sarkophag flankiert von zwei kleineren. Von den blauen Wandkacheln sind nur noch Reste vorhanden, und aus Richtung der hohen Kuppel schallten unsere Stimmen zurück.
Nach diesen beiden Besichtigungen ließ ich mich mit einer Fahrrad-Rikscha zurück zum Bahnhof fahren, denn zu Fuß wäre das absolut unmöglich gewesen. Man darf hier in Hyderabad sowieso nur alle Minuten Luft holen, sonst geht man kaputt. – Im Restaurant am Verkehrsrondell direkt an der Fortmauer kam ich erst wieder zu mir, als ich eine Coca Cola und etwas Chapatti mit scharfer Sauce im Magen hatte; mir war unverständlich geblieben, warum es in dieser Stadt keinen Reis gibt.
Abermals Stromausfall – wie gestern Abend. Beleuchtet waren nur noch die vielen Verkaufsbuden, die kleinen Straßenrestaurants und die Fahrzeuge, jedoch gefährlich schummerig beziehungsweise höchst unzureichend – besonders die Esels- und Kamelkarren. Welch ein Irrenhaus, diese Stadt! Ein fast verdörrter Bettler setzte sich genau vors Restaurant in den Dreck. Rikschas knatterten und qualmten, mit tausend Mustern und Blumen bemalte Pkw, Lastkraftwagen und Busse quälten sich hindurch, Esel-Tongas haben’s da sehr schwer sich zu behaupten. Links neben mir schmiss ein Chapattibäcker ununterbrochen seine dünnen Fladen auf ein glühendheißes, nach oben hin gewölbtes Backeisen, Hitze, Staub, Lärm, kein einziger Quadratmeter saubere Straße oder intakter Fußweg, zu viele Menschen hier. Aus diesem Irrenhaus wäre ich am liebsten geflohen!
Natürlich hatte auch mein Hotel keinen Strom, man fummelte mit Taschenlampen herum oder behalf sich mit Kerzen. Als ich mich mehr tot als lebendig auf die Pritsche legte, wusste ich, die bisher verrückteste Stadt des Orients kennengelernt zu haben. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass da noch mal eine Steigerung drin wäre – ja, vielleicht Hyderabad im Wolkenbruch!