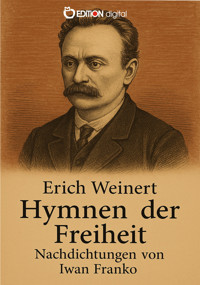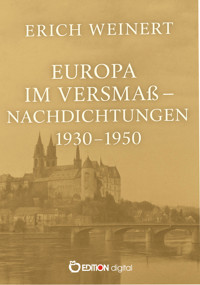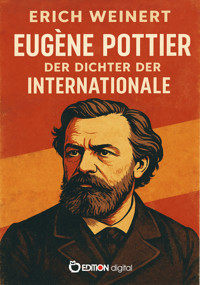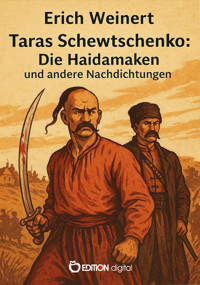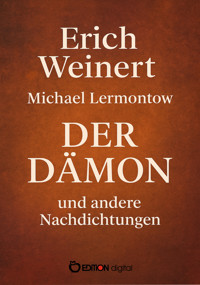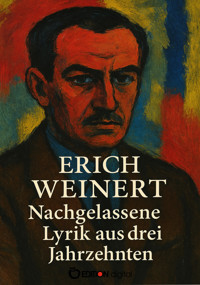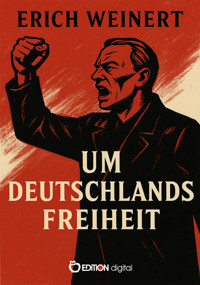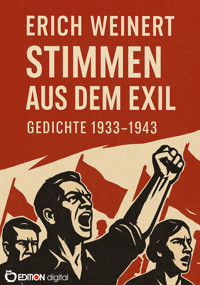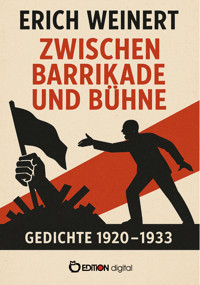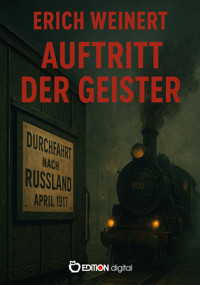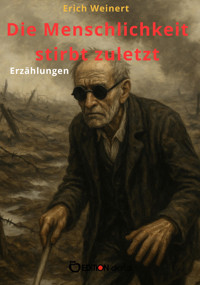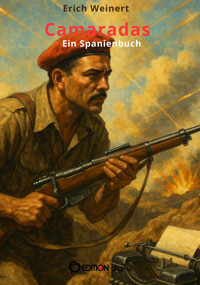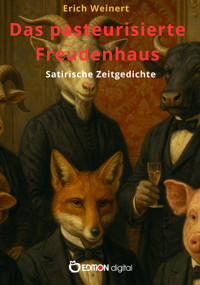2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinen packenden, autobiografisch gefärbten Berichten nimmt Erich Weinert die Leser mit an die Frontlinien der politischen Auseinandersetzungen der Weimarer Republik, in die Hinterhöfe der Arbeiterviertel, in Kneipen, Versammlungssäle und Gefängniszellen. Mit scharfem Blick und unverstellter Sprache erzählt er von Begegnungen mit Ernst Thälmann, vom 1. Mai 1932 im Berliner Lustgarten und vom heldenhaften Leben des Kommunisten Fiete Schulze. Weinerts Erzählungen sind keine bloßen Erinnerungen – sie sind gelebte Geschichte, politisches Zeugnis und literarisches Dokument zugleich. Eine Sammlung, die den Nerv der Zeit trifft – damals wie heute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Erich Weinert
Fiete Schulze – Ein Name, ein Kampf
ISBN 978-3-68912-519-6 (E–Book)
Die Berichte wurden dem Sammelband „Prosa – Szenen – Kleinigkeiten“, erschienen 1955 im Verlag Volk und Welt Berlin, entnommen.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
ARBEITER UNTER ARBEITERN
Es war im März 1930. Die Hamburger Arbeiterschaft war zu Zehntausenden nach dem Ohlsdorfer Friedhof marschiert, wo die Feier für die Opfer der Revolution stattfand. Von einer Bank am Kapellenhügel sprachen Ernst Thälmann und ich. Tausende von Fahnen leuchteten in der Märzsonne. Zehntausende von gespannten Gesichtern schauten zum Hügel hinauf, als Thälmann sprach. Die Weiteststehenden konnten seine Stimme gar nicht mehr vernehmen; aber sie verstanden an seinen Gesten, was er sagte. Und sie hoben die Fäuste als Zustimmung.
Nach dieser Kundgebung sollten wir in einem Meeting in Altona sprechen. Da aber der Aufmarsch in Ohlsdorf zwei Stunden später geendet hatte, als vorgesehen war, so war die Altonaer Versammlung inzwischen geschlossen worden.
Wir hatten nun ein paar Stunden Zeit bis zur Abendversammlung. Ernst Thälmann, der Genosse Sch. und ich standen auf der Straße; und Thälmann sagte: „Wat mok wi nu?“
Ein Hitler oder Göring wären in einem solchen Falle wohl in ihren Luxuswagen zum Diner in die Villa irgendeines ihrer Geldgeber gefahren.
Ernst Thälmann sagte: „Kommt, Genossen, setzen wir uns hier in eine kleine Budike, wo wir ein bisschen diskutieren können!“
Wir gingen in die nächste Eckkneipe und bestellten drei Becher. Ernst sah sich aufmerksam im Lokal um, dann verzog er das Gesicht und sagte: „Hier is et muffig, hier verkehrt nix Gutes! Kommt!“
Wir gingen durch die kleinen Straßen. Endlich fanden wir ein kleines Lokal, das Ernst Thälmann gefiel. „Hier sitzen wir gut. Das ist ein solides Proletenlokal.“
Da es Sonntagnachmittag war, saßen wir fast allein im Gastzimmer. Nur selten kam ein Gast, der im Vorbeigehen an der Theke sein Glas Bier trank.
Meine Begegnungen mit Ernst Thälmann waren im Trubel der Versammlungskampagnen immer nur flüchtig gewesen. An diesem stillen Sonntagnachmittag saß mir nun nicht der ernste und arbeitsame Parteiführer gegenüber, sondern der vitale, liebenswerte und heitere Mensch. Er sprach fast nur Hamburger Platt und erzählte mit viel Humor, was die sozialdemokratische Presse ihm alles anzuhängen versuchte. Zu seiner Tochter hätte vor einigen Tagen eine Mitschülerin bedauernd gesagt: „Nun hast du ja keinen Vater mehr, deinen Teddybär haben sie ja gestern in die Heilanstalt geholt!“ Mit einer bösen Niedertracht hatten die Gegner versucht, Thälmann in den Augen der Hamburger Arbeiter herabzusetzen.
An der Wand des Gastzimmers entdeckten wir ein Bild. Es war ein Holzschnitt in der Art der Neunzigerjahre, auf welchem in einer Reihe von Abbildungen Rückkehr und Empfangsfeierlichkeiten der unter dem Sozialistengesetz Ausgewiesenen dargestellt waren. „Na“, sagte Ernst Thälmann, „so gemütlich würde das wohl das nächste Mal nicht wieder zugehen!“ Er betrachtete das Bild und meinte: „Das ist aber ein interessantes Dokument!“ Er rief die Wirtin und fragte sie, ob sie das Bild nicht verkaufen wolle. „Nein“, sagte die, „das ist ein sozialdemokratisches Verkehrslokal, und das Bild hängt schon bald vierzig Jahre hier.“
Mittlerweile waren einige Arbeiter an der Theke erschienen. Sie flüsterten miteinander. Zweifellos hatten sie Thälmann erkannt. Einer ging wieder hinaus und brachte nach kurzer Zeit ein Dutzend anderer mit. Aller Augen waren nun auf unseren Tisch gerichtet. Aber es war kein einziger feindseliger Blick wahrzunehmen. Die Hetze gegen Thälmann konnte bei den einfachen Proleten nicht verfangen. Wir hörten keine böse oder höhnende Bemerkung; ihre Unterhaltung hatte einen durchaus ernsten Charakter. Vielleicht stellten sie Vergleiche an: Hier sitzt der Kommunistenführer bescheiden im sozialdemokratischen Arbeiterlokal, ein Arbeiter unter Arbeitern! Kann man sich dagegen vorstellen, dass ein Wels* einmal in einem Berliner Kommunistenlokal einkehrte?
Als wir das Lokal verließen, grüßten die Arbeiter ruhig und achtungsvoll. – Ich habe in den Jahren der Emigration, sooft ich an Ernst Thälmann dachte, auch an die sozialdemokratischen Arbeiter in der Altonaer Kneipe denken müssen. Vielleicht sitzen einige von ihnen auch heute noch da, in Flüsterunterhaltung; und einer von ihnen sagt: Hier in dieser Ecke hat auch mal unser Genosse Thälmann gesessen!
* Otto Wels war von 1919 bis in die ersten Monate der Nazidiktatur einer der rechten Führer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, einer derer, die die Hauptverantwortung für die Spaltung der Arbeiterschaft und damit für die Möglichkeit der Errichtung eines offen faschistischen Regimes in Deutschland trugen.
DER ERSTE SCHRITT
Erinnerung an den Ersten Mai 1932
Der letzte Maiaufmarsch unserer Partei vor dem Einbruch der braunen Schlammflut fand im Berliner Lustgarten statt. Da die SPD auch Anspruch auf den Platz gemacht hatte, so hatte der Polizeipräsident angeordnet, dass sie von elf bis eins und die KPD von eins bis drei Uhr demonstriere. Um eins hätte der Platz also von den Demonstranten der SPD geräumt sein müssen. Das war geschehen; aber der Platz wurde nicht ganz leer. Es waren nämlich Tausende von Sozialdemokraten dort geblieben, zu unserer großen Verwunderung.
Man fragte einige, weshalb sie geblieben wären. Sie antworteten: „Wir möchten einmal hören, was eure Meinung ist, was jetzt getan werden muss.“
Dass sie nicht in feindseliger Absicht oder um uns zu stören geblieben sein konnten, war uns sofort klar. Im Gegenteil: es war der erste schüchterne Annäherungsversuch; es war eine spontane Aktion, eigentlich von niemandem gemacht, in ihrer Bedeutung vielleicht auch vielen nicht bewusst. Es war etwas ganz Neues.
Was das für unsere Stimmung bedeutete, dass zum ersten Mal bei unserer größten Kundgebung Tausende von sozialdemokratischen Arbeitern erschienen, kann nur ermessen, wer die bitteren Kämpfe miterlebt hat, die wir jahrelang führten, um die sozialdemokratischen Arbeiter von der Notwendigkeit der brüderlichen Einheit zu überzeugen. Wer es erlebt hat, bis zu welcher Bösheit und Feindseligkeit die sozialdemokratischen Arbeiter gegen uns verhetzt worden waren, wird verstehen, dass uns an diesem Maitag wirklich frühlingshaft zumute war.
Lasst mich einen Vorfall erzählen, dessen Augenzeuge ich dreiviertel Jahr vorher im selben Lustgarten war.
Das Reichsbanner* hatte zur Feier seines siebenjährigen Bestehens einen Paradeaufmarsch veranstaltet. Das war eine gute Gelegenheit für uns, mit den sozialdemokratischen Massen zu diskutieren, die sich im Lustgarten versammelt hatten.
Die Losung ging durch Berlin: Friedliche Diskussion! Viele Genossen waren gekommen und hatten sich im Lustgarten verteilt. Ich stand mit einem Genossen unter den Sozialdemokraten, in der Nähe des Doms.
Der Aufmarsch und das offizielle Programm hatten noch nicht begonnen. Auf der breiten Freitreppe des Doms war eine Unmenge Polizei postiert. Die Offiziere liefen nervös hin und her.
Wir fragten einige Arbeiter, weshalb denn da so viel Polizei wäre, es handle sich doch um eine Demonstration staatserhaltenden Charakters. Sie sagten: „Die Kozis (mit diesem albernen Witzwort bezeichneten sie uns Kommunisten) wollen wahrscheinlich Radau verüben.“
Als ich etwas verwundert fragte: „Wozu Radau?“, wurden sie schon misstrauisch und beobachteten uns schärfer.
„Hier ist schwer ranzukommen“, sagte ich zu meinem Freunde.
Plötzlich wird an irgendeiner Stelle des Platzes die Internationale gesungen. Der Gesang schwillt schnell an und erfasst bald den ganzen Lustgarten. Wir nehmen unsere Mützen ab und singen. Alles um uns singt mit. Da hören wir ein paar Pfiffe vom Dom, sehen, wie die Offiziere den Mannschaften Befehle erteilen. Die Sozialdemokraten sehen das ebenfalls. Es dämmert ihnen, dass die Internationale wohl nicht zum Programm einer „staatserhaltenden“ Parade gehören kann. Einer nach dem anderen stockt im Singen. Der Gesang verstummt. Wir setzen die Mützen auf und schweigen. Die Polizei stürzt in langen Linien durch die Masse. Jetzt rufen die Sozialdemokraten um uns: „Die Kozis haben provoziert!“ Es geht ein wüstes Denunzieren los. „Die die Mützen abgenommen haben, sind Kommunisten! Der da! Und der da!“ Sie zeigen auf uns beide. Die Polizei aber in ihrer Raserei kann nicht alles fassen, was angegeben wird; so schlüpfen wir durch und drängen in andere Gruppen.
Ich frage einen Mann: „Seit wann ist denn das Singen der Internationale verboten?“
Ein anderer hört die Frage und springt heran! „Ich kenn Sie! Wachtmeister! Hier ist noch einer!“
Ehe die Polizei da ist, sind wir aber schon woanders im Gedränge. Ich sehe einen Denunzianten herumsuchen; und da kann ich es mir nicht mehr verkneifen: „Ihr denunziert eure Klassengenossen, weil sie die Internationale singen? Pfui!“ Kurz darauf fielen wir der entgegenkommenden Polizeihorde in die Hände, die uns dann mit Hunderten anderen über die Brücke bis weit in die nächste Straße hineinprügelte.
Schweigend, niedergeschlagen, aller Hoffnungen beraubt, gingen wir nach Hause.
Und nun versteht ihr wohl, was es für uns bedeutete, am Ersten Mai 1932 Tausende sozialdemokratischer Arbeiter unter uns zu sehen, und was wir dabei empfanden.
Diesmal war eine technische Neuerung eingeführt worden, die der Kundgebung einen besonders einheitlichen und geschlossenen Charakter gab. Früher nämlich sprachen an vielen Stellen des Platzes Redner, die aber immer nur von einem kleinen Kreis der Umstehenden verstanden wurden. Diesmal war ein einziger Rednerturm auf der Schlossterrasse errichtet, der ein empfindliches Mikrofon trug. Diesmal sprach nur ein Redner, und dieser Redner war Ernst Thälmann.