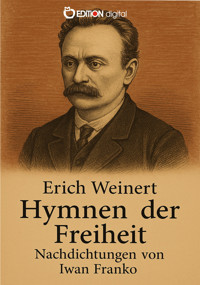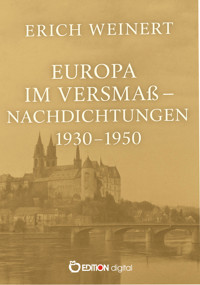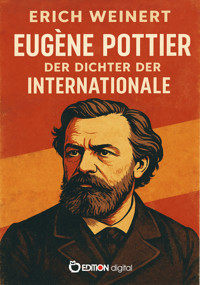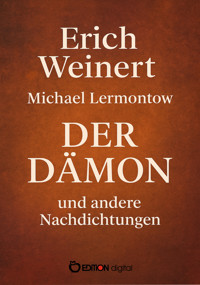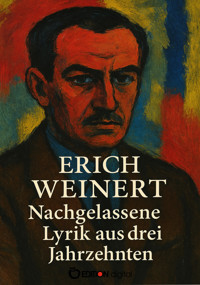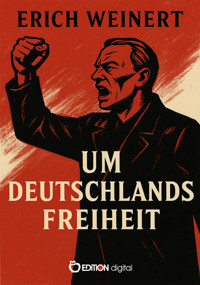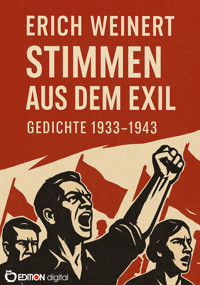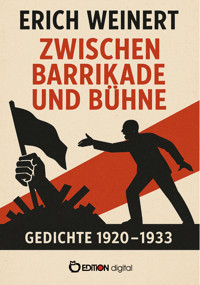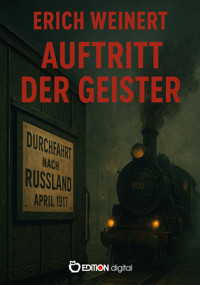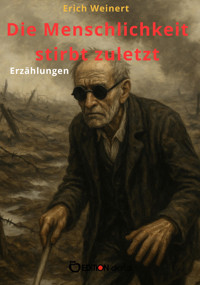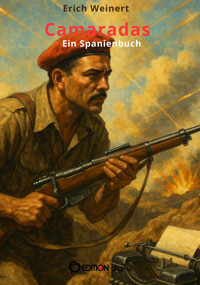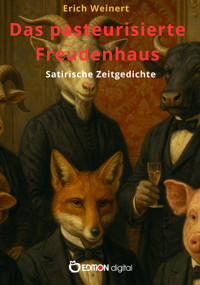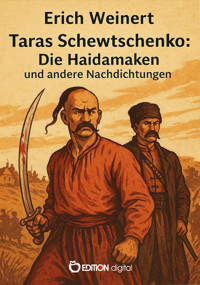
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Taras Schewtschenkos Epos Die Haidamaken zählt zu den bedeutendsten Werken der ukrainischen Literatur. In eindrucksvoller Bildsprache schildert der Dichter den großen Bauernaufstand von 1768 gegen die polnische Adelsherrschaft – ein Aufschrei gegen Unterdrückung, Willkür und nationale wie religiöse Demütigung. Erich Weinert hat dieses Werk während seines Moskauer Exils kongenial ins Deutsche übertragen. Mit sprachlicher Wucht und politischer Leidenschaft bringt er die Figuren, ihre Qualen und ihren Freiheitswillen eindringlich zum Ausdruck. Diese literarische Annäherung ist nicht nur ein historisches Zeugnis, sondern auch eine Erinnerung daran, wie viel Mut es braucht, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Erich Weinert
Taras Schewtschenko: Die Haidamaken und andere Nachdichtungen
ISBN 978-3-68912-554-7 (E–Book)
Auszug aus dem Sammelband „Nachdichtungen“, erschienen 1959 im Verlag Volk und Welt, Berlin.
Das Titelbild wurde mit der KI erstellt.
© 2025 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Godern
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Tel.: 03860 505788
E–Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
DIE HAIDAMAKEN
An Wassili Iwanowitsch Grigorowitsch zur Erinnerung an den 22. April 1838
VORBEMERKUNG
Die Haidamaken sind das größte und inhaltlich bedeutendste Werk Schewtschenkos. In diesem Gedicht gab Schewtschenko ein erschütterndes Bild aus dem Bauernaufstand. Im Verlauf des ganzen achtzehnten Jahrhunderts flammten in der rechts des Dnjepr gelegenen Ukraine immer wieder Aufstände auf, vom polnischen Adel, der Schlachta, durch unerträgliche Knebelungen hervorgerufen. Das ukrainische Volk wurde durch Leibeigenschaft und national-religiöse Konflikte zur Verzweiflung getrieben. Nun rächten sich die Aufständischen, die Haidamaken, grausam an den Panen, ihren Unterdrückern.
Im Jahre 1768 brach ein mächtiger Bauernaufstand aus, die sogenannte „Koliiwstschina“, deren Anführer Maxim Shelesnjak und Iwan Gonta waren. Der Aufstand flammte im Kreis Tschigirin auf und verbreitete sich unaufhaltsam über die ganze Ukraine. Die Aufständischen nahmen die Stadt Uman. Die Zarenregierung schickte den Polen Truppen zu Hilfe; sie erschrak über das bisher noch nicht dagewesene Ausmaß der Bewegung. Der Aufstand wurde unterdrückt, Shelesnjak nach Sibirien verbannt, Gonta nach furchtbaren Folterungen von den Polen hingerichtet.
Diese Ereignisse werden in dem Gedicht geschildert. Damals war aber die Geschichte der Koliiwstschina noch nicht genügend erforscht; der Dichter folgte in vielen Punkten nur der mündlichen Überlieferung, die zuweilen von der historischen Wirklichkeit abwich.
Das Gedicht erschien erstmalig 1841. Die zaristische Zensur machte dem Dichter dauernd Schwierigkeiten. „Mit den ‚Haidamaken’ hatte ich viel Kummer“, schrieb Schewtschenko später. „Das Zensurkomitee ließ die Dichtung kaum durch. Es hieß, sie sei ‚aufrührerisch’ – und das sagt alles.“
Die Haidamaken sind Wassili Iwanowitsch Grigorowitsch gewidmet, dem Konferenzsekretär der Akademie der Künste in Petersburg, der sich für die Befreiung Schewtschenkos aus der Leibeigenschaft tatkräftig eingesetzt hatte. In einer Widmung, die dem Gedicht vorangestellt ist, erinnert der Dichter an den Tag seiner Freikaufung.
In dem einleitenden Kapitel (Schewtschenko hat ihm keinen besonderen Titel gegeben) stellt er Betrachtungen über seine Laufbahn als Dichter an, polemisiert gegen die reaktionäre Kritik und sendet „seine Söhne, die ,Haidamaken‘ auf den Weg in die weite Welt.
E. W.
Im Sommer 1940 begann Weinert in Moskau mit der Nachdichtung Taras Schewtschenkos. Erich Weinert hatte zusammen mit Alfred Kurella, Hugo Huppert, Hedda Zinner, Franz Leschnitzer u. a. vom Fremdsprachenverlag Kiew den Auftrag erhalten, das Gesamtwerk des großen ukrainischen Nationaldichters ins Deutsche zu übertragen. Der Kriegsausbruch im Juni 1941 verhinderte die Drucklegung.
Weinert veröffentlichte seine Nachdichtung: Taras Schewtschenko „Die Haidamaken und andere Dichtungen“ 1951 im Verlag Volk und Welt, Berlin. Der hier veröffentlichte Text entspricht dieser Erstausgabe.
VORSPANN
Alles kommt und geht – in endlosem Kreise …
Wo schwand es im Dunklen? Wo stieg es herauf?
Nichts wissen wir, nicht der Tor, nicht der Weise.
So lebt es … So stirbt es … Das eine blüht auf,
Das andere verwelkt, auf ewig verloren,
Verloren wie tote Blätter im Wind.
Nur der Sonne Licht wird wiedergeboren,
Und nur die Sterne werden nicht blind
Und schweifen wie ehmals … Und du, mein Blasser,
Hinwandelst du ruhig, des Himmels Sohn;
Du schaust dich in Rinnlein und Brünnlein, im Wasser,
Des Meeres. Wie einst über Babylon
Du schwebtest und seinen Gärten und Hainen –
So wirst du noch unsren Urenkeln scheinen.
Du ewiges Antlitz! … Von Kind an schon
Liebt ich, mit dir wie ein Bruder zu plaudern,
Zu lauschen in deinen Flüsterwind.
Du bist bei mir, wenn mich Kummer umschaudern.
Ich bin ja kein einsames Waisenkind:
Ich habe auch Kinder. Ins Grab mitnehmen?
Das wär eine Sünde: Die Seele lebt fort.
Sie würde sich drüben weniger grämen,
Wenn hüben ihr läset das Kummerwort,
Das ihr wie Tränen vom Herzen geflossen,
Die einst sie unter Schluchzen vergossen.
Ich begrabe sie nicht, die Seele lebt fort.
Denn wie die Himmel nicht Maß und Wende,
So kennt auch die Seele nicht Anfang noch Ende.
Ihr fragt mich: Wo ist sie? Ein müßiges Wort!
So lasst uns schon ihrer auf Erden gedenken.
Wie bitter wär’s, ruhmlos von hinnen zu gehn.
Lasst, Mädchen, sie nicht aus den Herzen verwehn.
Sie liebte ja, auch mit Tränen zu tränken
Und ließ euren Ruhm in Liedern bestehn.
Nun schlaft noch! Bald tagt es. Und euch zu beschenken,
will ich den Hetman jetzt suchen gehn.
Meine Söhne, Haidamaken!
Groß und weit die Erde!
Macht euch auf! Und eurem Zuge
Glück und Segen werde!
Doch ihr, unerfahrne Jungen,
Arm’ und mutterlose,
Meine Söhne, wer auf Erden
Wird euch zärtlich kosen?
Meine Söhne! Meine Adler!
Auf der Heimat Wegen
Minder als in fremdem Lande
Wird euch Leid begegnen.
Dort noch fandst du Bruderliebe,
Die dein Herz betreute.
Aber hier … nicht leicht zu leben!
Triffst du hier die Leute:
Neunmalkluge, Afterweise,
Hochgelahrte Wichte,
Möchten gar noch, dass die Sonne
Sich nach ihnen richte.
„Sie geht auf, fängt an zu leuchten,
Ohne uns zu fragen,
Ob sie falsch, ob richtig leuchte …“
Was willst du drauf sagen?
Und gehorcht sie? Scheint doch wirklich,
Dass sie nicht so zünftig
Aufgeht, wie die Weisen wünschen …
Ist auch sehr vernünftig.
Und was reden sie von euch denn?
Die ich euch doch schätze!
Lustig machen sich die Kerle,
Hört doch, was sie schwätzen:
„Mögen sie gewickelt schlafen
In verblichnen Fahnen!
Bald wird man euch was erzählen
Von dem Atamanen! (Ataman oder Hetman hießen im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert in der Ukraine zuerst die Führer der Kosakenschaft und später, seit den Zeiten Bogdan Chmelnitzkis, die Regenten der Ukraine.)
Wie dem Narren die Geschichten
Aus dem Munde quellen!
Ein Jarema ist es, den er
Wünscht uns vorzustellen.
Doch dem Narren mit den Bastschuhn
Nutzen nichts die Prügel.
Von den Atamanen blieben
Nur die Gräberhügel.
Und auch die Kurgane wurden
Wieder aufgegraben.
Macht uns vor, wie einst die Alten
Schön gezwitschert haben.
Singst umsonst, Freund! Ruhm und Ehre
Bringt dir keine Groschen.
Wozu singst du, was uns langweilt?
Sing was von Matroscha,
Sing von Liebchen, Grübchen, Stübchen,
Rittern, Edelfrauen!
Das ist Ruhm! Und der singt immer:
„Rollt das Meer, das blaue“ –
Weint sogar; im Hintergrunde
Lungert die Gemeinde
Im zerschlissnen Mantel! …“ – Bravo!
Besten Dank auch, Freunde!
Warm der Pelz! Doch mir zu eng nur,
Ist nicht anzukriegen.
Guter Ratschlag, doch gefüttert
Ist er nur mit Lügen.
Ihr verzeiht mir! … Mögt ihr schreien!
Ich hab keine Ohren.
Hab noch nie mir Rat erbeten
Von den weisen Toren.
Bin ein Narr, vor meinem Häuschen
Sitz ich auf dem Steine,
Sing mein Lied, und wie ein Junge
Schluchz ich oft und weine.
Sing mein Lied – der Wind, der dunkle,
Wiegt das Meer gelinde,
Dämmrung fällt, die Gräberhügel
Flüstern mit dem Winde.
Sing mein Lied – und die Kurgane
Öffnen ihre Schächte;
Wie ein Meer die Saporoshzen
Brausen durch die Nächte;
Auf den Falben die Hetmane,
Ihre Stäbe schwingend,
Sprengen weit voran … Die Winde
Wild im Schilfrohr singen
Wie der sprühnden Wasserschnellen
Dröhnende Gewalten.
Hör sie brausen weit. Und traurig
Frag ich meinen Alten:
„Seid ihr auch so traurig, Alter?“
„Siehst’s an meiner Miene?
Immer, wenn er tobt, der Dnjepr,
Weint die Ukraine …“
Nun auch ich; doch da – nun seh ich,
Wie in alten Trachten
Reiten her die Atamane
Mit den Hundertschaften.
Blitzend Gold! Zu meiner Hütte
Reiten die Erwählten,
Sitzen ab, bei mir zu rasten.
Was sie mir erzählten?
Vieles aus der Ukraine,
Manche Unternehmung,
Ssetschs Erbauung („Ssetschs Erbauung“: die Saporosher Ssetsch war eine Kosakenorganisation in der Ukraine, die im sechzehnten Jahrhundert links des Dnjeprs entstand. Sie wurde unter Katharina II. im Jahre 1775 aufgelöst.), wie sie schwammen
Durch die wilde Strömung,
Wie sie sich nach weiter Seefahrt
Bei Skutari (Vorort von Konstantinopel, heute Stambul.) wärmten,
Wie sie, ihre Pfeifchen rauchend,
Über Polen schwärmten,
Wie sie in der Heimat schmausten,
Stopften sich die Backen.
„Spielt die Kobsa! Wirt, zu trinken!“
Riefen die Kosaken.
Der schenkt ein; das leere Gläschen
Auf den Boden splittert.
Und nun klimpert, klirrt und tanzt es
– Ganz Chortiza (Insel im Dnjepr, wo eine Zeit lang die Ssetsch saß) zittert –,
Und der Takt des tollen Hopaks
Wirbelt durch die Glieder;
Rundum geht der volle Humpen.
Trocken kommt er wieder.
„Brüder, aus jetzt die Shupanc!
Sturm, feg übern Acker!
Spielt die Kobsa: Wirt, zu trinken!
Unser Glück kommt wacker!“
Hand in Hüften, hüpft und schwippt es,
Hockt es auf den Hacken,
Alt und jung. – „So richtig, Kinder!
Werdet Herrn, Kosaken!“
Ehrbar nur die Atamane
Noch beim Mahle sitzen,
Steif und würdig, doch schon sieht man,
Wie die Augen blitzen …
Plötzlich wirbeln sie dazwischen,
Stampfen durch die Schenke.
Unter Tränen muss ich lächeln,
Wenn ich daran denke.
Lasst mich dran ergötzen, sei’s auch unter Tränen! …
Nein, ich bin nicht einsam, wenn das um mich lebt.
In der armen Kammer, bei des Wetters Dröhnen,
Immer ziehn Kosaken, in den Traum verwebt;
In der armen Kammer geht des Meeres Stöhnen,
Und die Gräber trauern, und die Pappel bebt.
Und die Grizja hör ich singen von der Schönen.
Nein, ich bin nicht einsam, weiß, was um mich lebt.
Seht, hier ist mein Ruhm und Reichtum,
Den ich nie verschmähte!
Nochmals Dank für euren Ratschlag,
Hinterlistige Räte!
Nun genug von meinen Reden!
Eh sie mich begraben,
Ist viel Leid noch auszugießen.
Mögt euch wohl gehaben!
Nun, so will ich mit den Kindern
Auf den Weg mich wenden.
Wünschte, dass sie dann den Alten,
Den Kosaken, fänden,
Der schon wartet, sie mit Tränen
An sein Herz zu zerren.
Doch genug. Noch einmal sag ich:
Ich bin Herr der Herren!
Und so sitz ich und so sinn ich
Hinterm kalten Ofen:
Wer wird hier mein Held? Wen frag ich?
Hell wird’s schon im Hofe;
Sonne macht den Mond erbleichen.
Meine Haidamaken
Standen, beteten; ich sah sie
Ihre Sättel packen.
Standen um mich, kindlich-traurig,
Neigten sich: „O segne,
Segne uns, dass unsren Zügen
Ruhm und Glück begegne!
Dass wir unsre Freiheit retten
Aus den trüben Zeiten.“
Ja … Die Welt ist nicht das Dörfchen,
Wer wird euch denn leiten?
Sagt mir, einen guten Hetman
Kann man sich nicht borgen.
Unerfahren seid ihr, Jungens,
Und das macht mir Sorgen!
Tüchtig seid ihr aufgewachsen,
Geht auf guter Fährte.
Alle, die jetzt in die Welt gehn,
Werden dort Gelehrte.
Ach, ich selbst konnt euch nichts lehren.
Ich ward auch geschlagen,
Und nicht zaghaft: Seht, doch das hat
Auch was eingetragen!
Tma, mna kann ich, doch oksija (Tma, mna, oksija: Schewtschenko hatte in seiner Jugend das Lesen noch nach der kirchenslawischen Fibel erlernt. Tma und mna sind Silben aus dieser Fibel; oksija ist die kirchenslawische Bezeichnung für den Begriff Betonung.)
Ist mir heut noch schleirig.
Doch was sag ich euch? Kommt, Söhne,
Bleibt mir frisch und feurig!
Seht, hier ist ein lieber Vater
(Nicht der Anverwandte) („Seht, hier ist ein lieber Vater (nicht der Anverwandte)“ bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf W. I. Grigorowitsch, an den die Widmung gerichtet ist.),
Weiß, er gibt euch guten Ratschlag,
Weil er alles kannte;
Heimatlos und ohne Eltern
Lebt’ er seine Tage;
Nehmt ihn, wie er ist – sein Herz ist
Vom Kosakenschlage!
Was ihm einst die arme Mutter
Sang in Glück und Grämen
An der Wiege, niemals wird er
Sich des Liedchens schämen.
Niemals schämt er sich des Alten,
Der im Heimatlande
Arm und blind am Zaun sang, immer
Singt er seine Schande.
Ja, er liebt das Lied der Wahrheit,
Der Kosakenehre.
Ja, er liebt es! Gehn wir, Söhne,
Nehmt die gute Lehre!
Hätte einst er nicht gewonnen
Schon das Herz des Knaben,
Längst schon läg ich in der Fremde
Unterm Schnee begraben.
Hätten um mein Grab gestanden:
„Niemand wird ihn missen …“
Schwer ist’s, auf der Welt zu leiden
Und von Schuld nichts wissen.
Schwer, doch alles geht vorüber!
Und nun lasst uns eilen!
Ja, auch in der toten Fremde
Wird er bei euch weilen,
Lächeln wird er, als ob ihm der
Eigne Sohn erschiene.
Also zum Gebet, und ziehn wir
Durch die Ukraine!
Guten Tag, mein teurer Vater!
Hier im Brüderkreise
Segne meine lieben Kinder
Für die weite Reise!
Petersburg,
7. April 1841
EINLEITUNG
In der Einleitung schildert der Dichter den Zustand völliger politischer Anarchie, in der sich Polen im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert befand.
Damals war der Adel Polens
Zügellos am Wirken,
Schlug sich mit den Moskowitern,
Schlug sich mit den Türken,
Schlug sich mit den Deutschen … Damals …
Ja, das waren Zeiten!
Lebte hin in Rausch und Hochmut,
Müßiggang und Streiten.
Könige waren seine Puppen …
Zwei nur ausgenommen:
Stephan und Johann Sobieski (Stephan (Batory) und Johann Sobieski: polnische Könige, der erste im sechzehnten, der andere im siebzehnten Jahrhundert.)
War nicht beizukommen.
Doch die andern armen Teufel
Waren leicht zu biegen.
Wild im Landtag schrie der Adel,
Und die Nachbarn schwiegen,
Schauten zu, wie sich die Könige
Aus dem Staube machten,
Hörten das Gelärm des Landtags,
Wie die Herren lachten.
„Nie pozwalam! Nie pozwalam!“ („Nie pozwalam!“ (Ich erlaube es nicht): Veto, mit dem nach den polnischen Gesetzen jedes Mitglied des Sejms gegen jeden Beschluss des Sejms protestieren konnte.)
Toben die Schlachzizen,
Legen Feuer an die Hütten,
Und die Säbel blitzen.
Die verrufne Herrschaft hätte
Lang kein End genommen,
Wäre damals Ponjatowski (Ponjatowski (Stanislaus II., August): der letzte polnische König (1764–1795), wurde mit Unterstützung Katharinas II. auf den Thron gewählt.)
Nicht zum Thron gekommen.
Den Adel dacht er kleinzukriegen
Und seinen Hochmut nicht zu scheun.
Und wie die Mutter ihre Kinder,
So wollt er alles recht betreun.
Vom übermütigen „Nie pozwalam“
Wollt er das Regiment befrein.
Doch da … Ganz Polen stand in Flammen.
Die Herrchen wurden blass … Sie schrein:
„Auf Ehr, kein Henker soll dich schonen!
Du Knechtshund Moskaus, gib nur acht!“
Und mit Pulawskis Eskadronen
Herritt die ganze Adelsmacht,
Ja, hundert Konföderationen! (Konföderationen: bewaffnete Verbände; die Schlachta hatte das Recht, sie zum Schutz ihrer Interessen gegen Beschlüsse des Königs oder des Sejms aufzustellen. Im Jahre 1768 wurde in der Stadt Bar die Barsche Konföderation mit Pulawski und Krasinski an der Spitze ausgerufen. Später stieß Paz zu ihr, der Führer der litauischen Konföderation. Diese Konföderation war gegen die Erlasse der polnischen und der russischen Regierung gerichtet, die den rechtgläubigen (griechisch-katholischen) Edelleuten die gleichen Rechte zugestehen wollten wie den römisch-katholischen. Die wilden Ausschreitungen der Truppen der Konföderation, die in der Ukraine plünderten und brandschatzten, waren der unmittelbare Anlass für den schon lange reifenden Aufstand.)
Und die Herrn Konföderierten
Schwärmten durch Wolhynien,
Litauen, Moldawia, Polen
Und die Ukraine.
Ihre Freiheit? Ach, sie hatten
Ganz darauf vergessen!
Gingen gar mit reichen Juden,
Um das Volk zu pressen.
Mit Vernichtung, Mord und Bränden
Hausten die Verwegnen …
Doch die Haidamaken ließen
Schon die Säbel segnen.
JAREMA
„Jarema, hörst du, Bauernstoffel?
Geh, hol die Stute, Hundsgestalt!
Die Herrin will die Hauspantoffel!
Und bring mir Wasser! Wird es bald?
Dann streu den Gänsen und den Puten!
Bring Holz zum Heizen! Feg das Haus!
Denk an die Kuh! Du musst dich sputen.
Ich mach dir Beine, träge Laus.
Dann troll dich schleunigst nach Wilschana!
(„Wilschana oder Olschana: eine kleine Ortschaft im Kiewschen Gouvernement; zwischen Swenigorod und Olschana liegen der Hof und die Schenke von Borikow, wo Jarema Beistrjuk, später Galaida, beim Juden als Tagelöhner arbeitete (wie die alten Leute berichten).“ (Anmerkung Schewtschenkos.) In Wilschana diente der junge Schewtschenko als Diener beim Gutsbesitzer Engelhardt.)
Die Herrin will es. Pack den Kram!“
Jarema lief, das Herz voll Gram.
Das war sein morgendlich Hosianna,
So sprang der Schankwirt mit ihm um.
Jarema bog den Rücken krumm.
Er wusste ja nicht, dass ihm Flügel gegeben,
Die tragen ihn bis in die Wolken fern –
Er wusste ja nicht …
Mein Gott, ist das Leben
So schwer auf der Welt, und man lebt es doch gern:
Zu schaun in die liebe Sonne droben,
Zu lauschen des Meeres brausendem Toben,
Der Vöglein Zwitschern, der Stürme Gedröhn,
Der Mädchen Lied, mit dem Winde verwoben …
O mein guter Gott, ist das Leben schön!
Jarema, der arme Waisenknabe,
Nie sah er ein schwisterliches Gesicht,
Getretener Knecht, ohne Heimat und Habe.
Doch hasst und schilt er die Menschen nicht.
Weshalb sie schmähn? Ob sie unterscheiden,
Wen man streichelt und wen man schlägt?
Lass sie feiern … Sie kennen kein Leiden,
Weil ja der Arme ihr Leid mitträgt.
Zuweilen ihm heimlich die Tränen rinnen,
Doch nicht vor Kummer, es ist so schön,
In seltne Träume sich einzuspinnen …
Dann brüllt der Patron: An die Arbeit gehn!
Was nutzen Eltern und reiche Gabe,
Wenn einer kein Herz hat, das sich vergibt.
Wie reich ist Jarema, der Waisenknabe!
Er weiß, was ihn liebt und was ihn betrübt.
Hat Augen, schön wie Sterne am Morgen,
Hat junge Hände, die zärtlich sich sorgen,
Die Seele ist ihm von kindlicher Helle,
Sie weint und lacht und lebt ohne Sünde.
Und sie wehrt von seiner Schwelle
Nachts die schwarzen Winde.
Seht ihr, das ist mein Jarema,
Reicher Waisenknabe!
Ach, so war auch meine Jugend –
Trug sie längst zu Grabe!
Längst verflogen, hingeschwunden,
Ohne Spur im Trüben.
Altes Herz, wo das Vergangne,
Wo ist es geblieben?
Wo ist es geblieben? Wohin verklungen?
Er ging in Kummer und Tränen zur Ruh.
Sie nahmen alles dem armen Jungen:
„Was braucht er Glück? Das steht ihm nicht zu.
Er ist ja auch so reich …“
Ja, reich an Fetzen,
An armen Tränen – das rechnet ja nicht!
Mein Glück, mein Geschick! Ich such dein Gesicht.
O kehre zurück zu den stillen Plätzen,
Wenn auch nur in Träumen … Ich schlafe noch nicht.
Gute Leute, ihr verzeiht mir
Ungereimtes Klagen.
Aber wen hat wohl des Unglücks
Fluch nicht schon geschlagen?
Treffen wir vielleicht uns wieder
Einst in hellren Tagen,
Während ich Jarema suche?
Kann es noch nicht sagen.
Unglück, Leute, allerorten,
Nirgends Glück und Bleiben:
Wo des Schicksals Wind dich hinjagt,
Dahin musst du treiben.
Stumm beugt er den Rücken, lächelt,
Keiner soll es wissen,
Was im Herzen schläft; ihn ekelt
Gar vor Mitleidsküssen.
Heuchler … Mögen sie in ihren
Glücksgefilden säumen,
Doch der arme Waisenknabe
Hat nichts mehr zu träumen.
Schwer und traurig zu erzählen,
Doch wär Schweigen Sünde …
Worte fließen mir wie Tränen.
Sonne nicht und Winde
Trocknen sie. Mit meinen Tränen
Mögt ihr heimlich trauern …
Nicht mit den Geschwistern sprech ich,
Nur mit stummen Mauern
In der Fremde … Aber gehn wir
Jetzt zurück zum Schankhaus:
Was geschieht?
Der reiche Jude
Hockt und räumt den Schrank aus.
Fluchend zählt er die Dukaten
Auf die weißen Dielen.
Auf dem Lager – ach, die Schwüle! –
Weiße Händchen spielen.
Müde spreitet sie die Schöne …
Zart wie weißer Flieder
Schimmern sie; der seidne Kittel
Glitt vom Busen nieder,
Aufgerissen … Gott, die Flitze
Glüht aus allen Daunen,
Einsam liegt sie, keiner hört auf
Ihre jungen Launen.
Und die schöne Ungetaufte
Flüstert stummen Mundes.
Seht, das ist die junge Tochter
Dieses gierigen Hundes.
Schnarchend liegt am Herd die alte
Ghajka wie ein Schmersack.
Nach Wilschana jetzt Jarema
Trabt mit seinem Quersack.
DIE KONFÖDERIERTEN
„Mach auf die Tür, verfluchter Jude!
Sonst prügeln wir dich windelweich.
Los! Wir zerhaun dir deine Bude,
Du grindiger Höllenhund.“
„Gleich, gleich!
Im Augenblick!“
„Wo sind die Knuten?
Du machst dich lustig hier, du Schwein.
Wohl über uns?“
„Ihr Herrn, im Guten!
Mein Gott, der Schlüssel geht nicht rein.
Erlauchte Herrn!“ (Er denkt: „Ihr Schweine!“)
„Herr Oberst, drauf! Die Tür ist dick.“
Schon bricht sie ein … Im Augenblick
Klatscht ihm die Peitsche um die Beine.
„Grüß dich Gott, verstunkner Jude!
Willst du dich wohl bücken?
Her die Knute! Her die Knute!
Fetzt dem Hund den Rücken!“
„Lasst den Spaß doch, Euer Gnaden!
Sein Sie meine Gäste!“
„Haut dem Schurken auf die Waden!
Gebt’s dem Lümmel! Feste!
So, nun geh die Tochter holen!“
„Herr, sie starb im Winter.“
„Schwindler! Schlagt ihn auf die Sohlen!
Schlagt ihn auf den Hintern!“
„Oi, ihr Herrchen, oi, ihr Täubchen,
Lasst mich doch nicht sterben!“
„Hast gelogen.“
„Wenn ich lüge,
Soll mich Gott verderben.“
„Gott nicht, aber wir. Die Tochter
Wollen wir besuchen.“
„Wenn sie noch am Leben wäre,
Gott sollt mich verfluchen.“
„Hahahaa! … und Litaneien
Singt das Teufelsschnäuzchen.
Jetzt bekreuzige dich!“
„Ich weiß nicht,
Was das ist: bekreuzigen?“
„So, schau her!“
Er macht das Zeichen;
Nach ihm macht’s der Jude.
„Bravo, bravo! Bist getauft jetzt.
Richte nun die Bude!
Für das Wunder wolln wir Trinkgeld.
Los, getauftes Luder!
Hörst du nicht?“
„Ihr Herr’n, ich laufe
„Hol zu saufen, Bruder!“
Und sie brüllen, bis die Kannen
Auf den Schanktisch krachen.
„Noch ist Polen nicht verloren!“ („Noch ist Polen nicht verloren!“: Vers aus der Hymne der polnischen Schlachzizen.)
Dröhnt betrunknes Lachen.
„Jude, rühr dich!“
Der Getaufte
Springt, sie zu bewirten,
Schleppt, was Küch und Keller bieten.
Die Konföderierten
Schrein: „Wir haben nichts zu trinken!“
Und der Jude zittert.
„Hol die Zimbal! Spiel ein Lied auf,
Dass die Diele splittert!“
Und nun poltern sie Krakowiaks,
Walzer und Mazurken.
Und der Schankwirt spielt und denkt sich:
„Hochgeborne Schurken!“
„Gut! Genug! Jetzt sing ein Liedchen!“
„Wird mir nicht gelingen.“
„Willst du singen, Hundeseele?“
„Gott, was kann ich singen?
Lebte einmal Gandsja,
Voll von Grind und Wunden,
Lag und flehte
Im Gebete,
Bis die Knie zerschunden;
Hatte keine Lust zum Dienen,
Doch bei jungen Leutchen …
Saß sie pfiffig,
Mäuschenschnüffig
In den Steppenkräutchen.“
„Schluss damit! Das ist doch närrisch.
So ein Schisma-Liedchen!“ (Schisma (griechisches Wort): Kirchenspaltung. Schismatiker: Abtrünniger.)
„Was denn dann? Ich überlege …
Wart doch ein Minütchen …
Vor dem Herrchen Fedor
Geht ein Jud, ein blöder,
Hinten rum,
Vorne rum
Um das Herrchen Fedor.“
„Schluss damit! Und nun bezahle!“
„Macht euch lustig, Herren.
Für was zahlen?“
„Für das Hören.
Hund, hör auf zu plärren!
Geld her! Hier gibt’s nichts zu spaßen.“
„Leer ist meine Lade.
Keinen Groschen! Wäre reich nur
Durch der Herren Gnade.“
„Missgeburt, du lügst. Gestehe!
Wenn der Herr belieben:
Her die Peitsche!“
Und sie tauften
Ihn erneut mit Hieben.
Und die Knuten pfiffen, klatschten,
Bis die Fetzen flogen.
„Esst mein Herz auf! Keinen Groschen!
Hab euch nicht belogen.
Keinen Groschen. Hilfe! Schont mich!“
„Ja, ich helf dir schwören.“
„Halt, ich hab euch was zu sagen.“
„Aber schnell! Wir hören.
Kein Geschwätz mehr! Jede Lüge
Wird dir ausgedroschen.“
„In … Wilschana …“
„Ist dein Geld dort?“
„Meins? – Bei Gott! Kein Groschen.
Nein, ich sag doch … In Wilschana…
Bei den Schismatisten,
Wo im Haus drei, vier Familien
Beieinander nisten.“
„Kerl, da waren doch wir selber.
Schon gerupft, die Hühner.“
„Ja, nein, da nicht … Haut nicht wieder!
Hört … ergebner Diener …
Mög euch von Dukaten träumen!
Wisst ihr, in Wilschana …
In der Kirche … lebt des Küsters
Töchterlein Oksana!
Gott im Himmel! Wie die Sonne
Schön und wohl geraten.
Und Dukaten. Wenn auch fremde.
Nun, was heißt? Dukaten!“
„Alles eins, woher die Dinger.
Lügst du, sollst du sehen!
Dass du uns nicht angeschwindelt,
Musst du mit uns gehen.
Zieh dich an!“
Und nach Wilschana
Die Erlauchten führt er.
Blieb zurück und lag betrunken
Ein Konföderierter.
Könnt nicht aufstehn, grunzt’ und lallte
Aus versoffner Kehle:
„My zyjemy, my zyjemy,
Polska nie zginieta.“ („Wir leben, wir leben, Polen ist nicht verloren.“)
DER KÜSTER
„Hör in den Zweigen
Nächtiges Schweigen.
Sieh unsern Mond sich
Über uns neigen!
Komm aus dem Stübchen,
Komm doch, mein Liebchen.
Komm, mein betrübtes
Täubchen, geliebtes!
Hörst du, mein Fischlein?
Will dich beschwärmen.
Lass mich dich wärmen!
Ach, wie so traurig,
Scheiden zu müssen!
Morgen schon bin ich
Von dir gerissen.
Komm doch! Herzinnig,
Sehnend erschaur ich …
Schwer, dich zu missen!“
So voll Sehnsucht streift Jarema
In den nächt’gen Schlehen,
Singt sein Liedchen; doch Oksana
Lässt sich nicht mehr sehen.
Sterne blinkern; durch die Wolken
Geht der Mond, der bleiche.
Schön die Nacht. Die alten Weiden
Spiegeln sich im Teiche.
In den Büschen überm Wasser
Nachtigallen schlagen,
Schwermutsvoll, als ob sie fühlten
Des Kosaken Klagen.
Durch die Wiese schweift Jarema
Still an seinem Stabe,
Hört nichts, denkt in seinen Sinnen:
„Bin ein hübscher Knabe,
Doch ich hab kein Glück, mein Dasein keinen Sinn;
Ach, die Jahre welken wie die Blumen hin.
Allein auf der Welt, ohne Heimat und Freude,
Wie Gräschen und Kräutchen auf windiger Heide,
Wie Gräschen und Kräutchen, vor Tage verdorrt.
Die Menschen schelten; kein freundliches Wort.
Da ruft keine Seele, mich hinzulehnen,
Nicht Mutter noch Brüder; ich hab ja keine.
Nur eine liebte mich. Doch die eine
Nun wendet sich auch!“
Ihm stürzten die Tränen.
Er wischt mit dem Ärmel das nasse Gesicht.
„Leb wohl für ewig! Was soll ich ersehnen!
Vielleicht hinterm Dnjepr, im Steppenkraut dicht
Leg ich mich sterben. Du wirst nichts fühlen,
Du siehst ja nicht, wie der Rabe frisst
Aus meinem Kopf die Augen, die kühlen,
Die du, mein Herz, so zärtlich geküsst.
Vergiss meine Tränen, vergiss den Kosaken!
Nimm einen andren! Vergiss mein Weh!
Was bin denn ich in der armen Jacke
Für dich, mein Engel! – Leb wohl! Ich geh.
Lieb, wen du willst! – Mein Glück ist verdorben.
Vergiss mich, Vöglein, und all meine Qual!
Und wenn du hörst, dass ich draußen gestorben,
Dann bete für mich zum letzten Mal!
Dass ein Herz nur in der Welt sich
Neigt zu meinem Grabe!“
Und von neuem bitter schluchzend
Lehnt er auf dem Stabe.
Ohne Maß sind seine Tränen …
Plötzlich – süßer Schrecken –
Knackt’s im Holz. Und sieh, Oksana
Schlüpft durch Busch und Hecken.
Und sie fliegen zueinander …
„Herz!“ – Und hingerissen
Stehn sie. Ihre heißen Lippen
Stammeln nur in Küssen.
„Lass genug sein!“
„Ach, mein Falke,
Küss mich, küss mich wieder!
Trink doch meine Seele … fester!
Machst mich immer müder!“
„Ruh dich aus, mein treues Herze!
Kommst vom Mondgefilde.“
Warf den Mantel aus. Nun saß sie
Wie ein Sternchen milde.
„Komm doch, Schatz, an meine Seite!“
Und er ließ sich nieder.
„Du mein Morgenlicht, mein schönes,
Leuchtest du mir wieder.“
„Hab mich heut verspäten müssen.
Kaum die Zeit zum Essen.
Musst’ beim kranken Vater sitzen.“
„Und hast mich vergessen.“
„Dich vergessen, Gott, wie sprichst du?“
Ihre Tränen blinken.
„Wein nicht, Herz, es war ein Scherz nur.“
„Scherz!“
Sie ließ sich sinken
Auf den Schoß ihm, wie im Schlummer
Seinen Kuss zu trinken.
„Lass mich dir den kleinen Kummer
Von den Wimpern küssen!
Sieh, Oksana, Lieb, schon morgen
Musst du mich vermissen.
Morgen bin ich fern, Oksana.
Muss zu den Kosaken,
Muss zur Nacht in Tschigirin sein (Tschigirin: Stadt am Fluss Tjasmin, unweit Kiew, Bogdan Chmelnitzki machte diese Stadt zu seiner Hetmansresidenz.)
Bei den Haidamaken.
Ach, vielleicht werd ich zu Reichtum,
Ruhm und Glück gelangen;
Schöne Kleider wirst du haben,
Schuh’ mit goldnen Spangen.
Sitzt dann bei den Hetmaninnen
Auf geschnitzten Bänken …
Werd nicht müd, dich anzuschauen.“
„Wirst an mich nicht denken,
Wenn du reich bist und durch Kiew
Gehst in Glanz und Tressen.
Findst ein schönes Polenfräulein;
Und ich bin vergessen.“
„Lieb, wo fänd ich eine Schönre?“
„Weiß nicht – bei den Reichen.“
„Herz, du lästerst unsre Liebe.
Nein, nicht deinesgleichen
Gibt es hinter Berg und Meeren,
Nicht in allen Weiten;