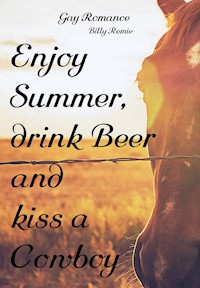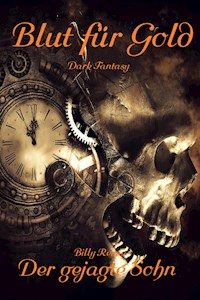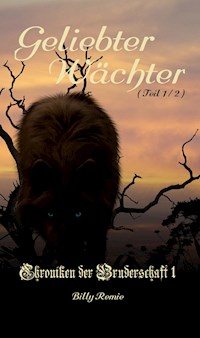
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Bruderschaft 1
- Sprache: Deutsch
Nach all der Zeit, die er sich für unantastbar hielt, läuft Bellzazar – Fürst der Unterwelt – ein unscheinbarer Mensch über den Weg, der all das in ihm auslöst, was er für unmöglich hielt: sterbliche, wahrhaftige Liebe. Zwei Jahrzehnte nach seiner Verbannung erwacht er und sieht sich dieser Liebe unverhofft wieder gegenüber. Sein Herz, seine Seele und selbst sein messerscharfer Verstand sind mit diesem brennenden Gefühl der Sehnsucht infiziert. Er will diesen Menschen, er begehrt ihn wie nichts zuvor. Nach all der Zeit geschieht auch ihm die Liebe - und alles, was ihn betrifft, seine ganze Welt, seine gesamte Macht, verschiebt sich, bis all sein Verlangen auf eine einzige Person gerichtet ist. Doch diese Liebe ist unerreichbar und zum Scheitern verurteilt, denn er begehrt einen Mann, der bereits tot ist und in der falschen Welt strandete. Um zu verhindern, dass er ein verirrter Geist ohne Willen und Verstand wird, muss Bellzazar einen Weg finden, ihn in die Nachwelt zu geleiten. Doch die Zeit drängt und die Welt ist im Wandel, fremde Mächte stellen sich ihnen in den Weg und am Ende steht die Frage, ob Bellzazar bereit ist, den einzigen Mann gehen zu lassen, dem es gelang, nach all der Zeit sein dunkles Herz zu erreichen. Eine unmögliche Liebe zwischen zwei ungleichen Männern, deren Zukunft auf Messers Schneide steht. Eine gefühlvolle Reise, die mit Verachtung begann und in Zuneigung endete - und an deren Ziel das zerbrechliche Erblühen einer tiefen Liebe wartet. Nach den "Legenden aus Nohva" nun die weiterführende Reihe, die eine neue Generation einleitet, mit vielen bekannten und neuen Gesichtern und alten sowie neuen Geheimnissen. Keine Vorkenntnisse von Nöten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 918
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Billy Remie
Geliebter Wächter
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Die Legende
Vorwort
Teil Eins – Nohva
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Teil Zwei – Elkanasai
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Nachwort
Über den Autor
Impressum neobooks
Widmung
Für Yvonne,
denn ohne dich, läge dieses Buch nun im Mülleimer. Du hast mir den Mut geschenkt, es noch einmal zu versuchen, indem du einfach genau das richtige gesagt hast. Du kennst mich. Danke.
Und für Helena und Alex, die sich mein Gejammer anhören mussten und mir oft eine unbezahlbare Stütze sind. Danke, dass ihr testgelesen habt.
Und natürlich für all die da draußen, die schon einmal oder immer noch im verbogenen leben und/oder lieben, ohne je das zu sein oder das auszusprechen, was in ihren Herzen wohnt.
Die Legende
(Eine kurze Zusammenfassung der Vorgeschichte)
Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, werte Lords und Ladys, eine Geschichte über zwei Brüder, die von einer Göttin abstammten und die Welt retteten.
Bevor wir uns in das nächste Abenteuer stürzen, solltet ihr mir kurz eure Aufmerksamkeit schenken.
Ich spreche von Bellzazar – Gott der Toten – und seinem Halbbruder Desiderius, der sich in einen Drachen verwandelte und die Ketten einer Prophezeiung sprengte.
Was gibt es sonst über sie zu sagen? Desiderius war ein Vagabund wie er im Buche stand und liebte zeit seines Lebens zu viele Männer. Bellzazar hingegen zog die Liebe zu seinem Bruder aller Liebe vor. Es verband sie viel, denn als Desiderius einst von seiner ersten Liebe – dem Verräter Rahff – davongejagt wurde, war Bellzazar der einzige Mentor, den er kannte.
Es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, euch die Geschichte von Anfang bis Ende zu erzählen, also komme ich gleich zu ihrem verworrenen Kern.
Einst kämpften beide für das Gute in der Welt, stellten sich gegen die Tyrannei einer Kirche. Bis sich Desiderius` Schicksal offenbarte: er sollte sterben für sein Volk. Denn er war das Gegenstück zu dem Bösen, das sich unter der Erde erhob. Sein Leben war mit dem Leben des Bösen verbunden.
Das konnte Bellzazar jedoch nicht hinnehmen, er bestieg den Thron der Unterwelt selbst, um die Götter zu verraten und um mit seinem Bruder verbunden zu werden. Dadurch zog er auch Desiderius` Zorn auf sich, der lieber gefallen wäre, als seine Heimat brennen zu sehen.
Desiderius einte die Völker Nohvas und führte sie in den Krieg.
Um seinen Bruder zu retten, musste Bellzazar dessen Schicksal erfüllen. Er tötete ihn, ließ sich aber im Kampf ebenso tödlich verwunden. Sie starben Arm in Arm, wodurch sie beide ihre Ketten lösten und die Götter verdammten.
Doch dies war nicht das Ende, sie erhoben sich aus der Asche, denn wie ich bereits erwähnte, liebte Desiderius zeit seines Lebens viele Männer, und einer gab sein Leben für ihn, damit er wiederauferstehen konnte. Cohen war sein Name, merkt ihn euch, er wird nicht zum letzten Mal fallen.
Bellzazar – seiner Macht beraubt – wurde von seinem Bruder verbannt, denn er glaubte noch immer, ihre Leben seien verbunden. Wenn Bellzazar starb, würde auch er sterben. Außerdem konnte er trotz allen Verrats die Liebe zu Bellzazar nicht vergessen. Er war außerstande, seinen Bruder zu töten, weshalb er ihn fortschickte.
Als Desiderius nach dem Opfer seines Geliebten zum König von Nohva gekrönt wurde und damit sein Schicksal endgültig entkommen war, begann ein neues Zeitalter ohne Götter und ohne die Tyrannei der Kirche. Vier Kinder wurden geboren – jedes von einer anderen Hexe – drei Söhne und eine Tochter von Desiderius, und mit der Geburt seiner Kinder, erstrahlte die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und dort, wo einst die Welt brannte, herrscht heute Frieden.
Doch diese Geschichte war nur der Grundstein zu einer Legende, die hier und heute ihren Anfang nimmt…
Vorwort
Ich wusste nicht, dass eine solche Sehnsucht in meinem Herzen brennt, bevor du da warst.
Du bist das Feuer, das in mir lodert, und gleichzeitig die Flut, die es löscht.
Du bist der Sturm in mir, die Ruhelosigkeit und auch der Frieden und die Erlösung.
Du bist alles.
Wir waren blind, es nicht zu wissen.
Aber es war immer da. Immer zwischen uns. Das Feuer. Die Liebe. Die Bindung.
Das sind wir.
Werden es immer sein. Auf ewig.
In Liebe, Dein…
Teil Eins – Nohva
Schatten der Vergangenheit
In den Schatten lauern Lügen und Wahrheiten zugleich. Doch nicht jede Lüge ist bösartig – und nicht jede Wahrheit birgt Frieden.
Kapitel 1
Für einen Moment war es wieder ruhig, nur sein flacher Atem erzeugte ein Geräusch. Es hatte sich angefühlt, als hätte ihn etwas aus einem tiefen Schlaf gerissen. Einem sehr langen Schlaf, der mit lieblichen und friedvollen Träumen erfüllt gewesen ist. Nun erdrückte ihn eine seltsame Schwere.
Sie war ihm nicht fremd, er konnte sich noch an sie erinnern. An diese ganz spezielle Schwere. Und doch war es so lange her, dass sie ihm unangenehm auffiel. Es fühlte sich an, als würde ein Baumstamm auf ihm liegen.
Nur das Leben barg eine solche Schwere in sich.
Er war sich beinahe sicher, sollte er den Kopf heben und an sich hinabblicken, würde er einen umgestürzten Baum oder gar einen Felsen auf sich liegen sehen.
Doch er wusste instinktiv, dass nichts Greifbares ihn niederdrückte. Es war eine unsichtbare Macht, die dort Einzug erhalten hatte, wo sie kein Gewicht haben sollte.
Blinzend hob er die trägen Lider, die Sonne strahlte ungehindert auf sein Gesicht und blendete ihn. Es dauerte einen Moment, bis er sich an das Licht gewöhnt hatte. Dabei war ihm auch das nicht fremd.
Hier … hier war es selten Nacht. Und wenn es Nacht wurde, war der Himmel ein dunkelblaues Meer aus funkelnden, winzigen Diamanten und zwei silbrigen Mondkugeln, die so groß waren, dass sie den Nachthimmel zu dominieren schienen, wie zwei Berge in einem ebenen Tal. Regenschauer aus Sternen erhellten die Nächte und spiegelten in dem ruhigen Fluss, der sich durch das unberührte wilde Land zog, in dem kein Leben existierte. Nur Frieden und Leichtigkeit und … Erinnerungen.
Sehnsucht. Einsamkeit. Das lange Warten darauf, mit denen vereint zu sein, die man zurückgelassen hatte.
Aber vor allem Leichtigkeit. Ein Gefühl, das er immer in vollen Zügen genossen hatte. Stets lag er im hohen Gras unten am Flussufer, lauschte dem leisen Plätschern des Wassers und dem Rascheln des Windes in den hohen Wiesen. Zeit hatte hier kein Gefühl, keine Bedeutung. Er liebte das, die Ruhe und das Fehlen von unvollkommenem Leben. Kein Hass, keine Angst, kein Kummer.
Kein Argwohn, keine Niedertracht.
Das Warten machte ihm nicht viel aus, er wusste nicht recht, wie viel Zeit vergangen war. Manchmal kam es ihm wie Jahre vor, manchmal nur wie ein einziger Augenblick. Wenn er sich die Lippen leckte, glaubte er noch seinen letzten Kuss darauf zu schmecken.
»Wir sehen uns bei Sonnenaufgang.«
Ja, das würden sie. Wenn die Zeit dafür reif war, würden sie sich hier treffen. Im urigen Abbild ihrer geliebten Heimat, für die sie ihre Leben und ihre Liebe geopfert hatten. Die Heimat, nur ohne Leben, ohne Zivilisation. Nur die Heimat und sie und alle, die sie Brüder, Familie und Geliebte nannten …
Es hätte so friedlich bleiben sollen, doch nun weckte ihn diese seltsame Schwere, wie er sie nur aus dem Leben kannte. Melancholie durchströmte ihn. Auch das war ein Gefühl, das ihn durch das Leben begleitet hatte, ihm hier aber fremd geworden ist. Nun war er zurück, der stetige Hauch Traurigkeit, der Kummer, den er nie ablegen konnte.
Ein Beben ging durch seinen Körper, eine Erschütterung, die aus dem Boden kam und direkt in ihn fuhr. Sein Innerstes fühlte sich aufgewühlt an, als hätte ein Schmiedehammer auf sein Bewusstsein geschlagen, um ihn auf grauenhafte Art zu wecken.
Seine Augen standen nun offen. Wobei er nur aus dem einem etwas sah.
Und da wusste er, dass etwas nicht in Ordnung war.
Er setzte sich auf, die Gräser um ihn herum waren braun wie Stroh und raschelten im sanften Wind. Befürchtend sah er sich um, suchte nach den anderen.
Hinter ihm befand sich der Rand eines tiefen Mischwaldes, die Bäume warfen lange Schatten auf die Wiese. Ein Tisch, Stühle und Bänke aus Baumstämmen waren in den Schatten aufgestellt. Die anderen saßen wie üblich dort und spielten Karten. Lachten, zankten, liebten sich. Brüder im Leben, Brüder im Kampf, Brüder im … Tod. Sie schienen keine Veränderung wahr zu nehmen.
»Junge, ich glaub, dass da ist nicht gut.«
Er sah sich weiter um. Der … der andere saß wie üblich allein am Flussufer und starrte in die sanfte Strömung.
Sie beide blieben immer allein, suchten die Einsamkeit. Trauerten einer verflossenen Liebe nach.
Der andere Einsame deutete mit einem Fingerzeig ins Wasser. Er folgte der Bewegung mit seinem Blick, sah das silbrige Schimmern darin, als ob einer der zwei Monde sich darin spiegeln würde, obwohl die Sonne schien.
Verwundert stand er auf. Etwas an dem Schimmern zog ihn an. Instinktiv näherte er sich dem Flusswasser. Das Gras wurde niedriger, spärlicher und wurde von einem sandigen Grund vertrieben. Er fühlte sich wie eine Motte, angezogen vom Licht. Obwohl er nicht genau benennen konnte, was das Funkeln in ihm auslöste, ging er weiter, konnte der Anziehung nicht widerstehen. Das Schimmern hatte ein Seil ausgeworfen, das sich um ihn geschlungen hatte und unaufhaltsam zu sich zog. Er konnte nicht weichen, nicht die Richtung ändern. Eine höhere Macht zog ihn zum Fluss.
Er ging an dem anderen Einsamen vorbei, der neugierig zu ihm aufsah, ihn aber nicht aufhielt. Immer weiter und weiter, bis er knietief im Wasser stand.
Er konnte es nicht spüren, nicht die Nässe, nicht die Kühle. Direkt vor dem Schimmern blieb er stehen. Das Wasser sprudelte, als hätte sich ein Loch aufgetan, aus dem es abfloss. Tatsächlich kam das Schimmern aus einem langen Riss im Fluss, der stetig größer wurde. Wie eine brechende Eisfläche.
In der Nähe des Risses war das Gefühl der Schwere deutlicher, die Melancholie nahm zu, die Erinnerungen wurden lebendig.
Der andere Einsame stand auf einmal hinter ihm, so groß, dass er den Himmel verdunkelte. »Du bist noch nicht fertig.«
Und dann, ganz unvermittelt stieß er ihn hinein. Ein kräftiger Stoß traf ihn in den Rücken, der ihn vorwärts katapultierte.
Er war zu überrascht, um es zu verhindern. Mit einem erschrockenen Laut krachte er durch die Flussoberfläche, Wasser füllte seine Lunge, und ein Sog erfasste ihn, der ihn in den Riss zog, bis er von einem Strudel silbrigen Lichts umhüllt wurde.
Er hatte das Gefühl, zu fallen und hilflos mit den Armen zu rudern. Er konnte nichts sehen und ihm wurde übel, als er durch das Nichts geschleudert wurde, wie ein Staubkorn durch einen Sandsturm.
Es war, als ob er noch einmal sterben würde.
So überraschend wie der Fall begonnen hatte, endete er auch. Durch einen heftigen Aufprall wurde sein scheinbar endloser Sturz gebremst. Der Schmerz setzte ihn für einen Moment blind und taub seiner Umgebung aus. Keuchend rang er nach Luft. Erinnerungen strömten auf ihn ein. Erinnerungen an Zeit, an Atmung, an Schmerz und Schwere.
Ein Schatten glitt über sein Gesicht und er zwang die Augen auf. Er spürte, dass sich nur eines bewegte, die andere Augenhöhle fühlte sich hart, leer und vernarbt an. Die Luft in seinen Lungen brannte, er hustete.
Fassungslos starrte er in das Gesicht, das über seinem ragte und auf ihn hinab starrte.
Er erkannte die vertrauten Züge. Er kannte sie nur zu gut.
»Faszinierend«, sagte der Mann mit samtweicher aber gleichwohl monotoner Stimme, »das muss doch weh getan haben.«
»Wo … wie …?« Mehr brachte er nicht heraus, war zu verwirrt von all den Eindrücken. Dem Geruch des Waldes, nach Moos und feuchten Blättern, dem Lichtspiel aus Schatten und Sonne unter dem dichten Blätterdach, dem Gesang der Vögel und dem Mann, der über ihm stand.
Dieser schüttelte den Kopf, verzog bedauernd die blassen Lippen und ging neben ihm in die Hocke, um sich zu ihm hinab beugen zu können. Lässig legte er einen Arm über sein Knie und sagte mit einer natürlich angeborenen Verschlagenheit: »Unwichtig. Du bist hier. Und ich könnte gerade etwas Hilfe gebrauchen.«
Kapitel 2
Drei pechschwarze Raben sammelten sich auf dem Ast eines knorrigen Sperberbaumes, dessen saftig grüne Blätter schwer vor Feuchte hinabhingen. Gierig drehten die unheimlichen Vögel ihre Köpfe und wetzten die langen, kohlschwarzen Schnäbel an der Rinde. Sie warteten darauf, dass Blut vergossen und Leichen hinterlassen wurden.
Die Klugheit in ihren schwarzen Augen konnte einem gestandenen Mann eine Gänsehaut einbringen. Es war, als läge alles Wissen aller Welten in den Augen eines Raben. Als gäbe es nichts, weder in der Vergangenheit, Gegenwart noch in der Zukunft, was diese Vögel nicht wussten. Sie schienen wie Boten zwischen den Welten umherreisen zu können und sich über Dinge klar zu sein, die kein Sterblicher je begreifen könnte.
Es musste schließlich einen Grund geben, warum diese Tiere überall vertreten waren, es gab kein Schlachtfeld, das vor ihnen sicher gewesen wäre. Sie saßen am Rande und sahen dem Geschehen zu, in Erwartung eines Festmahls.
»Ragon!«
Doragon riss den Blick von den drei Raben los, als Fen`zume ihn rief. Er suchte mit seinem scharfen Blick die überwucherte Straße nach seinem Weggefährten ab. Sein Freund stand inmitten der Trümmer einstmaliger Planwagen. Sie hatten die Karawane hinter einer Kreuzung gestoppt, indem sie eine Palisade errichtet und aus den Baumkronen und dem Unterholz heraus Pfeile zwischen die Radachsen geschossen hatten, um sie zu brechen. Dabei waren einige Wagen umgekippt. Lederplanen wehten nun über den Weg, Holzsplitter lagen verstreut umher, am Rand der Straße saßen die gefangen genommenen Wächter der Karawane in einer Reihe im Dreck und starrten mit grimmigen, entschlossenen Gesichtern zu ihren Angreifern empor, während sie darauf warteten, dass über ihr Schicksal entschieden wurde. Ihre Herkunft war deutlich an ihrer dunklen Haut, den leicht angespitzten Ohren und den seltsamen weiß glühenden Schlangenlinien unter ihrer Haut zu erkennen, die sich wie eine Krankheit über ihre freien Arme, Hände, Hälse und Schläfen ausbreiteten. Genau wie Wurzeln eines Baumes streckte das weiße Glühen seine Fühler in ihren Nervenbahnen aus.
Fen winkte Doragon zu dem Wagen in der Mitte. Es waren insgesamt fünf Karren voll mit Vorräten, gezogen von Maultieren, die sie bereits losgebunden und beladen hatten. Sie würden sie mitnehmen. Eine gute Ausbeute, viel Essen für das Lager. In den nächsten Wochen würden sie sich nicht um den anhaltenden Hunger kümmern müssen. Selbst Heilkräuter waren säckeweise unter den Vorräten vorhanden. Offensichtlich hatten sie eine Lieferung an die Herrin selbst erwischt. Sie hatten nur das Beste vom Besten erbeutet.
Doragon trat neben Fen und sah ihn fragend an. Dieser nickte auf das, was er und zwei weitere Kameraden entdeckt hatten. Der Wagen in der Mitte war hinten leicht eingesunken, da ein Rad gebrochen war, ansonsten schien er unversehrt. Jemand hatte die Plane runtergerissen und einen Käfig freigelegt. Er war nicht einsehbar, die Wände bestanden aus massivem Eisen und ließen das Gebilde mehr wie eine übergroße Metalltruhe wirken.
»Das solltest du dir ansehen«, sagte Fen mit belegter Stimme und deutete mit seiner dunklen Hand zur Tür des Käfigs. Seine gelben Augen wirkten erschüttert, beinahe ratlos. Das kannte Doragon nicht von ihm, Fen hatte stets einen frechen Kommentar auf den Lippen, ganz gleich mit wem er sprach und wovon er sprach, und ob sie am Lagerfeuer saßen oder in die Enge getrieben ihrem Tod entgegenblickten. Er fand immer eine alberne Bemerkung.
Heute war er still. Zu still. Seine spitzen Ohren zuckten nervös unter seinem langen haselnussbraunen Haar. Etwas hatte ihn tief getroffen.
Doragon erwartete nichts Gutes, noch nie hatte etwas oder jemand Fen zum Schweigen gebracht.
Er reichte wortlos seinen Bogen an Fen weiter und stieg auf das Trittbrett des Wagens. Durch eine kleine Öffnung konnte er in den Käfig spähen. Er hielt sich an den dicken Eisenstäben einer winzigen Fensteröffnung fest und verengte die Augen, um etwas erkennen zu können. Sein Gesicht schwitzte unter seiner ledernen Maske, die stets sein Antlitz verhüllte.
Es war dunkel in dem eisernen Kasten, aber er hatte die Augen eines Raubvogels. So sagte man über ihn. In Wahrheit konnte er vermutlich einfach gut sehen. Seine Pupillen gewöhnten sich an das wenige Licht hinter der Tür, stickige Luft schlug ihm entgegen, es roch nach Unrat, Schweiß und Verzweiflung. Der Raum war innen wie außen aus kaltem Eisen, drinnen war er rostrot verfärbt. In der hintersten Ecke schlängelten sich dicke Ketten über den Boden, wie man sie von Ankern für große Segelschiffe kannte. Sie begannen in der Dunkelheit und endeten an einem dicken Eisenring, der um ein beunruhigend knochiges Fußgelenk lag. Die Kette samt Ring mussten zu schwer für das dünne Bein sein, das sie festketteten. Die Haut des Gefangenen erinnerte an das Wachs einer Kerze, zerlaufen und blass. Der Eisenring, der ihn ankettete, hatte Blutergüsse auf dem Gelenk hinterlassen, die wegen der ansonsten weißen Haut geradezu leuchteten.
Doch mehr als Beine und Füße gab die Dunkelheit nicht preis. Doragon erwartete bei diesem Anblick nichts als eine Leiche vorzufinden.
So mager, so blass, so … leblos. Nur dünne Haut über leicht zerbrechlichen Knochen. Wie ein Kind, das in einem Brunnen verhungert ist und dessen Überreste man nach einem oder zwei Jahren aus dem Schacht zog.
Doragon packte den Türgriff und riss daran. Die Tür bewegte sich nicht, schwere Schlösser sicherten den Kasten.
Er sprang vom Trittbrett und ging einige Schritte zurück. »Tsuri. Haru. Brecht den Käfig auf!«
Die beiden vermummten Kameraden setzten sich sofort in Bewegung, gingen an Doragon vorbei und machten sich an die Arbeit.
Doragon rückte seine Maske zurecht und nahm dann seinen Bogen wieder an sich, den Fen ihm entgegenhielt. Er schlang ihn sich um den muskulösen Oberkörper. Tsuri und Haru zogen kleine Ledersäckchen hervor und schütteten schwarzes Pulver in die Öffnungen der Schlösser.
»Ist es noch am Leben?«, fragte Fen Doragon mit gesenkter Stimme.
Doragon musterte seinen Freund. Er war dünn, auf den ersten Blick nicht mehr als ein Bursche, und das schmutzige Hemd und die braune Lederhose saßen so locker um seinen Leib, dass sie seine drahtige Gestalt noch unterstrichen.
Doragon wandte den Blick wieder ab, die Maske gab nur seine Augen preis, nicht seine mahlenden, angespannten Kiefer. »Die Frage ist, warum sie es in einem Käfig transportieren«, antwortete er nachdenklich, seine Stimme klang wegen seiner Maske leicht gedämpft.
Etwas zischte in der Luft, wie Wasser auf heißer Glut. Das Pulver wurde entzündet, mit einem lauten Knall sprang das erste der drei Schlösser auf.
Hinter der Tür erklang ein Schaben, wie von Ketten, die über den Boden schliffen, als hätte sich das Geschöpf im Inneren weiter zurückgezogen. Ein ängstliches Wimmern erklang.
Doragon drehte sich der Magen um, ließ es sich aber nicht anmerken.
Bei allen Geistern … was hatten sie mit ihm gemacht?
Fen sah zum Käfig, dann richtete er die buttergelben Augen wieder auf Doragon. »Scheint, als steckt noch Leben in den Gebeinen.«
Doragon wandte sich wortlos ab, um eine Fackel zu entzünden.
Er hockte sich zwischen die Trümmer und schlug zwei Feuersteine aufeinander, um den in Pech getränkten Stoff in Flammen zu hüllen, als jemand vor ihn trat und das Licht unter dem Blätterdach verdunkelte.
Er blinzelte zu dem jungen Mann auf, der mit geballten Fäusten vor ihm stand. »Wir sollten sie töten!«, forderte er verbissen.
Doragon folgte seinem energischen Nicken und leckte sich unter der Maske die Lippen. Er betrachtete die entschlossenen Gesichter der gefangengenommenen Wächter und ihre vor Zorn glühenden Augen. Das Leuchten der weißen Linien unter ihrer dunklen Haut zeugte davon, dass sie nicht Herr ihrer Selbst waren. Sie wussten nicht, was sie taten. Niemand konnte ihnen noch helfen, niemand würde sie von ihrem Weg abbringen. Sie waren befallen.
»Nein«, sagte er dennoch und zündete die Fackel an.
Der junge Bursche, dessen Namen er nicht kannte, stampfte wütend auf. »Aber … sie sind nicht mehr zu retten. Sie sind eine Gefahr! Wir müssen …«
»Ich sagte, nein!« Doragon brauchte die Stimme nicht zu erheben, er blieb stets ruhig. Wer schreien musste, um Gehör zu finden, dem schenkte man keinen Respekt. Das hatte der Mann ihm beigebracht, der ihn großgezogen hatte.
Doragon stand auf und trug seinen Kameraden auf, die die Gefangenen bewachten: »Verbindet ihnen die Augen und treibt sie gefesselt in den Wald hinein. Sorgt dafür, dass sie nicht wissen, wohin ihr sie bringt. Sie können sich dann gegenseitig aus den Fesseln helfen, wenn ihr verschwunden seid. Hinterlasst ihnen keine Spuren, die sie verfolgen könnten. Mögen die Geister des Waldes ihnen gnädig sein – oder sie in die Irre führen.«
Die drei Männer nickten und zogen Stofffetzen hervor, um seinem Befehl Folge zu leisten.
Das zweite Schloss wurde gesprengt, und er wandte sich mit der Fackel in der Hand zum Käfig.
Da packte ihn der Bursche am Arm und zerrte ihn herum. »Das ist nicht Recht! Nach allem was sie uns angetan haben, verdienen sie den Tod durch unsere Klingen! Sie würden uns auch keine Gnade erweisen. Haben sie nie und werden sie nie …«
»Wir werden kein Blut vergießen!«, zischte Doragon den Burschen an, wobei er sich dicht zu ihm beugte, dass er auch wirklich verstand. Sein Blick brannte sich in die braunen Augen des Jüngeren, der widerwillig aber eingeschüchtert das Gesicht wegdrehte. »Sie wissen nicht mehr, was sie tun, sie sind auch nur Sklaven. Und selbst wenn nicht, so sind wir nicht wie sie. Wir werden niemanden töten, wenn es nicht sein muss. Deshalb sind wir nicht hier! Wir sind keine Schlächter und wir ermorden auch keine gefesselten Gefangenen! Lassen wir sie ziehen, sollen sie ruhig der Herrin Bericht erstatten. Lassen wir sie Gerüchte über uns verbreiten.«
Erst der letzte Satz schien den Burschen milde zu stimmen. Er wirkte noch immer unglücklich darüber, dass er seine Wut nicht an seinen Feinden auslassen durfte, doch er nickte immerhin ergeben.
Doragon atmete ruhig unter der Maske aus und legte dem Jüngeren versöhnlich eine Hand auf die Schulter, die sich unter dem leichten Hemd erschreckend knochig anfühlte. Er war noch nicht lange bei ihnen, sein Körper und Geist zeigten noch die Spuren seines Sklavenlebens.
»Rache bringt uns nicht zum Ziel«, sagte Doragon mitfühlend zu ihm, »noch bringt sie uns Seelenfrieden. Was wir wollen, wird größer sein, befriedigender. Ich gebe dir mein Wort. Und nun geh und sammle alle Waffen und Pfeile ein, die du finden kannst.« Er verstummte einen Augenblick lang nachdenklich und blickte empor zu den drei Raben auf dem Ast, die ebenso enttäuscht über seine Entscheidung schienen wie der Bursche. »Wir werden Waffen brauchen. Aber nur, um uns zu verteidigen. Die blutigen Gräueltaten überlassen wir unseren Feinden, denn wir sind nicht wie sie!«
Als das dritte Schloss gesprengt wurde, drückte Doragon dem Burschen noch einmal die Schulter, dann wandte er sich ab und ging zu Fen und dem Käfig zurück.
Der Jüngere zog ab, der Ärger verrauchte langsam, er war froh, eine Aufgabe zugeteilt zu bekommen und ging dieser gewissenhaft nach.
»Ich gehe allein rein«, sagte Doragon zu seinem Gefährten.
Fen nickte. »Aye, natürlich.«
Tsuri und Haru zogen die schwere Tür für ihn auf. Sie war so dick wie der Arm eines ausgewachsenen Mannes.
Doragon schwang sich auf das Trittbrett und ging mit der Fackel voran geduckt in den eisernen Käfig. Der widerliche Geruch nach Unrat und kaltem Schweiß lag so schwer im Inneren, dass er befürchtete, die offenen Flammen könnten ihn entzünden und eine Feuerflut auslösen.
Er war froh um die Maske.
Langsam ging er weiter, das Licht vertrieb die Dunkelheit wie Ebbe die Flut. Pechschwarze Schatten glitten über die dürren Beine nach oben. Es waren kurze Beine, doch so dünn, dass sie wieder lang wirkten. Nicht mehr als dünne Äste, die bei der schwächsten Windbriese brechen würden. Schwach wie zwei Seile.
Das Geschöpf wich vor dem Licht zurück. Doragon schluckte seine Übelkeit hinunter, eigentlich wollte er gar nicht sehen, was ihn erwartete. Und doch trieb ihn etwas in seinem Inneren weiter an.
Die Fackel leuchtete dem Gefangenen ins Gesicht. Es war ein Junge. Ein Junge aus dem Westen, seine helle, blanke Haut und die runden Ohren gaben seine Herkunft preis. Er war nackt, kränklich, verdreckt von Kopf bis Fuß, unterernährt und offensichtlich ausgemerzt, als hätte ihm jemand die Lebenskraft aus dem Leib gesaugt. Als das Licht ihn traf, riss er sofort die knochigen Ärmchen hoch und verbarg das Gesicht dahinter, er kauerte erbärmlich in der dunklen Ecke, die Knie an die Brust gezogen, Arme und Beine mit Eisenringen versehen und an die Wand gekettet.
Doragon unterdrückte einen Fluch. Er ging noch weiter in die Hocke, versuchte nicht an den Schock zu denken, der seinen Magen krampfen ließ.
»Hallo.« Sehr geistreich, dachte er und verdrehte über sich selbst die Augen, aber wie sollte er den Burschen sonst ansprechen? »Was haben sie …« Er brach ab. Was für eine dumme Frage. Und so unpassend. Die Befragung musste warten, dies war der schlechtmöglichste Zeitpunkt.
Doragon streckte die behandschuhte Hand aus, wollte dem Burschen zur Beruhigung berühren. Doch dieser zuckte heftig zusammen, rutschte von ihm davon in die andere Ecke, wie ein verschrecktes Wildtier, das nicht mehr fliehen konnte. Die Ketten rasselten unheilvoll.
»Nein, schon gut, ich will dir helfen!« Er hob seine Hand, um seine gute Absicht zu signalisieren. »Ich bin hier, um dir zu helfen.«
Der Junge sah ihn nicht an, wimmerte nur ängstlich.
»Ist gut, ich will dir nichts Böses. Fürchte dich nicht!« Ihm war übel, und nicht wegen des beißenden Geruchs. »Du musst keine Angst vor mir haben, ich bin hier, um dir zu helfen.«
Der Junge rührte sich nicht, doch er floh auch nicht, als Doragon langsam auf ihn zu kroch.
Gute Geister…was in aller Welt haben sie ihm angetan? Doragon konnte es nicht begreifen, er versuchte, den aufkommenden Unglauben runter zu schlucken.
»Mein Name ist Doragon. Du kannst mich Ragon nennen.«
Keine Antwort.
»Wie heißt du?«
Immer noch keine Rührung.
»Ich werde jetzt näherkommen, du musst dich nicht fürchten«, sprach er unbeirrt weiter, aber seine Hände zitterten, er konnte nicht glauben, was er sah.
Er hatte schon viele Sklaven befreit, aber niemals waren sie in solch einem schlechten Zustand gewesen. Mehr tot als lebendig.
Wieso taten sie so etwas einem Jungen an? Warum? Wozu? Er konnte es nicht begreifen.
»Keine Angst.« Er sprach nun leise, mehr zu sich selbst. »Hab keine Angst vor mir, ich will dir helfen. Ich werde dir helfen.«
Doragon streckte seine Hand aus und berührte eine der gelockten Haarsträhnen, sie waren matt, und die helle Farbe sah stumpf im Dunkeln aus, wie verblasste Bronze. Das Haar wirkte wie ein Nest aus sich kringelnden Schlangen auf seinem Kopf, es hing ihm über den Ohren und verdeckte die Stirn.
Der Junge zuckte leicht unter der Berührung zusammen, aber er flüchtete nicht mehr. Vielleicht hatte er ihn verstanden, vielleicht hatte er auch einfach keine Kraft mehr, um vor ihm zu fliehen.
Vorsichtig legte er die Haarsträhne beiseite und betrachtete die mit Schmutz bedeckte Stirn. Er zog die Augenbrauen verwundert zusammen, als er einen Kreis auf der hellen Haut erkannte.
Ein Brandmal.
Zögerlich hob der Sklave den Kopf und blinzelte aus rotunterlaufenen Augen zu ihm auf.
Ein helles Blau schlug Doragon entgegen, schimmernd wie das türkise Meer, das er aus seiner Kindheit kannte.
»Fürchte dich nicht«, flüsterte er mit rauer Stimme, »du bist jetzt frei. Ich bringe dich in Sicherheit.«
Hoffnung, aber auch Skepsis blitzten in dem stummen Gesicht auf.
So zart, so jung wirkte der Sklave, dass es Doragon wütend machte, was ihm widerfahren war. Wer tat einem so wehrlosen, zartem Geschöpf solche Grausamkeit an?
»Dürfen meine Freunde reinkommen?«, fragte Doragon behutsam. »Sie werden deine Ketten lösen.«
Der Sklave schien zu überlegen, spähte vorsichtig an ihm vorbei und blinzelte des Tageslicht wegen, das in den Käfig fiel. Er schnupperte, als würde er seit einer Ewigkeit wieder frische Luft wittern.
»Es wird alles gut«, sagte Doragon heiser. Er berührte den Kleinen am Arm, dieser zuckte zusammen, ließ es aber geschehen und beruhigte sich.
Dann sah er Doragon an und nickte ängstlich.
»Tsuri. Haru. Die Ketten: löst sie!«
Als die beiden vermummten Gestalten eintraten, löste Doragon seinen Umhang. Er legte die Fackel auf den Boden, um den nackten Sklaven in die braune Wolle zu hüllen.
Der Sklave wich ängstlich vor den beiden Männern zurück, die mit Meißel und Hammer die Verankerung an der Wand bearbeiteten. Man hörte sie fluchen.
Doragon zog den Kleinen an sich, wickelte ihn in seinen Umhang und erschrak darüber, wie dünn und kalt sich der Leib des Sklaven anfühlte. Er fragte sich, wie dieses wandelnde Skelett überhaupt noch atmen konnte.
Er unterdrückte ein Zittern und war froh um seine Maske, die seine Erschütterung verbarg. Sicher war er leichenblass und sah so ratlos aus, wie er sich fühlte.
Er war kein Druide, aber er war sich sicher, dass der Kleine bereits auf der Schwelle zur anderen Seite stand. Ob er überleben würde war fraglich.
Als die Verankerungen gelöst waren, hob Doragon den geschwächten Sklaven aus dem Käfig. Das Tageslicht blendete diesen so sehr, dass er das Gesicht drehte und es an Doragons Brust verbarg. Seine langen, dürren Finger krallten sich an Doragons Hemd fest.
Es bereitete ihm Übelkeit und Zorn, wie leicht der Kleine war. Er wog nicht mehr als ein Sack voll Lumpen. Die Ketten, die noch um seine Gelenke lagen, rasselten bei jedem Schritt. Sie waren das einzige, spürbare Gewicht an ihm. Doragon hatte die unbestimmte Angst, der Kleine könnte ihm davonfliegen, wenn sie die Ketten von seinen Gelenken lösten.
Fen stellte sich Doragon draußen in den Weg und musterte den Sklaven mit fliegenden Augen. »Ist er ein Mensch?«
»Sieht so aus.«
»Siehst du das Mal auf seiner Stirn?«, fragte Fen schmallippig. »Ist er…?«
Doragon bugsierte den Sklaven an Fen vorbei und ging weiter. »Wir müssen ihn zum Lager bringen, er braucht Hilfe. Schnell.«
Fen murmelte hinter seinem Rücken etwas wie: »Mutter, steh uns bei, er ist ein Magier.«
Und ein Mensch. Doragon und Fen mussten es nicht aussprechen, sie wussten, wen sie befreit hatten. Das Schicksal hatte ihnen heute in die Hände gespielt.
Doch Doragon wusste ebenfalls, dass die Konsequenzen schrecklich sein würden. Der Feind würde alle Mittel aufbringen, um sein Hab und Gut zurückzufordern.
Und die drei Raben krächzten ein höhnisches Gelächter.
Kapitel 3
»Du solltest nicht hier sein.«
Der Eindringling richtete sich wie ein erschrockenes Kaninchen kerzengerade auf, das etwas gewittert hatte und mit aufgerissenen Augen Ausschau nach einem Raubtier hielt. Langsam drehte der Junge sich zu ihm um, die Sonne fiel durch die Blätter der Obstbäume und ließ dessen ahornroten Schopf wie einen seltenen Edelstein funkeln. Zimtbraune Augen blinzelten ihn verwundert an.
»Wie bitte?«, fragte der Rotschopf. Trotz seiner Haarfarbe besaß sein Gesicht nicht die dafür typischen Sommersprossen, noch die helle Haut. Sein Teint war rosig, leicht gebräunt von der Sommersonne, und ebenmäßig wie ein Gemälde.
»Du solltest nicht hier sein«, wiederholte Vaaks und strich dem Kaninchen auf seinem Arm beruhigend über den Kopf, Fremde machten die Tiere im Garten nervös.
Wie immer sprach er mit monotoner, wenig gefühlsbetonter Stimme. Weder tadelnd noch drohend, er hatte lediglich eine Tatsache festgestellt. »Das hier ist der königliche Obstgarten. Fremde haben hier nichts verloren«, erklärte er dem Eindringling.
Der andere Junge sah von dem Kaninchen zu Vaaks` darüber liegendem Gesicht, und wieder zurück, hin und her, bis er schließlich auf geradezu dreiste Art zu grinsen begann.
»Ich bin Fenjin.« Der Junge sprang auf und wollte ihm die Hand reichen.
Unwillkürlich trat Vaaks zurück, beinahe ängstlich.
Einen Moment lang starrten sie sich beide überrascht an.
Fenjin lachte verlegen und ließ zögernd die Hand fallen. »Ich kam mit meinem Vater zur Festung. Er ist Kaufmann und handelt mit dem König. Bist du ein Prinz?«
Vaaks fand, dass Fenjin zu schnell und ohne Pausen redete. Er antwortete nicht, für ihn schien es offensichtlich, dass er ein Prinz war – auch wenn er sich selbst nicht als solchen bezeichnete –, immerhin standen sie auf dem Rasen des königlichen Gartens.
Fenjin wirkte ein wenig verunsichert, da Vaaks nicht mit ihm sprach. Seine Augen blieben wieder an dem Kaninchen hängen. »Ein süßes Kerlchen. Dein Haustier?«
»Ein Wildtier.«
»Aber du hast es gezähmt.«
»Nein, es ist immer noch wild.«
Das verwunderte den anderen Jungen, er wölbte die Augenbrauen unter den roten Haarspitzen. »Aha…«
»Der König hat die Kaninchen in seinem Garten unter Naturschutz gestellt«, sagte Vaaks, nun klang er doch ein wenig tadelnd. Er ließ das Kaninchen auf dem Boden ab, es hoppelte davon. Als er sich wieder aufrichtete, sah Fenjin dem Tier nach. Vaaks sprach weiter: »Es ist nicht erlaubt, sie hier zu jagen.«
Fenjin fuhr zu ihm herum. »Ich habe sie nicht gejagt.«
»Du hast sie durch die Bäume beobachtet.« Vaaks hatte es gesehen und er ließ es den anderen durch seinen ernsten Blick und Tonfall wissen.
»Nur beobachtet«, erwiderte Fenjin aalglatt und grinste mit einem frechen Funkeln im Blick.
Als Vaaks ihn mit verengten Augen musterte, lachte er auf und hob die Arme, drehte sich einmal um sich selbst, und sagte: »Siehst du: keine Waffen.«
Vaaks musterte ihn eingehend. Einfache aber saubere Kleidung aus Leinen und minderwertigem Leder. Ein Gürtel, an dem weder Steinschleuder noch Dolch hing.
Etwas ernüchtert ließ Fenjin die Arme wieder fallen, die schmalen Schultern gleich mit. Er seufzte. »Ich weiß auch gar nicht, wie man jagt.«
Das machte Vaaks stutzig, er schüttelte den Kopf. »Hat es dir dein Vater nicht gezeigt?«
»Er ist Kaufmann«, lachte Fenjin und winkte ab. »Er hält nichts von Waffen, auch nicht vom Jagen. Und was und wo sollen wir schon jagen? Uns gehört kein Land.«
Das klang folgerichtig, musste Vaaks zugeben. Immerhin war es eine ernste Straftat, zu wildern.
Fenjin schien zu spüren, dass er ihm glaubte. Er strahlte und machte einen fröhlichen Satz auf ihn zu: »Wie heißt du?«
Vaaks lehnte sich nachhinten, als wollte er wieder einen Schritt zurücktreten, entschied sich dann jedoch anders. Etwas an der Art des anderen Jungen faszinierte ihn. Er war so aufgeschlossen, locker und fröhlich, es war beinahe ansteckend.
»Vaaks«, antwortete er und spürte ein Lächeln im Mundwinkel.
Fenjins zimtbraune Augen strahlten noch mehr. »Wollen wir spielen, Vaaks?«
»Was willst du denn spielen?«, fragte Vaaks amüsiert.
»Fangen!«, rief Fenjin aus und tippte ihm auf den Arm. »Du bist!« Damit rannte er lachend an ihm vorbei.
Verwirrt drehte Vaaks sich um und blinzelte dem aufgeweckten Jungen hinterher.
Fenjin winkte ihm. »Komm schon, komm schon! Fang mich, Vaaks, fang mich!«
Vaaks grinste und rannte los. Fenjin neckte ihn, ließ ihn rankommen, rannte um Bäume herum und versteckte sich hinter Büschen. »Vaaks«, rief er lockend, »Vaaks … Vaaks … «
…»Vaaks!«
Er schlug ruckartig die Augen auf.
»Vaaks, hörst du mich?«
Er blinzelte, bis sich seine Sicht klärte und das rote Schimmern im Halbdunkel des Heubodens Formen annahm.
»Hör auf, mich zu rütteln, ich bin wach«, sagte er mit noch dunkler, verschlafener Stimme.
Fenjin nahm die Hände von seinen Schultern und ließ sich neben Vaaks` gemütlichem Bett – das nichts weiter als ein Heuhaufen war – auf den Hintern fallen. »Du hast so tief geschlafen, ich dachte, ich würde dich nie wieder wach bekommen.«
Vaaks setzte sich langsam auf und rieb sich den Schlaf aus den Augen. »Ich habe geträumt«, gähnte er genüsslich und streckte sich anschließend. Seine breiten Schultern knacksten.
»Wovon?«
»Von unserer ersten Begegnung«, antwortete er trocken, strich sich die dunkelbraunen Locken aus dem Gesicht, um sie zusammen zu binden, und sah aus der Heubodenluke nach draußen. Die Sonne ging hinter den weißen Bergspitzen unter, in deren Schutz die Festung samt Stadt lag. Ziegeldächer und graue Turmzinnen tummelten sich vor der malerischen, bergigen Kulisse, es stieg Rauch von unzähligen Kaminen auf und schlängelte sich träge dem Himmel entgegen.
»Wie lange ist das jetzt her?«, fragte Fenjin. Ein breites Grinsen schwang in seiner melodischen Stimme mit.
Vaaks überlegte mit verengten Augen. »Wie alt waren wir da?«
»Du sieben und ich acht Sommer.« Der Heuboden knackste, als Fenjin sich erhob und sich das Heu aus dem roten, kurzen Haar zupfte.
Vaaks überschlug die Jahre im Kopf. »Zehn Sommer«, flüsterte er, als könnte er selbst kaum glauben, wie lange sie schon Freunde waren. Fenjin hatte sich kaum verändert, er war noch immer eine Frohnatur und noch immer für jeden Streich zu haben. Er war gewachsen, das waren sie beide, aber noch immer war er schlank mit schmalen Schultern und noch schmäleren Hüften. Feingliedrig und groß, die perfekte Statur für einen schnellen Reiter. Oder eben für einen Kaufmannssohn, der in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Kein Krieger, das war Fenjin nicht. Ganz im Gegensatz zu Vaaks, der beinahe wöchentlich neue Hemden und Hosen brauchte, weil sein Körper einfach nicht aufhören wollte, an Masse zu gewinnen. Er wuchs und wuchs, die Schultern gingen in die Breite, alles andere in die Höhe. Riath, einer seiner Brüder, nannte ihn bereits neckend einen Berg. Neben ihm sähe Fenjin mittlerweile wie ein dünner Grashalm aus.
»Und du verlierst heute noch beim Fangen«, neckte Fenjin ihn und trat ihm gegen den Stiefel, womit er ihn aus seinen Gedanken riss. »Genug geschlafen, lass uns gehen, bevor dein Bruder uns wieder zusammen sieht und ich um mein Leben fürchten muss.«
Letzteres sagte er so zynisch, dass Vaaks sich veranlasst sah, zu seufzen.
»Dass er dich nicht mag, liegt allein daran, dass er niemanden leiden mag.«
Fenjin schnaubte herablassend, aber nicht über Vaaks, sondern über seine Behauptung. Er wandte sich ab und ging zur Leiter. Als er sich auf die erste Sprosse schwang, konterte er: »Von allen Personen bist du derjenige, der ihn am Schlechtesten kennt, glaub mir.« Vaaks runzelte verständnislos seine Stirn, aber Fenjin ging nicht weiter darauf ein. Traurig sah er Vaaks in die kastanienbraunen Augen. »Er hält mich für unwürdig, dein Freund zu sein. Er bewacht dich!«
»Du irrst dich, er kann mich nicht mal richtig leiden. Und er mag dich, er kann es nur nicht zeigen.«
Fenjin verdrehte die Augen, als wollte er sagen: »Hast du eine Ahnung.« Doch er ließ das Thema fallen, sie hatten es schon zur Genüge diskutiert.
»Jetzt komm, spute dich, mein Prinz.« Fenjin grinste herausfordernd. »Oder willst du wieder Letzter sein? Ich habe allmählich das Gefühl, du findest Gefallen daran, zu versagen.«
Vaaks` Augen blitzten seinem Freund schelmisch zu. »Vielleicht habe ich dich über all die Jahre ja auch immer gewinnen lassen.«
Fenjin zog anzüglich eine Augenbraue nach oben. »Aha! So ist das also. Wollte der pflichtbewusste Prinz mir etwa den Hof machen?« Er legte keck den Kopf schief und blinzelte so übertrieben wie eine Bühnendarstellerin.
Vaaks nahm eine Handvoll Heu und warf sie nach ihm.
Lachend duckte Fenjin sich hinter die Leiter.
»Von wegen!« Vaaks stand auf. »Ich wollte dich nur nicht wie ein Mädchen weinen sehen!«
Als er auf die Leiter zu ging, ließ Fenjin sich geschickt hinabrutschen und lachte unten im Stall voller Dreistigkeit. »Ha! Schon wieder entwischt.«
Als Vaaks amüsiert zu ihm hinabsah, verlor sich augenblicklich sein Lächeln.
Fenjin runzelte verwirrt die Stirn, doch bevor er nachfragen konnte, was Vaaks den heiteren Moment vermiest hatte, landete eine Hand auf seiner Schulter, und er fuhr erschrocken herum.
»Warum so ängstlich, Fenjin?«, fragte der dunkelhaarige Stallbursche. Argwöhnend sah er von Fenjin zu Vaaks und wieder zurück. »Hab ich euch bei etwas erwischt, hm?«
Vaaks` Miene blieb hart, er mochte den Kerl nicht sonderlich, aber er gehörte zu Fenjins Freunden.
»Klay!« Fenjin schlug sich die Hand flach auf die Brust, als wollte er sein Herz dort halten. »Hast du mich erschreckt, ich dachte schon, es wäre…«
»Die Großfresse, die Vaaks Bruder nennt?« Klay sah mit seinen bösen, kleinen Augen zu Vaaks auf und zog herausfordern seine dunklen Brauen in die Höhe. »Hat man deinen irren Bruder endlich an die Leine gelegt? Oder ihn im Fried eingesperrt, weil man der Öffentlichkeit seine unansehnliche Fresse nicht zumuten kann? Ich habe ihn hier nicht mehr gesehen, seit diesem … hässlichen Gerücht«
Vaaks sprang vom Dachboden, er wollte nicht vor dem Großmaul die Leiter runter klettern. Direkt neben Klay kam er auf und starrte diesem hart ins Gesicht. »Kein Wort über einen meiner Brüder«, warnte er ohne die Stimme zu erheben oder zu drohen. Es war schlicht ein gut gemeinter Rat.
Klay verengte die Augen, schätzte ab, wie weit er gehen konnte. Er war ein Widerling, ein richtiger Kotzbrocken. Vaaks wusste nicht, warum Fenjin mit ihm befreundet war. Aber vermutlich aus dem Grund, weshalb die halbe Festungsstadt mit ihm befreundet war. Er sah gut aus und war beliebt bei den jungen Damen. Er musste also auch eine charmante Seite besitzen, diese hatte Vaaks nur leider nie gesehen.
»Hört auf! Lasst uns in die Schenke gehen«, versuchte Fenjin, die Stimmung aufzulockern.
Vaaks sah ihn an und trat einen Schritt zurück. »Ich muss gehen, bevor sie sich sorgen.«
Klay höhnte, auf seine Mistgabel gestützt: »Muss das Möchtegern-Prinzchen sich füttern und den Arsch abwischen lassen? Ist dir der Wein der Bauernschenken nicht gut genug?« Seine Stimme wurde ernst, geradezu wütend. »Was kommst du eigentlich immer hier runter? Bleib auf deiner Festung und bade in goldenen Wannen.«
Vaaks rollte innerlich mit den Augen, Klay hatte eine völlig falsche Vorstellung. Aber was wollte er auch erwarten, er musste sich Klay nur kurz in seinen lumpigen, alten und dreckigen Leinenkleidern ansehen, um zu wissen, woher dessen Neid herrührte. Sie waren gleich alt, aber nur einer von ihnen musste Mist schaufeln. Dass Vaaks dafür andere Pflichten besaß, das wollte niemand sehen.
»Hör auf, Klay.« Fenjin schlug dem neidischen Stallburschen gegen den Arm. »Vaaks ist nicht so, das weißt du.«
Klay hörte das Pfeifen des Stallmeisters und sah sich über die Schulter, dann stieß er schnell die Gabel ins Heu, als würde er arbeiten. »Ich kenne seine Brüder«, murrte er verbittert, »Riath hält sich für den größten Hecht im Teich, und Xaith glaubt, er sei eine Art Gott. Der Weißhaarige hält uns nicht mal für würdig genug, uns zu beachten, ich glaub, er war noch nie in der Stadt. Und das Mädchen? Die Schwester…«
»Wage es nicht…«, fiel Vaaks ihm ins Wort.
Klay lächelte zynisch. »Sie hält sich für männlicher als all ihre Brüder zusammen. Vielleicht hat sie ja recht.« Herausfordernd musterte er Vaaks` Körper. »Man hört ja so einiges. Lässt die Weiber links liegen – vielleicht wärst du ja lieber selbst das Weibchen, hmmm?«, höhnte er und schielte dann zu Fenjin.
Vaaks ballte die Fäuste, doch er hielt seine Wut zurück. Der Streit würde nur eskalieren, wenn er darauf einging.
Fenjin schüttelte den Kopf. »Lass Vaaks in Ruhe, Klay, er kann auch nichts dafür, dass die Fräuleins dich stehen lassen, sobald er den Raum betritt!«
Wütend fuhr Klay zu ihm herum, aber Fenjin entwaffnete ihn mit einem neckischen Lächeln. Freundschaftlich schlug er dem Stallburschen noch einmal auf den Arm. »Sei nicht so ein Griesgram, nur weil du hier schuften musst und wir auf dem Heuboden ein Nickerchen machen konnten.«
Klay entspannte sich, er schüttelte mit einem Schnauben den Kopf. Dann nickte er Vaaks zu, der ihn noch immer argwöhnisch beobachtete. »Wenn der Prinz mir einen Becher Wein spendiert, werde ich ihm verzeihen, dass er vom König höchstpersönlich aufgenommen wurde, während wir anderen Nichtblaublüter unsere Hände blutig arbeiten.«
Es war ein unterschwelliger Seitenhieb. Klay deutete die Tatsache an, dass Vaaks nur der Ziehsohn von König Desiderius war, und nicht sein Fleisch und Blut.
Lange starrte Vaaks ihn reglos an, ehe sich langsam ein Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete und er gemeinsam mit Klay und Fenjin zu lachen anfing.
Klay war ebenso, er konnte gar nicht anders, er wurde als mürrischer Bastard geboren, wie er sich selbst immer betitelte. Wenn er schlechter Laune war, suchte er sich gern einen Sündenbock, den er für sein Leid verantwortlich machen konnte. Das Leid des einfachen Lebens.
Klay hatte ja keine Ahnung, dass Vaaks manchmal gerne mit ihm tauschen würde. Mistgabeln schwingen, statt auf dem staubigen Platz gegen seinen eifrigen Bruder Riath zu bestehen, der alles daran setzte, der beste Schwertkämpfer, der beste Bogenschütze und der beste Reiter weit und breit zu werden, um dem König zu imponieren. Riath wollte stets dafür sorgen, dass alle wussten, dass er der stärkste und geschickteste Prinz war, dass er seine Brüder alle übertrumpfte und besiegen konnte. Dafür trainierte er hart. Und seine Verbissenheit zahlte sich aus, er war wirklich gut, und er wusste das. Er war sich auch nicht zu schade, sich in diesem Ruhm lächelnd zu sonnen.
Klay streckte Vaaks seine schmutzige Hand entgegen. »Was meinst du, Ziehsohn des Königs, gibst du mir einen Becher aus und lässt deine goldenen Hallen einen Abend für einen Bauern wie mich sausen?«
Vaaks rang mit sich, er wusste, dass seine Antwort für sein Verhältnis mit den »normalen« Kindern entscheidend war, aber …
»Wie wäre es, wenn ich dir einen Wein spendiere!«
Sie fuhren alle drei zu der Stimme herum. Ein großer Schatten bewegte sich in einer leeren Pferdebox hinter ihnen und trat in das goldene Abendlicht, das von draußen auf die Stallgasse fiel. Blondes Haar schimmerte im Sonnenuntergang, der dazugehörige Junge war fast so groß wie ein ausgewachsener Hüne, breite Schultern, sehr schmale Hüfte, beinahe überproportionierte Armmuskeln unter einem stramm sitzenden Hemd aus robustem, dunklem Eberleder. Markantes Gesicht, das ihn hart aber ebenso anmutig aussehen ließ, das Haar an den Seiten kürzer, das Deckhaar lang und zurückgekämmt, als bliese ihm ein starker Wind ins Gesicht. Lodernde, entschlossene Augen in der Farbe dieses seltsamen, benebelndem Getränks. Absinth. Augen in der Farbe von Absinth.
Ein königlicher Samtumhang, außen schwarz und innen purpurn, ließen jeden Fremden erkennen, wer er war.
Der Blonde ging direkt mit wogendem, selbstsicherem Gang auf Klay zu, der seine Sprache, aber nicht seine trotzige Miene verloren hatte. »Und wie wäre es mit einem ganzen Fass, das ich dir dann in deinen armen, knochigen Arsch schieben werde!«
»Halt!« Vaaks drängte sich zwischen die Beiden, in der Luft knisterte übergroßer, männlicher Stolz. »Riath!«
Sein Bruder baute sich auf, seine grünen Augen loderten angriffslustig, aber Vaaks blieb vor Klay stehen. »Du solltest etwas mehr Respekt zeigen, Stallbursche! Oder muss ich dir erst Respekt einflößen, du Großmaul!«
Vaaks wollte ansetzen, um zu beschwichtigen, als…
»Oh nein, jetzt habt ihr den Hahn geweckt! Und er plustert sich wieder angeberisch auf«, mischte sich eine weitere Stimme ein. Abschätzig, trocken und durch und durch gelangweilt, mit einem samtweichen Unterton, der ihr beinahe etwas Sanftes verlieh.
Vaaks gefror bei dieser Stimme das Blut in den Adern, während sein Herz sofort in Raserei verfiel.
Nein, nicht er. Alle, nur nicht er. Nicht hier, nicht jetzt.
Klay und Fenjin traten unwillkürlich einen Schritt zurück und senkten umgehend sehr schweigsam die Köpfe.
Vaaks kannte das, so verhielten sich die Menschen stets in der Gegenwart seines Bruders. Sie wichen vor ihm zurück oder senkten ergebend die Köpfe, fühlten sich sichtlich unwohl, fast bedroht, allein durch seine Anwesenheit. Nur hinter seinem Rücken wurde gelästert, was er natürlich wusste.
»Wer hat dich denn aus deiner Gruft gelassen?«, verspottete Riath Xaith. »Kommst du nicht für gewöhnlich erst bei Nacht heraus, wie all die anderen Schreckgestalten?«
Wenn Xaith die Bemerkung kränkte, ließ er es sich nicht anmerken. Sein stets durch und durch müder Blick ließ kaum eine Gefühlsregung erkennen, als würde ihn alles und jeder zutiefst langweilen. Der Umgang mit anderen Lebewesen ermüdete ihn, so sagte er selbst.
Wobei er mit Tieren auf einer Ebene umgehen konnte, wie es kaum ein anderer vermochte. Nicht wie ein Jäger, der seine Tiergefährten als Freunde betrachtete, sondern mehr wie ein Meister. Es schien, als könnte Xaith Tiere an sich binden, sie geradezu beherrschen. Auf eine wirklich gruselige Art und Weise.
Seine zwei Raben waren vermutlich die einzigen Geschöpfe, die so etwas Ähnliches wie seine Freunde waren. Wobei man sie wohl eher als Untertanen bezeichnen konnte. Und sie begleiteten ihn stets, auch in diesem Moment. Gagat, der schwarze Rabe mit den roten Augen, saß an seinem angestammten Platz auf Xaiths linker Schulter, und Petalit saß auf seinem angewinkelten rechten Arm. Petalit war ein besonderer Rabe, denn er war weiß, selbst seine Augen, als hätte Xaith ihm jegliche Farbe ausgesaugt.
»Was bist du doch geistreich, Bruder.« Xaith grinste kühl und schlenderte herein, dabei streichelte er den weißen Raben mit einem Finger unter dem Schnabel. Petalit schien es zu genießen. »Dass mich deine Worte kalt lassen, dürfte dir Aufschluss darauf geben, wie gleich mir deine Meinung und du im allgemeinen als Person bist.«
Riaths kantiges, männliches Gesicht wurde steinhart, er hasste Abweisung in jeglicher Form, selbst von Xaith. Dieser lächelte Riath an und genoss seinen Triumph sichtlich.
Vaaks kannte Xaith schon sein ganzes Leben. Natürlich, sie waren Brüder, wenn auch nicht blutsverwand und nicht einmal der gleichen Rasse angehörig – denn Vaaks war ein Mensch, der von Luzianern, von Blutsaugern, großgezogen wurde –, so gehörten sie doch derselben Familie an, wenn auch nur symbolisch. Das machte sie zu Brüdern, von Anfang an. Und doch besaß sein Bruder eine undurchdringlich düstere Aura, die ihn immer wieder fasziniert blinzeln ließ, als sähe er ihn zum ersten Mal.
Aber Xaith war auch eine … besondere Erscheinung. Und das nicht, weil er besonders groß war, dazu aber elegant schlank, was ihm einen beneidenswert drahtigen Körper verlieh, der sich hervorragend zum Meucheln eignen würde. Oder zum Tanzen.
Er wäre sicher ein begnadeter Tänzer.
Seine Brust und sein Bauch waren flach, seine Gliedmaßen lang, schlanke Muskelstränge lagen unter seiner straffen, rosigen Haut, seine Schultern waren nicht nennenswert breit, aber durch seine lange Körperform machte er das wieder wett. Doch vor allem waren seine Augen beeindruckend. Diese lodernden, gelbgrünen Augen mit den geschlitzten Pupillen, die einem die Seele aus dem Leib zu brennen schienen, wenn man nur lange genug hineinsah. Vaaks hatte schon immer ein Prickeln im Nacken verspürt, wenn sein Bruder ihm nur etwas länger in die Augen sah. Xaiths Haar war etwa so lang wie der Zeigefinger eines ausgewachsenen Mannes, es war schwarz und erinnerte an das Federkleid eines Vogels, wenn es sich bewegte. Es hing ihm stets verwegen in der Stirn und unterstrich seine besonderen Augen. Sein Gesicht war vergleichsweise schmal, besaß aber scharfe Kanten, genau wie sein Vater, der König. Die Wangenknochen, die lange Nase und das spitze, lange Kinn hatte Xaith eindeutig vom König vererbt bekommen. Nur sein Mund war schöner, wie Vaaks zugeben musste. Die Lippen blass, mit einem sanften Schwung, nicht zu schmal, aber auch nicht zu voll. Ein richtiger Kussmund, würden die Damen sagen. Doch aufgrund seiner roten Punkte und den vielen Kratern in seinem Gesicht war Xaith nicht gerade ein Frauenschwarm. Er hatte mit seiner unreinen Haut schwer zu kämpfen, das wusste Vaaks, und es tat ihm leid. Ihm persönlich fiel es gar nicht wirklich auf, Xaith bestand aus mehr als aus seinem Makel, Vaaks sah meistens ohnehin nur dessen Augen, wenn er ihm einen Blick zuwarf. Wie könnte man etwas anderes sehen? Und doch wurde Xaith ausgestoßen, obwohl so viel mehr in ihm steckte, als seine äußere Erscheinung erkennen ließ.
Nicht, dass nur sein Makel daran Schuld trug, dass er ein Einzelgänger und Sonderling war. Wie man an Fenjin und Klay sehen konnte, war es vor allem seiner kalten Ausstrahlung zu verdanken, dass er gemieden wurde. Es schien allerdings so, als legte er Wert darauf, gefürchtet zu werden.
Das sagte auch seine Kleidung. Sie schrie geradezu: »Bleibt weg von mir, ich bin ein Sonderling.«
Xaith trug stets einen Mantel aus schwarzem Leder, ganz gleich wie heiß oder kalt es war. Den Kragen aufgestellt, die Front offen. Darunter trug er ein schwarzes Hemd, das er lässig bis zum Bund seiner dunkelbraunen Lederhose offen ließ und damit seine haarlose, makellose Brust preisgab, als wollte er beweisen, dass nur sein Gesicht einen Makel besaß.
Hinzu kam sein Gang. Gleitend, kein bisschen federnd. So selbstbewusst und beinahe anpirschend wie ein Raubtier. Er schien es nie eilig zu haben, als ob es in seiner Macht läge, einfach die Zeit anzuhalten, sollte er drohen, zu spät zu kommen.
Vaaks war sich nie sicher, ob Xaiths düsteres, abgebrühtes Gehabe nur Fassade war oder sein wahres Gesicht zeigte. Wobei er oft das Gefühl hatte, dass diese Frage nicht so leicht zu beantworten war. Vermutlich traf beides und nichts zu.
Als Xaith langsam nähertrat, sank Vaaks das Herz in den Magen, weil niemand vorausahnen konnte, was sein Bruder im Schilde führte.
Wenn er nur hier war, um mit Riath zu zanken, würden Fenjin und Klay glimpflich davonkommen.
Doch wenn er nur hier war, um mal wieder Vaaks` Freunde zu vergraulen, konnte es heikel werden, denn Klay war ein Großmaul, der sich nicht zurückhalten konnte, und Xaith demonstrierte gern seine Macht. Er wurde schnell wütend – und das nicht auf solch vorhersehbare Weise wie Riath.
Vielleicht war dies sogar Xaiths einziger Antrieb. Vaaks hatte oft das Gefühl, dass Xaith schlicht Spaß daran hatte, Vaaks` Freunden Angst einzuflößen. Dass er gefürchtet sein wollte und die Einsamkeit bevorzugte.
Im Stall ging Xaith nun auf Riath zu, umrundete den Rücken seines breitschultrigen Bruders mit einem intensiven, musternden Blick aus seinen gelbgrünen Drachenaugen und stellte sich dann ganz beiläufig zu Vaaks, als stünde er zum ersten Mal nicht nur im wörtlichen Sinn an dessen Seite.
»Was würde Vater wohl davon halten, wüsste er um deine zweifelhaften Umgangsformen mit unseren Untergebenen?«, fragte Xaith Riath und warf sich ein paar Kerne aus seiner Manteltasche in den Mund, den Rest verfütterte er an Gagat und Petalit. »Ich glaube, das würde ihm gar nicht gefallen«, grinste er verschlagen mit vollem Mund, als freute er sich bereits auf den Moment, wenn der König hiervon erfuhr.
Riath bewegte genervt den Kopf hin und her. Es war kein richtiges Schütteln, die Geste unterstrich lediglich sein leichtes Augenrollen. »Es geht hier nicht um mich, mir gefällt es nun mal nicht, wie respektlos dieser Stalljunge mit unserem Bruder spricht.« Er nickte zu Klay, der mit seinen kleinen Augen unsicher umherblickte. Zorn zuckte in seiner Mimik, aber er war klug genug, den Mund zu halten.
Xaith konterte gelangweilt: »Er ist nicht unser Bruder.«
Ganz gleich wie oft er es sagte, es milderte den Stich in Vaaks` Brust nicht, wenn diese Worte seinen Mund verließen. Unwillkürlich sah Vaaks den strohbedeckten Stallboden vor sich, weil sich sein Blick gesenkt hatte. Obwohl Xaith ihn noch nie als Bruder ansehen wollte, war es für Vaaks immer wieder aufs Neue erschütternd, es so trocken und endgültig von ihm zu vernehmen.
Xaith hätte ebenso gut sagen können, Vaaks gehöre nicht zu seiner Familie.
Fenjin legte von hinten eine Hand um Vaaks` Schulter, da er wusste, was er in diesem Moment fühlte. Er spendete ihm stumm Trost. Vaaks sah sich flüchtig über die Schulter, sein Freund lächelte aufmunternd, und er lächelte flüchtig zurück.
»Doch, das ist er!«, beharrte Riath und wollte wieder auf Klay zugehen, der hinter Vaaks und Xaith stand. »Und dieser Bursche hat ihn gefälligst wie einen Prinzen zu behandeln. Ebenso wie uns! Beuge dein Haupt – und höre auf, mich anzustarren, als könntest du es mit mir aufnehmen, das kannst du nämlich nicht!«
»Vielleicht kann er es ja doch, wenn er sich traut«, warf Xaith mit einem gewitzten Augenfunkeln ein. »Ich finde, du solltest ihm eine Chance lassen. Jeder Mann sollte das Recht haben, sein Können unter Beweis zu stellen.«
Riath starrte den Stalljungen mit seinen stechendgrünen Augen nieder. »Soll er es versuchen.«
Xaith drehte sich zur Seite und sah gelangweilt zwischen Riath und Klay hin und her, seine Raben schlugen mit den Flügeln, als wollten sie den Streit anfeuern.
Doch Klay rührte sich nicht, er stand wie angewurzelt da und ballte die Fäuste, bis die Haut an seinen Knöcheln weiß wurde. In seinem Gesicht stand ein Zorn, der ihn feuerrot anlaufen ließ. Zwiegespalten zwischen Wut und dem Wissen, dass es Konsequenzen haben würde, sollte er sich mit einem Prinzen messen und diesen verletzen. Vielleicht dachte er auch darüber nach, was es für ihn und seinen Stolz bedeutete, sollte Riath ihn innerhalb eines Atemzugs von den Beinen fegen.
Die Anspannung im Stall stieg greifbar an, während das schweigsame Anstarren anhielt.
»Hört auf!« Vaaks kam endlich zu sich, nachdem er sich an die knisternde Aura gewöhnt hatte, die seinen Bruder Xaith stets umgab, und schob sich zwischen alle. Einzeln sah er sie an, Klay, Xaith, dann Riath. »Es war nur ein Spaß! Klay hat es nicht so gemeint. Und er ist mein Freund« - das entsprach zwar nicht der Wahrheit, aber das war gleich in diesem Moment – »ich will gar nicht, dass er mich anders behandelt. Wir haben nur gescherzt.«
Riath hob den Kopf, er starrte Klay noch immer fest ins Gesicht, als wollte er ihn auffressen, aber Vaaks konnte unter der harten Fassade sehen, dass sein Bruder einigermaßen besänftigt war, wenn auch nicht sonderlich glücklich.
»Du hast großes Glück«, murrte Riath an Klay gewandt, »dass Vaaks ein gutes Herz hat.« Seine Augen zuckten zu Xaith, dann wieder zurück. »Aber ich behalte dich im Auge, Stallbursche. Und ich dulde kein schlechtes Wort über meine Brüder. Verstanden?«
Klay rang mit sich, Fenjin musste ihm erst einen Ellenbogen in die Rippen rammen, damit er leicht den Kopf senkte und murmelte: »Jawohl, mein Prinz.«
Das stimmte Riath milde, er mochte untertäniges Gehabe. »Ich meine es ja nicht böse, ich finde lediglich, dass du dir zu viel rausgenommen hast.«
Klay starrte angestrengt zu Boden. »Ihr habt recht, mein Prinz.«
Xaith stieß ein durch und durch abfälliges Grunzen aus. Alle sahen ihn an, Vaaks` Blick flehte inständig, dass er es dabei belassen sollte. Xaith verdrehte die Augen zum Heuboden. »So leicht zu beschwichtigen, wer soll dich einmal ernstnehmen.« Er schien enttäuscht, dass der Konflikt im Keim erstickte.
Riaths markante Gesichtsmuskeln zuckten ärgerlich. »Kannst du nicht irgendwen anderes mit deiner Anwesenheit gruseln?«
»Gern.« Geradezu erhaben glitt er zwischen ihnen allen hindurch und schlenderte auf das Tor der Ställe zu, das den Blick auf die Koppel preisgab. »Im Übrigen«, sagte er im lässigen Tonfall über die Schulter, »erwartet Vater euch an den Koppeln. Und zwar … oh … ich glaube, das war vor einer Stunde. Hm. Hoffen wir, dass unser Vater so leicht zu beschwichtigen ist wie du, mein geschätzter Bruder.«
Vaaks und Riath wurden beide bleich, sie sahen sich an, beide innerlich über Xaith fluchend, dann eilten sie ihm nach. Sie rannten an Xaith vorbei, der es wie immer nicht eilig hatte.
Fenjin entschuldigte sich halbherzig bei Klay, der beschämt zurückblieb, und holte schnell zu Vaaks auf. Wo Vaaks hinging, folgte auch Fenjin. So war es seit zehn Jahren.
Xaiths Blick bohrte sich in Fenjins und Vaaks` Rückseiten. Vaaks konnte es spüren, wie ein kaltes, bedrohliches Prickeln, das ihm den Rücken hinabrieselte. Auch das war seit zehn Jahren konstant: wo Vaaks und Fenjin waren, war Xaith nie weit.
Kapitel 4
»Was sind das für … Dinger?«, rief er, während er rannte, als würde sich die Erde unter ihm auftun.
Was gar nicht so absurd war, denn tatsächlich bebte der Boden, auf dass sich Risse im Wald bildeten und links und rechts von ihm Bäume und Felsen verschluckt wurden, als hauste unter der Erde ein Ungeheuer, das einen unstillbaren Hunger hatte. Es dröhnte, donnerte und krachte im Wald, als stampfte ein Riese umher.
Die Erschütterungen im Boden erschwerten das Davonkommen zunehmend. Und ihre Verfolger eilten ihnen ungehindert nach, denn weder das Beben noch die Risse konnten sie aufhalten, sie schwebten einfach darüber hinweg.
»Bellzazar!« Sein lautes Brüllen klang fordernder als beabsichtigt. »Was, bei den Göttern, sind die?«
»Erscheinungen. Schemen«, rief Bellzazar rechts von ihm. Er hatte sein Schwert in der Hand, einen Zweihänder mit dünner, gewellter Klinge aus schwarzem Stahl. Runen waren in die Klinge hineingeritzt und leuchteten feuerrot auf, wenn sie durch die Erscheinungen glitten.
Das Unterweltschwert namens Flammberge.
»Verirrte Geister. Sie haben keine Erinnerungen mehr, sie sind schon zu lange tot und im Schleier verdorben. Sie kommen aus dem Portal, diese Welt macht sie verrückt!«
Cohen hechtete hinter einen Baum und drückte den Rücken dagegen. Drei dieser Schemen zogen an ihm vorüber, tiefer in den dichten Wald, unter dessen dichten Blätterdächern kaum die Sonne durchdrang und Zwielicht herrschte. Er kam sich wie in einem natürlichen Dom unter einem grünen Kuppeldach vor. Es war halbdunkel und roch nach feuchter Erde, während das Beben im Boden die Blätter wie im Sturm rascheln ließ.