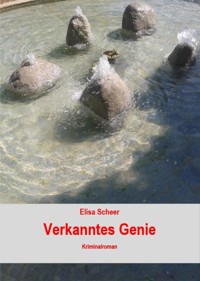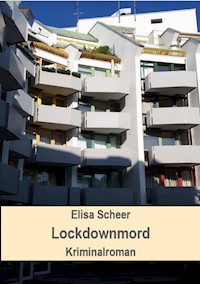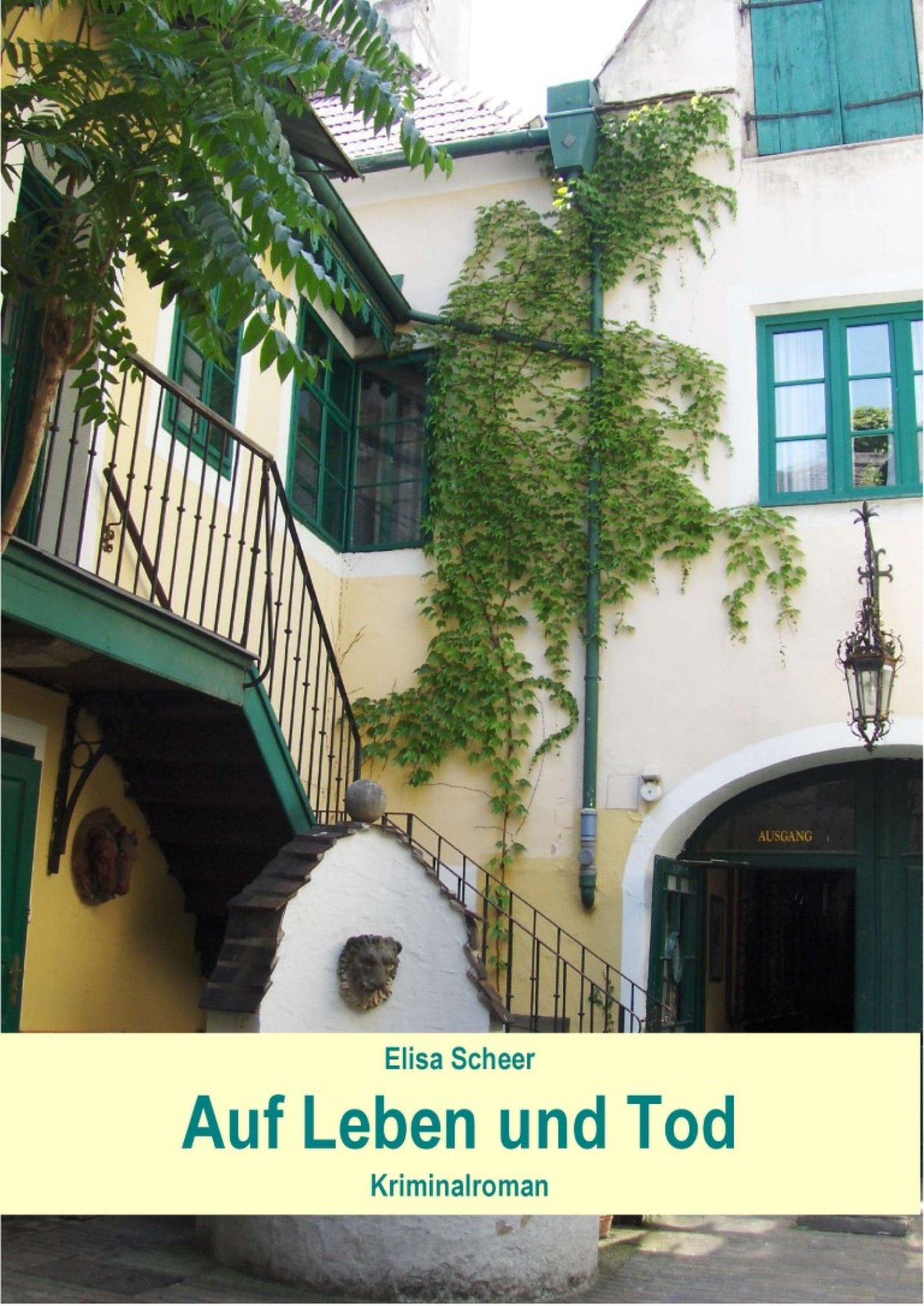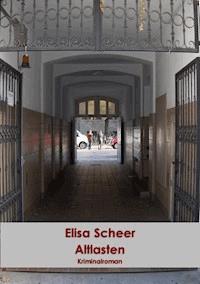Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Auf dem Traumjob liegt eine halbjährige Besetzungssperre, ihr Freund frisst ihr die Haare vom Kopf, das Konto ist leer - Anne braucht dringend einen Job. Alles, was sie findet, ist Putzen, aber das ist interessanter, als sie zunächst angenommen hat: Sie lernt nette und durchgeknallte Leute kennen und einen Schriftsteller, der sich mit dem Gedanken quält, vor einigen Jahren als Dozent eine Studentin in den Tod getrieben zu haben. Aber war es wirklich so? Und wer wirft ihm Steine durchs Fenster, um die Schuldgefühle am Leben zu erhalten? Anne beginnt, selbst zu recherchieren, wobei sie weder von dem vergrämten Kampmann noch von der Polizei zunächst unterstützt wird. Und je näher sie der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird es für sie selbst - und für ihren Seelenfrieden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alles frei erfunden!
Imprint Grundreinigung. Kriminalroman
Elisa Scheer
Eins
Ich war eigentlich immer schon ein sehr ordentlicher Mensch. Die Post holte ich täglich aus dem Briefkasten, und im Gegensatz zu Heiner öffnete ich auch alle Briefe sofort. Die Werbung natürlich nicht, die warf ich sofort weg, aber alles andere wurde geöffnet, glattgestrichen, beantwortet oder abgeheftet, damit nichts herumlag; die Wohnung war schließlich klein und vollgestopft genug.
Heiner häufte in seiner Ecke jede Menge ungeöffnete Umschläge auf und arbeitete den Haufen dann einmal im Vierteljahr ab. Er glaubte wohl, für einen Künstler gehöre sich das so. Dummerweise neigte ich aber dazu, Briefe, die keine Antwort erforderten, ungelesen abzuheften – zum Beispiel Kontoauszüge, und dieses Verfahren kann man eigentlich nicht zur Nachahmung empfehlen.
*
An diesem Freitag saß ich wieder vor meiner Post und riss Umschläge auf, warf flüchtige Blicke auf den Inhalt und machte zwei Häufchen.
„Spießerseele“, spottete Heiner und versuchte vor dem kleinen Spiegel im Flur, seine Haare so hinzufrisieren, dass die grüne Strähne vorne hochstand und genau zu seinem ebenso froschgrünen Poloshirt passte.
„Wie du meinst. Wo musst du eigentlich hin in deiner Froschverkleidung?“
„Besprechung in der Redaktion.“
„Schön für dich.“
Heiner arbeitete bei City News in der Szene-Redaktion, er besuchte neueröffnete Kneipen, Discos und Restaurants, berichtete von Vernissagen und trendigen Ausstellungen, schrieb ab und an auch Buchkritiken (an die ich mich bei meiner Lektüre nie hielt, unser Geschmack war doch zu unterschiedlich) und hielt sich für den Kulturpapst der Stadt. Sein erbitterter Konkurrent, Alex Dietersheimer, glaubte von sich allerdings das Gleiche.
Natürlich musste man sich dafür trendy stylen, das war mir auch klar, und ebenso klar war, dass mein künftiger Job nicht halb so glamourös war – ich hatte ab nächstem Monat eine Planstelle bei der staatlichen Museenverwaltung in Aussicht. Was heißt in Aussicht - sie war mir fest zugesagt, und beim Staat war das gleichbedeutend mit einer Lebensstellung. Das fand Heiner spießig, er zog mich schon dauernd mit meinem künftigen Beamtenstatus auf.
Ich schlitzte weiter Briefe auf und sortierte. Handyrechnung – ablegen. Steuerbescheid – ablegen. Kontoauszug – ablegen. Aboangebot – wegwerfen. Brief von der Museenverwaltung – beantworten, nachher. „Wenn du schon den ganzen Tag nichts zu tun hast, könntest du mir nachher ein Theater heute und Fine Arts besorgen.“
„Lass mir doch die kurzen Ferien, ich hab erst vor zwei Wochen meine letzte Prüfung gehabt“, wehrte ich leicht gereizt ab. „Die Zeitschriften kann ich besorgen, aber ich hätte das Geld gerne mal zurück. Fine Arts ist schweineteuer.“
„Mein Gott, bist du pingelig, ich hab letzte Woche neue Schuhcreme gekauft und die einsneunundneunzig auch nicht von dir zurückverlangt.“
„Die Schuhcreme benutzen wir beide, und Fine Arts kostet zehn Euro und ich kann es für nichts gebrauchen. So esoterischer Krempel wird mir in den staatlichen Museen nie begegnen.“
„Das siehst du mal, wie verschnarcht die sind. Also, vergiss die Zeitschriften nicht, du hast ja sonst nichts zu tun.“
„Ja, ja“, murmelte ich und öffnete den letzten Brief. Büchersonderangebote. Später mal durchlesen, vielleicht. Also, den Brief von der Museenverwaltung! Ich registrierte noch mit einem halben Ohr, wie Heiner die Wohnung verließ, und begann zu lesen.
Sehr geehrte Frau Holler,
Bezug nehmend auf unser Angebot einer Planstelle in der staatlichen Museenverwaltung müssen wir ihnen leider mitteilen, dass für die für Sie in Aussicht genommene Planstelle eine sechsmonatige Besetzungssperre verfügt wurde (Aktenzeichen...) und wir Sie deshalb erst zum 1. April 2003 einstellen können. Wir hoffen, dies bereitet Ihnen keine Unannehmlichkeiten, und freuen uns darauf, Sie am ersten April 2003 in den Räumen der Museenverwaltung, Schloss Ludwigskron, Ostflügel, begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen,
K. Lierheim, RegR´in
Der erste April war ein Montag, registrierte ich automatisch. Doofes Datum für einen ersten Arbeitstag, übrigens.
Klasse – wovon sollte ich denn eigentlich leben, während ich darauf wartete, dass die Besetzungssperre ablief? Das war sicher ein Teil dieser allgemeinen Sparmaßnahmen, aber mit meinen wüsten Studienfächern, einer Mischung aus Wirtschaft, Recht, Sprachen, Kunst und Medienwissenschaften, war ich für den Job einfach prädestiniert, und etwas anderes war mir auch gar nicht angeboten worden. Da blieb mir wohl nichts anderes übrig, als das halbe Jahr abzuwarten. Ich schrieb sofort einen entsprechenden Brief, eine gelungene Mischung aus Ungehaltensein und Geduld, und legte ihn für den Briefkasten bereit. Ein halbes Jahr, da brauchte ich wohl irgendwoher etwas Geld. Sechs- bis neuntausend Euro würde ich für Miete, Versicherungen und ab und zu einen Kanten Brot schon benötigen...
Ich hatte doch gerade einen Kontoauszug bekommen, wie sah der eigentlich aus? Nicht gut, musste ich feststellen – mein Konto war um die zweitausend Euro im Minus, und genau das war auch mein Dispolimit. Wenigstens war die Miete für Oktober schon abgebucht. Aber die Krankenkasse noch nicht, Mist!
Im Geldbeutel hatte ich noch elf Euro. Sollte Heiner sich seine dämlichen Kunstzeitschriften gefälligst selber kaufen! Und sonst... zwei Sparbriefe, noch nicht fällig. Auf diesem halb vergessenen Postsparbuch noch dreihundertfünfzig Mark – nicht mal umgeschrieben! Das war alles, damit kam ich nur noch eine Woche weiter. Dann musste Heiner eben mal den Haushalt finanzieren, bis jetzt war er ohnehin ziemlich billig davongekommen. Überhaupt, wieso zahlte ich eigentlich immer alles? Fast alles wenigstens?
Ich wollte mich gerade in einen gesunden Ärger auf Heiner hineinsteigern, aber dann brach ich diese fruchtlosen Überlegungen doch lieber ab und ging erst einmal zur Post, wo ich das Sparbuch auflöste und die Hälfte der lumpigen hundertachtzig Euro auf mein Girokonto einzahlte. Viel besser sah es damit nicht aus, aber für die Krankenkasse reichte es hoffentlich noch.
Brot hatten wir auch keins mehr. Bei Aldi kaufte ich extrem preisgünstig ein, obwohl ich wusste, dass Heiner meckern würde – Aldi war ihm zu spießig. Spießig – das war überhaupt sein Schreckenswort, und er war demzufolge so unspießig, wie es nur ging, angefangen bei der trendigen grünen Strähne bis hin zur Begeisterung für völlig unverständliche Kulturevents und eher befremdliches Essen, wenn es nur aus exotischen Ländern stammte. Meiner Ansicht nach war diese ängstliche Bemühtheit schon wieder eine andere Art der Spießigkeit, aber das wollte Heiner natürlich nicht hören.
Zu seinem Image passte es auch, dass er so bedürfnislos lebte. Kunststück, ärgerte ich mich auf dem Heimweg. Er brauchte kein Auto, weil er alles Schwere – inklusive seiner kostbaren Person – im Zweifelsfall von mir transportieren ließ, denn ich Spießerin hatte natürlich ein Auto, ich war dem Konsumwahn erlegen und fuhr einen uralten Fiat Panda, der klapperte und schepperte, aber immer noch durch den TÜV kam, auch wenn er aussah, als sei er der Schrottpresse schon mal zu nahe gekommen.
Er brauchte keine große Wohnung, weil er a) sich in Wirklichkeit nach dieser teuren Scheidung (haha, so geht´s, wenn man auch keinen Anwalt zu brauchen glaubt) gar nichts Besseres leisten konnte und b) genau genommen auf meine Kosten lebte. Die zweihundertfünfzig Euro warm für fünfundzwanzig Quadratmeter Chaos drückte ich ja alleine ab! Heiner zahlte dafür den Prosecco auf den abendlichen Kulturevents, zu denen ich aber nur mitging, wenn sonst ein Krach drohte.
Er musste kein Geld für Kondome ausgeben, weil ich eine Spirale trug, sparte teure und unökologische Ferienflüge, weil meine Eltern ein selten genutztes Ferienhäuschen im Schwarzwald hatten (wo wir dann regelmäßig im Regen saßen) und konnte sich auf Flohmärkten und in Secondhand-Shops einkleiden, weil er sich darauf verließ, dass ich die versifften Fetzen schon mitwaschen würde.
Als ich mit billiger Nahrung und ohne teure Kulturkäseblätter wieder zu Hause ankam, war es nur Heiners Glück, dass seine Redaktionssitzung länger dauerte – ich war so richtig in Stimmung für eine Grundsatzdebatte.
Während ich weiter an rhetorischen Geschossen feilte, die ich wahrscheinlich doch nie einsetzen würde, putzte ich die Wohnung durch, was bei dem beengten Raum recht flott ging, spülte ab, bügelte – sogar einige T-Shirts von Heiner – und räumte meine Unterlagen ordentlich in ein abschließbares Regalfach. So, nun stammte alle Unordnung nur noch von ihm. Und warum mussten eigentlich T-Shirts, die man als Erinnerung an Live Art oder Ähnliches erworben hatte, immer aus so besonders schlechter Baumwolle sein und besonders stark verdrehte Nähte haben? Genau wie seine Super-Öko-Jeans mit natürlicher Färbung, die musste ich immer noch separat waschen, sonst hätte ich nur noch dunkelblauen Kram besessen.
Ich sammelte eine Ladung weiße und eine Ladung bunte Wäsche ein und fuhr damit in den Keller, wo wir immerhin eine ziemlich anständige Waschküche hatten. Wieder so ein Punkt, warum Heiner sich nicht mit sinnlosem Konsumschrott belasten musste – er brauchte keine Waschmaschine, denn bei seiner Freundin stand ja eine im Keller, und diese Freundin war auch noch dämlich genug, seine Sachen mitzuwaschen. Alleine deshalb war schon ein grundsätzliches Gespräch dringend notwendig! Ich stopfte den Inhalt der beiden Reisetaschen in die beiden Maschinen und reservierte mir auch gleich den Trockner, dann trabte ich wieder in den zweiten Stock und traf auf Heiner, der missmutig am Tisch saß und auf meinen Laptop einhackte.
„Was machst du da?“
„Ich muss einen Artikel schreiben, was denkst du denn?“
„Dann nimm gefälligst deinen Rechner!“
Er klappte meinen wieder zu. „Muss ich ja sowieso. Seit wann hast du denn ein Passwort?“
„Seitdem du mir etwas Wesentliches gelöscht hast.“ Ich verstaute die Reisetaschen im Kleiderschrank, zog den Wäschekorb heraus und kippte ihn um, so dass Heiners Turnschuhe auf den Boden fielen.
„Wo ist denn das neue FineArts?"
„Hab ich nicht gekauft. Heiner, ich bin restlos pleite, ich krieg den neuen Job erst in einem halben Jahr und mein Konto ist in den Miesen. Zehn Euro überfordern mich.“
„Ich hätte es dir schon wieder gegeben“, murrte er.
„Ja, irgendwann. Überhaupt, ich kann es mir nicht mehr leisten, dich hier durchzufüttern.“
„Übertreib nicht so“, murmelte er und lud den Akku seines Laptops an meiner Steckdose auf, „ich zahle doch dauernd was.“
„Einmal Schuhcreme und ab und zu ein Glas Prosecco nützt mir nichts. Ich zahle die Miete ganz alleine!“
„Das ist doch immer noch deine Wohnung, oder?“
„Und das Essen für zwei? Alleine hab ich deutlich weniger ausgegeben.“
Heiner lehnte sich zurück und verschränkte die Arme im Nacken, um von der Höhe seiner intellektuellen Überlegenheit auf mich herabzublicken. Wie ich das hasste – aber er sah wirklich süß aus, das konnte ich nicht bestreiten, schlank und elegant, trotz der Antispießerkluft und der albernen Drahtbrille.
„Anne, du dokterst doch an den Symptomen herum! Auch wenn ich weniger esse, brauchst du Geld, oder? Such dir vorübergehend einen Job, sei flexibel, anstatt hier herumzujammern.“
„Das hab ich auch vor“, gab ich scharf zurück, „aber wenn du mir mal erstatten würdest, was ich in den letzten neun Monaten für dich ausgelegt habe, wäre die Sache mit dem Job nicht gar so dringend. Da kämen bestimmt so - na, zweitausend Euro zusammen.“
Die entspannte Haltung verschwand schlagartig. „Spinnst du?“ Er schaukelte heftig nach vorne, als er die Arme fallen ließ. „So viel? Du hast mich nicht gerade mit Kaviar bewirtet!"
„Nein, aber mit drei Mahlzeiten täglich, gewaschener und gebügelter Wäsche und kostenlosen Übernachtungen.“
„Willst du für die Nächte auch noch einen Preis ansetzen?“
„Für die Nächte nicht, aber für die Übernachtungen schon. Du sparst ganz schön Geld, wenn du hier wohnst!“
„Und du weißt auch genau, warum!“ Er stand auf und trabte vor dem einzigen Fenster auf und ab. Schmierig und blind war es, stellte ich mechanisch fest, aber Putzen nützte nicht allzu viel, die alte Doppelverglasung war innen angelaufen.
„Ich kann doch nichts dafür, dass Gisi mich so gnadenlos abgezockt hat!“
„Sie hat dich nicht gnadenlos abgezockt“, widersprach ich, „sie hat nur das gefordert, was ihr zusteht, wenn sie zwei kleine Kinder zu versorgen hat. Dass du so wenig verdienst, ist nicht ihre Schuld, die Kinder brauchen trotzdem was zu essen.“
„Was zu essen, ja – aber diesen ganzen sinnlosen Konsumkram doch nicht, hier einen Pulli, hier ein paar Nobelturnschuhe, dort ein albernes Spielzeug...“
„Kinder wachsen nun mal. In ihre Babysachen passen sie jetzt nicht mehr rein, das hättest du doch schon wissen können, als du die beiden in die Welt gesetzt hast.“
„Du weißt genau, dass Gisi mich reingelegt hat! Ich war viel zu jung!“
„Du warst damals sechsundzwanzig, Himmel noch mal! Und ein Fall von Samenraub war er doch wohl nicht, oder?“
„Samenraub?“ Er hielt inne und musterte mich verdutzt.
„So wie bei Boris Becker, du weißt schon!“
„Dass du dich so sehr für das Liebesleben der Möchtegernprominenz interessierst? Sehr kleinbürgerlich!“
„Wenn schon!“ Ich winkte ab. „Jedenfalls hätte dir doch klar sein können, dass Bumsen zu Kindern führen kann und Kinder zu Kosten führen, oder?“
„Ich dachte, sie verhütet!“
„Ja doch – aber du hast sie nicht gefragt, oder?“ Wie oft hatten wir dieses Gespräch eigentlich schon geführt? Wahrscheinlich jedes Mal, wenn er den ausgebeuteten Geschiedenen gab, weil er sich nicht an den Kosten unserer Lebensführung beteiligen wollte. Dabei verdiente er gar nicht so schlecht. „Egal“, schloss ich das Ganze ärgerlich ab, „jedenfalls erwarte ich von dir pro Monat einen festen Unkostenbeitrag, sonst kann es so nicht weiter gehen.“
„Würdest mich sonst rausschmeißen? Annemaus, das glaubst du ja wohl selbst nicht!“
„O ja, das würde ich, du wirst schon sehen.“ Er streckte einen Arm aus und zog mich an sich. „Nein, das brächtest du nicht übers Herz“, raunte er und ließ seine Zunge kurz in mein Ohr gleiten. „Nein, wahrscheinlich nicht“, seufzte ich, „aber wenn ich noch einen Rest Hirn hätte, täte ich es.“
„Für mich hast du noch genug Hirn“, murmelte er und küsste mich genießerisch. Seine Hand stahl sich langsam unter mein Flanellhemd. „Hm... du fühlst dich so gut an“, flüsterte er und zog mich entschlossen auf das immer noch ungemachte Bett.
Hinterher plagten mich widerstreitende Gefühle. Einerseits war ich so richtig satt und zufrieden, wie immer, wenn Heiner und ich unsere Streitereien im Bett beigelegt hatten. Andererseits ärgerte ich mich, weil das Thema damit für ihn erledigt zu sein schien – aber ich hatte immer noch keinen Cent mehr im Geldbeutel! Und außerdem hatte ich allmählich das Gefühl, dass wir überhaupt nur noch miteinander schliefen, wenn wir uns vorher gestritten hatten. Stritten wir so oft oder bumsten wir so selten? Ich wollte die Frage Heiner vorlegen, aber der war eingeschlafen. Na, typisch! Ich rappelte mich auf und zog mich wieder richtig an – ganz ausgezogen hatten wir uns gar nicht.
Und jetzt? Woher Geld nehmen? Meine Eltern anpumpen? Nur im äußersten Notfall! Verdammt, ich wurde im nächsten Januar dreißig, da konnte ich doch nicht mehr winselnd nach Hause gerannt kommen! Außerdem hatten meine Eltern schließlich noch mehr Kinder, und drei muntere Spätteenies bzw. Studienanfänger waren kein billiger Spaß. Erst vor einigen Wochen hatte Papi gesagt, wie froh er sei, dass wenigstens eine jetzt mit der Ausbildung fertig war. Als ob er sie bezahlt hätte, ärgerte ich mich darüber auch. Ich hatte immer nebenher gejobbt. Heiner hatte eigentlich Recht, musste ich zugeben, ich sollte mir einfach einen vorübergehenden Job suchen, dann war das Problem vom Tisch. Aber zahlen musste er doch. Dreihundert Euro im Monat, beschloss ich. So schlecht verdiente er auch wieder nicht, und Gisi zockte ihn absolut nicht ab, die sechshundert, die er ihr unter großem Wehklagen jeden Monat überwies, standen ihr zu. Himmel, Jennifer war drei und Patrick fünf, da konnte sie doch nicht voll arbeiten!
Wann hatte Heiner eigentlich zum letzten Mal etwas mit seinen Kindern unternommen? Ach ja, vor drei Wochen. Toller Sonntag, wirklich – er hatte sie abgeholt und hierher gebracht, und dann hatte sein Handy geklingelt.
Später hatte er geschworen, der Anruf sei echt gewesen, ein ganz, ganz dringender Notfall in der Redaktion (bei einem Wochenblatt??), aber jedenfalls saß ich dann mit den beiden Zwergen da und durfte den ganzen Nachmittag auf dem Spielplatz im Prinzenpark verbringen und mir anhören, dass es hier doof sei und Papa mit ihnen sicher was ganz Tolles gemacht hätte. Was, wussten sie leider auch nicht, aber vor Kummer liefen ihnen dauernd die Nasen. Und dann war Patrick noch vom Klettergerüst gefallen. Natürlich auch meine Schuld...
Ein Abstecher zu MacDonald´s versöhnte sie dann mit mir, und als ich sie schließlich abends bei Gisi ablieferte, waren sie soweit, dass sie bei mir einziehen wollten, obwohl ich versicherte, dass MacDonald´s nicht täglich auf dem Programm stand. Gisi grinste mitfühlend, als sie die beiden müden, überdrehten und ketchupverschmierten Kinder in Empfang nahm.
„Hat er sich wieder gedrückt, ja?“
„Dringender Notfall“, singsangte ich und grinste ebenfalls. „Warum behältst du ihn?“, fragte sie und schälte ihre Kinder aus den Jacken. „Er nutzt dich doch genauso aus, wie er es bei mir gemacht hat.“
„Weiß ich, aber ich stehe immer noch auf ihn. Wenn die Anziehungskraft nachlässt, fliegt er, versprochen.“ Wir tranken noch ein Glas Wein zusammen, als die Kinder endlich im Bett lagen und aufgehört hatten, abwechselnd nach uns zu rufen oder wieder aufzutauchen, und tauschten unsere Erfahrungen mit dem lieben Heiner aus. Er hasste nichts mehr als solche „Weiberverschwörungen“, alleine deshalb mussten wir uns regelmäßig besprechen. So hielten wir ihn wenigstens einigermaßen im Zaum!
Aber wenn er, anstatt seinen Anteil an den Kosten zu tragen, glaubte, ein nettes Nümmerchen würde ausreichen, um mich abzulenken, hatte er sich getäuscht – in Naturalien zahlen war nicht! Misslaunig suchte ich nach dem Stellenmarkt der heutigen Zeitung, aber viel war nicht geboten. Empfangsdamen, CallCenter, Putzkräfte. Wirklich nicht, irgendwo musste man die Grenze ziehen.
Etwas Nettes in einem Kulturbüro, überhaupt in einem Büro, Ablage, Briefe tippen, Kaffee kochen – ach, ich würde richtig gerne so was machen! Aber jetzt sollte ich vielleicht doch mal die Wäsche aus den Maschinen räumen.
Mit dem nicht trocknergeeigneten Kram keuchte ich die Treppen wieder hinauf und traf natürlich Frau Hartwig.
„Haben Sie eigentlich einen Untermieter?“
„Nein, hab ich nicht. Das ist bloß mein Freund.“
„In einer Einzimmerwohnung? Und den höheren Wasserverbrauch zahlen wir dann alle mit!“
„Wir haben doch Wasseruhren, extra letztes Jahr eingebaut, wissen Sie nicht mehr?“ Der Korb war verdammt schwer, wenn man so unnötig aufgehalten wurde. „Trotzdem, das ist Überbelegung und strafbar!“
„Nein, das ist nicht strafbar“, entgegnete ich müde. „ich bin Juristin, Sie können mir schon glauben.“
„Ich werde mich auf jeden Fall bei der Hausverwaltung beschweren!“
Ich packte meinen Korb fester und stieg an ihr vorbei. „Wenn es Sie glücklich macht, bitte!“
Verdammt, wenn ich den neuen Job schon gehabt hätte, hätte ich mich langsam nach etwas Besserem umsehen können! Vielleicht zwei Zimmer, eine eigene Waschmaschine... Mit oder ohne Heiner? Das wusste ich auch nicht so recht. Jetzt wohnte ich schon sieben Jahre hier, und als ich diese Wohnung gefunden hatte, war ich richtig glücklich gewesen, das WG-Leben war nichts für mich. Jedenfalls nicht in einer WG, in der alle anderen ihre Entscheidungen davon abhängig machten, ob das Pendel über dem selbstgeschroteten Frühstücksmüsli kreiste oder ausschlug oder was Pendel eben so zu tun pflegten. Ich wollte auch als einzige nicht wissen, was ich im Mutterleib gefühlt hatte (eine gewisse Enge, konnte ich mir vorstellen), und mit der Zeit schlich sich ein etwas gezwungener Ton zwischen uns ein, so dass ich begeistert zugegriffen hatte, als Sabine damals nach Münster zurückzog und mir ihre Wohnung vermachte. Ich hatte fleißig gestrichen, einen günstigen Teppichbodenrest verlegt, den IKEA-Katalog in der Rubrik Erstes Appartement ausführlich studiert und eine recht platzsparende Einrichtung geschaffen, wie ich mir schmeichelte. Sicher, das große Bett dominierte etwas, aber man konnte auch zum Fernsehen darauf liegen. Wenn Heiner mich mal etwas Spannendes, Hirnloses gucken ließ! Außerdem war es komplett mit Regalen umbaut, und gegenüber umgaben weitere Regale den Tisch, der als Esstisch, Schreibtisch, Ablage und Mülldeponie diente.
An die Regale schloss sich ein dazu passender Schrank an, der allerdings mit den Klamotten von uns beiden etwas überfordert war, und neben diesem – schon im Flur – befand sich ein weiterer, etwas tieferer Schrank. Der war schon drin gewesen, und hinter seinen weißen MDF-Türen verbargen sich zwei Kochplatten, ein Zwergenspülbecken, ein winziger Kühlschrank und ein Mülleimer, darüber zwei Regalbretter für Geschirr, Gläser und Vorräte, alles mit einer leichten Fettschicht überzogen, sobald man leichtsinnigerweise etwas gebraten hatte.
Mensch, eine richtige Küche! Wo man die Tür zumachen konnte, wenn man mal Fisch oder Blumenkohl gekocht hatte! Wo man mehr als zwei Teller auf einmal ins Spülbecken schichten konnte! Darauf musste ich wohl bis April warten. Und wie ich den Staat als Arbeitgeber einschätzte, dauerte es dann sicher noch länger, bis ich wirklich mal ein Gehalt auf meinem Konto vorfand. Dafür musste ich dann wohl wirklich meine Eltern anpumpen, aber sie würden es ja wiederkriegen. Heiner pennte immer noch selig. Hatte ich ihn derartig gefordert? Also, so toll war es nun auch wieder nicht gewesen!
Wenn er nicht quer im Bett läge, könnte ich mich selbst dort ausstrecken und diese schrägen Kurzgeschichten weiter lesen, die ich mir letzte Woche gekauft hatte, Böse Mädchen... Sehr anregend!
Morgen musste ich mal wieder zu JobTime schauen, sicher hatten die etwas Brauchbares für mich. Während des Studiums hatten sie auch immer was gehabt. Und wenn ich schon ein halbes Jahr Leerlauf hatte, dann würde ich mich auch nicht exmatrikulieren, sondern mir bei Professor Mahler auch noch ein Dissertationsthema geben lassen. Die würden staunen, wenn sie sich für ihr Anfängergehalt eine veritable Frau Doktor eingekauft hatten!
Genau! Ich hatte auch schon eine gute Idee, von 1897 bis 1901 hatte es in dieser Stadt einen recht esoterisch angehauchten Kunstverein gegeben, mit einer Muse, die aussah wie von Gustav Klimt gemalt, der damals legendären Frau von Strahleneck. Sie hatte ein Schlösschen im Waldburgviertel bewohnt, dort Künstler bewirtet und in der Altstadt ein Haus gekauft, das sie zu einem Museum der Moderne umbauen ließ. Warum war dieser Kunstverein eigentlich eingegangen? Allein diese Frage wäre schon interessant. Es gab jede Menge staubige Akten, über die ich während meiner Magisterarbeit gestolpert war, aber noch keine umfassende Untersuchung. Das müsste dem alten Mahler doch gefallen?
Ich vermutete ja stark, dass sie „ihren“ Künstlern auch menschlich zu nahe getreten war und der ganze Kunstverein in wilden Eifersuchtsszenen geendet hatte, aber das blieb eben noch zu beweisen. Bis Heiner sich endlich wieder bewegte, hatte ich die Wäsche aus dem Trockner geholt und alle meine Ideen, was den Kunstverein betraf, niedergeschrieben und meinen Laptop schon wieder ausgeschaltet. Er räkelte sich ächzend, sah dann auf die Uhr und fuhr erschrocken hoch. „Mensch, Anne, warum lässt du mich denn so lange pennen? Ich hab um halb drei einen Termin, du weißt doch!“
„Nein, weiß ich nicht. Ich verwalte doch nicht deine Termine. Außerdem ist es erst eins, also was soll der Stress?“
„Aber vorher muss ich noch die Fotografin abholen. Tolle Frau, übrigens.“ Er grinste und beobachtete meine Reaktion so offen, dass es schon albern wirkte. „Schön für dich. Wohin müsst ihr denn?“ Ich interessierte mich nur mäßig dafür, schließlich war es sicher wieder irgendetwas Abstruses.
„Vorbesprechung für die Filmwoche im Alten Keller. Du weißt doch, ugandische Jungfilmer.“ Ich hatte es ja gewusst, aber ich konnte es doch nicht lassen: „Was soll denn eine Fotografin bei der Vorbesprechung? Gibt´s da schon etwas Spannendes zu sehen?“
„Na klar, die Veranstalter. Du, das ist total wichtig, die Filmwoche kann unser verschnarchtes Kaff richtig berühmt machen.“
„Wie Cannes oder Venedig?“, spottete ich.
„Klar, nur weniger kommerziell und dafür mit mehr Niveau. Du hast ja keine Ahnung, wie kläglich das Niveau des kommerziellen Films ist, von der Aussage, von den künstlerischen Mitteln her, von der Schnitttechnik...“
Seine Stimme erstarb zu Gemurmel, als er ins Bad schlappte und sich prustend wusch. „Was gibt´s heute Abend?“, kam er wieder an, durch das Handtuch sprechend. Offenbar hatte er den künstlerischen Anspruch schon wieder vergessen. „Spaghetti mit Tomatensauce. Für mehr reicht das Geld nicht mehr.“
„Du wolltest dir doch einen Job suchen?“
„In den letzten eineinhalb Stunden hab ich aber noch keinen gefunden!“, fauchte ich. „Und du wolltest dich an den Kosten beteiligen. Dreihundert Euro im Monat fände ich recht angemessen.“
„Was? So viel? Ich denke ja nicht daran!“
„Und an wie viel denkst du so?“
„Weiß nicht. Ich werde es mal durchrechnen. Aber mehr als vier Euro verbrauche ich am Tag nie!“
„Das glaube ich dir gerne, deine Kosten trage ja immer ich. Okay, dann koche ich mir heute Abend Spaghetti, und du kannst dir eine Pizza bestellen.“
„Sei nicht albern!“ Er küsste mich rasch. „Willst du nicht langsam mal Schuhe anziehen?“
„Wozu denn?“
„Fährst du mich nicht schnell in den Alten Keller?“
„Nein, ich muss in die Bibliothek“, log ich. „Nimm den Bus – aber das wird deine täglichen Unkosten natürlich gewaltig nach oben schnellen lassen.“
„Kann ich dann den Wagen haben?“ Das hatte er ja noch nie gefragt, bis jetzt hatte er immer Wagen plus Chauffeuse geordert! „Hast du überhaupt einen Führerschein?“, fragte ich misstrauisch.
„Klar, was denkst du denn!“
„Dann zeig ihn her. Ich hab dich noch nie hinter dem Steuer gesehen, ich wüsste gerne, wie alt der Lappen schon ist.“
„Den finde ich doch jetzt nicht!“
„Ohne Führerschein darfst du sowieso nicht fahren. Was ist, wenn dich die Polizei anhält?“
„Scheißbullen. Die haben wohl auch nichts Wichtigeres zu tun, was? Und deine kleinbürgerliche Angst vor der Obrigkeit...“
„Ich hab Angst um meinen Führerschein, wenn sie dich erwischen – nicht vor der Obrigkeit. Verdreh doch nicht immer alles!“
„Du willst das bloß nicht wahrhaben. Kann ich den Wagen jetzt haben?“
„Nein, fahr mit dem Bus“, entgegnete ich ungnädig.
Er grummelte ein bisschen herum, dann versuchte er es auf die altbekannte Weise und schmuste ein bisschen mit mir herum, aber dieses Mal blieb ich hart, das war mir wirklich zu riskant. Und die drei Busstationen bis zum Alten Keller würden ihn schon nicht umbringen! Ich musste eigentlich überhaupt nicht in die Bibliothek, aber nun bliebt mir nichts anderes übrig, als hinzufahren, mühsam einen Parkplatz zu suchen, ein bisschen sinnlos im Lesesaal herumzustöbern, einige Dinge auf gut Glück zu bestellen und dann zu überlegen, was ich kochen sollte, was exakt für eine Portion reichen würde. Blöde, aber manchmal brauchte der liebe Heiner eben einen kleinen Dämpfer, sonst glaubte er, die ganze Welt sei nur zu seiner Bedienung geschaffen worden.
Als er schließlich nachts neben mir lag, ärgerlich, weil im Bus so komische Leute gewesen waren (lauter Spießer, wahrscheinlich), und hungrig, weil er für eine Pizza zu geizig gewesen war und ich eine winzige Dose mit einem Teller klitschigem Nudeleintopf für mich aufgewärmt hatte, überlegte ich, ob ich einlenken sollte. Nein, ich hatte doch Recht, und das würde er schon noch einsehen. Musste er ja!
Zwei
Berauschend war die Auswahl bei JobTime am nächsten Morgen nicht, und ich musste mir energische ins Gedächtnis rufen, dass ich, als ich ein Jahr vor dem Examen zum letzten Mal dort einen Job gesucht hatte, eine wirtschaftlich deutlich bessere Lage erwischt hatte. Niemand war länger krank, niemand war schwanger und musste vertreten werden - oder die Jobs wurden einfach eingespart.
Konnte man ja verstehen, aber für mich war das der letzte Mist. Ein Angebot gab es, das akzeptabel klang, drei Monate lang vom Band tippen, im Niederbayerischen, aber als der Sachbearbeiter auf meinen Wunsch nachfragte, warum die bisherige Kraft ausgefallen war, erhielt er so unklare Antworten, dass mir die Sache ziemlich suspekt war – entweder grassierte dort eine Seuche, über die sie nicht reden durften, oder der Chef hatte meine Vorgängerin massiv belästigt. Oder... jedenfalls wollte ich den Job nicht, da hätte ich ja fast schon umziehen müssen. „Tja, dann haben wir bloß noch putzen“, betrachtete er ratlos die Karteikarten in seiner Hand. „Mal sehen, ob im Internet etwas Besseres hereingekommen ist...“ Er drehte sich um und bewegte seine Maus, dann klickte er eine Zeitlang herum. „Briefe sortieren im Zentralpostamt, täglich von zwei bis fünf Uhr...“
„Nachmittags?“
„Nachts natürlich. Sieben Euro die Stunde brutto.“ Das waren netto vier – und dafür meinen Schlafrhythmus ruinieren? So nötig hatte ich es auch wieder nicht. „Und Putzen natürlich, jede Menge Angebote.“ Ja, das konnte ich mir denken. Wenn ich Geld hätte, würde ich auch putzen lassen! „Das muss ich mir noch überlegen“, zögerte ich. Putzen, das war stinkendes Wasser, der Dreck fremder Leute, Gummihandschuhe oder raue Finger – und schlechte Bezahlung. „Fünfzehn Euro netto die Stunde“, lockte der Sachbearbeiter.
Hm... nicht übel. Wenn ich zehn Stunden in der Woche putzen würde... mit hundertfünfzig Euro käme ich – nicht weit, Mist. Zwanzig Stunden, dann würde es auch für die Miete reichen. Natürlich, wenn Heiner endlich mal etwas Geld abdrücken würde...
Ich entschloss mich. „Okay, zeigen Sie mir mal die Angebote!“
„Da hätten wir eine Frau von Jessmer. Alte Dame, große Wohnung, viele Antiquitäten. Einmal die Woche vier Stunden, vorzugsweise donnerstags. Am Waldburgplatz. Dann ein Ehepaar mit Baby, Korff/Brandes, in der Tizianstraße. Zweimal wöchentlich zwei Stunden nachmittags. Pflegeleichte Wohnung – wird behauptet, Sie müssten sich das eben mal ansehen. Und Schillmeier in Henting, großes Haus, vier Kinder, dreimal die Woche nachmittags.“
„Dann sind die Kinder ja auch da und schmeißen mir den Putzeimer um“, kommentierte ich mäßig begeistert.
„Tja... passen Sie auf, ich gebe Ihnen die Telefonnummern. Rufen Sie an und machen Sie was aus, dann regele ich das für Sie.“ Besser als nichts!
Zu Hause rief ich bei Jessmer und Korff/Brandes an. Jessmer klang zickig und zittrig, nach sehr alter Dame, aber hoch erfreut, dass sich die deutsche Jugend anscheinend doch noch nicht restlos zu schade war für ehrliche Arbeit. Bei Korff/Brandes ertönte schrilles Babygeschrei und die Frauenstimme am Telefon klang etwas müde.
Ich vereinbarte sofort Vorstellungstermine und marschierte am Nachmittag los. Was Heiner wohl sagen würde? Da war ich ehrlich gespannt: Seine ästhetischen Ansprüche mussten aufs Tiefste verletzt werden, wenn seine Freundin als Putzfrau arbeitete, aber in puncto Konsumdenken und verwöhnter Wohlstandsgesellschaft musste er voll hinter mir stehen, wenn ich mich in proletarische Niederungen begab. Das war doch echte Arbeit – allerdings dürfte ich es sicher niemandem erzählen!
Korff/Brandes kam zuerst dran. Eine schöne Wohnung, aber über zwei Etagen. Ich überlegte sofort, dass man da dauernd den Staubsauger die Wendeltreppe rauf und runter schleifen musste. „Das waren mal zwei Wohnungen“, erklärte Frau Korff, die mir, einen ganz winzigen Säugling an der Schulter, von Zimmer zu Zimmer folgte, „also haben wir auch in jeder Etage einen Staubsauger. Sie müssten halt alles abstauben und saugen, ab und zu das Parkett einlassen, so einmal im Vierteljahr, naja, und die Bäder eben und die Küche. Fenster nach Bedarf.“
„Ich mache das nur vorübergehend“, verwahrte ich mich sofort gegen die Parkettpflege, „zum ersten April kriege ich einen richtigen Job.“
„Was denn?“ Ich erzählte von der Museenverwaltung und wir stellten fest, dass wir beide die gleichen Vorlesungen in Kunstgeschichte gehört hatten. Damit waren wir im Handumdrehen per du, und Karen war von meinem ulkigen Studiengang sehr beeindruckt. „Da kommt man sich als popliger Lehrer ganz ordinär vor. Wie nennt sich das?“
„Kulturfachwirtin. Das gibt es so nur hier an der Uni. In Passau gibt´s was Ähnliches, ich glaube, da heißt es Kulturmanagement.“
Wir vereinbarten Montag und Freitag von zwei bis vier. „Dann kann Jens mit dem Kleinen spazieren gehen, der brüllt sich sonst die Seele aus dem Leib, wenn hier ein Staubsauger läuft.“
„Wie alt ist er denn?“, fragte ich und fuhr mit einem vorsichtigen Finger über die kleine krebsrote Wange. So weich... „Drei Wochen. Das Brüllen lässt hoffentlich bald etwas nach, er hat eben Blähungen, der arme Zwerg. Gell, Svenni, du bist ein ganz, ganz Armer?“ Das Baby sah sie konsterniert an und verstummte für einen Moment, dann legte es mit unverminderter Kraft wieder los. Ich verabschiedete mich hastig und trabte zum Waldburgplatz.
Frau von Jessmer war ungefähr einen Meter fünfzig groß und mager wie ein altes zähes Hühnchen. Aber energisch war sie, das musste man ihr lassen, sie schleifte mich sofort durch eine reichlich vollgestopfte Vierzimmerwohnung mit altmodischem Mobiliar. Angesichts der üppigen Schnitzereien befürchtete ich schon das Schlimmste, was das Staubwischen betraf, aber sie zeigte mir triumphierend einen Staubwedel, wie ihn Zimmermädchen in Boulevardkomödien benutzten. So was hatte ich schon mal im Fernsehen gesehen. Wahrscheinlich, als Heiner gerade nicht da war, er wäre empört gewesen und hätte sofort auf irgendeinen authentischen mongolischen Erstlingsfilm mit Wackelkamera umgeschaltet und dann nie zugegeben, dass er auch nichts verstanden hatte.
Immerhin gab es hier reichlich Perserteppiche, die sich leichter pflegten als Parkett, ein altmodisches, aber blitzsauberes Bad und eine große, altertümliche Küche. Ich sah mich anerkennend um. „Das ist aber eine schöne Wohnung!“
„Nicht? Alles so, wie es war, als mein seliger Mann noch lebte. Nicht dieser moderne, seelenlose Plastikkram. Aber keine Sorge, Sie müssen die Teppiche nicht klopfen, nur saugen. Ich habe nämlich einen Staubsauger.“
Oh ja. Der Staubsauger war fast so alt wie sie, der hatte sicher schon im Zweiten Weltkrieg gute Dienste geleistet. Den Staubbeutel aus Stoff musste man im Müllhäuschen ausleeren und ihn dann waschen, bevor man weiter putzen konnte. Hier gab es auch richtige Staubtücher, nicht diesen neumodischen antistatischen Kram, wie mir eifrig versichert wurde. Und für Marmor war Bohnerwachs immer noch das Beste! Ich schluckte, dachte an die sechzig Euro jede Woche und sagte zu – ab nächstem Donnerstag hätte ich hier einmal in der Woche von eins bis fünf zu tun. Um fünf kamen dann Frau von Jessmers Freundinnen zum Tee, und bis dahin musste die Wohnung blinken und blitzen.
Na toll – worauf hatte ich mich da denn eingelassen? Die Schillmeiers schenkte ich mir, Henting und vier Kinder, das war wirklich zu hart.
Ich fuhr nach Hause und rief bei JobTime an. Dass ich zwei Kunden gewonnen hatte, wurde beifällig vermerkt, ab nächster Woche würden dann jede Woche hundertzwanzig Euro auf meinem Konto eintrudeln. Das reichte knapp für die Fixkosten. Wenn ich etwas essen, Waschpulver kaufen oder tanken wollte, musste ich mehr arbeiten. Aber erst sollte ich feststellen, ob ich das überhaupt konnte – vielleicht putzte ich Karen oder Frau Jessmer ja zu schlampig oder brauchte zu lange?
„Na, hast du jetzt einen Job?“, fragte Heiner, der mit dem Kulturteil der Süddeutschen auf dem ungemachten Bett lag. „Ja, aber nichts Tolles. Bis jetzt sind es nur acht Stunden in der Woche. Putzen.“
Die Zeitung glitt zu Boden. „Putzen??“
„Ja, putzen. Es gab nichts anderes. Mensch, Heiner, wir haben eine Wirtschaftskrise, da bringen die Sekretärinnen die Ablage selbst in Ordnung, um unentbehrlich zu wirken!“
„Putzen... Meine Freundin ist eine Putzfrau... Bei wem?“
„Bei einer alten Dame und bei einem Lehrerehepaar.“
„Lehrerehepaar... Gott, wie bürgerlich. Und die alte Dame? Ist die wenigstens schräg drauf? So was wie Lotti Huber?“
„Wer ist Lotti Huber? Nein, dass ist eine ganz feine und ziemlich altmodische kleine Person. Schräg drauf ist da nur der Staubsauger, eine echte Antiquität.“
„Du kennst Lotti Huber nicht?“ Entsetzen klang aus seiner Stimme.
„Nein.“ Desinteressiert wühlte ich im Schrank herum. Was sollte ich zum Putzen anziehen? Alte Jeans und ein Sweatshirt, am besten. Schürze? Hatte ich nicht. Und Putzkittel – das ging wirklich zu weit.
Heiner erklärte mir nicht, warum ihm Lotti Huber so am Herzen lag, sondern kehrte seufzend zu seiner Zeitung zurück. „Was gibt´s denn zu essen?“
„Nichts, ich bin pleite. Ich esse das letzte Knäckebrot. Geld krieg ich erst nächste Woche, und du hast mir keinen Cent gegeben.“
Heiner grinste. „Welches Knäckebrot?“
„Hast du mir das etwa weggefressen?“
„Ich hatte Hunger, und etwas anderes war nicht da. Komm, Schätzelchen, ist doch egal. Wenn du ein paar Tage weniger isst, schadet das auch nichts.“
„Ach ja?“, fuhr ich auf. „Wie meinst du das, bitte?“
„Na, du jammerst doch immer herum, dass deine Oberschenkel zu dick sind, oder?“
„Sind sie wirklich zu dick?“ Ich musterte mich kritisch im Spiegel.
„Ach, lass doch. Gut, weiße Jeans solltest du lieber nicht tragen, aber diese schwarzen kaschieren ja ziemlich.“ Blöder Hund, aber leider hatte er Recht. Der Rest meiner Figur ging einigermaßen, wenn ich auch eigentlich nicht wirklich schlank war. Zweiundsiebzig Kilo auf einen Meter achtundsiebzig, das war zwar ein Body Mass Index von 22,7, also ziemlich okay, aber mein Idealgewicht lag doch bei sechs bis acht Kilo weniger, wenigstens, wenn man den einschlägigen Frauenzeitschriften glauben wollte.
Aber diese Oberschenkel! Gut, die Taille war auch nicht gerade die von Scarlett O´Hara, aber die Oberschenkel! Wenn ich gerade dastand, dann gingen sie richtig etwas nach außen, anstatt die Hüftlinie fortzusetzen. Sie schwabbelten zwar nicht, aber sie waren eindeutig zu dick. Wo hatte ich denn das Maßband? Heiner hatte nach seinem Tiefschlag wieder das Interesse verloren und sich den Theaterkritiken zugewandt, wie man seinem entrüsteten Schnauben und den halblauten Kommentaren über die Ahnungslosigkeit seiner Kollegen entnehmen konnte. In Jeansstoff hatte ich sechzig Zentimeter Oberschenkelumfang. Durfte ich für den dicken Stoff wohl einen Zentimeter abziehen, oder hielt der die Massen bloß fester zusammen? Ich sollte dringend Gymnastik für die Beine machen. Und für die Taille. Und für feste Oberarme. Und einen straffen Busen. Und einen knackigen Po. Und elegante Hüften. Ich sollte mir einen neuen Körper kaufen, das wäre einfacher. Nur wovon?
Hunger hatte ich trotzdem, immerhin hatte ich ja heute schon etwas geleistet. Im Küchenregal fand ich noch ein Glas sauer eingelegten Blumenkohl; ich öffnete es, goss die Essiglake ab und futterte die Röschen direkt aus dem Glas. Heiner sah missmutig auf. „Du traust dich was!“
„Wieso? Die können praktisch keine Kalorien haben.“
„Nein, aber was, wenn du die ganze Nacht furzen musst?“
„Muss ich nicht. Außerdem musst du gerade reden!“
„Man soll so was nicht unterdrücken, das ist ungesund.“
„Doch, wenn direkt daneben jemand einen Rest Sauerstoff zum Schlafen braucht, sollte man so was schon unterdrücken. Außerdem – was soll das eigentlich heißen? Du darfst, wegen deiner Gesundheit, und ich darf nicht?“
„Bei Frauen ist so was unästhetisch.“
„Blödmann.“
„Tolles Argument.“
Ich drehte mich um und aß den Blumenkohl auf. Gelegentlich hatte ich schon Sättigenderes gegessen, musste ich zugeben, aber jetzt waren wirklich nur noch Gewürze im Haus. Unauffällig zählte ich mein Geld und lief dann doch noch schnell zum Aldi an der Ecke. Neues Knäckebrot, ein paar Konserven, die sogar für Aldi-Verhältnisse billig waren, zwei Gläser Senfgurken. Trinken konnten wir Wasser. Na gut, die Kaffee-Hausmarke, dafür würde es wohl gerade noch reichen.
Wie konnte ich aus Heiner Geld herauspressen? Oder sollte ich ihn rauswerfen? Dann konnte ich meine sauer verdienten Kröten wenigstens alleine verfuttern. Und weniger Sprit brauchte ich dann auch. Aber er war doch niedlich. Und nachts so ganz alleine – das war auch nichts. Ach, Blödsinn. Heiner schlief auch nur mit mir, wenn er von der Geldfrage ablenken oder mich nach einem Krach besänftigen wollte. Hatte ich das eigentlich nötig?
Jetzt wollte ich aber nicht darüber nachdenken! Zur Not gab es zu essen, und ich sollte mein Hirn lieber dafür benutzen, gut organisiert zu putzen und aus dem alten Mahler mein Wunschthema herauszuholen. Wann hatte er eigentlich Sprechstunde? Ich trug meine magere Ausbeute nach Hause, verräumte sie und wühlte nach der Sprechstundenliste – heute, um fünf. Zehn vor war es, also gleich wieder weg. Heiner plärrte noch etwas hinter mir her, wahrscheinlich einen Fahrauftrag, aber das überhörte ich unauffällig.
Bei Mahler saß schon eine lange Reihe auf dem Armesünderbänkchen vor der Tür und auf dem schmutzigen Linoleum unter dem Anschlagbrett.
Ich reihte mich in die Schlange ein, prägte mir ein, welche der angestaubten Gestalten auf dem Boden schon vor mir dagewesen waren, akzeptierte von einem zotteligen Kommilitonen eine Selbstgedrehte, verkniff mir den Hustenanfall, blödelte ein bisschen herum und horchte die anderen aus, ob sie einen anständigen Job wüssten. Putzen war doch eigentlich unter meiner Würde!
Nein, Zottel, der sich als Bernie vorstellte, hatte letzte Woche eine Kellerentrümpelung ergattert, ein bebrilltes Wesen namens Astrid prüfte Belege in einem Elektronikgroßhandel und jammerte, die Dinger seien mit einem so alten und schmierigen Nadeldrucker hergestellt, dass sie bald eine stärkere Brille bräuchte, ein ätherisches Wesen namens Sybille modelte gelegentlich. Klasse, alles nichts für mich. Zwei andere putzten auch und warnten mich nachdrücklich vor allein stehenden Herren, die es einem doch bloß über dem Putzeimer besorgen wollten.
„Kinder sind noch schlimmer“, behauptete eine andere daraufhin, „die schmeißen den Putzeimer um und machen alles wieder dreckig, und dann heißt es, du hättest nicht sorgfältig gearbeitet, und sie zahlen weniger.“
„Hast du schon mal Umfragen gemacht?“, meldete sich eine andere zu Wort. „Leute auf dem Markt anquatschen, was sie von irgendeinem dämlichen neuen Deo halten, das ihnen so scheißegal ist wie dir selbst? Wenn du siehst, wie sie alle schon Haken schlagen, um dir auszuweichen, kriegst du irgendwann echt die Krise.“
„Wird das wenigstens gut bezahlt?“
„Ach wo. Und wenn du die Fragebogen selbst ausfüllst, merken die das ziemlich schnell.“
„Ich gebe Nachhilfe“, verkündete einer, der schon so aussah, „das Geld ist okay, aber ich hätte nie gedacht, dass es so doofe Schüler gibt. Nach unten gibt´s da offenbar gar keine Grenze.“
Ein wirklich hübscher Kerl mit langen, dunklen Haaren (bei dem seidigen Schimmer musste er eine echt teure Kur verwendet haben – oder wirklich gute Gene besitzen) beklagte sich, er habe im Baumarkt im Lager gearbeitet. „Gut für den Muskelaufbau war´s schon, aber die haben echt geglaubt, nach ein paar Tagen müsste ich schon wissen, wo was steht – wer soll sich das alles denn merken?“
Betretenes Schweigen. „Was willst du denn von Mahler?", fragte die, die die Umfragen gemacht hatte, vorsichtig an.
„Mahler? Wieso Mahler? Ich warte auf die Priebeck!“
„Die Priebeck sitzt in 307“, merkte ich vorsichtig an. „Ja, ich weiß.“ Hübsche, kugelrunde blaue Augen. Und ein entzückender Mund...
„Hier ist 407.“
„Echt? Oh. Na, dann...“
Er rappelte sich auf und trabte in die Richtung davon, in der die Treppen nicht waren. Mit einem verlegenen Lächeln kam er einen Moment später wieder an uns vorbei. „Blind oder blöd?“, fragte die Umfragefrau halblaut.
„Eher blöd“, befürchtete ich. „warum sind schöne Männer immer beschränkt?“
„Na hör mal“, regte Bernie sich auf. „Von dir redet doch niemand“, beruhigte ich ihn. „Schon klar“, er grinste, „wirklich schöne Frauen haben aber meist auch nicht gerade viel zwischen den Ohren.“
„Echte Beauties kommen eben so durchs Leben, die lernen gar nicht erst, sich anzustrengen“, behauptete die Belegefrau. Wie alle albernen Vorurteile hatte auch das etwas für sich – wir verglichen die jeweils Schönsten in unseren früheren Schulklassen und stellten fest, dass ein hoher Anteil nicht gerade mit Intelligenz gesegnet war. Dass Mahler ab und an jemanden zu sich hereinbat, wirkte eher störend, aber wer fertig war, setzte sich wieder zu uns auf den Boden und zog genussvoll mit über Abwesende her. Mahler guckte schließlich ganz verzweifelt. „Wollen Sie alle noch zu mir? Es ist schon zehn vor sechs!“
„Wir waren doch schon“, wehrte die Umfragefrau ab, „wir unterhalten uns bloß noch.“
„Ich wollte noch zu Ihnen“, gab ich zu und rappelte mich mäßig elegant auf, „aber ich bin wohl die letzte.“
Er reichte mir erleichtert die Hand. „Frau Holler, nicht wahr?“
Klasse Leistung, er hatte mich erst vor drei Wochen im Mündlichen geprüft. Ich lächelte anerkennend, sagte aber lieber nichts zu seinem hervorragenden Namensgedächtnis, sonst fühlte er sich doch noch verscheißert.
„Nun, was kann ich für Sie tun?“
„Ich würde gerne über den ersten Städtischen Kunstverein promovieren“, fiel ich mit der Tür ins Haus. War ich so zielstrebig oder hatte ich bloß Angst, dass Heiner alle meine Vorräte vertilgte, wenn ich ihn zu lange alleine ließ?
Eher letzteres, befürchtete ich, aber wenigstens lächelte Mahler nachsichtig und zeigte seine graugelben Zähne. Die waren bestimmt noch echt, niemand würde für ein solches Gebiss auch noch Geld zahlen. Das gleiche galt für das schüttere grauschwarze Haar, das er in bewährter Manier quer über die Glatze gebürstet hatte. Dann doch lieber eine ehrliche Billardkugel!
„Ein heikles, aber reizvolles Thema“, kommentierte er vorsichtig.
„Also lief in der Umgebung der Frau von Strahleneck doch so einiges ab?“, erkundigte ich mich. „Oh ja, aber sind Sie sicher, dass Ihnen das Thema nicht zu – naja, sagen wir, zu anrüchig ist?“
„Echter Forscherdrang schreckt vor nichts zurück“, verkündete ich heldenhaft. Klatsch und Tratsch – und dafür noch akademischer Lorbeer: Was wollte ich denn mehr?
„Nun, wenn Sie meinen... Mittlerweile wird sich in der Stadt auch niemand mehr darüber empören... Sie sollten Ihr Augenmerk auch auf die Tagebücher von Lorenz Teisner richten... Und das Städtische Archiv, nicht wahr...“
Ich schrieb diese Tipps fleißig mit. An das Archiv hatte ich schon selbst gedacht, aber dass Teisner, der junge Bildhauer, der sich 1903 erschossen hatte, Tagebuch geführt hatte, war mir neu. Hoffentlich hatte er offen geschrieben!
„Ich werde das Thema für Sie reservieren. Sie berichten mir dann regelmäßig, nicht wahr. Einmal im Monat, denke ich. In der Sprechstunde, nicht wahr.“
„Aber sicher – und vielen Dank!“
Die angeregte Runde vor der Tür hatte sich zerstreut, ohne zu den Themen Schöne Menschen sind behämmert und Wo gibt es gute Jobs? die ultimativen Antworten gefunden zu haben. Auch egal, dann würde ich eben erst mal putzen. Schadete mir gar nichts. Basisarbeit, sozusagen. So könnte ich das Ganze wenigstens Heiner verkaufen. Heiner war nicht da, als ich nach Hause kam, aber er hatte eins der Gurkengläser geleert und die verbeulte Thermoskanne mitgenommen, also hatte er sich auch Kaffee gemacht. Lange Nacht in der Redaktion? Auch gut, dann war er erst einmal aus dem Weg.
Ich kramte einen eselsohrigen, aber leeren Pappschnellhefter aus meinem abgeschlossenen Schrankabteil, schmierte mit dickem Edding DISS darauf und legte ihn ins Regal, nachdem ich die Tipps und meine eigenen Ideen und Mutmaßungen auf einen Zettel gekritzelt und den eingeheftet hatte. Das zweite Gurkenglas und die Hälfte des Brots sperrte ich auch in meinen Schrank. Solange dieser Parasit meine Ration fraß, würde er nie zahlen! Dazu musste ihm erst mal ordentlich der Magen knurren.
Drei
Natürlich hatte er immer noch kein Geld herausgerückt, als ich Anfang der nächsten Woche zum ersten Mal bei Karen antrat.
Ziemlich problemlos, musste ich hinterher zugeben – in zwei Stunden hatte ich alle Böden gesaugt, Staub gewischt und die Bäder geputzt. Die Küche könne ich auch am Freitag machen, fand Karen, die das Ergebnis flüchtig prüfte, während ihr Mann gerade das jammernde Baby aus dem Kinderwagen nahm. „Alles prima. Am Freitag wieder? Wenn du da nicht saugen musst, kann Sven auch hier bleiben, ohne dass er sich aufregen muss.“ Sie nahm den Kleinen von ihrem Mann entgegen und legte ihn sich an die Schulter, wo er sich beruhigte und einschlief. Ihr Mann lächelte mir flüchtig zu und verschwand nach unten. „Ich muss noch dieses Ex korrigieren... bis nachher.“
„Würde ich auch gerne“, knurrte Karen. „Nächstes Jahr jammere ich über die Korrekturen und Jens beneidet mich, ha!“
„Ihr wechselt euch ab? Finde ich gut“, kommentierte ich höflich. „Gut, dann komme ich am Freitag um zwei wieder und mache die Küche und was so anliegt.“
Frau von Jessmer war anspruchsvoller, aber auch da kam ich in fünf Stunden ganz gut durch. Dieser Staubwedel war wirklich praktisch! Dass ich bei Gelegenheit mal die Teppiche aufrollen und das Parkett frisch einlassen müsste, stimmte mich zwar nachdenklich, aber Frau von Jessmer sprach diesbezüglich eher vage von Frühling und Wenn es draußen wieder wärmer wird... Bis dahin hatte ich mich ja hoffentlich in die Museumsverwaltung gerettet. Hundertzwanzig Euro hauten einen nicht um – vor allem musste ein Großteil des Geldes auf meinem Konto bleiben, um die Fixkosten zu decken.
„Heiner, ich brauche Geld!“, verkündete ich deshalb am Donnerstag streng, als ich nach Hause kam. Er schnupperte. „Du riechst nach Putzmittel. Willst du nicht erstmal duschen?“
„Nein, ich will das jetzt klären. Dreihundert im Monat, oder du verschwindest hier. Ich sehe nicht mehr ein, dass ich unser Leben alleine finanziere, obwohl du viel mehr verdienst als ich.“
„Tue ich gar nicht! Du weißt doch, was Gisi mir jeden Monat abknöpft.“
„Ja, das weiß ich. Und ich weiß, was du verdienst. Da bleibt genug übrig. Ich kann mir dich nicht mehr leisten, und langsam will ich das auch nicht mehr.“
„Aber Anneschätzchen, das meinst du doch gar nicht ernst. Was tätest du ohne mich?“ Er nahm mich zärtlich in den Arm. Ärgerlich machte ich mich los. „Was ich ohne dich täte? Die Wohnung aufräumen, mich satt essen, Sprit sparen, mich weniger ärgern...“
„Und was tätest du nachts – ohne mich?“ Das erotische Timbre in seiner Stimme war wirklich perfekt austariert. „Wegen der paar Minuten Spaß ruiniere ich doch nicht mein ganzes Leben! Lieber schlafe ich alleine. Also, rückst du jetzt einen Anteil an den laufenden Kosten raus?“
„Ja, mach ich, wenn ich am Geldautomaten war“, versprach er und streichelte meinen Busen. „Geh doch gleich“, schlug ich vor, schon wieder halb versöhnt. „Würde ich ja gerne, aber jetzt muss ich zur Redaktionssitzung. Wir haben eine Zeitung zu machen, vergiss das nicht!“
„Dann bring das Geld auf dem Rückweg mit. Solange gibt´s hier nichts zu essen, klar?“
„Gott, bist du besitzgierig. Du verspießerst wirklich zunehmend!“
Damit verschwand er zu seiner hochwichtigen Sitzung.
Am Freitagmorgen hatte er natürlich kein Geld: Der Automat war außer Betrieb gewesen.
Am Freitagnachmittag hatte er so viel zu tun, dass er die Sache mit dem Geld leider total vergessen hatte.
Am Freitagabend musste er zu einer Vernissage. Da gab es keinen Geldautomaten in der Nähe.
Am Samstagmorgen verschlief er, bis die Läden zu hatten. Danach argumentierte er, jetzt bräuchte ich bis Montag ja wohl kein Geld mehr, oder? Am Montagmorgen war Heiner verschwunden, als ich aufstand. Leider nicht auf Dauer, stellte ich fest, er hatte einen Zettel mit Anweisungen zurückgelassen, den ich sofort zerknüllte und wegwarf, bevor ich mich in die Unibibliothek aufmachte. Ich orderte alles, was der Katalog zum Kunstverein auflistete – besonders viel war es nicht; am Dienstag sollte ich den Vormittag wohl tunlichst im Städtischen Archiv verbringen, beschloss ich. Und essen würde ich unterwegs, dann musste ich keine Vorräte zu Hause lagern und Heiner würde hoffentlich verschwinden, sobald der Service nichts mehr taugte.
Immer noch krebste ich mit den paar Euro herum, die ich vom Postsparbuch geholt hatte, aber mittlerweile musste ich wirklich jede Münze einzeln umdrehen und war empfänglich für Überlegungen, dass Semmeln deutlich weniger kosteten als Brezen, Brezen aber länger sättigten. Eine Semmel und eine Breze gab es am Montagmittag, dann ging ich zu Karen putzen (wo es einen kostenlosen Kaffee gab, den ich gerne annahm) und ärgerte mich still über Heiner – wieso zahlte er nicht?
Ich konnte zwar nur zu gut verstehen, dass er nicht gerne Geld ausgab, das tat ich zurzeit ja auch nicht, aber ihm musste doch klar sein, dass ich ihn nicht ernähren konnte? Heiner war ein ziemlicher Parasit, wenn ich ehrlich war. Immer schon? Oder hatte ich ihn zu schlecht erzogen? War ich zu doof gewesen? Hatte ich mich ausbeuten lassen? Schwer zu sagen, aber auf jeden Fall herrschten jetzt andere Sitten, das Geld von meinen letzten, sehr viel lukrativeren Jobs war weg und mit Putzen ernährte ich doch keinen voll berufstätigen Journalisten!
Konnte ich auch gar nicht, im Moment kam ich in der Woche gerade mal auf acht Stunden. Hundertzwanzig Euro, das waren im Monat vierhundertachtzig. Man konnte gut rechnen, während man Badewanne, Waschbecken und Toilette schrubbte. Das reichte gerade für die Miete und meine Kassenbeiträge. Gut, die TV-Gebühren und das Handy waren wohl auch noch drin, aber dann war Schluss! Beim Aufwischen aller Nassräume fiel mir ein, dass ich für meinen Dispokredit ja auch noch happige Zinsen zu zahlen hatte. Wie viel wohl? Zweitausend... bestimmt zwölf Prozent... das waren – hm - zweihundertvierzig im Jahr, also zwanzig im Monat, mehr als das Handy kostete. Ich musste den Kredit unbedingt tilgen, sonst schmiss ich denen ja bis April über hundert Euro in den Rachen.
Und ich hatte keine anständigen Klamotten für den neuen Job. Bloß ein brauchbares Sakko war noch da, der Rest war einfach zu alt. Und verbeulte Jeans zum Sakko? Ich brauchte korrekte Kleidung, die außerdem meine dicken Oberschenkel kaschierte. Auf jeden Fall musste ich mehr putzen. Eigentlich war die Arbeit gar nicht so mühsam, Karen wenigstens war sehr zufrieden und quatschte mich nicht die ganze Zeit voll. Manchmal hörte ich sie im Nebenzimmer, wie sie ihren übellaunigen kleinen Sohn tröstete, und ab und zu schaute sie vorbei, lächelte und fragte, ob ich gut zurechtkäme. Noch zwei, drei solche Arbeitgeber und ich könnte mein Konto allmählich wieder in Ordnung bringen!
Am Dienstag fragte ich bei JobTime nach. Mein „Berater“, wie das hier seit Neuestem hochtrabend genannt wurde, machte „Hm“ und blätterte einen Stapel Ausdrucke durch. „Ja, zwei Angebote hätten wir schon noch. Einen schlecht gelaunten Schriftsteller – ich sehe gerade, da haben schon mehrere aufgegeben – und eine Frau Rössel in der Altstadt. Hier steht pingelig.“
„Und wo wohnt der muffige Schriftsteller?“, fragte ich nach, fest entschlossen, lieber noch mehr zu sparen. „Hinter dem Helenenbad. Helenenweg elf. Das andere wäre Fuggergasse drei.“
Die Lage wäre nicht so ungünstig, überlegte ich, aber bei beiden würde ich sicher dauernd angemeckert, und das hatte ich ja auch schon zu Hause. Trotzdem, acht Stunden mehr waren das bestimmt, dann hätte ich neunhundertsechzig Euro im Monat...
„Okay, ich versuch´s“, seufzte ich und ließ mir die Daten geben.
Frau Rössel ging so schnell ans Telefon, dass ich mir richtig vorstellen konnte, wie sie schon seit Tagen direkt daneben gesessen und gelauert hatte. Ihre Stimme klang scharf, das war sicher eine richtige Sklaventreiberin. Nein, sie besitze alle wirklich guten Putzmittel, und natürlich müsse ich vormittags kommen, nur Schlampen hätten die Hausarbeit mittags noch nicht fertig. Mittwochs von neun bis zwölf – dann ging ich mittwochs eben nachmittags in die Bibliothek. Täglich musste ich da ja auch nicht hin!
Der Schriftsteller, Kampmann hieß er (nie gehört), brummte. Eine Vorstellung sei nicht nötig. Dienstag und Freitag, am späteren Nachmittag, jeweils drei Stunden. Ungewöhnlich tiefe Stimme – oder kam das von der brummigen Laune? Jedenfalls sagte ich zu, gleich für heute Nachmittag, um fünf. Nein, mitzubringen hätte ich nichts.
Zu Hause wühlte ich meine Habseligkeiten durch, schloss alles Wichtige wieder weg und schleppte einen Stapel unwichtiger Taschenbücher in die Lesefabrik. Wieder fünfzehn Euro mehr! Das komische goldene Armband, das ich mal geschenkt bekommen hatte, brachte leider auch nur zehn Euro, es war gar nicht echt. Hätte ich mir ja denken können, es hatte gar so intensiv golden geglänzt. Es hätte von Heiner sein können, überlegte ich, während ich die Wäsche (nur meine eigene) in den Keller schleppte. Mich mit Tinnef reinzulegen, damit ich ihn im Gegenzug durchfütterte! Aber ich wusste, dass er mir noch nie etwas geschenkt hatte. Geschenke fand er unwesentlich, Zeichen der übersättigten Konsumgesellschaft und überflüssigen Tand. Ich hatte meine Versuche, ihn umzuerziehen, schnell wieder eingestellt.
Was fand er eigentlich an mir? Hatte er sich schon, als wir uns in einer Ausstellung kennen gelernt hatten, gedacht Die ist doof genug, auf deren Kosten kann ich leben? Oder hatte ich ihm gefallen? Abstoßend fand er mich wohl nicht, er hatte keine Probleme, immer dann mit mir zu schlafen, wenn er mich von seinen Fehlern ablenken wollte.
Seine Fehler... Er war ein Parasit, arrogant und nahm mich nicht ernst. Eigentlich nervte er furchtbar, aber er sah gut aus und sein ständiges Genörgel hielt mich geistig fit. Hatte diese Beziehung eine Zukunft? Der Gedanke erschreckte mich plötzlich – ein Leben lang an der Seite von Heiner? Das Wesen neben ihm sein, das für die niedrigen Aspekte des Lebens gerade mal gut genug war? War ich etwa Christiane Vulpius? Aber Goethe hatte seine Christiane ehrlich geliebt, und Heiner war nicht Goethe, egal, was er sich einbildete.
Nein, das durfte gar keine Zukunft haben. Außerdem könnte ich nicht in Ruhe in der Museenverwaltung arbeiten, wenn er dauernd stänkerte, wie sehr meine Arbeit bloß die herrschenden Strukturen verfestigte und der allgemeinen Volksaufklärung zuwiderlief.
Eigentlich war Heiners Weltanschauung eine ekelhafte Mischung: Einerseits spielte er den Postkommunisten – wenn man das so nennen durfte - , andererseits war er elitär bis zum Gehtnichtmehr, und seine frauenfeindlichen Sprüche waren ihm nicht mal peinlich, weil er fand, dass ein Mensch mit seinem hohen Bewusstseinsstand über political correctness erhaben sein durfte. Und dafür, auf anderer Leute Kosten zu leben, war er sich auch nicht zu schade! Glaubte er etwa, es müsse mir eine Ehre sein, das Genie durchzufüttern?
Heiner war, wenn man es recht bedachte, das perfekte Arschloch, schloss ich meine Überlegungen ab und warf mich in meine Putzkluft, weil es schon fast vier war. Meine Wäsche bügelte ich schnell noch durch und verräumte sie; alles, was Heiner auch passte, kam in das verschließbare Regalfach.
Wie konnte ich ihn loswerden? Er zahlte ja doch nichts, und in letzter Zeit machte er auch nichts mehr im Haushalt - außer Unordnung. Gute Gespräche hatten wir schon lange nicht mehr geführt, und seine Zärtlichkeiten waren mir eindeutig zu zweckbestimmt: Vögle sie, dann hört sie auf zu nörgeln. Früher hatten wir auch mal ernsthaft diskutiert, gemütliche Abende verbracht, uns zärtlich geliebt. Im Bett war er wirklich nicht schlecht, aber die Gefühle waren irgendwie eingeschlafen... Welch schlampig formulierte Diagnose!
Nein, Heiner musste hier raus. Gisi hatte sich nicht ohne Grund von ihm getrennt. Vielleicht sollte man eine Regel aufstellen: Immer die Vorgängerin befragen - ohne eine anständige Referenz von ihr sollte kein Mann mehr eine Chance haben!
Ich räumte noch ein bisschen auf, aß die letzte Brotscheibe auf und versteckte den Löwenanteil des Kaffeepulvers. Je ungastlicher ich auftrat, desto eher würde Heiner sich eine Neue suchen! Wo steckte er überhaupt? Schon wieder so eine lange Redaktionssitzung? Na, wenn ich mit diesem Kampmann zurechtkam und gleich bei ihm putzte, wäre ich erst gegen halb neun zurück, müde und gereizt, und Heiner hätte einen knurrenden Magen. Die ideale Situation für den großen Krach. Dann könnte er gegen zehn gepackt haben und verschwinden, und morgen früh würde ich das Schloss ändern lassen. Zack, das Leben wieder in Ordnung gebracht!
Das Haus im Helenenweg war eine Riesenscheune aus den Sechzigern. Mir wurde ganz flau, als ich das alles musterte – da putzte ich mich ja tot! Kurz überlegte ich, ob ich einfach wieder gehen sollte – aber das war mir dann doch zu feige. Also klingelte ich brav und wartete. Es dauerte etwas, dann summte die hässliche schmiedeeiserne Gartenpforte und ich drückte sie auf. Der Kiesweg war voller Unkraut, aber als Gärtnerin war ich hier nicht angestellt. Und welcher Schwachkopf hatte das Haus mit den schönen Proportionen denn senfgelb angestrichen? Und diese Haustür – Milchglas mit asymmetrischen Messingstreben! Einfach schauerlich, Kampmann musste einen Geschmack haben wie ein Pferd. Das Milchglasungetüm öffnete sich und ich erstarrte mitten im Erklimmen der Stufen. Was für ein Kerl!
Bestimmt einsfünfundneunzig groß, oder noch mehr. Und breit gebaut, wenigstens spannte das angeschmuddelte Sweatshirt über den Schultern. Die verbeulten Chinos ließen keine Rückschlüsse zu, aber die graubraunen Haare – viel zu lang und offenbar auch länger nicht mehr gekämmt. Kein schlechtes Gesicht, aber eindeutig übellaunig. Reichlich Falten, der Kerl war bestimmt Mitte vierzig oder noch älter. „Ja?“
„Ich bin Anne Holler und komme von JobTime. Wir haben telefoniert, wegen der Putzstelle.“
„Ach so, ja. Kommen Sie rein.“
Drinnen fiel es mir schwer, ein Pokerface beizubehalten. Ich sah eine große, im Stil der Sechziger geflieste Diele, von der aus eine leicht gehaltene Treppe nach oben führte. Glasbausteine in der Wand ließen neben der Treppe genügend Licht ein. Eine Tür neben der Haustür, noch eine an der Schmalseite, die zur Straße zeigte, dann eine an der Breitseite (Gartenfront, ich vermutete dahinter das Wohnzimmer), und eine an der nächsten Schmalseite. Oben sicher das Entsprechende.
Das wäre, abgesehen von der Weitläufigkeit, kein Problem gewesen, aber alle Wände waren mit bunten Tapeten im Stil optische Täuschung beklebt, Wellenlinien, Op-art und so weiter. Grausig. Und der Boden war mit Fußspuren bedeckt, in den Ecken lagen reichlich Staubmäuse. Möbel gab es kaum, nur ein pseudoantikes Tischchen mit unnatürlich verdrehten dünnen Beinen, das dunkle Holz stumpf und verkratzt. Darüber hing ein Spiegel in einem ganz anderen Stil.
Ich verkniff mir jeden Kommentar und ließ mich in ein riesiges Wohnzimmer führen. Kamin, Kachelboden, drei schauerliche Polstersofas mit geschnitzten Füßen, eine eichene Schrankwand, die aussah, als fehlte ihr die zweite Hälfte, daneben ein Billy neunzig/weiß/hoch, an dem die Beschichtung schon fast abplatzte und das mit zerlesenen Krimis vollgestopft war. Und überall alte Zeitungen. In der Ecke ging es weiter ins Arbeitszimmer, das ähnlich scheußlich eingerichtet und außerdem kniehoch mit Papieren bedeckt war.
Alle Fenster waren schmierig und verdreckt.
An der anderen Seite des Wohnzimmers befand sich eine Art Esszimmer, aber darin war nur ein gigantischer dunkler Tisch zu finden – ohne Stühle. Und darauf folgte eine Küche voller leerer Flaschen und vergammelter Pizzakartons. Die Kücheneinrichtung war mal das Allerneueste gewesen, schätzungsweise 1964, aber man hätte sie mal pflegen müssen – und man hätte sie nicht über und über mit Prilblumen bekleben dürfen. Ich gestattete mir ein „Hm“ als Kommentar und sah das verantwortliche Ferkel streng an. Er schaute ausdruckslos zurück. „Gefällt es Ihnen?“
„Das tut doch nichts zur Sache“, wich ich aus, „aber ob sechs Stunden pro Woche ausreichen, das alles auf Vordermann zu bringen...“
„Keinesfalls.“