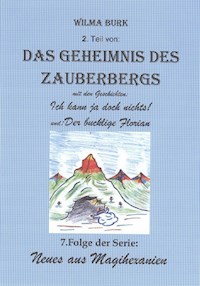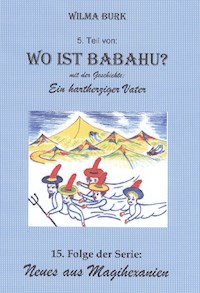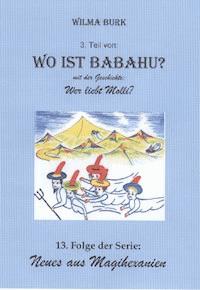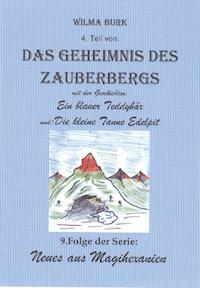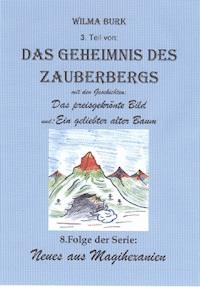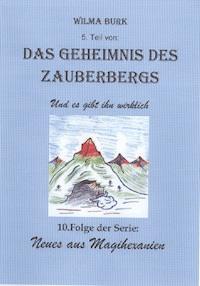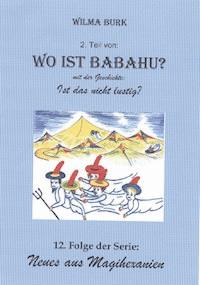2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die Ich-Erzählerin aus dem ersten Buch "Tauziehen am Myrtenkranz" erzählt aus dem Leben ihrer jüngeren Schwester: Sie ist neunzehn, als sie heiratet und West-Berlin verlässt. Voller Begeisterung widmet sie sich der Mitarbeit in einer Kfz-Werkstatt eines Onkels, die ihr Mann einmal übernehmen soll. Sie geht voll in der Berufstätigkeit auf, während ihre Mutter ihre drei Kinder großzieht. Das bleibt nicht ohne Reiberein zwischen den beiden Frauen aus zwei Generationen mit unterschiedlichen Ansichten. Ausgleichend wirkt dabei der Mann, der am liebsten in seiner Werkstatt werkelt und alles Geschäftliche gerne seiner Frau überlässt. Sie ist es also, die in der Zeit der Teilung Deutschlands aus einer kleinen Werkstatt in Hannover einen stadtbekannten Autosalon macht. Die Kinder werden groß dabei und mit ihnen wachsen die Sorgen. Nicht jeder Weg, den sie einschlagen, gefällt ihr. Mit zunehmendem Alter macht sich auch Unzufriedenheit in ihr breit. Plötzlich fühlt sie sich, wie an den Betrieb gekettet und glaubt, im Leben viel versäumt zu haben. Und dann kommt einer und will der noch immer attraktive Frau Anfang fünfzig die Welt zeigen. Kann sie widerstehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Ähnliche
Wilma Burk
Kinder erzieht man nicht so nebenbei
Zweites Buch von: Heute ist alles anders als gestern - besser?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Einleitung
1. Kapitel - 1955
2. Kapitel - 1956
3. Kapitel - 1957
4. Kapitel - 1958
5. Kapitel - 1959
6. Kapitel - 1960
7. Kapitel - 1961
8. Kapitel - 1962
9. Kapitel - 1963
10. Kapitel - 1964
11. Kapitel - 1965
12. Kapitel - 1966
13. Kapitel - 1967
14. Kapitel - 1968
15. Kapitel - 1969
16. Kapitel - 1970
17. Kapitel - 1971
18. Kapitel - 1972
19. Kapitel - 1973
20. Kapitel - 1974
21. Kapitel - 1975
22. Kapitel - 1976
23. Kapitel - 1977
24. Kapitel - 1978
25. Kapitel - 1979
26. Kapitel - 1980
27. Kapitel - 1981
28. Kapitel - 1982
29. Kapitel - 1983
30. Kapitel - 1984
31. Kapitel - 1985
32. Kapitel - 1986
33. Kapitel - 1987
34. Kapitel - 1988
35. Kapitel - 1989
Impressum neobooks
Einleitung
Mir ist, als wäre es gestern erst gewesen, dass Mama empört gesagt hat: „Kinder erzieht man nicht so nebenbei!“ Danach hatte die kleine energische Person ihre Koffer gepackt und war von Berlin aus zu meiner acht Jahre jüngeren Schwester Traudel nach Hannover gefahren. Das war 1959.
Ich sehe sie noch vor mir, wie sie am Fenster des Zuges stand, uns munter aus großen Augen ansah und sich die grauer werdenden Haare unter den kleinen schwarzen Hut strich. Sie strotzte vor alter Energie, so, wie ich sie immer gekannt habe. Für sie war es unfassbar, dass Traudel ihre Mitarbeit in ihrem Familienbetrieb, einem Autogeschäft mit Kfz-Werkstatt, wichtiger zu sein schien als ihre Kinder. Ich wusste, meine Schwester würde sich einiges von ihr anhören müssen.
„Katrina, ich bin bald zurück!“, rief sie mir noch zu, als der Zug begann, aus dem Bahnhof zu rollen.
Ich nickte. Doch Konrad, mein Mann, der neben mir stand, sagte leise: „Wenn das man stimmt!“
Nachdenklich verließ ich mit ihm den West-Berliner Bahnhof-Zoo. Wir gingen die lange Treppe vom Bahnsteig hinunter und vorbei an den Fahrkartenhäuschen, in denen Reichsbahnangestellte der DDR in ihren blauen Uniformen saßen. Es gehörte zu den unverständlichen Regelungen jener Zeit in Berlin, dass das gesamte Reichsbahngelände innerhalb West-Berlins von Ost-Berlin aus verwaltet wurde. Wir durchquerten die staubige und unfreundliche Bahnhofshalle, die wieder, bis auf ein paar herumlungernde Gestalten, leer wirkte. Leben war hier nur, wenn ein Zug ankam oder abfuhr. Und dies waren Interzonenzüge von oder nach der Bundesrepublik, denn West-Berlin war eine Insel innerhalb der DDR. Kein Zug fuhr mehr von hier aus in das Umland von Berlin, in die Mark Brandenburg oder weiter. Berlin war eine unter den vier Siegermächten des Krieges in Sektoren aufgeteilte Stadt. Wobei die drei Westsektoren sich zu West-Berlin zusammengeschlossen hatten und der Ostsektor zur Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) erklärt wurde.
Schweigend, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt, fuhren wir vom Bahnhof aus mit unserem ersten Auto, einem VW-Käfer, durch die Straßen Berlins nach Hause. Wir wohnten am Rande der Stadt, in einem der dort neu errichteten Wohnblöcke. Noch waren wir von Feldern umgeben bis zur nahen Grenze der DDR, Dahinter begann die Mark Brandenburg.
Ich weiß noch, wie wehmütig mir bei dieser Heimfahrt zumute war. Wenn Mama wirklich in Hannover blieb - was Konrad vermutete -, so wäre nur noch ich allein als Einzige aus unserer Familie in Berlin. Vorbei die Zeit, in der es früher sonntags lebhaft in unserem kleinen Schrebergarten zuging, wenn Mama und Papa mit meinem Bruder Bruno und meiner Schwester Traudel zu uns kamen und sich in unsere Runde unter dem alten Kirschbaum noch Helmut Bruns, Konrads Freund aus Kriegstagen, dazugesellte.
„Bist du traurig?“, holte mich Konrad aus meinen Gedanken heraus, als wir unsere Wohnung fast erreicht hatten.
„Nein, nein!“, beeilte ich mich zu versichern. Aber ich wurde den traurigen Gedanken nicht los, wie schön es jetzt wäre, wenn wir wenigstens Kinder hätten. Vielleicht würde ich es dann nicht so empfinden, als wäre ich hier in West-Berlin übrig geblieben. Doch wir werden ja kinderlos bleiben. Das hatte mir zur traurigen Gewissheit werden müssen. Traudel war es, die Mama ihre geliebten Enkelkinder beschert hatte.
*
Traudel hatte schon früher als Kind ihren eigenen Kopf gehabt. Als Nesthäkchen von uns drei Geschwistern verstand sie es, viel mehr durchzusetzen als mein jüngerer Bruder Bruno oder ich. Sie konnte mit trotziger Bewegung zuerst ihre roten Zöpfe, später ihre üppige rote Haarfülle, so in den Nacken werfen, dass man lachen musste. Eben noch bockig, verstand sie es, bald darauf zu schnurren wie eine Katze, wenn sie etwas erreichen wollte. Damit hatte sie besonders bei Papa Erfolg.
Als sie gerade siebzehn Jahre alt war, wusste sie bereits, dass sie ihren Karl-Heinz heiraten würde.
Karl-Heinz Roth war ein junger Mann aus unserer Laubenkolonie am Rande der Stadt, acht Jahre älter als Traudel. Mama hatte sich bald Sorgen um diesen Altersunterschied gemacht. „Der will doch nicht mehr nur Händchen halten“, hatte sie gesagt. Am liebsten hätte sie da ihr erst sechzehn Jahre altes Nesthäkchen von ihm ferngehalten.
Doch Traudel interessierte sich für keinen anderen Jungen, nur für ihren Karl-Heinz. Alle Einwände, alle Bedenken von Papa oder irgendjemand anderem konnten sie nicht umstimmen. Eines Tages machte sie Papa klar, dass sie nicht studieren werde, so wie er es erhofft hatte. Dabei war es doch für ihn schon eine Enttäuschung gewesen, als unser Bruder Bruno vorzeitig von der Schule ohne Abitur abgegangen war. Das Abitur aber wollte Traudel wenigstens noch machen, so versprach sie. Doch dann würde sie sofort Karl-Heinz heiraten und mit ihm nach Hannover gehen.
Traudel war das letzte Kind von Mama und Papa, welches das Elternhaus verlassen wollte. Ich, die Älteste, hatte ein paar Jahre vorher geheiratet und danach war unser Bruder Bruno nach Australien ausgewandert. Das hatte Mama und Papa sehr getroffen. Nun schmerzte es sie besonders, dass auch Traudel, ihr Küken, nicht in Berlin bleiben würde.
„Aber sie bleibt doch in Deutschland“, versuchte ich Mama zu trösten, als 1955 der Tag von Traudels Hochzeit näher kam.
„Und wenn schon!“, entgegnete sie traurig. „Sie ist dann aber so weit weg von uns.“
Karl-Heinz Roth war Kfz-Meister. Er sollte die Autowerkstatt eines kinderlosen und verwitweten Onkels bei Hannover übernehmen.
„Bestimmt kann ich in dem Betrieb mitarbeiten“, nahm sich Traudel vor und himmelte ihren Karl-Heinz an.
„Sobald du aber Kinder hast, hörst du doch damit auf?“, fragte Mama erschrocken. „Das kennt man ja, wenn eine Frau in einem selbständigen Betrieb erst einmal mitarbeitet, wird sie immer gebraucht. Doch die Kinder benötigen die Mutter schließlich auch.“
Traudel lachte und warf ihre rote Haarfülle in den Nacken, wobei ihre grünlich schimmernden Augen herausfordernd blitzten. „Wer denkt denn gleich an Kinder. Das hat Zeit! Warum sollten die sofort kommen. Und überhaupt! Warum soll ich mit der Arbeit im Betrieb dann aufhören? Heute ist das anders als bei dir, Mama! Heute begnügt man sich als Frau nicht mehr mit Haushalt und Kindererziehung.“
„Begnügt? Wie sich das anhört! Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit so ein Haushalt macht?“ Dass ein Mädchen einen Beruf erlernte, fand Mama richtig, sogar, dass sie studieren wollte, aber alles sollte nur gelten, bis eine Frau heiratet und Kinder bekommt. So sah sie das!
Doch Traudel war überzeugt davon, ihre Aufgabe würde der Betrieb sein, den Karl-Heinz einmal von seinem Onkel Oskar übernehmen sollte.
„Wie willst du das schaffen, ohne Ausbildung in irgendeinem Beruf?“, wunderte sich Papa.
„Das wird sich finden. Wenn ich erst einmal sehe, was dazu nötig ist, kann ich mich darin bestimmt schulen lassen“, antwortete Traudel unbekümmert.
„Na, hoffentlich irrt sie sich nicht“, meinte Konrad dazu, der als Leiter einer kaufmännischen Abteilung in einer Firma in West-Berlin tätig war.
„Du kennst Traudel noch nicht gut genug. Sie hat einen eisernen Willen, wenn sie etwas will“, erklärte ich.
„Katrina, immerhin sind wir seit fast sieben Jahren verheiratet. In dieser Zeit habe ich sie schon ein bisschen kennenlernen können. Bei uns im Betrieb würde sie sich wundern, wenn sie so einfach ohne Vorbildung einsteigen wollte.“
„Das ist ja auch eine größere Firma. Hier aber handelt es sich um einen kleinen Familienbetrieb. Ich denke, dass sie es schafft“, behauptete ich.
Da lachte Konrad. „Ihr Frauen! Jetzt genügt euch noch immer nicht, was ihr an Gleichberechtigung erreicht habt, jetzt wollt ihr schon ganze Betriebe übernehmen. Ich sehe Traudel bereits als Chefin eines großen Autosalons“, höhnte er.
„Wart 's ab!“, sagte ich nur.
1. Kapitel - 1955
Die Teilung Berlins und die Schwierigkeiten, mit denen die Sowjetunion und die Führung der DDR West-Berlin seit Jahren bedrängten, setzten sich fort. Aber die drei Westmächte, Amerika, England und Frankreich, beharrten darauf, in ihren drei Westsektoren der Stadt präsent zu sein. Sie beriefen sich auf den Viermächte-Status der Stadt, den die vier Siegermächte bei Kriegsende miteinander ausgehandelt und vereinbart hatten, und sie protestierten heftig, wenn die UdSSR dagegen verstieß oder von der SED-Regierung in Ost-Berlin eigenmächtige Handlungen zuließ. Längst waren aus einer ehemals einheitlichen Stadt zwei einander fremde Städte geworden, obgleich man noch von der einen in die andere gelangen konnte. Nur das Umland von Berlin war weder für West-Berliner noch für Bundesbürger frei zugänglich, seit die DDR 1952 mit Straßensperren ganz Berlin abgeriegelt und nur einige Übergänge in Ost-Berlin freigelassen hatte. Noch scheuten sie sich, Ost-Berlin gegen West-Berlin genauso abzuriegeln, denn noch versuchten sie, so manche Forderung mit dem Viermächte-Status der Siegermächte für die Stadt zu begründen. Um eben diesen Status von Berlin gab es immer wieder Spannungen und Streit zwischen Ost und West. Jeder berief sich darauf und jeder legte ihn anders aus.
Die Bundesrepublik erreichte man von West-Berlin aus über Transitwege durch die DDR, mit Interzonenzügen oder durch die Luftkorridore der Westmächte, die aber nur von alliierten Flugzeugen benutzt werden durften.
In West-Berlin pulsierte das Leben, die Hungerjahre waren vergessen. Die West-Berliner wussten die Freiheit ihrer Insel, umgeben vom Ostblock - und doch nicht gefangen - sehr zu schätzen. So nahmen sie es hin, Straßenbenutzungsgebühren für Pkws und Lkws für die Benutzung der Transitstrecken auf dem Gebiet der DDR bis zur Bundesrepublik bezahlen zu müssen. Die stabile D-Mark der Bundesrepublik verachteten die östlichen Machthaber dabei nicht, die nahmen sie gern ein.
*
Wie Traudel es sich vorgenommen hatte, so machte sie ihr Abitur. Sie erreichte dabei eine so gute Note, dass Papa noch einmal enttäuscht seufzte: „Schade, du hättest wirklich das Zeug zum Studieren gehabt.“
„Lass man!“, tröstete Mama ihn. „Bei einem Mädchen ist das nicht so wichtig. Irgendwann hätte sie später geheiratet. Dann wäre das ganze Studieren umsonst gewesen.“
„Wir hätten sie aber noch eine Weile bei uns gehabt“, wandte Papa ein. Er hatte sich sehr schwer damit abfinden können, dass sein Nesthäkchen schon mit gerade neunzehn Jahren das Elternhaus verlassen wollte. Doch Traudel war ihm schnurrend so lange um den Bart gegangen, bis er seine Einwilligung zur Hochzeit gegeben hatte. Und die war zu der Zeit noch erforderlich. Erst mit einundzwanzig wäre Traudel volljährig gewesen und hätte darüber allein entscheiden können.
Kurze Zeit später, nachdem Traudel ihr Abitur gemacht hatte, heiratete sie ihren Karl-Heinz an einem schönen und heißen Sommertag. Wie bei der Hochzeit von Konrad und mir vor sieben Jahren kamen alle Verwandten und Freunde aus West und Ost zur Feier. Aus dem Osten allerdings nur die, die noch kommen konnten. Die Gäste aus dem Westen erkannte man daran, dass sie nicht mehr - wie noch bei unserer Hochzeit - umgearbeitete alte Kleider trugen, sondern neue Garderobe, die sie extra für die Hochzeit gekauft hatten. Die Männer füllten ihre Anzüge wieder aus, verschwanden vor Magerkeit nicht mehr darin wie früher. Auch die Hochzeitstafel zu füllen, wäre jetzt für Mama nicht mehr schwer gewesen wie bei uns damals, als gerade die sowjetische Blockade von West-Berlin begonnen hatte. Doch diesmal musste sie sich nicht darum kümmern. Die Feier fand in einem Raum für Vereinssitzungen oder Familienfeiern in der Kneipe an der Ecke unserer Straße statt. Hier sorgte der Wirt für Speisen und Getränke. Mama rannte nicht zwischen Küche und Hochzeitstafel hin und her, sondern sie saß mit Papa auf einem Ehrenplatz gleich neben Karl-Heinz, dem Bräutigam.
„Was haben sich die Zeiten doch gebessert“, stellte sie zufrieden fest.
„Ja, wenn nur auch die Spannungen um Berlin aufhören würden“, meinte Karl-Heinz.
„Darum werdet ihr euch in Hannover bald nicht mehr kümmern“, vermutete Konrad. Wir wussten von unserer Reise in die Berge her, wie wenig sich die Bundesdeutschen für Berlin interessierten.
„Das sicher nicht!“, wehrte Traudel ab. „Dazu habe ich hier viel zu lange gelebt.“
„Ich sollte dir eigentlich böse sein, dass du uns Traudel so zeitig und so weit weg entführst“, sagte Mama zu Karl-Heinz und gab ihm scherzhaft einen Klaps auf seinen Arm. Es war aber nicht zu übersehen, er hatte längst ihr Herz erobert.
Sahen Konrad und ich damals als Brautpaar auch so glücklich aus wie die beiden, die da nebeneinander auf den bekränzten Stühlen saßen? Ja, man ging noch voller Illusionen in eine Ehe. Ich dachte daran, wie Traudel mich damals vor meiner Hochzeit besorgt gefragt hatte, ob sie jemals eine schöne Braut sein könnte, weil sie rote Haare hatte. Die Sorge hatte ihr wohl Karl-Heinz längst genommen, wenn er sie verliebt „Mein kleiner roter Teufel“ nannte.
Und Traudel war eine hübsche Braut. „Wie eine Prinzessin“, hörte ich jemand sagen, als wir in die Kirche gingen. Ihr kurzer Schleier - wie es gerade modern war - wurde von einem Krönchen aus Myrtenzweigen auf ihrem roten Haar gehalten. In langen Locken fiel es ihr über die Schultern. Dabei leuchteten ihre meergrünen Augen wie unergründliche Bergseen - so drückte es Karl-Heinz in seiner Verliebtheit aus.
Er hielt sie fest, als befürchtete er, sie könne jeden Moment verschwinden wie ein schöner Traum. Beim Laufen zum Altar in der Kirche hatte er Mühe, nicht auf ihren langen, weit schwingenden Rock zu treten, unter dem Traudel - wie jetzt üblich - einen steifen Petticoat trug. Das ließ ihre Taille besonders schlank erscheinen.
Sie waren ein schönes Brautpaar, und es war ein schönes Fest.
Zum Tanz spielte kein Akkordeonspieler mehr auf wie bei uns, sondern hier stand eine Musikbox mit den neuesten Platten und Schlagern.
Es wurde aber noch Walzer getanzt neben all den modernen aufkommenden Tänzen. Da sah ich dann auch Mama und Papa sich beschwingt im Kreise drehen. Dabei bemerkte ich, Mama sah Papa an, als hätte sie sich gerade eben erst in ihn verliebt.
Ich lächelte, schmiegte mich tiefer in Konrads Arm und drehte mich mit ihm. Auch uns überkam ein Gefühl inniger Verbundenheit.
Onkel Oskar, der Onkel aus Hannover von Karl-Heinz, hatte eine besondere Überraschung für das Brautpaar. Plötzlich hupte es laut und vernehmlich vor der Kneipe. Onkel Oskar hatte sein Geschenk geholt. Geschmückt mit einer großen Schleife auf der Motorhaube, stand da ein kleines Auto.
Traudel rannte aufgeregt hinaus und zog Karl-Heinz mit sich. Neugierig folgten die Gäste, neugierig kamen Kinder auf der Straße dazu und blieben Passanten stehen.
„Soll der für uns sein?“, fragte Traudel ungläubig und drückte ihre Hände an die Brust.
„Was dachtest du?“, fragte Onkel Oskar selbstgefällig. „Ein Kfz-Meister in meinem Betrieb, der kein Auto besitzt, wo gibt es denn so was?“ Und er blickte verschmitzt über den Rand seiner silbern eingefassten Brille. Dabei lachte er zufrieden, dass sein kleiner Schmerbauch vergnügt dazu auf und ab hüpfte. Er hatte sich extra einen neuen dunklen Anzug zu der Feier gekauft und eine schwarze Fliege umgebunden. Seine dünnen, mit weißen Fäden durchzogenen dunklen Haare hatte er besonders sorgsam von dem tiefen Scheitel aus gleichmäßig über den Kopf verteilt.
Ich sah wohl Konrads sehnsüchtigen Blick nach dem Auto. Auch Onkel Oskar sah es. „Lassen Sie man, junger Mann“, wollte er ihn trösten, „das dauert nicht mehr lange, dann haben auch Sie ein Auto. Nicht umsonst bauen sie jetzt hier in der Stadt das erste Stück einer Stadtautobahn. Die Zukunft gehört dem Auto. Da führt nichts dran vorbei. Bald geht keiner mehr zu Fuß.“
Ich sah ihn zweifelnd an.
„Bestimmt! Glauben Sie mir, kleine Frau! Ich kann das in meiner Autowerkstatt spüren“, bekräftigte er seine Worte.
Helmut Bruns, Konrads Freund aus Kriegstagen, den wir seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hatten, besaß bereits ein eigenes Auto. Wie oft war er mit uns durch die Stadt gefahren, damals, als unsere Freundschaft mit ihm noch bestand, hatte es Konrad nichts ausgemacht. Doch jetzt, da immer häufiger dieser oder jener plötzlich ein Auto vor der Tür stehen hatte, spürte ich, wie gern auch er eins hätte. Zunächst aber war uns das nicht möglich, ohne einen Kredit aufzunehmen – und davor scheute er zurück.
Kaufen auf Kredit, das wurde jetzt üblich. Man hatte Arbeit, man verdiente sein Geld und konnte somit in die Zukunft planen. Die Wirtschaft in West-Berlin entwickelte sich zwar nicht so schnell und so gut wie in der Bundesrepublik - bedingt durch die Insellage der zweigeteilten Stadt innerhalb der DDR -, aber es ging spürbar aufwärts.
Darüber redeten die Alten auch auf Traudels Hochzeit. Vielleicht taten sie sich sogar wichtig mit dem, was sie bereits erreicht hatten. Die Jungen aber tanzten lieber in die Nacht hinein. Eigentlich waren Konrad und ich schon fast ein altes Ehepaar, doch an diesem Tag fühlte ich mich um Jahre zurückversetzt. Ich sah ihn mit den verliebten Augen der ersten Tage, sein schmales Gesicht unter dunklen Haaren, und schmiegte mich beim Tanzen enger an seine schlanke aufrechte Gestalt. Wie gut ihm der dunkle Anzug stand. Ein paar Falten um seine Augen, die ihren warmen Glanz nicht verloren hatten, verrieten, dass er keine zwanzig mehr war. Jetzt mit zweiunddreißig Jahren war er etwas breiter geworden. Aber auch mich ärgerten bereits gewisse kleine, fast unmerkliche Pölsterchen um die Taille. Ein Zeichen der Zeit, dass es allen wieder besser ging. Längst gab es Dicke, man kämpfte mit seinem Gewicht, mit Torte und Sahne. So mancher Hochzeitsgast sagte bei einem Gläschen auch ein „Prost“ zu viel. Damit war man nicht zimperlich, man war fröhlich. Es war viel zu schön, dass es sich nach dem Krieg wieder zu leben lohnte.
Alle verabschiedeten sich gegen Morgen in guter Laune, wenn auch müde. „Wann sehen wir uns wieder?“, wurde gefragt.
„Bei der nächsten Hochzeit“, sagte jemand.
Doch einen hörte ich murmeln: „Vielleicht auch bei der nächsten Beerdigung.“
Ärgerlich wollte ich etwas erwidern. Doch Konrad zog mich zur Seite. „So ist das nun einmal mit Familienfeiern“, sagte er.
Und es stimmte ja. Entfernte Verwandte, wann sah man sie? Zu Hochzeiten oder zu Beerdigungen.
Karl Heinz verabschiedete sich hier schon von seinen Eltern, während das junge Paar mit zu Mama und Papa gingen.
Obgleich Karl-Heinz nach der Feier nicht mehr so ganz sicher auf den Beinen war, ließ er es sich nicht nehmen, sein neues, kleines Auto die paar Meter in der Straße bis vor das Haus von Mama und Papa zu fahren. Traudel hatte sich fröhlich beschwipst dazu neben ihn geklemmt. Myrtenkrönchen und Schleier waren längst verschwunden, doch den weiten Rock in dem engen Auto unterzubringen, hatte sie Mühe. Ich stopfte ihr noch die letzen Zipfel von Rock und Petticoat mit hinein. Die Hochzeitsgesellschaft umstand johlend das Auto. Da waren wohl alle Leute in der Umgebung wach geworden. Alle winkten zum Abschied, als gingen Traudel und Karl-Heinz auf Hochzeitsreise. Alle lachten und winkten immer noch, als sie nur ein paar Meter weiter wieder hielten, ausstiegen und mit Mama und Papa im Haus verschwanden.
Die Hochzeitsgäste zerstreuten sich. Die einen gingen zur U-Bahn, die andern zur S-Bahn und einige zur Straßenbahn wie wir.
Als die Bahn mit uns so gemütlich, manchmal quietschend, nach Hause zuckelte, dachte ich an Traudel und Karl-Heinz. Doch ich erinnerte mich auch an unsere enttäuschende Hochzeitsnacht von damals, bei der Konrad vor Trunkenheit einfach eingeschlafen war. Im Nachhinein musste ich darüber lachen.
„Na, ob Traudel und Karl-Heinz eine bessere Hochzeitsnacht haben werden als wir?“, neckte ich Konrad.
Er grinste. „Bei denen ist es bestimmt nicht das erste Mal wie bei uns. Und außerdem konnte er tatsächlich noch ein Auto bewegen, dann ist er wohl nicht so betrunken, wie ich es damals war.“
„Mein Gott, ist das schon lange her!“, stellte ich fest, gähnte und sah müde aus dem Fenster der Straßenbahn auf die noch stillen Straßen und verschlafenen Häuser dieses Morgens.
*
Am nächsten Tag verabschiedete sich Traudel ohne Wehmut von Mama und Papa und von ihrem bisherigen Leben. Sie stieg zu Karl-Heinz in ihr vollgepacktes Auto. Da war alles drin, was ihnen mitnehmenswert erschien, Erinnerungsstücke neben praktischen Dingen und Geschenken. Sie hatten nicht mehr in der Hauptsache Glaswaren und mehrere Likörservice zur Hochzeit bekommen, wie wir damals. Bei ihnen hatte sich jeder vorher informiert und gezielt gekauft, was sie brauchen konnten. Eingeklemmt zwischen Beuteln, Kisten, Taschen und Koffern saß Traudel neben Karl-Heinz und strahlte glücklich.
„Da werden bei euch die Vopos an der Grenze zur DDR ganz schön was zu kontrollieren haben“, vermutete Konrad.
„Ich fürchte auch, dass wir den Wagen auspacken müssen“, befürchtete Karl-Heinz. „Dabei haben wir bereits vieles zu Paketen verpackt, die Mama uns mit der Post zuschicken will.“
„Ach was“, meinte Traudel optimistisch, „dann dauert die Kontrolle an der Grenze eben länger als sonst. Wir werden es überstehen. Haben ja nichts Verbotenes dabei.“ Und sie fuhr zuversichtlich ab, nach Hannover in ein neues Leben. Ich wusste, sie war froh, Berlin verlassen zu können, da sie meinte, es werde nie aufhören, Spannungen um diese Stadt zwischen Ost und West zu geben.
*
Mama und Papa blieben nun allein zurück. Es war ruhig bei ihnen geworden, alle Kinder aus dem Haus. Abends, nach meiner Arbeitszeit in einem Verlag, fuhr ich jetzt manchmal für kurze Zeit zu ihnen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie weiterleben sollten, nur sie beide, kein Lachen, kein Rufen mehr von einem ihrer Kinder, für die sie doch immer da gewesen waren.
Mama freute sich, wenn ich, das einzige Kind, das noch in Berlin lebte, zu ihnen kam. Kaum hatten wir die ersten Worte gewechselt, lief sie schon und holte von Traudel oder Bruno einen Brief, den sie mir vorlas. Und Traudel schrieb zuerst fleißig. Sie berichtete von ihrer kleinen Wohnung, die Onkel Oskar ihnen in seinem Haus eingerichtet hatte. Es war außerhalb Hannovers, da, wo die Stadt begann, wo eine schon lebhaft befahrene Landstraße aus der Stadt hinausführte und sich weiter im Land verlor. Das Haus stand in einem großen verwilderten Garten. Daneben gab es einen geräumigen Hof, auf dem stets irgendwelche Autos standen, nicht nur zur Reparatur, sondern auch einige zum Verkauf. Dahinter befand sich die Werkstatt und dann dehnten sich nur noch weite Wiesen neben der Landstraße bis hin zu einem kleinen Fluss und weiter bis zu einem Waldesrand.
Den Garten würde Traudel am liebsten gleich in Ordnung bringen, berichtete sie. Sie schwärmte aber auch davon, dass man sie in dem Büro der Werkstatt zu beschäftigen wusste. Dabei betonte sie, wie sehr sie sich Mühe gab, alles zu verstehen, was dort geschah.
„Warum hat ein Tag nur so wenige Stunden?“, schrieb sie. „Ich würde am liebsten alles auf einmal tun. Und da ist ja auch noch der Haushalt. Jetzt weiß ich erst, wie viel Arbeit du immer hattest, liebe Mama. Noch ist mein Haushalt klein und doch ist es nicht so einfach, alles Nötige zu tun, weil ich so gern im Betrieb mitarbeite. Onkel Oskar begrüßt das sehr. Er lobt mich, ich hätte gute Ideen. Seine alte Bürohilfe, die Frau Jäger, meint auch, auf mich höre er bestimmt, ich sollte versuchen, ihm abzugewöhnen, alles auf irgendwelche Zettel zu notieren, die sie dann zusammensuchen muss. Sie sagt, an mir hätte er einen Narren gefressen. Ich mag Onkel Oskar besonders gern. Karl-Heinz ist sehr fleißig. Sooft ich will, kann ich ihn durch das Fenster vom Büro aus zur Werkstatt hin sehen, wie er in seinem grauen Kittel an den Autos arbeitet, manchmal unter ihnen liegt, manchmal halb in ihnen steckt.“
Mamas Augen glänzten, ihre Jüngste war glücklich. Dann lachte sie leise. „Kommt uns doch bald einmal besuchen, so schreibt sie noch. So ganz ohne Sehnsucht geht es eben doch nicht, wenn man aus der Heimat weggeht.“
Auf Briefe von Bruno musste sie länger warten. Und sie wartete sehnsüchtig darauf. Australien war weit. Sie berichtete mir von ihm, dass er als Elektromeister in einer kleinen Firma arbeitete, und dass sich für ihn zu dem Besitzer, einem Handwerker, eine freundschaftliche Verbindung entwickelt habe.
„So hat der Junge wenigstens Familienanschluss“, stellte Mama erleichtert fest. „Bruno ist offensichtlich sehr fleißig“, betonte sie noch.
Sie musste es mir nicht sagen, ich spürte, wie sehr sie ein Wort von Heimweh oder Sehnsucht in seinen Briefen vermisste. Irgendwann bemerkte ich, dass in dem Kleiderschrank in meinem alten Jungmädchenzimmer die Sachen von Bruno hingen, die er hiergelassen hatte, als er vor drei Jahren nach Australien ausgewandert war. Das Zimmer war immer ordentlich aufgeräumt, als könne jeden Moment einer einziehen. Ich glaube, Mama hoffte insgeheim, er könnte eines Tages zurückkommen.
Wenn Papa abends von der Arbeit nach Hause kam, ihn keine Probleme um die Kinder empfingen, wenn er wirklich ungestört seine Zeitung genießen konnte, während Mama in der Küche das Essen zubereitete, dann seufzte er: „Diese Ruhe, weißt du, daran muss ich mich erst gewöhnen. Ein Tag geht wie der andere vorbei. Soll ich dir etwas verraten? Ich fange an, meine Rentenzeit herbeizusehnen.“
„Papa, du bist gerade sechzig geworden. Bis dahin hast du noch ein paar Jahre Zeit“, erinnerte ich ihn.
*
Traudel war noch nicht lange fort, da tobte ein böses Unwetter über Berlin. Es wurde fast so dunkel wie in der Nacht. Sturm jagte durch die Stadt, es goss in Strömen, die Straßen waren bald überschwemmt und der Verkehr brach zusammen. Grell blitzte es, es donnerte unaufhörlich und es krachte, wenn ein Blitz einschlug. Der Regen trommelte gegen die Fensterscheiben und der Sturm pfiff durch alle Ritzen. In kurzer Zeit verwandelte sich auch die Straße vor unserem Haus in einen reißenden Bach. Ich hatte es von der Arbeit gerade noch nach Hause geschafft. Ich fürchtete mich wie lange nicht mehr bei einem Gewitter und sehnte Konrad herbei. Ich machte mir Sorgen, wie sollte er bei diesem Wetter nach Hause kommen. Unruhig lief ich ständig ans Fenster.
Es war bereits spät am Abend, das Unwetter hatte nachgelassen, als ich glaubte zu träumen. Zischend, Fontänen zur Seite spritzend, bahnte sich ein mir wohlbekanntes kleines Auto seinen Weg durch Wasser und Schlamm bis vor unsere Haustür. Nein, ich irrte mich nicht, nach Konrad stieg Helmut Bruns aus, sein Freund aus Kriegstagen. Sie sprangen beide mit großen Schritten auf unser Haus zu.
Einen Moment lang verharrte ich wie gelähmt. Zwei Jahre war es her, dass wir uns zum letzten Mal gesehen hatten. Davor hatte Helmut nicht nur Konrad, sondern auch mir als Freund sehr nah gestanden. Als ich irgendwann bemerkte, dass er in mich verliebt war, hätte ich mich, von Konrad enttäuscht, beinahe mit meinen Gefühlen zu ihm hin verirrt. Nachdem ich das jedoch erkannt hatte und wir unsere fast gescheiterte Ehe noch retten konnten, gingen wir uns aus dem Weg.
Und jetzt kam Konrad mit ihm die Treppe hoch, als wäre es nie anders gewesen. Ich hatte nicht mehr viel Zeit zum Überlegen. Ich hörte wie Konrad die Tür aufschloss, hörte sein unbekümmertes Lachen und ging ihnen entgegen.
Nun also standen wir uns wieder gegenüber, Helmut und ich, nach zwei Jahren. Befangen lächelte ich ihn an. Auch er reichte mir mit einem zwar neugierigen, doch scheuen Lächeln die Hand. Abschätzend musterte er mich, während er sich mit einer hilflosen Bewegung durch seine widerborstigen Haare strich.
„Wie geht es dir?“, fragte er verhalten.
„Danke, gut.“
Konrad tat so, als bemerke er unsere Befangenheit nicht. „Zieh die nasse Jacke aus, Helmut! Und Lass uns erst mal einen Schnaps zum Aufwärmen trinken.“, sagte er und ging voran ins Wohnzimmer.
Ich nahm Helmut die Jacke ab. Dabei traf mich noch einmal ein fragender Blick aus seinen mir so vertrauten blauen Augen. Dann aber rieb er sich die Hände, wandte sich ab und folgte Konrad, als hätte er es gestern erst getan.
Ich hängte seine Jacke auf einen Bügel und sah ihm nach. Ich schaute auf seine breiten Schultern und dachte daran, wie gut es mir einmal getan hatte, mich an ihn lehnen zu können. Zugleich spürte ich aber auch, dass für mich von ihm nun keine Anziehungskraft mehr ausging.
Schon im Laufe des Abends legte sich die Verlegenheit zwischen uns. Konrad beobachtete uns nicht mehr misstrauisch wie früher. Vorsichtig fanden wir zu unserem alten freundschaftlichen Ton zurück, so, wie es war, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Und doch bemerkte ich bald, dass eine besondere Vertrautheit zwischen uns bestehen geblieben war. Das aber tat niemandem mehr weh.
„Den Helmut schickte mir der Himmel“, erzählte Konrad. „Ich stand zusammen mit anderen Fahrgästen im U-Bahnausgang und wusste nicht, wie ich weiterkommen sollte. Alles war überschwemmt. Keine Straßenbahn fuhr mehr. Da kam plötzlich Helmut mit seinem Auto zischend durch das Wasser angefahren und hielt neben mir. Er rief mir nur zu, ich solle schnell einsteigen. Dazu brauchte er mich nicht lange aufzufordern.“
„Hast du gesehen, wie die andern dich beneidet haben?“, ergänzte Helmut.
„Doch weit sind auch wir nicht mehr gekommen“, berichtete Konrad. „Die Wassermassen, die da vom Himmel kamen, wurden so bedrohlich und die Straße zu einem reißenden Fluss, dass wir es doch vorzogen, an einer Kneipe zu halten, wo wir die Eingangstür noch erreichen konnten, ohne dass uns Wasser in die Schuhe lief. Hier warteten wir ab, bis der herabstürzende Regen nachließ.“
Der Zufall also, dieses verheerende Wetter, hatte sie wieder zusammengeführt. Doch wie schafften sie es, sich jetzt so ungezwungen zu begegnen, als hätte es die verwirrende Zeit zwischen uns nie gegeben? Es musste ihnen wohl gelungen sein, sich dort in der Kneipe auszusprechen.
Ich war erleichtert, als ich spürte, dass nun eine echte Freundschaft ohne jedes Begehren zwischen Helmut und mir möglich wurde. Ich war auch glücklich darüber, dass an unserm Ehezwist, in den Helmut damals hineingezogen wurde, die Freundschaft der beiden nicht zerbrochen war.
*
Zwei Jahre war das her, als die Ehe von Konrad und mir fast an unserem Stolz, an dem Kampf, unsere Erwartungen gegenseitig durchzusetzen, gescheitert war. Da hatte sich Helmut große Hoffnungen darauf gemacht, dass ich für ihn frei werden könnte. An jenem Tag aber, als ich unglücklich zu Mama geflüchtet war und bei ihr saß, weil Konrad mich betrogen hatte, als ich begriff, wie viel mir Konrad trotz allem bedeutete, da musste Helmut erkennen, dass seine Hoffnung vergeblich war. Enttäuscht und traurig hatte er mich verlassen. Von da an war jeder Kontakt zwischen uns abgebrochen. Ich ging zu Konrad zurück. Danach suchten wir Helmut nicht und er uns auch nicht.
Konrad und ich hatten genug damit zu tun, wieder zueinander zu finden. All die Verletzungen, die wir uns zugefügt hatten, mussten wir überwinden und neues Vertrauen zwischen uns aufbauen.
Ich war bald wieder berufstätig, hatte eine Anstellung in einem Verlag gefunden. Die Arbeit gefiel mir, sie war nicht so eintönig wie in der Versicherung, in der ich früher gearbeitet hatte. Nur machte es mir Schwierigkeiten, wieder Haushalt und Beruf in Einklang zu bringen, nachdem ich schon längere Zeit arbeitslos gewesen war.
Konrad vertrat noch sehr die Meinung alter Generationen. Er kam nach Hause und tat das Wenige, was eben Männersache war, wie er meinte. Wobei er nicht einmal mehr wie früher Kohlen aus dem Keller hoch zu tragen brauchte, denn wir wohnten in einer zentralbeheizten Neubauwohnung am Rande der Stadt, dort, wo hinter Gärten und Einfamilienhäusern die Felder begannen. Von mir erwartete er, dass sonst alles unauffällig und reibungslos funktionierte. Ich tat mein Bestes. Und doch bockte ich manchmal gegen die einseitige übermäßige Arbeitsbelastung im Haushalt auf, die sich voll auf die Zeit nach einem Arbeitstag im Verlag konzentrierte. Aber ich tat es leise, denn ich war bemüht, keine Spannung in unsere neu wachsende Beziehung zu bringen. Das ging so, bis es Konrad auffiel, wie müde ich oft war. Da setzten wir uns zusammen und sprachen darüber.
Konrad verstand mich, nur bat er mich, nicht zu erwarten, dass er am Ende ein Verfechter der aufkommenden Emanzipation der Frauen werde. Er könne seine Einstellung zu alldem nicht so leicht ändern.
Und doch änderte er sich. Er griff zu, wenn er abends sah, dass ich mich plagte. Er scheute sich nicht, einkaufen zu gehen, wenn mir die Zeit dazu fehlte.
„Zuerst kam ich mir in den Geschäften zwischen den Frauen ziemlich komisch vor“, gestand er mir ein, „und die musterten mich auch so seltsam. Dabei wollen die Frauen heute doch, dass die Männer ihnen bei ihrem Kram helfen sollen, denke ich.“
Ich wollte das nicht weiter vertiefen, aber eigentlich hätte ich ihn gern gefragt, warum das von ihm gekaufte Brot - zum Beispiel -, das er doch auch aß, mein Kram sein sollte? Ich lachte nur und sagte: „Das kommt sicher daher, dass du mit deiner Aktentasche einkaufen gehst und da Butter und Wurst hineinpackst.“
„Na, wenn ich schon einkaufe, dann will ich nicht auch noch mit einem Einkaufsnetz die Straße entlanggehen“, meinte er. „Wie sieht denn das aus?!“
Über Helmut sprachen wir anfangs nicht mehr. Später, wenn es zufällig doch geschah, spürte ich Konrads Misstrauen, ob da nicht vielleicht mehr zwischen Helmut und mir gewesen war, als er wusste.
Doch mit der Zeit fiel es uns immer leichter darüber zu reden, wie das gewesen war mit Helmut und uns. Ja, es wurde mir zum Bedürfnis, damit auch mir zu erklären, wie wir uns so hatten entfremden können, dass Konrad mich schließlich betrog und ich mich zu Helmut hingezogen fühlte.
Erst allmählich hatte ich gespürt, wie Konrad begriff, dass ich selbst in jener Zeit eigentlich nur ihn geliebt hatte und es nur durch die Enttäuschungen über unser Zusammenleben möglich geworden war, dass Helmut eine gewisse Anziehungskraft auf mich ausüben konnte.
Irgendwann hatten wir dann ohne jede Scheu wieder über alles reden können. Dabei war mir auch klar geworden, wie sehr Konrad es bedauert hatte, dass seine langjährige Freundschaft mit ihm zu Ende sein sollte.
*
Und nun war Helmut wieder da. Ein Unwetter über Berlin hatte ihn zurückgebracht.
Am nächsten Tag waren die Straßen voller Schlamm. Ziegel von den Dächern lagen auf den Gehwegen. Ich bahnte mir den Weg zu meiner Arbeitsstelle. Alle Feuerwehreinheiten waren im Einsatz. Sie pumpten die Keller leer, beseitigten umgestürzte Bäume und räumten schwere Äste von den Fahrbahnen. So ein schweres Unwetter hatte die Stadt noch nicht erlebt, meinte ich.
Gleich früh am Morgen klingelte bei mir im Büro das Telefon. Traudel war es. Sie machte sich Sorgen, hatte von dem Unwetter erfahren und wollte wissen, ob bei uns und Mama alles in Ordnung sei.
„Na, Gott sei Dank!“ Sie war sichtlich erleichtert. „Ihr könntet euch bald mal ein Telefon zulegen“, fügte sie noch hinzu. „Es ist schlimm, dass ich dich nicht zu jeder Zeit anrufen kann. Am liebsten wäre mir, Papa und Mama hätten auch eins.“
„Dann sparst du das Briefschreiben“, neckte ich sie.
„Als ob es darauf ankommt.“
„Ich glaube nicht, dass Mama für ein Telefon zu begeistern ist“, vermutete ich.
„Warte nur ab, bis auch Bruno einmal anrufen kann, dann wirst du dich wundern, wie schnell sie ein Telefon hat“, behauptete Traudel.
Und so geschah es.
*
Die Tage waren kürzer geworden, die Schatten am Abend länger, wenn wir uns sonntagabends wieder auf den Heimweg aus unserem Schrebergarten machten. Noch kamen Papa und Mama nachmittags zu uns und wir konnten zusammen unter dem Kirschbaum Kaffee trinken. Mama hatte immer den neuesten Brief von Bruno oder Traudel dabei. Auch Helmut stellte sich mitunter bei uns ein.
Zuerst hatte Mama ihn reserviert begrüßt. Doch ihre Sorge war umsonst, mich verband nur Freundschaft mit ihm. Mama wollte natürlich wissen, was er jetzt mache, doch eigentlich interessierte sie viel mehr, ob er eine Freundin hatte.
Er lachte. „Natürlich habe ich eine Freundin“, versicherte er.
„Und warum bringen Sie ihre Freundin nicht einmal mit?“, fragte sie lauernd.
„Mama!“, mahnte ich.
Aber sie ließ sich nicht beirren. „Man wird doch mal fragen dürfen.“, beharrte sie.
„Natürlich!“, bestätigte Helmut und fügte hinzu: „Und sollte es mal eine feste Beziehung sein, so werde ich sie auch mitbringen.“ Dennoch spürte ich, es war ihm nicht recht, danach gefragt zu werden, und sein Lächeln gezwungen verbindlich.
„Aha“, sagte Mama kurz und sah prüfend zu mir.
Ich angelte aus meiner Kaffeetasse eines der Blätter, die jetzt, vom sanften Wind gelöst, vom Kirschbaum auf unseren Kaffeetisch fielen. So hätte Mama ihn nicht aushorchen müssen, fand ich.
Doch es dauerte nicht lange, bis auch Mama mit ihm wieder so vertraut wie früher umging, als sie über seine Späße herzhaft lachen konnte.
So häufig wie früher kam Helmut allerdings nicht mehr zu uns. Es gab eben diese Freundin, mit der er ausging. Bald jedoch erfuhren wir, diese Beziehung war schnell zu Ende gegangen. Danach hatte er eine andere. Doch auch das war nicht von Dauer.
„Du mit deinen wechselnden Bekanntschaften“, zog Konrad ihn auf.
„Ich genieße meine Freiheit“, behauptete Helmut.
Ich aber fragte mich im Stillen: War er noch nicht fähig zu einer neuen Liebe, weil er mich einmal geliebt hat?
*
Seit Traudel in Hannover weilte, war Mamas erster Weg, wenn sie sonntags mit Papa zu uns kam, zu den Eltern von Karl-Heinz gegenüber von unserem Garten. Die besaßen bereits ein Telefon in ihrer Stadtwohnung. „Ich muss mal hören, ob Erna etwas Neues von den Kindern weiß. Der letzte Brief von Traudel ist bereits zwei Wochen alt“, rief sie uns zu, ehe sie verschwand.
Und Erna, die Mutter von Karl-Heinz, wusste bestimmt wieder etwas von den „Kindern da in Hannover“, was Mama noch nicht bekannt war.
„Was die alles weiß! So ein Telefon wäre vielleicht doch ganz schön“, sagte sie einmal nachdenklich.
„Wieso?“ fragte Papa verwundert. „Traudel kann dir alles schreiben. Außerdem ist es viel zu teuer.“
„Hast ja recht“, stimmte sie ihm sofort zu.
*
Dann aber bekamen wir ein Telefon gelegt. Der Betrieb von Konrad war daran interessiert, dass er auch außerhalb der Arbeitszeit erreicht werden konnte. Sie boten ihm an, wenn er sich Telefon legen ließe, würden sie ihm einen Teil der Kosten erstatten.
Das fand mein sparsamer Konrad annehmbar. Und so bimmelte eines Tages bei uns zu Hause ein Telefon, wie jetzt bei immer mehr Leuten in der Stadt.
Jetzt fand man es wichtig, auch privat telefonisch erreichbar zu sein. Außerdem konnte man damit zeigen, wie gut es einem ging. Das Telefonbuch wurde von Jahr zu Jahr umfangreicher. Auch das war ein Zeichen dessen, was man begann als Wirtschaftswunder zu bezeichnen.
Ich rief sofort bei Traudel an.
Sie jubelte. „Dann kann ich jetzt sicher auch einmal mit Mama sprechen.“
Ich stutzte. Das klang, als würde sie Mama vermissen. „Hast du Kummer?“, fragte ich vorsichtig.
Da druckste sie herum. „Ich bin schwanger“, gestand sie schließlich fast schuldbewusst.
„Du bist was?“ Ich war fassungslos.
„Du hast richtig gehört.“
„Aber du bist doch erst seit ein paar Monaten verheiratet. Hast du vor Kurzem nicht noch gesagt, Kinder müssten nicht gleich kommen?“
„Na und? Ist eben passiert!“, antwortete sie leicht pikiert.
Das war ja eine Neuigkeit!
Mama war aus dem Häuschen. Sie kam sofort zu uns, als sie davon erfuhr, und rief Traudel an. Es wurde ein langes Gespräch. Ich sah schon unruhig auf die Uhr. Mama aber hatte so viele Ratschläge und Ermahnungen für sie, dass ich mir vorstellen konnte, wie ungeduldig Traudel dabei wurde. „Also, Liebes, arbeite jetzt nicht zu viel, denke daran, dass du nicht mehr nur Verantwortung für dich allein trägst“, waren noch Mamas letzte Worte.
Mich beschlich fast Eifersucht. Wie sagte sie doch damals mahnend, wenn Konrad mich zu sehr umsorgte, bevor ich das Kind verlor: „Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit!“
Doch nicht nur für die jetzt häufigen Anrufe und Gespräche mit Traudel war unser neues Telefon gut. Auch Bruno rief sofort zu Weihnachten an, als Mama und Papa bei uns waren. Sie hatte ihm unsere Telefonnummer brieflich mitgeteilt. Ich dachte zuerst, wir seien falsch verbunden, englische Sprache, die ich nicht verstand, dann Stille und endlich wie aus weiter Ferne Brunos Stimme. Ich holte Mama sofort ans Telefon. „Geht’s dir gut, mein Junge?“, fragte sie wieder und wieder, als hätte er es ihr nicht längst geschrieben. Dann lauschte sie und Tränen liefen über ihre Wangen. Papa musste ihr fast gewaltsam den Hörer aus der Hand nehmen, um auch ein Wort von Bruno zu hören. Seine Stimme zitterte verdächtig, als er fragte, ob es jetzt Sommer bei ihm in Australien sei. Dann lachte er und fuhr sich verstohlen über die Augen.
Als er danach den Hörer vorsichtig auflegte, sah Mama ihn gespannt an und sagte glücklich: „Das war Brunos Stimme!“ Sie sagte es so, als müsse sie es ihm erklären. „Heinrich, über das Telefon kann man wirklich mit ihm sprechen“, setzte sie noch hinzu.
Papa wusste, was das bedeutete. Und schon in den nächsten Tagen beantragten auch sie ein Telefon.
Mama und ihre Küken da draußen, außerhalb der Insel von West-Berlin!
2. Kapitel - 1956
Wie früher fuhr uns Helmut mit seinem Auto durch die Stadt, dabei in Gegenden, in die wir ohne Auto nie gekommen wären. So staunten wir jetzt, wie viel sich mit der Zeit verändert hatte. Überall wurde gebaut, so manche Ruine war verschwunden und hatte einem Neubau Platz gemacht. Leben war in den Straßen, die Geschäfte voller Waren. Unter den Menschen, die hier ihre Einkäufe tätigten, befanden sich viele aus Ost-Berlin oder der DDR. Zu einem hohen Kurs tauschten sie ihre Ost-Mark in D-Mark ein und besorgten sich dafür, was sie drüben nicht erhalten konnten. Wenn sie Glück hatten, so kamen sie damit auch gut nach Hause, ohne am Übergang von West-Berlin nach Ost-Berlin durch DDR-Beamte kontrolliert zu werden.
Wir fuhren auch an dem Flüchtlingslager Marienfelde vorbei. Hier ging es zu wie in einem Bienenhaus. Das Lager konnte die Flüchtlinge kaum noch fassen, die Tag für Tag aus Ost-Berlin und der DDR nach West-Berlin kamen. Allein 250 000 Menschen waren im letzten Jahr über die Grenze in den Westen gekommen. Und hier in Berlin konnte das noch ziemlich leicht mit der S-Bahn vom Ostteil der Stadt in den Westteil gelingen.
Für den Osten verlor der Westen nicht an Anziehungskraft. Die Verstaatlichung der Wirtschaft in der DDR ging weiter voran und der Flüchtlingsstrom aus Land und Stadt in den Westen riss nicht ab.
Doch bald interessierte sich Konrad für andere Dinge als Neubauten oder die sichtbaren Veränderungen der aufwärts strebenden Stadt, wenn Helmut mit uns durch die Straßen fuhr. Mit dem spürbar zunehmenden Verkehr war auch bei ihm der Wunsch nach einem Auto größer geworden. Plötzlich wollte er von Helmut wissen: „Wie viel PS hat dein Auto? Was verbraucht es Benzin? Welche Automarke hältst du für die Günstigste?“ Bald gab es nur noch ein Ziel. Wo wir mit Helmut auch entlangfuhren, stets hielten wir an jedem Platz, auf dem Gebrauchtwagen angeboten wurden.
Und davon gab es bald immer mehr im Stadtbild. Sobald ein Ruinengrundstück abgeräumt war, wurde dort eine kleine Bude aufgestellt und darum herum standen die ehemaligen blechernen Lieblinge von irgendwelchen vorherigen Besitzern, die sich nun wahrscheinlich ein größeres, besseres Auto leisten konnten. Der Gebrauchtwagenhandel begann zu florieren. Wir streunten durch die Reihen begehrter Gefährte, die täglich blank geputzt wurden, um Rost und kleine Beulen zu verbergen. Es machte auch mir Spaß und ich freute mich darüber, dass Konrad sich mit dem Gedanken trug, ein Auto zu kaufen. Helmut gab sich dabei ganz als der fachmännische Berater. Es war zum Lachen, wie sie eifrig debattierend durch die Reihen der Autos gingen und versuchten, dem Verkäufer, der sich beflissen sofort näherte, kluge Fragen zu stellen.
Jetzt waren die Männer wie Kinder, jeder wollte möglichst bald ein Auto haben. So mancher belastete die Haushaltskasse mit den Raten für die Kredite dazu über die Maßen. Da konnte es sein, dass so manche Frau genau genommen für ein Auto mitarbeitete.
Irgendwann in dieser Zeit begann es, dass auch viele Frauen eine Arbeit außer Haus, die bezahlt wurde, als wichtigen Teil ihres Lebens ansahen. Sie wollten ihre Berufe nicht umsonst erlernt haben. Eine „Nurhausfrau“, die nichts verdiente, was war das schon?! So hörte man es bald. Im Gegensatz dazu wurden berufstätige Frauen mit Kindern bald Rabenmütter genannt. In zwei fast unüberwindliche Lager zerfielen die Frauen mit ihren Lebenszielen.
Noch zögerte Konrad, wegen der Geldausgabe. „Ist ja doch eine ganz schöne Belastung“, überlegte er und schaute sehnsüchtig den vorbeifahrenden Autos nach.
Schließlich jedoch war der Wunsch bei ihm so groß, dass ich ihn zur Aufnahme eines Kredites überreden konnte. Für mich war es eine neue Erfahrung, dass er tatsächlich einmal auf mich hörte.
Wir gingen zu unserer Bank, bei der wir unser kleines Sparkonto hatten und stellten einen Kreditantrag. Wir waren richtig stolz, mit unserm Doppeleinkommen kreditwürdig zu sein.
„Die paar Zinsen Mehrkosten, auf die lange Zeit verteilt, das schaffen wir leicht, Konrad.“ Ich sah das zuversichtlich.
Auch vor unserem Haus würde nun bald ein eigenes Auto stehen.
Konrad musste zur Bestätigung seines Führerscheins, den er vom Krieg her hatte, noch einmal eine Prüfung abgelegen, dann konnten wir unser Auto, einen VW-Käfer, vom Händler abholen. Es war nicht das neueste Modell, aber preiswert, wie Helmut meinte. Was sollte es, wenn wir erst nach dem Kauf die kleine Beule am hinteren Kotflügel entdeckten, wenn die Motorklappe am Heck manchmal klemmte, wenn man bei höherer Geschwindigkeit – 100 km/h Höchstgeschwindigkeit, bergauf 80 km/h mit Rückenwind, bei 25 PS - innen erst gegen den Pfosten schlagen musste, damit der Winker heraussprang, den das Auto noch hatte. Es war unser erstes Auto. Und wir waren unsagbar glücklich damit.
Noch vor fast einem Jahr zu Traudels Hochzeit habe ich das nicht geglaubt, als uns Onkel Oskar prophezeite: „Sie werden auch bald ein Auto haben. Bald geht keiner mehr zu Fuß.“ Nun stand es also vor unserer Tür. Ich lief immer wieder ans Fenster, ich musste es sehen, ich war sicher ebenso stolz darauf wie Konrad.
Von nun an gehörte auch Konrad zu denen, die häufig am Kanal in der Nähe mit ihren Autos zu finden waren, Wasser aus dem Kanal schöpften und mit Ausdauer und Liebe ihre Kostbarkeiten auf vier Rädern schrubbten und putzten, bis sie nur so blitzten. Da wurde aber auch der geringste Kratzer nicht übersehen und möglichst gleich beseitigt. Das war schon seltsam, Männer, die es unter ihrer Würde fanden, zu Hause auch nur einen Waschlappen in die Hand zu nehmen, zogen mit Eimer, Bürste und Lappen los zum Putzen des Objekts ihrer Eitelkeit, außen und innen, aber gründlich! Noch hatte ja nicht jeder ein Auto oder sogar zwei oder drei wie heute. Da gab es noch jede Menge Parkplätze, keinen Kampf darum und keine Markstücke fressenden Parkuhren. Ein Auto zu besitzen, das war eben noch etwas!
Glücklich fuhren wir damit durch die Gegend. Ich kam in Ecken von Berlin, die ich nie gesehen hatte. Berlin wurde klein für uns, von Grenze zu Grenze. Noch hätten wir auch nach einer Kontrolle durch DDR-Volkspolizisten nach Ost-Berlin fahren können, aber dort zog uns nichts hin.
Auch mit dem Auto verreisen konnten wir jetzt. Wir packten in den ersten warmen Maitagen des Jahres unseren VW-Käfer voll und tauften ihn „Hannibal“, da er uns in die Berge bringen sollte.
„Was nimmst du nur alles mit“, moserte Konrad.
„Wieso? Du musst nichts mehr tragen, da spielt es doch jetzt keine Rolle mehr, wie viel ich einpacke“, erwiderte ich und schob noch ein zusätzliches Ersatzpaar Schuhe unter den Beifahrersitz.
War das schön, im eigenen Auto aus der Stadt hinauszufahren. An den Grenzkontrollstellen ging auch alles bereits geregelter zu, doch noch immer mit langen Wartezeiten, mit möglichen Schikanen und beklemmendem Gefühl. Die Kassen für die SED-Machthaber in Ost-Berlin klingelten zunehmend durch die Einnahmen der Straßenbenutzungsgebühren pro Auto in westlicher D-Mark. Es bewahrheitete sich wirklich - wie es Onkel Oskar vorhergesagt hatte – auf den Straßen fuhren mehr und mehr Autos. Was mochten wohl die Einwohner der DDR links und rechts der Autobahn empfunden haben, wenn sie die anwachsende Autolawine gen Westen vorbeirollen sahen?
Wenn irgend möglich, hielt Konrad auf der Transitstrecke durch die Zone (wie wir noch immer zum Gebiet der DDR sagten) auf keinem Parkplatz an. Wir atmeten erst auf, wenn wir den letzten Posten der DDR hinter uns hatten und uns die grünen Zöllner der Bundesrepublik begrüßten.
Unsere erste Reise mit dem Auto ging zu Onkel Anton, Papas Bruder, in die Alpen nach Immenstadt. Bei ihm hatten wir schon einmal einen Urlaub verbracht. Auch er hatte vor ein paar Jahren Berlin verlassen und sich aus dem Staub gemacht, weil er der Standhaftigkeit der Stadt dem Osten gegenüber misstraute. Jetzt war er Koch in einem erstklassigen Hotelrestaurant und hatte hier zugleich eine liebevolle Lebenspartnerin gefunden.
Mit großem Hallo begrüßte er uns. „Was denn“, rief er, als wir mit dem Auto vorfuhren, „ist das Wirtschaftswunder jetzt bis nach Berlin vorgedrungen?“ Und er lachte dabei. Dann wies er auf ein Auto, das vor seinem Haus stand. „Das ist meins“, sagte er voller stolz.
„Donnerwetter!“, bewunderte Konrad ihn gebührend. „Der ist natürlich ein bisschen größer als unser.“
Da lachte Onkel Anton, zwinkerte mit einem Auge, wies auf seinen vor Lachen zitternden umfangreichen Leib und sagte: „Bei euerm Auto brauchte ich wohl einen Schuhanzieher, um hineinzukommen.“ Mir schien, er musste wirklich noch zugenommen haben in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen hatten. Dafür war sein Kranz dunkler Haare schmaler geworden.
Vroni, seine Lebensgefährtin, liebte ihn so wie er war. Wir fühlten uns wieder wohl bei den beiden, liebevoll umsorgt von Vroni in ihrem Haus. Wir genossen es, jetzt nicht nur in der Nähe des Ortes herumwandern zu können, sondern auch weiter in die Berge hinein zu fahren. Manchmal klammerte ich mich ängstlich an meinen Haltegriff, wenn es steil bergan ging. Dann lachte Konrad mich aus. „Angsthase!“, schalt er mich. Doch bald hatte ich mich auch daran gewöhnt und vertraute seiner Fahrkunst.
Zuerst wussten wir nicht, warum uns mitunter ein entgegenkommender Autofahrer anhupte, bald aber erkannten wir, dass es West-Berliner waren, die sich auch auf Reisen befanden. Das war bereits zur Gewohnheit geworden. So weit ab von Berlin, fühlte man sich miteinander verbunden. Bald hupten und winkten auch wir eifrig mit. Selbst in einem Lokal wurden Wildfremde so begrüßt, als wäre Berlin ein Dorf und sie die besten Bekannten, nur weil sie zufällig auch aus West-Berlin waren.
Wir passten uns den Geflogenheiten an, kauften Kniehosen und Stiefel, wie wir es bei den andern Touristen sahen, die durch die Berge wanderten. Vor den Gattern auf den Almwiesen blieben wir nicht mehr hilflos stehen wie bei unserer ersten Reise. Auch an den Kühen dahinter gingen wir jetzt fast furchtlos vorüber.
Als wir nach vierzehn Tagen bei Onkel Anton wieder abfuhren, waren wir zu erprobten Alpenfahrern geworden. Drei Filme hatten wir verknipst, damit man uns auch glauben sollte, wo wir überall gewesen waren: an Wasserfällen, vor steilen Felswänden, auf serpentinenreichen Pässen. Sogar mit einer Kuh habe ich mich ohne Furcht fotografieren lassen.
Eigentlich wollten wir noch einen Abstecher zu Traudel nach Hannover machen. Doch der Umweg war uns zu weit und Urlaubstage hätte es auch gekostet. „Einmal, zu verlängerten Feiertagen kommen wir bestimmt“, hatte ich Traudel vertröstet auf einer Ansichtskarte aus den Bergen.
Traudel stand kurz vor ihrer Niederkunft. Mama war bereits ganz außer sich, dass sie nicht bei ihr sein konnte. Doch Papa meinte, das würde sie sicher allein schaffen, sie solle lieber hinterher hinfahren, wenn sich Traudel daran gewöhnen musste, ein Kind zu haben.
*
Und dann kam endlich die heiß ersehnte Nachricht, Traudel hatte ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Sie hatte es nicht leicht dabei gehabt.
„Das mache ich nicht noch einmal mit“, sagte sie mir am Telefon. „Karl-Heinz soll sich nicht einbilden, dass wir uns noch ein Kind anschaffen.“
„Das sagt man so“, lachte Mama. „Sie soll froh sein, dass es ein gesundes Mädchen ist.“
Sie nannten es Susanne, und wenn ich es richtig mitbekam, war Karl-Heinz ganz vernarrt in seine kleine Tochter.
„Der meint glatt, es besser zu wissen als ich, wann ich sie stillen muss“, empörte sich Traudel.
Bald aber begann sie auch darüber zu klagen, dass es ein Problem sei, wieder im Betrieb mitzumachen. „Da denkst du schon am Morgen, den Berg Arbeit kannst du gar nicht schaffen“, stöhnte sie.
So stand sie nun da mit dem Kind, dem Haushalt und dem Betrieb, in den es sie zog. Wir waren in Berlin und sie allein in Hannover. Nur der Onkel von Karl-Heinz, dem der Betrieb gehörte, war der einzige Verwandte, den sie dort hatte. Die Frau Jäger im Büro neben der Werkstatt, die seit Jahren für den Onkel arbeitete, war nie verheiratet gewesen, hatte keine eigenen Kinder, wusste nicht damit umzugehen.
„So schwierig habe ich es mir nicht vorgestellt“, teilte mir Traudel mit. Und sie war gerade erst zwanzig Jahre alt. „War ja Pech, dass Susi so früh bei uns kommen musste“, fügte sie hinzu.
„Das hört sich an, als würdest du deine Tochter nicht mögen, als wäre sie nur eine Last.“
„Bist du verrückt!“, wehrte sie sofort ab.
Mama wurde unruhig. Papa spürte es und lachte. „Sie geht mir hier ein, meine Familienglucke“, meinte er. Und er redete ihr zu, zu Traudel nach Hannover zu fahren. Noch nie habe ich Mama so strahlend gesehen wie an dem Tag, als sie begann ihren kleinen Koffer zu packen.
„Ich bleibe aber nur ein paar Tage“, versicherte sie Papa, denn sie sorgte sich um ihn. Wie sollte er ohne sie zurechtkommen, er, aus der alten Generation, der sich vielleicht einmal Bratkartoffeln machen konnte, aber ob ihm schon ein Spiegelei gelingen würde? Mama bezweifelte das. Sie fuhr mit großen neugierigen Augen los, als wir sie mit unserem Auto zum Interzonenzug zum Bahnhof-Zoo brachten.
*
Papa kam in den Tagen, da Mama bei Traudel war, nach der Arbeit zu uns. Ich kochte Essen für uns drei. Er lobte meine Küche. „Bei dir schmeckt die Kartoffelsuppe anders als bei Mama“, meinte er.
„Besser?“, fragte ihn Konrad scherzhaft.
Da lachte er etwas hilflos: „Wenn ich jetzt ja sage, und du erzählst es Mama, dann gibt es Ärger mit ihr“, antwortete er und zwinkerte mir zu. „Mama scheint es ja gut in Hannover zu gefallen. Hoffentlich hat sie überhaupt noch Lust wiederzukommen“, erzählte er dann, sah mich verschmitzt mit seinen grauen Augen an und griff mit seinen schlanken knochigen Händen nach den Spielkarten.
Doch so war es nicht. Mama versäumte nie, mich zu fragen, ob Papa richtig esse, ob er genug Brot zu Hause hätte und ich immer für ein sauberes Oberhemd für ihn sorgte. Halb war sie hier, halb war sie dort. Da konnte ich ihr zehnmal sagen, dass Papa vergnügt mit uns zusammen Karten spielte. „Na, wer weiß!“, antwortete sie stets am Ende.
Papa lachte über ihre Sorgen. Doch es gefiel ihm auch, dass sie sich um ihn Gedanken machte.
Hausarbeit, die ich abends nach der Arbeit im Verlag dringend machen müsste, blieb in diesen Tagen liegen. Stattdessen spielte ich zusammen mit Papa und Konrad Karten. Ich genoss es, ihn für mich zu haben. Und auch er fühlte sich sichtlich wohl bei uns. Selten habe ich ihn so viel lachen sehen, wie in dieser Zeit. Selten wirkte sein von Furchen durchzogenes Gesicht unter den dünnen grauen Haaren so entspannt, als in dem Moment, wenn er glaubte, eine unschlagbares Blatt zugeteilt bekommen zu haben. Dann lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück, sah uns herausfordernd an und begann voller Genuss um den Skat zu reizen. Skat spielen, das konnte ich. Dafür hatten Helmut und Konrad früher an langen Winterabenden gesorgt, wenn ihnen dazu ein dritter Mann gefehlt hatte.
Abends wollte Konrad dann Papa mit dem Auto nach Hause bringen, aber Papa lehnte es ab. „Ich bin noch gut zu Fuß“, meinte er. „Ich störe ohnehin euren Feierabend bereits genug.“
Dabei fühlte ich mich ihm in diesen wenigen Tagen so nah und verbunden, wie bisher in meinem ganzen Leben nicht. Schließlich war ja ein Junge, mein Bruder Bruno, früher immer wichtiger gewesen, der hatte mehr Aufmerksamkeit zu beanspruchen als nur wir Mädchen. - Warum das so war, werde ich nie verstehen.
Doch bald kam Mama glücklich und zufrieden zurück. Sie hatte gesehen, wie ihre Jüngste dort lebte. Und ihr Enkelkind erst! - Ein so schönes Kind hat noch keine Frau auf die Welt gebracht. „Der werden mal die Männer reihenweise hinterherlaufen“, scherzte sie und kicherte fröhlich.
Nur entsetzt war sie darüber, dass Traudel das Kind einfach mit ins Büro nahm, um dort arbeiten zu können.
„Reicht dir die Aufgabe nicht?“, hatte sie Traudel vorwurfsvoll gefragt. „Mutter zu sein, ist doch eine Aufgabe, der man sich ganz widmen muss.“
„Vielleicht noch in deiner Generation. Hast du schon einmal etwas von Emanzipation gehört? Was Karl-Heinz kann, das kann ich auch“, hatte Traudel ihr in altem Trotz erwidert. In Gedanken sah ich, wie sie ihre rote Haarfülle mit einem Ruck in den Nacken warf, als mir Mama von diesem Gespräch entrüstet erzählte.
Mama häkelte und strickte jetzt viele kleine Babysachen. Auch ich hatte inzwischen all die kleinen Jäckchen und Strampelhöschen hervorgeholt, die einmal für mein Baby bestimmt gewesen waren, packte sie ein und schickte sie Traudel. Da waren Jäckchen und Mützchen dabei, die Traudel damals selbst angefertigt hatte. Ich hatte mein Baby verloren, kurz bevor ich es zur Welt bringen konnte. Nun würde alles Traudels Kind tragen. Ein bisschen weh tat es mir doch, als ich das Paket fertig machte, obgleich ich mich inzwischen ganz gut daran gewöhnt hatte, dass wir nach der Totgeburt nie Kinder haben werden.
*
Wenn ich mit Traudel sprach, so hatte ich den Eindruck, dass sie Mama immer ähnlicher wurde. Sie war auch klein an Gestalt, und alles was sie jetzt sagte, klang so energisch wie bei Mama. Nur die roten Haare schienen sie noch wirklich zu unterscheiden, von denen niemand wusste, woher sie die hatte. Mamas Haare waren dunkel, später mit weißen Fäden durchzogen, und Papa war dunkelblond, ehe er ergraute.
„Bei Karl-Heinz scheint Traudel fast alles erreichen zu können, was sie will“, berichtete Mama. „Manchmal fragt man sich, wer bei den beiden eigentlich wen erzieht in ihrer Ehe?“ Und sie erinnerte daran, wie Karl-Heinz behauptet hatte, er nehme sich extra eine so junge Frau, damit er sie sich in der Ehe erziehen könne, wie er sie haben wolle.
Zu Traudel sagte ich danach am Telefon: „Du scheinst Glück mit Karl-Heinz zu haben. Mama meint, er würde dir meistens nachgeben.“
Doch Traudel lachte und wehrte ab: „Da täuscht sie sich! Du kannst alles machen, solange es für ihn nicht wichtig oder bequem ist. Aber wenn er einmal etwas will, dann bist du machtlos. Und er setzt es auch noch so durch, dass du gar nicht dazu kommst, mit ihm darum zu streiten.“
Ich konnte es kaum glauben. Traudel, diese Katze, die es verstand, eben noch einen Buckel zu machen, und im nächsten Augenblick jemand schnurrend zu umarmen, hatte es doch stets geschafft, ihren Willen durchzusetzen. Und ausgerechnet bei dem ruhigen und geduldigen Karl-Heinz sollte dieser Trick versagen, wenn er sich weigerte, ihr nachzugeben?
Mama machte sich Sorgen. Es gefiel ihr überhaupt nicht, dass der Onkel Oskar - wie sie es sah - die Arbeitswilligkeit von Traudel ausnützte, sie zu immer mehr und immer verantwortungsvolleren Arbeiten im Büro heranzog. Eigentlich sollte das besser Karl-Heinz als zukünftiger Chef erledigen, meinte sie. Auch die gut eingearbeitete Frau Jäger schob jetzt offensichtlich so manche ihr unliebsame Arbeit Traudel zu.
„Das Mädel ist aber auch wie besessen darauf!“, moserte Mama. „Karl-Heinz scheint darüber froh zu sein. Ihm scheint seine Arbeit in der Werkstatt völlig zu genügen. So habe ich mir wirklich nicht einen zukünftigen Chef vorgestellt. Wenn das so weitergeht, dann sehe ich eines Tages die Zügel in Traudels Hände übergehen.“
Und was sie davon hielt, das brauchte sie nicht mehr zu erklären.
3. Kapitel - 1957
Ein Jahr verging. Traudel schickte fleißig Bilder von der kleinen Susi: Susi in der Badewanne, Susi auf Traudels Schoß, Susi auf dem Arm von Karl-Heinz und dann als Clou noch, wie Onkel Oskar den Kinderwagen schob und wie Susi darin bereits saß und lachte. In Mamas Glasschrank war ein ganzes Fach mit Bildern von Klein-Susi vollgestellt.
„