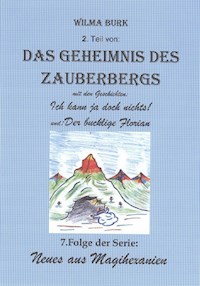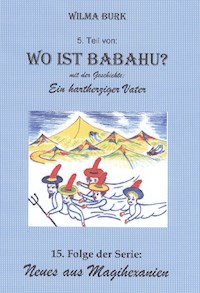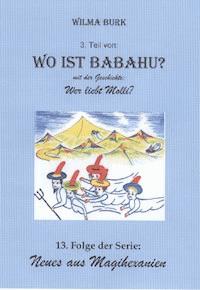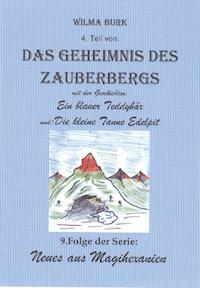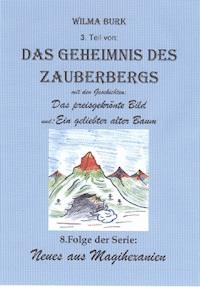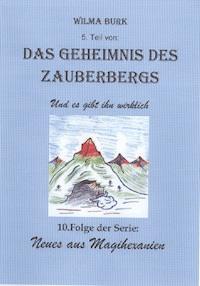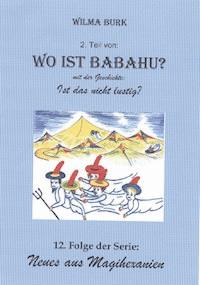Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ich-Erzählerin aus dem ersten Buch "Tauziehen am Myrtenkranz" und dem zweiten Buch "Kinder erzieht man nicht so nebenbei" erzählt hier aus dem Leben ihrer Nichte von 1990 bis 1996. Schweren Herzens gibt sie, eine Geschäftsfrau, ihre gut gehenden Geschäfte auf, weil er, ein Arzt, in einer anderen Stadt eine bessere Stelle annehmen will. Doch sie trägt es ihm nach. Im neuen Ort eröffnet sie ein neues Geschäft. Als er nach wenigen Jahren wieder in eine neue Stelle wechseln will, weigert sie sich, ihr Geschäft deshalb erneut aufzugeben. Die Kinder leiden unter der gespannten Stimmung. Sie einigen sich schließlich auf eine vorläufige Wochenend-Ehe. Kann die aber Bestand haben? Wie reagieren die Kinder darauf? Daneben berichtet die Erzählerin auch über ihr Leben dabei und über das Schicksal von Freunden aus vorhergehender Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilma Burk
Wo du hingehst, will ich nicht hin!
3. u. letztes Buch von: Heute ist alles anders als gestern - besser?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Impressum neobooks
Kapitel 1
Das Telefon schrillte. Ich fuhr hoch aus tiefem Schlaf. Automatisch schob ich meine Hand hinüber, wollte in ein Bett neben mir greifen und sagen: ,,Konrad, hörst du, Telefon! Geh doch mal ran!“ Da gab es aber kein Bett mehr. Konrad, mein Mann, war längst, nach fast neununddreißig Jahren Ehe, gestorben. Doch Julchen, mein kleiner Hund, mit seinem seidigem weißbraunen Fell und einer kurzen Nase, stand an meinem Bett und sah mich erschrocken fragend aus ihren großen schwarzen Augen an.
Ich rieb mir die Augen und richtete mühsam meine alten Glieder auf. Wo war nur das Telefon? Ungeduldig begann ich, auf dem Tisch neben meinem Bett danach zu suchen. Da lagen Notizen, Hefte, Akten, alles gehörte zu dem Roman, an dem ich gerade arbeitete. Griffbereit hatte ich hier alles liegen, brauchte in schlaflosen Nächten nur danach zu greifen.
Und das Telefon schrillte und schrillte. Wer wollte mich zu so früher Stunde am Morgen sprechen? Wo war nur das verdammte schnurlose Telefon? Endlich hatte ich es gefunden und meldete mich: „Katrina Haideck.“
„Entschuldige, dass ich so früh anrufe. Ich muss das einfach loswerden“, antwortete eine aufgeregte Stimme. Es war Traudel, meine acht Jahre jüngere Schwester, die am Rande von Hannover lebte und dort mit ihrem Mann ein Autohaus und eine Kfz-Werkstatt betrieb.
„Traudel, was ist passiert?“, fragte ich besorgt.
Sie holte tief Luft. „Susanne hat mich eben aus Berlin angerufen ...“
„Ist was mit den Kindern?“
„Nein, nein! Aber stell dir vor, Robert ist in dem neuen Krankenhaus, ganz bei dir in der Nähe, eine Stellung als Oberarzt angeboten worden“, teilte sie mir mit. Es klang empört.
„Hier bei mir?“ Meine Gedanken jagten sich. Was bedeutete das? Susanne, Traudels Tochter, besaß zwei gut gehende Modeboutiquen in Berlin. Endlich schien nach hektischen Jahren bei ihr, Robert und den drei Kindern alles ein wenig ruhiger und geordneter zuzugehen. Und nun?
„Ja, bei dir. Die ganze Nacht lang haben die beiden darüber diskutiert. Robert verlangt von Susanne, dass sie ihre Geschäfte aufgibt und zusammen mit ihm und den Kindern zu dir in den Harz zieht. Was sagst du dazu?“
Ich schwieg betroffen.
„Hast du verstanden, was ich gesagt habe?“, forderte Traudel ungeduldig.
„Ja, sicher! Das ist … also ich würde mich natürlich freuen, wenn Susanne wieder bei mir in der Nähe wohnte wie früher in Berlin, aber ...“
„Dann findest du es wohl richtig, wenn Susanne ihre Geschäfte aufgibt?“, fiel mir Traudel entrüstet ins Wort.
„Das habe ich damit nicht gemeint. Ich weiß sehr wohl, dass dies keine leichte Entscheidung für sie sein wird. Oder hat sie sich bereits entschieden?“
„Nein, bis jetzt noch nicht. Das wäre wohl zu viel verlangt.“
„Für Robert wird es aber auch nicht leicht, falls sie von ihm verlangt, auf dieses Angebot zu verzichten. Klingt es nicht wie eine Auszeichnung, dass man gerade ihn dort als Oberarzt haben will?“
„Mag ja sein. Doch wie viel Mühe und Arbeit es Susanne gekostet hat, aus einem kleinen dunklen Laden, einer heruntergekommenen Boutique - die wir damals für sie gekauft hatten - zwei große, gut gehende Geschäfte aufzubauen, daran denkst du wohl nicht? Auch Robert scheint sich darüber keine Gedanken zu machen, wenn er von Susanne verlangt, sie solle alles aufgeben. Warum nur glauben Männer immer noch, Arbeit und Beruf seien bei ihnen wichtiger als bei einer Frau? Wieso meint Robert, diesen beruflichen Aufstieg könne er sich nicht entgehen lassen und die Familie müsse mit ihm ziehen?“, ereiferte sich Traudel.
„Und Susanne, welche Meinung vertritt sie?“, fragte ich vorsichtig.
„Na, welche wohl? Sie wehrt sich dagegen, möchte, dass er wartet, bis sich ihm eine ähnliche Stellung in Berlin bietet. Sie meint auch, er sollte mal darüber nachdenken, dass ihm eben der damals noch spärliche Verdienst aus der ersten Boutique die letzte Studienzeit ermöglicht hatte. Das aber wollte er wohl nicht hören. Männer! Sie denken noch immer zuerst an sich“
Ich wusste, sie stand auf Susannes Seite. Doch konnte man das wirklich so einfach sehen? Prallten hier nicht bei ihnen ihre gegensätzlichen Interessen aufeinander? „Da haben beide ein schweres Problem zu lösen“, fand ich und seufzte.
„Ach, was! Mit ein bisschen Vernunft sollte das nicht schwer sein!“, erwiderte Traudel.
„Doch nur, wenn man es wie du von einer Seite aus sieht. Ich bin gespannt, wie sie sich entscheiden werden.“
„Ich auch! Das kannst du glauben. Tschüß denn!“, verabschiedete sich Traudel.
Ich legte das Telefon aus der Hand und fiel zurück ins Kissen. Sofort sprang Julchen zu mir aufs Bett. Während sie sich nun wohlig unter meiner streichelnden Hand streckte, hing ich meinen Gedanken nach. Eigentlich wäre es schön, Susanne mit ihrer Familie wieder in meiner Nähe zu haben. Sie war mir fast zu einer Tochter geworden in der Zeit, als sie in West-Berlin studiert und vorübergehend bei uns gewohnt hat. Das änderte sich auch nicht, als sie sich später mit ihrer ersten Liebe eine „Studentenbude“ nahm. Doch auch als diese Liebe zerbrach, sie sich danach in Robert, einen Medizinstudenten, verliebte und schwanger wurde, kam sie weiter mit ihren Sorgen zu mir. Zuerst quälten sie Zweifel, ob sie das Kind austragen sollte, aber dann redete ihr Robert zu, und sie entschieden sich dafür. Da gab sie ihr Studium auf und begann diese noch kleine heruntergekommene Boutique aufzubauen. Und jetzt sollte sie alles, was sie bisher erreicht hatte, aufgeben? Unrecht hatte Traudel damit nicht, dass es ungerecht sei, wenn ein Mann darauf besteht, sein Fortkommen im Beruf wäre wichtiger als das der Frau.
Wie hätte sich wohl Konrad, mein verstorbener Mann, an Roberts Stelle verhalten? Da brauchte ich nicht lange zu überlegen. Er hätte so eine Frage erst gar nicht aufkommen lassen. Für ihn wäre es selbstverständlich gewesen, dass ich dahin mitgegangen wäre, wo er hinging. Wie sagte Mama immer aus dem Verständnis früherer Zeiten heraus: „Wo der Mann hingeht, da soll die Frau auch hingehen.“ Wie oft hatte ich in unserer jungen Ehe gegen ihre Meinung und auch gegen Konrad aufgebockt.
Drei Jahre waren bereits seit 1987 vergangen, seit dem Jahr, in dem er starb. Doch die Sehnsucht stirbt nicht. Morgens, wenn ich erwachte, brach sie über mich herein. Wie oft musste ich mich tieftraurig erst langsam in den Tag hineintasten. An so einem Morgen sehnte ich mich gleich nach dem Abend. Tränen, die ich längst glaubte, genug geweint zu haben, drängten dann in meine Augen. Wenn Julchen es spürte, sprang sie zu mir ins Bett und scharrte mit ihren Pfoten so lange, bis sie mein Ohr erreichen konnte, um vorsichtig daran zu knabbern. Das war ihre Hundeart, mich zu trösten, wenn ich weinte. Wie gut tat es, in ihr warmes Fell zu greifen. Sie war jetzt mein kleiner Lebenskamerad.
Wie oft dachte ich, irgendwo da draußen vor dem Fenster, vor meiner Tür, vor meinem Haus pulsiert das Leben weiter. Doch fühlte ich mich auch, als hätte es mich vergessen, so sah ich noch gern mit den Augen einer alternden Frau dem Leben zu. Ich war interessiert an allem, machte mir Gedanken darüber und versuchte, selbst das zu verstehen, was ich eigentlich nicht begreifen konnte.
*
In Berlin - später West-Berlin - war ich in der Geborgenheit meines Elternhauses aufgewachsen. Behütet und von schweren Schicksalsschlägen verschont überstanden wir den Krieg. Drei Jahre danach heiratete ich Konrad. Als dann mein Bruder Bruno nach Australien auswanderte, meine Schwester Traudel mit ihrem Mann Karl-Heinz, die Kfz-Werkstatt eines Onkels von ihm in Hannover übernahm und sogar Mama, nach dem Tod unseres Vaters, zu ihnen zog, um ihre Kinder großzuziehen, da dachten Konrad und ich nicht daran, West-Berlin zu verlassen. Wir sind in all den Jahren nicht aus der Stadt fortgegangen, trotz aller Spannungen und Schwierigkeiten, die durch den Konflikt zwischen Ost und West gerade hier spürbar gewesen waren und mir stets erneut Angst gemacht hatten. Erst als Konrad wegen einer Erkrankung vorzeitig in Rente gehen musste, entschlossen wir uns zu diesem Schritt. Viele Westberliner handelten damals so. Sobald sie in Rente oder Pension gingen, verließen sie West-Berlin.
Leben war immer in der Stadt gewesen und die ersten schweren Jahre der Nachkriegszeit waren bald vergessen. Doch die von der DDR errichtete Berliner Mauer blieb allgegenwärtig. War sie für die Westberliner später mit Passierscheinen auch durchlässig, konnten sie auch jederzeit in die Bundesrepublik fahren, so begann jede Fahrt aus der Stadt hinaus mit langen Wartezeiten an den Grenzkontrollstellen der DDR und der stets als bedrückend empfundenen Abfertigung. Dabei wurde man nie das Gefühl los, auf eine gewisse Weise vogelfrei zu sein, so sehr der Westen sich auch bemühte, durch Abkommen mit der DDR den Transitverkehr für die Reisenden zu regeln. Danach folgte die lange deprimierende Fahrt über die Transitstrecke durch die Landschaft der ehemaligen Ostzone, in der sich die Menschen zu verstecken schienen. Nur wenn man mal einen Trabi auf der Autobahn überholte, sah man darin Gesichter, die uns neugierig musterten. Das war nicht viel anders, wenn man mit der Bahn fuhr, die auch nur über vorgeschriebene Strecken die Bundesrepublik erreichen konnte. Nur mit dem Flugzeug, über Luftkorridore, die unter den Siegermächten des Krieges vereinbart wurden, konnte man sich dies ersparen. So kam es, dass immer mehr Menschen, die ihr Arbeitsleben hinter sich hatten und nun reisen wollten, Berlin verließen.
Dabei hatte sich bereits vorher so mancher ein Feriendomizil im Westen besorgt. In kleinen Orten, von Berlin aus gut erreichbar, wuchsen regelrechte Berliner Siedlungen heran. So auch hier im Harz, in dem gemütlichen Ort Neuwied, in den wir gezogen waren. Zu dieser Zeit hatten wir nicht geglaubt, dass die Mauer jemals fallen könnte. Und doch war es im vergangenen Jahr geschehen, im November 1989. Noch waren die Grenzen danach nicht frei, aber leicht zu passieren; noch gab es eine DDR-Regierung, aber das alte System des SED-Staates war zusammengebrochen. Beide über vierzig Jahre getrennten Teile Deutschlands strebten wieder zusammen. Der gesamte Ostblock bröckelte. Stimmen in der Welt, die ein großes, einiges Deutschland gefürchtet hatten, wurden leiser. Schade, dass Konrad das alles nicht mehr miterleben konnte.
So war ich nun allein in dem Haus mit dem schönen Garten, wo mich noch jeder Winkel an Konrad erinnerte. Hier in der guten Luft hatten wir gehofft, es würde ihm besser gehen, hier hatten wir zusammen alt werden wollen. Es war uns nicht vergönnt.
In einer langen Ehe hatten wir zu einer tiefen Verbundenheit gefunden. Was uns jedoch nicht von Anfang an geglückt war. Erst nach Jahren mit Enttäuschungen, mit gegenseitigen Verletzungen, ja, erst nachdem wir fast daran gescheitert wären, war uns dies gelungen. Erst dann, als wir es gelernt hatten, auf den andern einzugehen, uns umeinander zu bemühen, wuchsen wir in einer lebenslangen Liebe zusammen.
Heute kommt es mir manchmal so vor, als würde niemand mehr an eine lebenslange Liebe glauben. Und doch scheint sich jeder danach zu sehnen, nach einem Menschen, der zu ihm gehört. Nur die Geduld miteinander ist wohl verloren gegangen. Wer will sich dem andern noch anpassen? Frauen, die früher dazu gezwungen waren, weil sie in Abhängigkeit von ihrem Mann lebten, wollen sich davon befreien. Sie wollen unabhängig sein, streben danach, eigenes Geld zu verdienen, ein Berufsleben zu führen wie ein Mann. Ob das aber der richtige Weg ist, den die Emanzipation geht, seit sich die Frauen voriger Generationen gegen das Schattendasein hinter den Männern auflehnten? Ich weiß, junge Frauen wollen meine Zweifel nicht hören, weder meine geschäftstüchtige jüngere Schwester Traudel, noch deren Tochter Susanne oder irgendjemand sonst. Hatte ich selbst mich früher nicht dagegen aufgelehnt, wenn Mama den Mann in den Mittelpunkt stellen wollte? Sie hatte, aus ihrer Erziehung heraus, dem Mann, als Ernährer der Familie, stets das letzte Wort überlassen. Nur wusste sie sehr wohl dabei, wie sie mit Diplomatie oder List ihre Interessen durchsetzen konnte, ohne dass er es merkte. Doch welche Frau will das heute noch? Sie fordern: „Mit dem gleichen Recht!“, wie sie es nennen. Welche Zugeständnisse haben sie damit den Männern eigentlich abgeluchst? Manchmal möchte ich die jungen selbstbewussten Frauen von heute fragen: „Seht doch einmal genau hin, wo steht denn der Mann heute? Was habt ihr gewonnen? Wo hat er nachgegeben? Überlässt er euch nicht dieses und jenes nur, wenn es für ihn Nutzen bringt oder bequem ist?“
*
Julchen wurde unruhig. Ich musste aufstehen. Mühsam bewegte ich meine über sechzig Jahre alten schon schmerzenden Knochen. Wirklich wie eine Alte, dachte ich. Man spricht zwar heute vorsichtig von den Übersechzigjährigen - eine höfliche Floskel, die das Wort „alt“ vermeidet, es aber dennoch meint -. Doch wie man es auch nennt, dein Körper und der Spiegel zeigen dir schonungslos dein Alter. Innerlich bist du so, wie du immer warst, und du empfindest so, wie du immer empfunden hast, als wärest du von Jugend an nicht einen Tag älter geworden. Nur hier und da hinterließ das Leben seine Spuren.
Den Spiegel an meinem Bett sollte ich zuhängen. Mich jeden Morgen darin zu sehen, war kein Vergnügen mehr. Der Rücken wurde mir immer runder, der Bauch drängte sich vor und der Busen ruhte sich darauf aus. Bestimmt habe ich wieder zugenommen. Auf die Waage stellte ich mich besser nicht. Gut, dass ich nicht mehr jung war, in dieser Zeit, wo nur Jugend und Schlanksein etwas zu gelten schien. Meine Haare waren noch so blond wie früher - na ja, mit ein bisschen Nachhilfe. Doch die wenigen grauen Strähnen darin fielen nicht auf. Das Schönste an mir schienen die falschen weißen Zähne zu sein. Wenn ich endlich angezogen mit Blusen oder Pullis, die alles verdeckten, mich noch einmal im Spiegel betrachtete, dann leuchteten mir diese Zähne perlweiß entgegen, falls ich es schaffte, mich anzulächeln.
Helmut, mit Siebenundsechzig fünf Jahre älter als ich, ein langjähriger Freund aus der Zeit mit Konrad, lachte jedes Mal darüber, wenn ich an mir herumkritisierte. „Was bedeuten alle Spuren des Alterns? Schau dich um, Kati, wie jugendlich du noch gegen all die andern wirkst. Du hast wirklich keinen Grund zu klagen.“ Und Margot, seine fünfzehn Jahre jüngere Frau, stimmte ihm zu.
Misstrauisch sah ich dann die beiden an. Welch ein Lob, jugendlich und nicht alt zu wirken. Wieso ist eigentlich alles, was jung ist, gut und alles, was alt ist, schlecht? Gehörte zu alt früher nicht auch weise und erfahren und zu jung unerfahren zu sein? Was zählt heute eigentlich noch?
Traudel, meine jüngere Schwester, die noch in den fünfziger Jahren war, kannte diese Gedanken darüber nicht. Zwar war auch sie nicht mehr so gertenschlank wie ein junges Mädchen und hatte hier und da ein ungeliebtes Polster, aber allein in ihrer selbstbewussten Haltung machte sie eine stattliche Figur. Ihre grünblauen Augen nahmen stets flink mit leichter Ungeduld alles in ihrer Umgebung wahr. Mit ihrem dezenten Make-up und den eingeschlagenen roten Haaren, die Strenge nur mit einer in die Stirn gekämmten lockigen Strähne vermindernd, war sie ganz die sich ihrer Wichtigkeit bewusste Geschäftsfrau.
Wie geduldig wirkte daneben ihr Mann, mein Schwager Karl-Heinz, wenn er mit seinem Meisterkittel, der schon ein wenig über dem Bauch spannte, aus seiner Autowerkstatt trat. Wenn Traudel dann auf ihn energisch einredete, fuhr er sich vielleicht über seine dünnen leichtlockigen Haare, durch die schon auf dem Hinterkopf die Kopfhaut schimmerte, antwortete ihr geduldig und umfasste sie stolz mit seinem Blick.
Ich fragte mich früher oft, ob sie sich jemals so zanken konnten wie Konrad und ich am Anfang unserer Ehe. Solange Mama bei ihnen war und ihnen ihre drei Kinder großzog, hat sie nie etwas davon erzählt.
„Mit Karl-Heinz kann man sich ja nicht streiten“, hatte Traudel nach dem Tod von Mama gesagt und darüber geklagt, dazu nun niemanden mehr zu haben. Und das stimmte wohl, war doch Karl-Heinz stets bemüht zu vermitteln. Auch zwischen Traudel und Mama hatte er das oft genug tun müssen.
Hier bei einer geschäftstüchtigen Mutter, einem ruhigen, fleißigen Vater und einer Großmutter, die immer für die Kinder sorgte und für sie Zeit hatte, war meine Nichte Susanne zusammen mit ihren Geschwistern Klaus und Regina aufgewachsen. Manchmal war mir der Verdacht gekommen, dass Traudel auf Mama um der Kinder willen eifersüchtig war. Doch so konnte sie sich völlig dem Geschäft widmen und es war ihr gelungen, aus einer kleinen Kfz-Werkstatt das stadtbekannte „Autohaus Roth“ zu machen.
Vielleicht lag es nicht nur an der ruhigen Art von Karl-Heinz, dass sie sich nicht richtig streiten konnten, sondern auch daran, dass die Arbeit von Traudel und Karl-Heinz mit dem Betreiben dieses Autohauses und der Kfz-Werkstatt auf eine gemeinsame Aufgabe konzentriert war. Wenn sie Erfolg hatten, dann hatten sie das gemeinsam, und wenn es eine Krise gab, so mussten sie die zusammen bewältigen. Das war so, trotzdem Karl-Heinz am liebsten nur in seiner Werkstatt rumwerkelte und Traudel alles sonst Geschäftliche überließ.
Manchmal versuchte Traudel aufzubegehren, Karl-Heinz aber wusste es zu übergehen. Bis, ja bis Traudel nach Mamas Tod durchdrehte. Wohl eine Folge ihrer ausklingenden Wechseljahre. Doch selbst wenn sie unzufrieden mit sich und der Welt Karl-Heinz anschrie, er reagierte nur ratlos darauf. So kam es nie zu einem wirklichen Streit.
Trotzdem hatte uns dann völlig unerwartet Traudels Ausbruch aus einem erfolgreichen und sicheren Leben getroffen, als sie, gerade über Fünfzig, dem Werben eines reichen Fabrikanten nachgab und mit ihm nach Florida flog. Was hatte sie in ihrem Leben vermisst, dass sie wie in Torschlusspanik alles hinter sich lassen konnte. Sie besaß alles, worum andere Frauen sie beneideten: Erfolg, Ansehen, drei gesunde Kinder, die sie bestens von ihrer Mutter versorgt wusste, und einen Mann, der sie bedingungslos liebte. Was war es, was ihr gefehlt hatte und sie alles vergessen ließ? Doch schon nach wenigen Monaten erkannte sie, dass sie mehr aufgegeben als gewonnen hatte. Dem reichen Fabrikanten hatte nur daran gelegen, sie, die stolze, selbstbewusste Frau zu erobern. Bald zeigte er ihr unverblümt, dass er ihr eine Jüngere vorzog. Da kam sie wieder zu sich. Bitter musste sie erwachen. Und sie kehrte heim in ihr Leben und zu ihrem Mann, der nur gelitten und sie nicht eine Sekunde verdammt hatte. Alle bemühten sich danach, so zu tun, als wäre es nie geschehen. Für Uneingeweihte hatte sie eine Geschäftreise nach Amerika gemacht.
*
Aufgewühlt durch das Telefongespräch mit Traudel, waren meine Gedanken in die Vergangenheit gewandert und ich hatte mich in der Erinnerung verloren. Doch nun kehrte ich in die Gegenwart zurück und dachte an Susanne. Sie saß in Berlin und musste so eine schwere Entscheidung treffen. Was Mama dazu sagen würde, war mir klar: „Natürlich geht sie mit Robert mit. Das ist nun einmal so, in einer Familie kann nur einer tonangebend sein, und das sollte der Mann sein. So ist es immer gewesen und darum gab es solche Konflikte nicht.“
So einfach war das früher? Doch wie viele Tränen mögen gerade darum vergossen worden sein, wenn eine Frau sich darein fügte und ihren eigenen Willen unterdrückte. Ich seufzte! Wie gut, dass ich nie vor so einer Entscheidung gestanden habe. Ich machte einen Schritt an das Regal neben meinem Bett, wo Bild neben Bild, die ganze Vergangenheit meines Lebens stand.
Ich nahm das Hochzeitsbild von meiner Nichte Susanne in die Hand. Da stand sie neben ihrem noch vollbärtigen Robert und lächelte zukunftsfroh in die Kamera, den Bauch, der bereits vorgeschrittenen Schwangerschaft, unter einem weiten Hängerkleid verbergend. Doch es war nicht mehr das erwartungsvolle Lächeln eines Mädchens, das bis über beide Ohren verliebt war, sondern das besitzsichere Lächeln einer Frau, die ihr zweites Kind erwartete. Das war kein Brautpaar, die Braut in Kranz und Schleier, sondern hier war ein Paar mit modernen Ansichten zu sehen, die eben einmal kurz beim Standesamt vorbeigegangen waren, weil es ihnen so in den Kram passte. „Unbedingt nötig - nein, das war es wirklich nicht“, meinte man, sie sagen zu hören.
Daneben stand das Hochzeitsbild ihrer Eltern, von meiner Schwester Traudel und Karl-Heinz. Sie war da gerade neunzehn Jahre alt geworden, eine strahlende Braut mit lockigen roten Haaren, in weißer Seide mit einem zum Krönchen gewundenen Myrtenkranz und Schleier. Neben ihr stand stolz Karl-Heinz, der acht Jahre ältere Bräutigam im dunklen Smoking. Wie herrlich war damals dieses Hochzeitsfest gewesen.
Ich blickte von einem Bild zum andern. Was war es, was die beiden so unterschiedlich machte, und dann doch wieder so gleich erscheinen ließ? Waren es die Illusionen, die sich in dem strahlenden Blick meiner Schwester Traudel ausdrückten, mit denen sie in die Ehe ging, genauso wie ich an meinem Hochzeitstag? Und was konnte man aus dem Blick meiner Nichte Susanne lesen, die doch bewusst sagte, solche Illusionen, wie Traudel und ich, wie unsere Generation sie noch hatte, die wollte sie sich erst gar nicht machen? Sie glaubte ja, so natürlich, so realistisch über alles zu denken. Nein, sie machte sich bestimmt nichts vor, Ehe - na gut, aber ohne Ehe wäre es auch nicht anders, meinte sie. Nur wegen der Kinder, wegen der immer noch veralteten gesellschaftlichen Meinung und der Gesetze, hatte sie ja gesagt. Sie hätte lieber allen bewiesen, dass man auch ohne Ehe genauso gut, wenn nicht noch besser miteinander leben könnte. Doch war das nicht auch eine Illusion, nur eben auf andere Art als bei Traudel und mir?
Ich stellte die Bilder zurück zu den andern, zu dem, auf dem Konrad liebevoll lächelte, zu dem, wo sich Mama an Papas Arm festhielt und voller Zuneigung zu ihm aufsah, zu dem, das meinen Bruder Bruno mit Frau und Tochter in Australien zeigte, und zu dem, auf dem die drei noch jungen, übermütig grinsenden Kinder von Traudel und Karl-Heinz zu sehen waren. Da stand meine Nichte Susanne als Älteste, die nun schon eigene Kinder hatte, neben ihrem Bruder Klaus und ihrer kleinen Schwester Regina. Der kleine Nachkömmling Regina fiel auf durch ihre eigenwillig jungenhaft kurz geschnittenen roten Haare. Sie mochte nun einmal keine langen Haare. Als Mama das durchsetzen wollte, hatte sie einfach die Schere genommen und sich selbst einen entsetzlichen Fransenkopf geschnitten. Karl-Heinz hatte sich darüber kaputtgelacht und sie gleich fotografiert, er konnte die Empörung von Mama und Traudel nicht teilen. Sein Liebling, das Nesthäkchen, war ihm recht in ihrer burschikosen Art, wo doch sein Sohn Klaus so ein sensibler, feinsinniger, langhaariger Typ war, gar nicht ein Junge, wie er ihn gern gehabt hätte. Klaus, heute zweiunddreißig Jahre alt, war auch später eine homosexuelle Beziehung mit einem Mann eingegangen. Mit ihm lebte er seit vielen Jahren in München zusammen. Beide arbeiteten dort in einer bekannten Modefirma, Klaus in seinem Traumberuf als Modedesigner. Nur schwer hatte sich Traudel damit abgefunden. Karl-Heinz dagegen meinte, wenn der Junge nur so glücklich werden kann, dann müsse man es hinnehmen. Regina aber, jetzt einundzwanzig Jahre alt, war so, wie es ihm gefiel, sie teilte seine Interessen. Stundenlang konnten die beiden über die neuesten Autotypen fachsimpeln. Sie war eben ganz seine Tochter. Sie hatte gerade bei ihm in der Werkstatt eine Lehre zum Kfz-Mechaniker hinter sich gebracht und wollte unbedingt sobald als möglich ihren Meister machen, denn eines Tages sollte sie das „Autohaus Roth“ übernehmen und weiterführen. Klaus hatte nie Interesse daran gezeigt, und Susanne hatte es bald verloren, als sie ihr erstes Kind bekam und eigenwillig darauf bestand, trotzdem Robert nicht zu heiraten, aber mit ihm zusammenzuleben. Dann hatte sie ihre ganze Kraft und Begeisterung in den Aufbau dieser heruntergekommenen Boutique gesteckt. Manchmal verstand Karl-Heinz Susanne, seine Große, nicht. Doch er würde es ihr nie sagen.
Ich konnte mir denken, was Karl-Heinz dazu sagte, dass Susanne ihre Geschäfte aufgeben und mit Robert hierher ziehen sollte. Wahrscheinlich hob er abwehrend beide Hände, falls Traudel ihn um seine Meinung drängte. „Diese Entscheidung ist schwierig genug, da mische ich mich nicht auch noch ein. Das müssen die beiden allein miteinander ausmachen“, so oder ähnlich würde er sich äußern. Doch dass Traudel sich einmischte, konnte er bestimmt nicht verhindern. In Gedanken hörte ich, wie sie Robert Vorwürfe machte.
Und welcher Meinung war ich? Wenn ich ehrlich war, so hoffte ich, Susanne würde nachgeben und bald wieder in meiner Nähe leben. Ich freute mich auf sie, auf Robert und ihre drei Kinder. Christine, die Älteste davon war temperamentvoll und manchmal eigensinnig mit ihren dreizehn Jahren. Dagegen war Daniela die Ruhige, die sich mit ihren erst zehn Jahren bereits fast mütterlich um ihre dreijährige Schwester Petra kümmerte. Und diese Kleinste konnte recht bockig sein, wenn wieder niemand Zeit für sie hatte. Geheiratet hatten Susanne und Robert erst, als Daniela bereits unterwegs gewesen war. Bei Susanne und Robert war immer Hektik. Schwer fiel es beiden, ihre unterschiedliche Berufstätigkeit mit den Verpflichtungen für die Kinder zu verbinden. So mussten sich die Kinder daran gewöhnen, mal hier und mal da zu sein, bei den Eltern eben nur, wenn diese es einrichten konnten. Ehrgeizig waren sie beide, und Robert als Arzt offensichtlich so erfolgreich wie Susanne in ihrem Geschäft. Wie oft war Margot, die Frau unseres langjährigen Freundes Helmut, eingesprungen und hatte die Kinder zu sich geholt, wenn Susanne wieder einmal nicht wusste, wo sie die drei lassen sollte.
Margot hatte sich dafür entschieden, ihre Berufstätigkeit aufzugeben, um für ihre beiden Kinder, Niklas und Katja, Zeit zu haben. Um Geld brauchte sie sich keine Sorgen zu machen, ihr gehörte von ihrem Vater her die Hälfte der Baufirma „Zumbold“, die Helmut mit ihrem Bruder zusammen leitete. So fand sie nicht nur Zeit für ihre Kinder, sondern auch noch für die Kinder von Susanne. Ich hörte, wie sie einmal zu Susanne sagte: „Was würdet ihr berufsbesessenen Frauen nur ohne uns Nurhausfrauen tun?“ Doch was Margot auch sagte, es klang nie vorwurfsvoll. Stets bemühte sie sich, Verständnis zu zeigen. So verband diese beiden Frauen eine tiefe Freundschaft, obgleich sie nicht nur sehr verschieden waren, sondern zwischen ihnen auch noch ein großer Altersunterschied bestand. Margot war zweiundfünfzig Jahre alt und Susanne vierunddreißig.
Bestimmt würde Susanne versuchen, sich für die Entscheidung bei Margot Rat zu holen. Wozu aber sollte man ihr raten? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie Robert diese Chance in seinem Beruf vereiteln würde. Traudel allerdings sah wohl nur den Nachteil für Susanne. Sie lehnte sich dagegen auf, dass Susanne einfach alles, was sie sich erarbeitet hatte, seinetwegen aufgeben sollte. Traudel und Susanne, Mutter und Tochter, sie waren Geschäftsfrauen durch und durch, darin waren sie sich ähnlich. Weder Traudel noch Susanne konnte ich mir als „Nurhausfrau“ wie Margot vorstellen. Obgleich ich mitunter meinte, für ihre Kinder wäre es besser, die Mutter zu Hause zu haben. Doch Susanne erklärte dann nur, sie sei nicht zum Faulenzen geboren. War das wirklich ihre Meinung, dass Frauen nur faul seien, die der Kinder wegen zu Hause blieben und nicht für eigenes Einkommen und spätere gesicherte Altersversorgung arbeiten gingen? Das allerdings sagte sie nie, wenn Margot in der Nähe war. Denn Margot, das war eben etwas anderes, sie hatte den Wohlstand in die Ehe mit Helmut mitgebracht, sie brauchte sich nicht um ihr Auskommen zu sorgen, so glaubte Susanne. „Aber trotzdem weiß ich nicht, wie Margot es aushält, immer nur zu Hause zu sein?“, fragte sie manchmal nachdenklich.
Julchen kam und stupste mich. „Was ist heute los, Frauchen, ich muss Gassi gehen, hast du das vergessen?“, schien sie sagen zu wollen.
Ich lachte, kehrte in die Gegenwart zurück und machte mich fertig zu unserem ersten Spaziergang am Morgen.
*
Kapitel 2
Ich nahm die Hundeleine vom Haken und trat mit meinem eifrig vor mir her springenden Hund aus Haus und Garten auf die Straße. Es war ein schöner Morgen. Frühling lag in der Luft, ein milder Wind umfächelte mich und sträubte das seidige Fell von Julchen. Auf den grünen Bergen um Neuwied lag ein goldener Schein der Morgensonne. Nur zu einer Seite hin ließen die Berge den Blick offen und frei über den weiten Himmel schweifen, sonst schlossen sie Neuwied wie beschützend ein. Wir gingen die Straße entlang, an deren Ende der Wald begann. Wir begegneten manch anderem Hund mit Herrchen oder Frauchen, die aus dem Wald zurückkehrten. „Guten Morgen, hat Sie auch die Sonne so früh aus dem Bett geholt oder ihr Hund?“, rief mir jemand zu. Man kannte sich vom häufigen Gassigehen. Die Hunde beschnupperten sich kurz, dann gingen sie weiter, jeder in eine andere Richtung irgendeinem Geruch nach. Wir waren noch stehen geblieben, wollten noch ein paar Worte miteinander austauschen. Die Hunde aber drehten sich um, als wollten sie fragen: „Kommt ihr endlich?“ Lachend trennten wir uns. „Was soll man da machen, also seien wir brav und folgen unseren Hunden“, sagte ich. „Na dann bis zum nächsten Mal“, antwortete das Herrchen, „vielleicht lassen sie uns dann ein bisschen mehr Zeit zum Reden.“
So war das mit den Hunden. Und Julchen bestimmte meistens auch, wo wir entlanggingen, wenn ich ihr, wie heute, gedankenverloren hinterhertrottete.
Susannes Problem ging mir nicht aus dem Sinn. Margot kann mir gewiss mehr davon erzählen, überlegte ich. Gestern hatte sie angerufen und mich gebeten, ihnen wieder ein Zimmer in der Pension bei uns um die Ecke zu bestellen. Sie wollten für das nächste Wochenende zu mir kommen. Helmut und Margot waren oft bei mir. So, wie Helmut versprochen hatte, er würde immer für mich da sein, so hielt er es auch. Sie waren es gewesen, die sofort kamen, als ich ratlos nach Konrads Tod allein dastand. Sie hatten mir bei all den schweren Wegen, die zu erledigen waren, geholfen. Und sie hatten mich gestützt, als ich hinter seinem Sarg hergehen musste und am liebsten mit ihm gegangen wäre. Ich war ihnen sehr dankbar dafür.
Helmut und mich verband eine tiefe, vertraute Freundschaft. Als ich Margot zuerst kennenlernte, da spürte ich kurz eine gewisse Zurückhaltung bei ihr, fast wie Eifersucht. Doch bald hatte sie wohl unsere Geschichte erfahren, hatte verstanden, dass von mir keine Gefahr ausging und ich gewann noch eine aufrichtige Freundin dazu. Helmut hatte sich gleich in mich verliebt, als er mir zum ersten Mal begegnet war. Da war ich aber bereits die Frau seines besten Freundes aus Kriegstagen gewesen. Mir gefiel seine aufmerksame Art, mit der er mich damals bedachte. Lange hatte ich nichts geahnt, ja, ich schloss mich ihm sogar gefährlich eng an, je größer die Enttäuschungen und Spannungen zwischen Konrad und mir wurden. Als dann unsere Ehe beinahe zerbrochen wäre, hatte sich Helmut Hoffnungen gemacht. Konrad und ich fanden aber wieder zueinander. Zwei Jahre lang hatten wir ihn danach nicht mehr gesehen. Doch plötzlich war er durch einen Zufall wieder da gewesen. Geblieben ist von alldem eine besonders vertraute Freundschaft, die uns beide seither miteinander verbindet. Das aber hat niemanden wehgetan, weder Konrad noch später Margot. „Wir wissen schon, wie wir mit euch dran sind“, hatten sie manchmal lachend gesagt.
Das war nun viele Jahre her. Ihre beiden Kinder, Niklas und Katja, waren erwachsen und gingen bereits eigene Wege. Katja war längst zu Hause ausgezogen, lebte in einer eigenen Wohnung und hatte, wie es schien, einen festen Freund. Der wiederum besaß ein Appartement. So waren sie mal bei ihm oder mal bei ihr zusammen. Dass ihnen das gefiel, verstand Niklas nicht. Er, dem es nicht an Freundinnen mangelte, zog es vor, noch in dem komfortablen Haus seiner Eltern zu wohnen. Das befand sich in einer vornehmen Gegend von Berlin, im Grunewald. Margot und Helmut waren eben sehr wohlhabend mit ihrem Anteil vom Vater her an der Baufirma „Zumbold“, die in Berlin nicht unbekannt war. Dennoch hat es in all den Jahren unserer Freundschaft zwischen uns nie eine Unstimmigkeit aus Neid gegeben, obgleich wir ihnen gegenüber bescheiden lebten. Nur als Margot ihre Kinder zur Welt brachte, da hatte es mir noch einmal wehgetan, weil ich kurz vor der Entbindung mein Kind verloren hatte und damit auch die Fähigkeit, jemals Kinder zu bekommen.
Irgendwann danach dachte ich daran, wieder arbeiten zu gehen und bekam nach längerer Arbeitslosigkeit eine Stellung in einem Verlag. Wir konnten viele Reisen in die Berge machen, wann wir wollten, ohne Rücksicht auf Kinder nehmen zu müssen. Durch diesen Verlag kam es wohl dazu, dass ich selbst eines Tages begann zu schreiben. Allerdings wollte mir der richtige Durchbruch damit nicht gelingen.
Manchmal hatte ich mich sogar gefragt, ob Konrad das überhaupt verkraftet hätte. Die jungen Frauen von heute erwarten das von ihren Männern. Doch ich glaube, es bringt kein Mann, nicht eifersüchtig auf den Erfolg seiner Frau zu sein. Oder warum sitzen Frauen noch immer hauptsächlich in untergeordneten Stellungen? Und wie schwer ist es noch immer für eine Frau, Familie und Beruf miteinander zu verbinden? Schon die Wirtschaftswelt tut wenig dazu, der Frau das zu erleichtern. Es wird erwartet, dass eine Frau sich beruflich so einsetzen kann wie ein Mann, wenn sie Erfolg haben will. Hatte Mama nicht recht gehabt, wenn sie behauptete, die Frauen machten sich mit ihrer Emanzipation etwas vor, so viel, wie sie glaubten, hätten sie in Wahrheit noch nicht erreicht?
Katja, die Tochter von Helmut und Margot, hatte sich darüber wohl Gedanken gemacht. Sie war jetzt fünfundzwanzig Jahre alt und studierte seit ein paar Jahren Architektur. Sie ging noch zur Schule, als sie bereits verkündete, sie würde nie heiraten, denn sie wollte eine Karriere als Architektin machen, und eins ginge nur. „Mich kann nur einer sonntags haben. Für seine Pantoffeln muss er selbst sorgen“, pflegte sie zu sagen. So war es eigentlich erstaunlich, dass ihre Freundschaft mit Alexander bereits so lange hielt. Er lachte sogar dazu. Ich hatte manchmal den Verdacht, vielleicht war es ihm sogar recht.
Über ihren großen Bruder Niklas, siebenundzwanzig Jahre alt, schüttelte sie nur den Kopf. Er wollte einmal eine Frau heiraten, die, genau wie seine Mutter, nur für die Familie da sein und Zeit für ihn und die Kinder haben sollte. „Ich will am Abend nicht eine abgehetzte Frau vorfinden, die nicht weiß, was sie zuerst machen soll, und von mir noch erwartet, dass ich das Staubtuch schwinge“, sagte er. Meistens jedoch waren seine Freundinnen studierte Frauen, von denen das wohl kaum zu erwarten war.
Katja lachte darüber. „So eine, wie du suchst, findest du heute nicht mehr, wenn du auch noch wert darauf legst, dass sie deinen geistigen Ansprüchen genügt“, hielt sie ihm vor.
Margot meinte dazu: „Jeder sollte leben können wie er will und sich nicht nach den andern richten. Ich finde es schlimm, wenn die Menschen irgendeinem Trend der Zeit hinterherlaufen und etwas tun, nur weil es gerade so gemacht wird.“
Ich freute mich auf den Besuch von Helmut und Margot am Wochenende. Neugierig war ich darauf, was sie mir von Susanne und Robert erzählen würden. Sicher wusste Margot mehr davon als Traudel. Wozu aber sollte man Susanne nur raten? Wie ich auch überlegte, ich wusste es nicht. Ich vermied es auch, sie in den nächsten Tagen anzurufen. Da ging es mir wohl wie ihrem Vater Karl-Heinz, ich wollte sie bei dieser schwierigen Entscheidung nicht noch mit meiner Meinung verwirren.
*
Mit frohem Gefühl erwachte ich, als mich Julchen an dem Tag wach stupste, da Helmut und Margot zu mir kommen wollten. Das Zimmer für sie in der Pension hatte ich bestellt. Noch als Konrad lebte, waren sie oft hergekommen. „Wenn ihr geglaubt habt, ihr werdet uns los, nur weil ihr von Berlin weggezogen seid, dann habt ihr euch geirrt“, flachste Helmut. Nur bei uns mit im Haus wohnen, das wollten sie nicht. „Ihr sollt euch freuen, wenn wir kommen. Wir wollen euch nicht auf den Geist gehen, nur weil wir uns nicht aus dem Wege gehen können“, meinten sie dazu. Vielleicht hatten sie recht. Besonders als Konrad zuletzt alles mehr und mehr anstrengte, war es sicher gut. Sie achteten auch darauf und waren immer rücksichtsvoll. Margot war ohnehin kein Mensch, der sich aufdrängte. Als dann Konrad gestorben war, behielten wir es einfach bei, dass sie in der Pension wohnten, obwohl jetzt wirklich Platz genug im Haus wäre.
Noch schlaftrunken griff ich Julchen ins Fell, die wie jeden Morgen erst einmal zu mir ins Bett gesprungen war. Ohne Streicheleinheiten am Morgen, das hätte sie mir übel genommen. Prüfend sah ich zu den noch zugezogenen Vorhängen hin. Das wird ein schöner Tag, glaubte ich. Mir war, als könnte ich den Sonnenschein des beginnenden Tages durch die dichten Vorhänge am Fenster ahnen.
Meine Vermutung fand ich bestätigt, als ich aufstand und die Vorhänge beiseiteschob. Windstill war es und die Sonne warf von Bäumen und Sträuchern noch lange Schatten im Garten. Oben auf dem Weg über den Berg gingen einige mit ihren Hunden entlang. Ein einzelner Reiter zog dort auch seines Weges in den frühen Morgen.
Julchen stand bereits an der Tür und wartete darauf, dass ich mit ihr unsere erste Runde ging. Ich nahm die Gießkanne mit. Sicher waren die Blumen auf dem Friedhof wieder durstig bei diesem trockenen und sonnigen Wetter.
Julchen sah die Gießkanne in meiner Hand und schon schlug sie gleich den Weg zum Friedhof ein. Fröhlich sprang sie vor mir her. Sie schnupperte hier, sie schnupperte da, damit erfuhr sie, wer alles schon vor ihr da gewesen war. Manchmal sträubte sich ihr Fell dabei, manchmal wedelte sie freudig mit dem Schwanz. Damit konnte ich ahnen, was sie mir vielleicht mitteilen würde: „Aha, hier war der alberne Köter mit dem zotteligen Fell, der mich immer nervt mit seinem Gepiepse und seiner Aufforderung zum Herumtoben. Doch nicht mit mir! Und da, das ist doch wirklich der Duft dieser eingebildeten Hündin, die Schwanz und Kopf nicht hoch genug tragen kann. Na warte! Ein Paar Tropfen muss ich noch in der Blase haben. Mal erst zu Frauchen hoch schielen - aha, sie lacht, sie weiß, was ich tun will. Also, dann! Wo genau ist die Stelle? Nur richtig zielen - ist gar nicht so einfach. So, geschafft, nun habe ich meine Duftmarke draufgesetzt. Noch kräftig mit den Hinterpfoten gescharrt, die wird sich wundern und kann ruhig ihre Nase rümpfen, wenn sie ihre Stelle sucht. Aber was ist das? Frauchen, lass uns umkehren! Da muss eben erst dieser braune Riese gewesen sein, der mich neulich so böse gejagt hat.“
Julchen stand wie festgenagelt.
„Was ist?“, fragte ich und zog an der Leine. Da sah ich ihn, den braunen Feind von Julchen. Doch er war längst vorbei. „Schau, der lauft da hinten bereits davon“, lockte ich sie.
Zögernd folgte sie mir. Brav setzte sie sich auf dem Friedhof neben die Bank, auf der ich sonst gern verweilte. Heute aber goss ich nur die bunten Stiefmütterchen, die das Grab so lustig, gar nicht traurig erscheinen ließen. Einen Moment blieb ich noch stehen und sprach mit Konrad in Gedanken. Doch wieder war es Susanne, die mich dabei beschäftigte. Fast aufbockend sagte ich in Gedanken: „Ich weiß, auch du wärst der Meinung, sie sollte mit Robert mitgehen und alles aufgeben. Doch warum eigentlich? Weshalb sollte das nicht auch einmal für den Mann gelten?“ Ich wusste, wie überlegen er jetzt lächeln würde, und genauso wie früher begehrte ich auf, als müsste ich ihn überzeugen. „Immer anspruchsvoller werden die Berufe, die Frauen heute ergreifen. Ist es da ein Wunder, dass sie diese dann nicht so leicht wieder aufgeben wollen? In Zukunft werden Paare immer öfter vor dieser Frage stehen, besonders da sich die Arbeitswelt zu verändern scheint. Wird nicht zunehmend von den Menschen die Bereitschaft erwartet, sich zu verändern, mit ihrem Lebenskreis ihrem Wirkungskreis zu folgen? Das kannst du nicht leugnen! Da kann es nicht mehr nur nach dem Mann gehen.“ Ich holte tief Luft, als erwartete ich eine Antwort. Und dann kam mir noch der verrückte Gedanke: „Wenn das so weitergeht, wird es in den Städten bald Stellplätze statt Wohnungen zu mieten geben, worauf die ihrer Arbeit nachziehenden Menschen ihre vielleicht immer komfortableren Wohnwagen abstellen können. Und Mutter hat einen Wohnwagen und Vater hat einen Wohnwagen, manchmal stellen sie diese nebeneinander. Und die Kinder? Wandern die Kinder mit, von einer Schule in die andere, von den einen Freunden zu den andern und mal mit der Mutter und mal mit dem Vater? So, das musste mal gesagt werden!“ Da glaubte ich Konrad hell lachen zu hören. Ich sah mich um, aber es war niemand da. Nur Julchen hatte aufmerksam die Ohren aufgestellt und blickte mich aus großen Augen fragend an. Ich hatte wohl wieder mit mir selbst gesprochen. Wie peinlich! Aber da war ja niemand.
„Komm, Julchen!“ Ich nahm meine Gießkanne und verließ mit ihr den Friedhof.
Ich ging über einen Wiesenweg am Rande des Ortes zurück nach Hause. Es war Frühling. Butterblumen säumten den Wegesrand und ließen diese oder jene Wiese wie eine gelbe Matte erscheinen. Die ersten gelben Rapsfelder begannen zu blühen, und ein linder Wind brachte gelben Staub und würzigen Duft von ihnen mit. Von der leichten Höhe aus, über die uns der Weg führte, sah ich unten im Ort Obstbäume blühen. Auch die roten und grauen Dächer von Neuwied konnte ich überblicken, und mittendrin ragte die hohe Turmspitze der alten Kirche heraus. Dieses oder jenes wunderschöne alte Fachwerkhaus säumte noch den Platz davor. Aus Blumenkästen an deren Fenstern quollen üppig die ersten Frühlingsblumen heraus. Sie schmückten die Fassaden, deren heller Putz gegen die dunkelbraun gestrichenen Balken des Fachwerks wirkungsvoll abstach. Einige Ornamente daran waren bunt bemalt. Das Zentrum von Neuwied war ein hübscher alter Ort. Dahinter gab es alte Harzer Häuser, wie sie vom Bergbau errichtet wurden. Die aber waren grau und mit Schieferplatten eingepackt, um Wind und Wetter zu trotzen. Doch auch hier hatte man nicht versäumt, mit Ornamenten aus hellen und dunklen Schieferschindeln den faden Anblick aufzulockern. Am Rand von Neuwied dann zog sich ein Kreis moderner Häuser um den Ort und an einer Seite den Berg hinauf. Der Ort war mit den Jahren gewachsen, und noch immer wurde gebaut. Da, wo die Berge sich öffneten, wurde eine Wiese nach der anderen zu Bauland. Doch jetzt, nach dem Mauerfall, kamen nicht mehr die Berliner hierher und kauften Häuser und Wohnungen, wie wir damals. Jetzt brauchten sie das nicht mehr, seit sie wieder ungehindert ins Umland der Stadt fahren konnten. So leicht wie früher fanden die Baufirmen für ihre hier errichteten Häuser und Eigentumswohnungen keine Käufer mehr.
Julchen hob den Kopf und schnüffelte in die Luft. Ich spürte es auch, ich sah es auch. So früh am Morgen begann sich bereits eine blaue Dunstwolke über dem Ort zu bilden. Auf der nicht weit entfernten Zufahrtsstraße blubberte ein Trabi hinter dem andern aus dem Osten in den Ort, den stinkenden blauen Dunst aus ihrem Auspuff in die Luft blasend. Seit die Grenze offen war, riss der Strom derer nicht ab, die aus der DDR zu uns kamen. Sie bewegten sich durch Straßen und Geschäfte wie Kinder in einem Schlaraffenland, die staunend umherblickten. Ich wusste ja, wie es drüben jenseits der Grenze aussah, nur ein paar Kilometer von hier entfernt. Ach was, wie es gleich hinter dem letzten Zaun der ehemaligen Grenzsperranlage mit dem kahlen breiten Todesstreifen aussah. Als ich dort zum ersten Mal hinfuhr, kam ich mir schlagartig vor, wie in einer anderen Welt. Grau, trist, farblos und öde wirkte alles. Abwechslungsreiche Felder gab es nicht. In riesigen Flächen dehnten sie sich aus über die Höhen und Täler. Hässliche Baracken der Landes-Produktionsgenossenschaften, welche die Stallungen für die Massentierhaltung waren, lagen außerhalb der Orte. Daneben große Anlagen für den anfallenden Mist. Und die Bauernhöfe in den Orten zerfielen. In schönen Städten wie Aschersleben oder Quedlinburg ließ man die herrlichen kleinen Fachwerkviertel einfach verfallen. Ein großer Platz um die Kirche von Aschersleben war total abgerissen worden. Trostlose öde Leere, mitten in einer Stadt. Da wo Bergwerke in Betrieb waren, erhoben sich hohe Abraumhalden, die mit ihrem Staub die Gegend bedeckten.
Aus dieser Welt drängten die Menschen über die Grenzübergänge, von denen mehr und mehr geöffnet wurden, zu uns. Sie kamen in unsere Welt der hellen freundlichen Häuser, der frei umherblickenden Menschen, der Geschäfte voller Waren, der leuchtenden Reklame, die darum warb, ihre Artikel zu kaufen. Nichts musste hier durch Beziehung oder unter dem Ladentisch beschafft werden, wie bisher bei ihnen. Niemand musste hier auf ein Auto dreizehn Jahre lang warten, wie sie auf einen kleinen Trabant, den Trabi, wie er liebevoll genannt wurde. Noch hatten sie Ostmark, noch konnten sie nur ausgeben, was ihnen Freunde oder Verwandte aus dem Westen zukommen ließen. Manch einer tauschte auch Ostmark zu einem hohen Kurs bei den Geldinstituten ein, nur um etwas von dem verlockenden Angebot mit nach Hause nehmen zu können. Die Supermärkte waren voll von ihnen. Hatte man es eilig, wollte mit seinem Einkaufswagen durch die Gänge der Regale laufen, so kam man nicht voran. Wie oft standen sie mit Augen wie Kinder staunend davor, konnten nicht fassen, was es bei uns alles gab, und vergaßen dabei die Welt um sich. Man sagte, drüben solle die Versorgung noch katastrophal sein. So wurden sogar einfache Dinge für den täglichen Bedarf gekauft. Ohne Bananen und Apfelsinen ging aber wohl niemand von ihnen zurück. Was mussten sie diese entbehrt haben. Berge davon wurden vor den Läden aufgebaut. Ständig rollten die Laster heran und brachten Nachschub von allem, was die Menschen aus dem Osten begehrten. Die hundert D-Mark Begrüßungsgeld, die ihnen bei uns nach dem Fall der Grenze gezahlt wurden, waren längst ausgegeben. Ich sah auch die, die sich kaum Westgeld beschaffen konnten, die nur sehnsüchtig dastanden und auf etwas blickten, was sie sich nicht kaufen konnten. Kinder bekamen hier manchmal große Augen, und so manche Mark habe ich ausgegeben, um ihnen die Süßigkeit zu verschaffen, die sie so stumm und sehnsüchtig anschauten. Manchmal schämten sich die Eltern und wollten es nicht annehmen. Wenn sie aber die aufkeimende Hoffnung ihres Kindes wieder verlöschen sahen, gaben sie nach. Was für eine Zeit!
Ich sah auf die dichter werdende blaue Wolke um den Kirchturm und seufzte. Ich musste noch einkaufen fahren, ehe Margot und Helmut kamen, und wusste, es würde wieder ein Kampf um einen Parkplatz beim Supermarkt werden, von dem fürchterlichen Gedränge im Laden abgesehen. Dort wurde fast nur noch Thüringisch oder Sächsisch um einen herum gesprochen. Man brauchte es nicht zu hören, man sah auch, wer aus dem Osten kam. Sie gingen noch scheu und zurückhaltend umher, als trauten sie dem ganzen Geschehen nicht.
Wie ich es vermutet hatte, so kam es dann. Gerade erwischte ich noch einen Parkplatz, gerade brachte jemand einen Einkaufswagen zurück, den ich ergattern konnte, während all die vielen anderen unterwegs im Laden waren. Mühsam bahnte ich mir meinen Weg durch die Gänge zwischen den Regalen. Es war Freitag. Vor dem Wochenende war es besonders schlimm. Doch es half nichts, bald würden Margot und Helmut vor der Tür stehen.
War ich froh, danach endlich wieder zu Hause zu sein und den Wagen in der Garage zu haben. Noch gab es viel zu tun. Voller Vorfreude bereitete ich alles für den Besuch vor, während Julchen aufgeregt zwischen Haus und Gartentor hin und her rannte. Sie ahnte längst, dass jemand kommen musste, wenn Frauchen sich nicht an die Schreibmaschine setzte, sondern eifrig herumwirtschaftete? Als es endlich vor dem Gartentor hupte und Margot und Helmut mit ihrem Auto davor standen, gebärdete sie sich wie toll vor Freude.
Ich legte aus der Hand, was ich gerade hatte und lief selbst aufgeregt aus dem Haus zum Gartentor. Margot saß noch hinter dem Lenkrad, da war Helmut schon ausgestiegen und kam auf mich zu. Warm fühlte ich mich von seinem Blick umfangen. Mit zwei kräftigen Schritten war er bei mir und umarmte mich. „Altes Mädchen, wie geht es dir? Was macht deine Schreibkunst?“, fragte er sofort. Er war an allem interessiert, was mich betraf. Inzwischen war auch Margot ausgestiegen, schloss das Auto ab und strich sich ihre dunklen Haare zurück, in denen nur ein paar weiße Strähnen ihr Alter verrieten. Sie lächelte mich warmherzig an und wollte auf mich zugehen. Doch da war Julchen, die wild von einem zum andern lief und nun erst von ihr beachtet werden wollte. An Helmut konnte sie hochspringen, so viel sie wollte, er nahm sich dazu keine Zeit, ließ mich nicht los. Margot aber lachte und beugte sich zu Julchen nieder. Endlich schaffte sie es zu mir zu kommen und begrüßte mich in der ihr eigenen ruhigen Herzlichkeit. Julchen voran gingen wir ins Haus.
„Wie war der Grenzübertritt, habt ihr lange warten müssen?“, fragte ich augenzwinkernd. Die Zeit der strengen Kontrollen war ja vorbei.
„Es ist ein unglaublich gutes Gefühl, durch die Bauten der Grenzkontrollstellen der DDR einfach durchfahren zu können, ohne geduldig warten zu müssen und sich einer Willkür ausgeliefert zu fühlen, wie sonst. Nur den Personalausweis braucht man bei dem Beamten noch hochzuhalten, schon winkt er dich durch. Davon muss dem der Arm bei der endlosen Autoschlange bald wehtun“, erklärte Helmut.
„Was ist in Berlin, hat sich bereits viel verändert?“, wollte ich wissen.
„Und ob! Wenn du in ein Kaufhaus gehst, meinst du, es gäbe keine Westberliner mehr. Die Trabis blubbern fleißig durch die Gegend und die Straßen sind ständig verstopft. Auf den grünen Wiesen um Berlin entstehen bereits Einkaufszentren. Unsere großen Handelsketten lassen sich nichts entgehen“, berichtete Helmut.
„Es fällt schwer, zu begreifen, wie sie da drüben gelebt haben. Wenn ich daran denke, wie erschüttert ich war, als ich hier zum ersten Mal hinüberfuhr, die Straßen voller Schlaglöcher, die Orte grau im Dunst rauchender Schornsteine, die Häuser vernachlässigt, Scheunen die zusammengefallen waren und die einfach so liegen blieben. Jetzt ist es, als seien die Menschen drüben wieder erwacht. Ich weiß nicht, wie viele Eimer Farbe von hier schon hinübergetragen wurden. Emsig räumen sie auf. Verrostete Landmaschinen verschwinden und so manche Fassade hat einen freundlichen Anstrich bekommen“, berichtete ich. So tauschten wir uns zuerst unsere Eindrücke aus.
Ich aber wollte doch wissen, was sie mir über Susanne und Robert erzählen konnten. Kaum dass wir uns gesetzt hatten, brachte ich das Gespräch darauf. Ich merkte, es beschäftigte sie ebenso wie mich.
Susanne hatte tatsächlich Margot um Rat gefragt. Doch auch sie wusste keine Lösung und hatte ihr gesagt: „Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich es richtig finde, wenn ihr euch wegen eurer unterschiedlichen Berufe trennt. Du weißt genau, dass bei mir die Familie an erster Stelle steht und ich immer danach handeln würde.“ So berichtete sie mir und fügte noch fast entschuldigend hinzu: „Was sonst hätte ich ihr sagen sollen? Ich kann weder dem einen noch dem andern Recht geben.“
„Glaubst du, Susanne denkt an eine Trennung?“ fragte ich erschrocken.
„Sie steht vor einer so schweren Entscheidung, Wir können ihr dabei nicht helfen“, bemerkte Helmut.
„Wir können ihr aber zuhören, wenn sie reden will. Vielleicht findet sie dabei allein den richtigen Weg für sich. Susanne ist wie in Panik. So habe ich sie noch nie erlebt.“
Ich spürte, Margot sorgte sich sehr.
„Und Robert? Besteht keine Möglichkeit, dass er auf diese Stellung als Oberarzt verzichtet?“, fragte ich vorsichtig.
Sofort schlug sich Helmut auf seine Seite: „Bei der einmaligen Chance, die dieses Angebot für ihn bedeutet? Das fragst du nicht im Ernst. Er hat bereits mit seiner besonderen Behandlungsmethode Aufsehen in interessierten Kreisen erregt. Und hier bietet sich ihm die Gelegenheit, seine Methode noch zu vervollkommnen. Meinst du wirklich, darauf kann er so leicht verzichten?“
,,Nein, aber …“
„Man muss eben auch ihn verstehen, wenn er die Meinung vertritt, Susanne könnte hier genauso gut ein Geschäft wieder eröffnen wie in Berlin“, unterbrach er mich.
„Er glaubt, für ihre gut gehenden Geschäfte in Berlin könnte sie einen so hohen Preis erzielen, dass es kein Problem wäre, hier in der Gegend ein neues zu kaufen oder zu eröffnen“, ergänzte Margot.
„Aber hier ist alles anders als in Berlin, hier ist eher Provinz. Das sollte er auch bedenken“, erklärte ich.
„Das sagt Susanne auch. Dabei liebt sie es, flotte Mode anzubieten. Darum meint sie, er müsse nicht woanders hingehen, auch in Berlin könne er sich als Arzt einen Namen machen und würde dann bestimmt eine interessante Stellung bekommen. So streiten sie zurzeit hin und her, ohne Ende.“ Das machte Margot Sorgen.
„Dass sie aber auch so unterschiedliche Berufe haben müssen, die so schwer unter einen Hut zu bringen sind“, bedauerte Helmut.
„Dabei hatte Susanne gemeint, sich die richtige Tätigkeit ausgesucht zu haben, eine Selbständigkeit, die sich mit Kindern und Mann am besten vereinbaren ließe. Das es nicht so war, hatte sich ja bald erwiesen. Wie oft fehlte ihnen die Zeit für ihre Kinder“, erklärte Margot.
„Oft genug bist du dann helfend eingesprungen. Wie gut!“, lobte ich.
„Margot ohne Kinder? Kannst du dir das vorstellen?“ lachte Helmut. „Als unsere beiden groß waren, kamen ihr die von Susanne gerade recht.“
„Wie nehmen es die Kinder überhaupt auf?“, wollte ich nun wissen.
„Petra und Dani sind fast verängstigt. Das ist auch kein Wunder, denn Christine, die Große, berichtete mir, regelrechte Wortkämpfe hätten zwischen den Eltern stattgefunden. Einer versucht den andern zu überzeugen. Dabei sparen sie nicht mit gegenseitigen Vorwürfen. Da half es auch nichts, wenn sie die Tür zu den Kindern verschlossen, irgendwann wurden sie laut und warfen sich gegenseitig Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Das alles also mehr oder weniger vor den Ohren der Kinder. Danach sollen sie manchmal tagelang nicht miteinander gesprochen haben. Die Stimmung bei ihnen muss schlimm sein“, berichtete Margot.
„Soll das Problem wirklich so unlösbar sein?“, überlegte ich.
„Wie gut, dass es so ein Problem bei uns nie geben kann“, sagte Helmut und griff nach Margots Hand auf dem Tisch.
„Aber nur, weil ich meinen Beruf aufgegeben habe und bei den Kindern geblieben bin“, antwortete sie. „Heute ist das nicht mehr so selbstverständlich. Ich kann schon verstehen, dass Frauen gerne durch ihre Arbeit unabhängig bleiben wollen.“
„Auch wenn du nicht arbeitest, unabhängig bist du trotzdem mit deinem Anteil an unserer Baufirma. Du und dein Bruder, ihr seid die eigentlichen Besitzer, auch wenn ich die Firma mit ihm gemeinsam leite. Wenn ich es recht überlege, bist du sogar meine Chefin und ich dein Angestellter“, stellte Helmut grinsend fest.
Margot wehrte das sofort ab. Das hörte sie nicht gern. „Da würde etwas Gutes bei rauskommen, wenn ich den Chef spielen wollte. Nein, nein, das ist dein Beruf und du bist es, der Erfolg hat und an jedem Gewinn beteiligt ist.“
„Ich weiß, mein Geld ist dein Geld und dein Geld ist mein Geld. Wo ist das heute noch so? Manchmal wundere ich mich wirklich, wie gut das bei uns funktioniert. Doch du stehst eben immer hinter mir.“ Nachdenklich schaute Helmut sie an.
„Dein Beruf, dein Erfolg und deine Zufriedenheit damit, sind eben für mich sehr wichtig“, antwortete Margot mit einer liebevollen Geste.
Da lachte er herzlich, legte ihr den Arm um die Schulter und sagte: „Ist das ein Wunder? Es ist doch dein Kapital, das ich verwalte.“
Ärgerlich entzog sie sich ihm und wies ihn zurecht: ,,Ich mag nicht, wenn du das betonst. Du hast doch deinen Anteil daran.“
„Ich weiß! Es belastet mich auch nicht.“ Beruhigend legte er wieder seine Hand auf ihre.
Erstaunlich, wie Margot es schaffte, Helmut nie spüren zu lassen, dass sie es war, die den Wohlstand in die Ehe mitgebracht hatte.
Nun war es für mich an der Zeit, nach ihren Kindern zu fragen.
Niklas war nach seinem Studium der Betriebswirtschaft seit einiger Zeit bei Helmut in der Baufirma beschäftigt. Eines Tages sollte er mit dem Sohn von Margots Bruder die Firma weiterleiten.
„Er macht sich gut, es gibt nichts zu klagen. Wenn er sich weiter so gut einarbeitet, kann ich langsam daran denken, mich aus dem Geschäft mehr und mehr zurückzuziehen“, berichtete Helmut stolz. „Hoffentlich kann mich Margot ertragen, wenn ich erst ganz zu Hause bin“
„Ich werde dich schon zu beschäftigen wissen, dass du mir nicht in der Gegend herumstehst“, lachte Margot. „Ich bin aber gespannt, ob du es wirklich fertig bringen wirst, Niklas alles allein machen zu lassen. Er beklagt sich jetzt schon, dass du ihm oft zu sehr auf die Finger siehst.“
„Warte nur ab, du wirst dich noch wundern! Wenn erst Enkelkinder da sind …“, erwiderte Helmut gut gelaunt.
Ich horchte auf. ,,Enkelkinder? Hat Niklas etwa eine Frau gefunden, die bereit ist, das Heimchen am Herd bei ihm zu spielen?“, wollte ich neugierig wissen.
„Ja!“, bestätigte Margot. „Aber ob sie sich damit abfinden kann, eines Tages nur noch Hausfrau zu sein?“
Prustend lachte Helmut los. „Wer glaubt an Wunder? Stell dir vor, wie immer verliebt er sich in eine, die studiert hat, diesmal ausgerechnet in die Bauingenieurin der Hoch- und Tiefbaufirma, mit der wir zusammenarbeiten.“
„Nein! Und sie soll auf ihren Beruf verzichten, eine Studierte, eine junge Frau dieser Zeit? Das kann ich mir auch nicht vorstellen“, entfuhr mir spontan. Und ich dachte: Wie leicht verspricht man etwas dem andern zuliebe, wenn man verliebt ist. Doch hoffentlich werden die beiden nicht einmal voneinander enttäuscht sein, wenn sich das Versprechen als nicht haltbar erweist.
„Mit siebenundzwanzig ist sie genauso alt wie Niklas, noch nicht lange im Beruf und hat sich noch keine besondere Position erarbeitet. Sie meint, sie liebe Niklas so sehr, dass sie auf eine berufliche Karriere verzichten könne. Uns steht bald eine Hochzeit ins Haus. Du kommst doch bestimmt auch dazu, wenn es so weit ist?“, wollte Margot wissen.
„Wenn es mir gut geht, gerne“, stimmte ich zu. „Das sind ja Neuigkeiten. Und was macht Katja? Ihr Studium der Architektur müsste bald zu Ende gehen.“
„Ja. Neulich konnte ich mit ihrem Professor sprechen, er betonte wieder, wie begabt sie für diesen Beruf sei. Sie wird also wohl ihren Weg gehen, wie sie es sich vorgenommen hat.“
„Was heißt das, Margot, wie sie es sich vorgenommen hat? Meinst du damit, sie wird nie heiraten, weil sie dies stets so verkündet hat und nun schon fast zwei Jahre lang mit Alexander geht, ohne an Heirat zu denken? Vielleicht ist er nur nicht der Richtige, vielleicht muss erst ein anderer kommen, dann kann sich das alles ändern. Sie wäre nicht die Erste, die ihre Vorsätze über den Haufen wirft“, widersprach Helmut.
„Du unterschätzt den Willen deiner Tochter, Helmut. Außerdem, wie redest du über Alexander? Behandelst du ihn nicht sonst wie einen Schwiegersohn?“
„Solange er mit Katja zusammen ist, so lange sehe ich ihn auch so. Doch da sie nicht verheiratet sind, jederzeit auseinandergehen können, muss wohl ein Vorbehalt gestattet sein.“, verteidigte sich Helmut.
„Nun ja, Katja will es so. Also müssen wir uns damit abfinden“, erklärte Margot daraufhin kurz.
„Was sagt sie denn zu den Heiratsplänen ihres Bruders“, fragte ich jetzt. Wusste ich doch, wie sie immer prophezeit hatte, Niklas würde nie eine Frau finden, die bereit wäre, ihren Beruf aufzugeben und ihm zuliebe zu Hause bliebe.
„Katja hat nur gelacht. Sie glaubt nicht, dass Niklas Braut Irmgard als Hausfrau glücklich werden kann, nachdem sie so viel Kraft in das Erlernen eines anspruchvollen Berufs gesteckt hat“, sagte Margot und ich spürte, auch sie bezweifelte das.
Damit war das Wichtigste erzählt und ich hatte genug erfahren. Helmut reckte sich müde, stand auf und drängte: „Komm, lass uns jetzt erst mal in unser Quartier gehen.“
„Zum Abendessen sehen wir uns aber wieder“, forderte ich sie auf und sah ihnen nach, wie sie mit dem Auto den kurzen Weg zur Pension fuhren. Es war schön, sie wieder in der Nähe zu wissen, auch wenn es nur für ein Wochenende war.
Am nächsten Tag machten wir eine Kaffeefahrt zur Okertalsperre. Wir spazierten wie viele andere über die Staumauer und ein Stück am Stausee entlang. Julchen war wie immer dabei. In einem Restaurant bei einem Wasserfall kehrten wir ein. Julchen legte sich brav zu meinen Füßen unter den Tisch, man bemerkte sie kaum, bis ein anderer Hund hereinkam, da knurrte sie leise. Doch nur so lange, bis er vorbei war. „Komm mir nicht zu nah“, sollte das wohl warnend heißen. Wir tranken Kaffee, aßen ein sündhaft großes Stück Torte und fühlten uns wohl miteinander. Wir redeten und redeten, der Gesprächsstoff ging uns nie aus.
Den Abend verbrachten wir noch gemeinsam bei mir im Haus. Dann verabschiedeten sie sich und gingen zurück in ihre Pension. Ich sah ihnen nach, wie sie Hand in Hand die Straße entlanggingen, zwei Menschen die zusammengehörten, die das Leben zusammenwachsen ließ wie einst Konrad und mich. Als ich ins Haus zurückkehrte, erschien es mir wieder besonders leer und ruhig. Ich nahm die Hundeleine vom Haken und lief in der Abenddämmerung noch eine Runde mit Julchen.
Morgen würden sie wieder zurückfahren nach Berlin. Ich war ihnen dankbar dafür, dass sie diese Strapaze für einen Wochenendbesuch um meinetwillen auf sich nahmen. Seit Konrads Tod, waren sie bemüht, mir das Gefühl zu geben, dass sie stets für mich da waren.
*