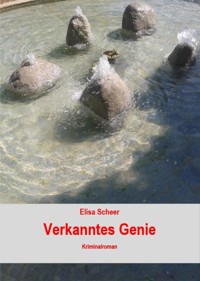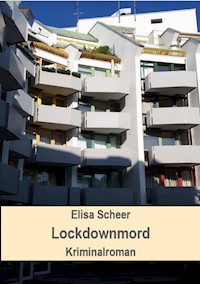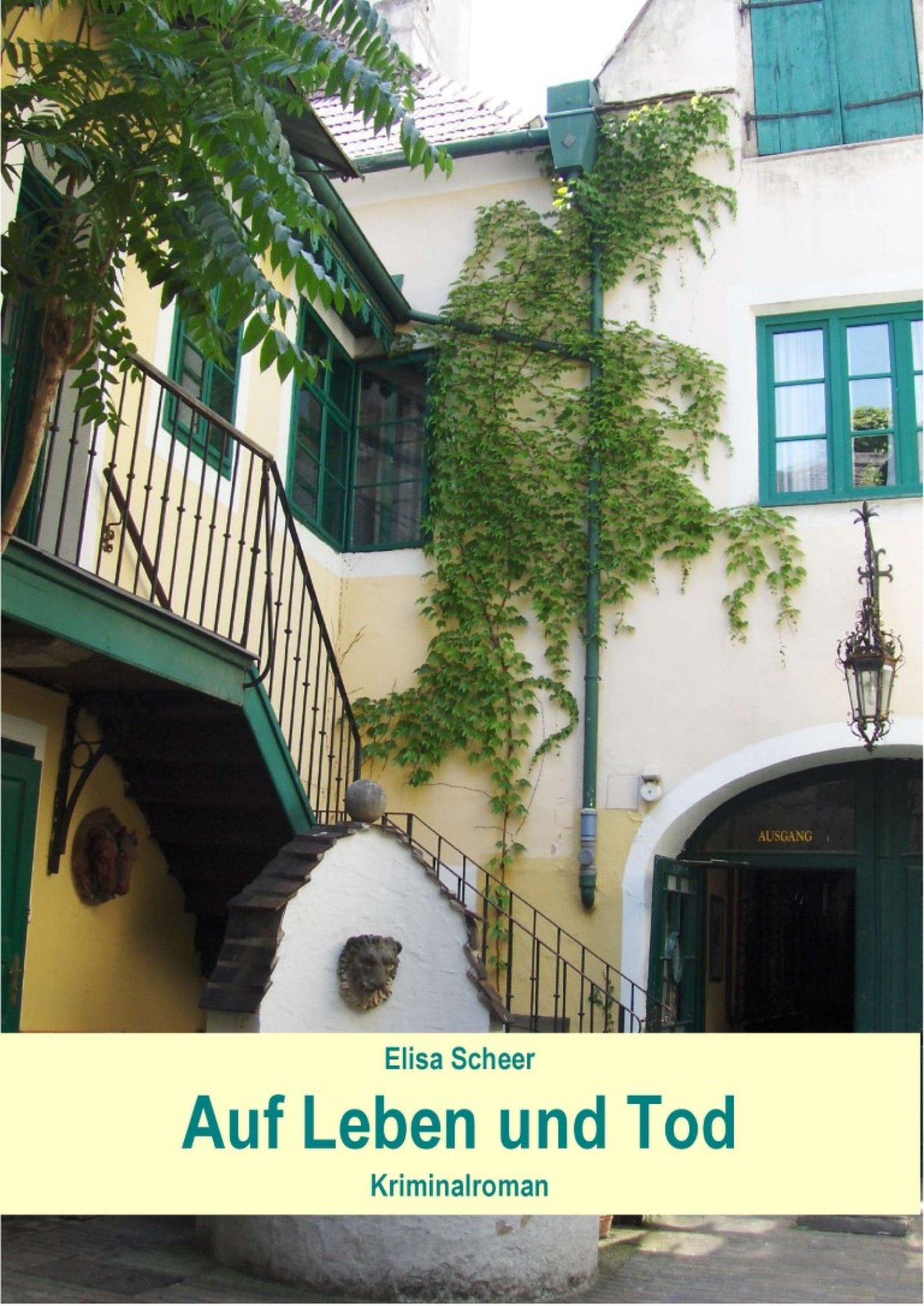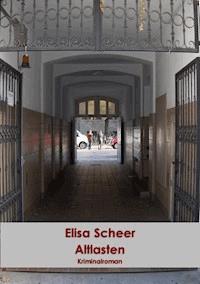Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Eva hat gerade ihre erste Stelle am Leisenberger Albertinum angetreten und wundert sich über die ungute Atmosphäre dort. Die Kollegin Bernrieder tyrannisiert die übrigen Lehrer und die Schüler, so dass sich, als sie eines Tages tot aufgefunden wird, reichlich Motive ergeben. Auch Eva wird ein Motiv unterstellt, denn sie ist pleite und es ist Geld verschwunden... Dass der Kollege Wallner sie sehr mürrisch beäugt, geht ihr dabei fast noch mehr auf die Nerven als der Mord und die pausenlosen Schulreformen, die für Aufruhr im Lehrerzimmer sorgen. Dann gibt es Mordversuche an weiteren Kollegen und Eva versucht zusammen mit dem langsam auftauendem Wallner der Kripo zu helfen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alles frei erfunden!
Imprint Medusas Ende. Kriminalroman
Elisa Scheer published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de Copyright: © 2015 Elisa Scheer
1
MO, 20.10.2003
Sobald der letzte trödelnde Neuntklässler das Zimmer verlassen hatte (Timo, wer sonst?), schloss ich die Tür ab und schleppte mich die drei Stockwerke hinauf ins Lehrerzimmer. Diese Schule war wirklich der reinste Turm, und natürlich gab es keinen Aufzug. Den hätten die Schüler auch im Handumdrehen kleingekriegt.
Sechs Stunden Unterricht und dazwischen Pausenaufsicht – ich wusste nach sechs Wochen Arbeit am Albertinum noch nicht, wer hier den Stundenplan machte, aber dass er mir nicht freundlich gesonnen war, war eindeutig. Oder er hatte sich gesagt Drücken wir´s der Neuen aufs Auge, die traut sich schon nicht, sich zu beschweren.
Recht hatte er! Ich traute mich wirklich nicht. Ich traute mich ja auch kaum, zu fragen, wenn mir ein Ablauf nicht klar war. Nach den ersten drei pampigen Antworten war schon deutlich geworden, dass die meisten Kollegen es nicht gerade schätzten, wenn jemand Neues, Junges, Unerfahrenes kam.
Nett waren hier eigentlich nur die Schüler, überlegte ich, während ich versuchte, so zu atmen, dass ich nicht dem Herzinfarkt nahe das Lehrerzimmer betreten musste. Und dieser etwas abgehobene Chef, aber der wusste wohl gar nicht, was an seiner Schule so abging. Und Frau Thiemig, die mich ab und zu angrinste. Der Rest mochte mich nicht. Scheißegal, dachte ich wütend, ich mochte die alle auch nicht. Und wenn das so blieb, würde ich eben einen Versetzungsantrag stellen.
Im Lehrerzimmer herrschte Hochbetrieb – die einen packten ein, die anderen aus, für den Nachmittagsunterricht in der Kollegstufe, und alle jammerten, wie furchtbar undiszipliniert und denkfaul die Schüler gewesen waren. Zu solchen Stunden merkte man, dass das Zimmer zu klein war – ursprünglich für fünfzig Leute ausgelegt, musste es jetzt fast siebzig beherbergen. Leute wie ich, die zu spät gekommen waren, hatten keinen Anteil am großen Tisch in der Mitte, sondern konnten froh sein, wenn ihnen ein Stuhl in der Ecke zugestanden wurde. So einen Stuhl hatte ich auch. Er wackelte, aber als Ablage für Bücher genügte er. Jetzt allerdings lagen die Bücher auf dem Boden und der Stuhl war weg. Typisch! Ich setzte mich neben die Bücher auf den Boden und begann, meine Schultasche, den Jutebeutel und die Plastiktüte so einzuräumen, dass ich im Bus damit zurechtkommen würde. „Soll das ein Sit-in werden?“, fragte mich jemand. Ich sah auf. Der blöde Wallner natürlich!
„Nein“, antwortete ich knapp.
„Warum wälzen Sie sich dann auf dem Boden herum?“
„Ich wälze mich nicht, ich hatte nur nach sechs Stunden Unterricht das Bedürfnis, mich einen Moment hinzusetzen. Aber wenn das hier auch verboten ist...“ Ich stand mit betonter Leidensmiene auf und packte in gebückter Haltung weiter ein.
„Seien Sie doch nicht so albern!“ Das würdigte ich keiner Antwort mehr. Der Kerl hatte doch sowieso immer was zu meckern! Frau Thiemig feixte und kam näher. „Hat man Ihnen den Stuhl geklaut?“
„Ja“, seufzte ich. „Wahrscheinlich war er heiliges Eigentum von irgendjemandem. Und auf dem Boden sitzen darf man auch nicht, das passt dem Wallner nicht. Wie man hier in einer Freistunde etwas arbeiten soll, ist mir echt ein Rätsel.“
„Mir auch. Ich hab ja auch keinen eigenen Platz, aber ich kann mich wenigstens in die Chemie-Vorbereitung verkriechen. Da stinkt es zwar fürchterlich, aber man hat wenigstens seine Ruhe.“
„Buttersäure?“, erinnerte ich mich an meine eigene Schulzeit.
„Nö, die Zigarren vom Bremml. Aber was will man gegen den Fachbetreuer schon machen!“
Von den meinen hatte ich noch nicht viel gesehen. Ich hatte sowohl in Deutsch als auch in Geschichte das Protokoll der Fachsitzung geschrieben, aber Hilfestellung hatten sie mir nicht geleistet. Nein, das war ungerecht – in Deutsch hatte ich einen hektographierten (!) Zettel bekommen, auf dem in wegrutschender Schreibmaschinenschrift stand, welche Schulaufgaben in welcher Klasse in welcher Reihenfolge geschrieben werden sollten. In Geschichte gar nichts. Da musste ich wohl auf die Anschisse warten, wenn meine ersten Arbeiten respiziert waren...
Learning by doing war hier anscheinend die Devise und Wenn wir Sie ignorieren, ist alles in Ordnung. Das erinnerte mich ein bisschen an den Mann meiner Freundin Silvia. So wie sie ihn zu beschreiben pflegte, bedeutete stummes Hineinschaufeln, dass das Essen okay war.
Vielleicht war das normal und nur ich blöde Kuh erwartete, dass man auf mich zukam, mich lobte (wofür?) und mir sagte, wie man sich freue, mich in der Mannschaft zu haben. Das war hier doch kein Volleyballspiel!
Heute Nachmittag sollte ich mal Leonie anrufen. Die war nach München versetzt worden: ob es bei ihr genauso lief? München – ein reizvoller Gedanke, aber ich hätte mir dort nie eine Wohnung leisten können, ich krebste hier ja schon am Existenzminimum herum. Vielleicht hatte Leonie nicht so viele Schulden angehäuft wie ich.
Die Übungsaufsätze der fünften Klasse passten zwar in den Jutebeutel, aber die Hefte der Neunten überforderten mich. Wieso hatte ich auch gleich über sechzig Übungsaufsätze schreiben lassen? Gleichzeitig? Geniales Timing! Sicher war es Vorschrift, aber nicht so. Eigene Blödheit. Die Hefte mussten eben noch in die Plastiktüte und die beiden Bücher in die Schultasche. Und der Bildband – den brauchte ich heute Nachmittag nicht so dringend, den konnte ich in mein Postfach stecken und beten, dass er morgen noch da war. Nein, der kriegte hier garantiert Beine, und er war ziemlich teuer gewesen, ein Nachkaufen konnte ich mir nicht leisten.
Ein Schränkchen hatte ich genauso wenig wie einen Anteil am Tisch, es gab eben auch nur fünfzig Schränkchen. Bei den Postfächern hatten sie mal einfach eine Reihe obendrauf gesetzt, man erkannte es an der unterschiedlichen Holzfarbe. Ich sah den Bildband verzweifelt an.
Frau Thiemig kam wieder zu mir. „Soll ich Ihnen eine Tüte leihen?“
„Das wäre toll“, antwortete ich erleichtert. „Ich kann den Schmöker ja nirgendwo hier lassen, also muss ich ihn mitschleppen.“
„Ich hätte auch noch Platz in meinem Fach“, bot sie mir an und ich hätte sie umarmen mögen. „Das wäre natürlich noch besser. Ich hab ja schon drei Taschen dabei.“
Frau Bernrieder kam vorbei und musterte uns missvergnügt. „Schlechte Organisation?“ Frau Thiemig bekam schmale Augen. „Wenn man Material für den Unterricht mitbringt und in dieser Bruchbude nirgendwo einen Platz hat, wo man es lassen kann, ohne dass es geklaut wird, ist das wohl keine Frage der persönlichen Organisation!“
Die Bernrieder sah uns von oben herab an. Ganz schöne Leistung, wenn man kein bisschen größer war als wir! „Alles ist eine Frage des persönlichen Missmanagements. Na, sogar Sie werden es eines Tages noch lernen, Frau Prinz.“ Damit segelte sie davon und ich starrte ihr mit offenem Mund nach. „Was heißt denn sogar Sie? Bin ich so bescheuert, dass es sogar hier noch auffällt?“ Ich schlug mir auf den Mund. „Oh, Entschuldigung – ich wollte damit nicht sagen, dass das hier weniger auffallen würde, weil - “
Die Thiemig grinste. „Keine Sorge. Die Idiotenquote ist hier wirklich auffallend hoch. Aber Sie kriegen das alles bestimmt schneller auf die Reihe als manch anderer. Wenn es Sie tröstet – die meisten sind so stinkig, weil sie Angst vor den Schülern haben und total fertig sind.“
„Ich finde, die Schüler sind die einzig netten hier“, antwortete ich verwundert und nicht gerade taktvoll, aber sie lachte bloß. „Ich auch! Kann ich Sie übrigens irgendwohin mitnehmen?“
„Ich glaube nicht“, antwortete ich voller Bedauern. „Ich wohne in Selling, und da müssen Sie garantiert nicht hin.“
„Nein, aber ich kann da vorbeifahren. Los, kommen Sie schon! Sie wollen doch nicht ernsthaft diesen ganzen Krempel zum Bus schleppen, oder?“
„Das mach ich doch jeden Tag, ich bin es schon gewöhnt.“
„In diesem Beruf braucht man ein Auto. Meinetwegen alt und klapprig, Hauptsache, es hat eine Rückbank. Jetzt kommen Sie schon!“
Ich fügte mich, gar nicht so ungern. Frau Thiemig fuhr einen nagelneuen Golf und ich konnte einen Anflug von Neid nicht unterdrücken. Einmal ein eigenes Auto haben! „Haben Sie – ach was, hast du überhaupt schon Gehalt gekriegt?“, fragte sie, als sie vom Parkplatz fuhr. „Ich heiße übrigens Nadja.“
„Eva“, antwortete ich dankbar. „Nein, aber man hat mich schon gewarnt, dass das ein Vierteljahr dauern kann.“
„Aber du hast doch eine Planstelle? Dann müsste es eigentlich schneller gehen.“ Ich seufzte. „Ich hab mal bei der Bezügestelle angerufen, aber die waren bloß ehrlich überrascht, dass ich nicht umsonst arbeiten will. Ob ich keine Rücklagen hätte? Ob meine Eltern mir nicht helfen könnten?“
Nadja schnaubte und setzte den Blinker. „Das ist so was von typisch! Schuften lassen sie einen, aber wenn man auch mal was essen will, soll man bei den Alten schnorren. Weißt du, warum die das machen?“
„Schikane?“, vermutete ich, durch Erfahrung gewitzt.
„Ja, das sowieso – aber vor allem legen die das Geld, das sie dir nicht zahlen, gut an und kassieren Zinsen. Und du zahlst für den Dispo, ohne Ende.“
„Tue ich seit Jahren“, gestand ich. „Ich hab schon das Studium nur mit Schulden hingekriegt. Eltern! Meine Mutter hat gar nicht daran gedacht, mich nach dem Abi noch durchzufüttern, und bei diesen Blödeljobs im Studium wirst du doch wirklich nicht reich.“
„Stimmt. Wenn es dich tröstet: Sobald das Gehalt mal läuft, kannst du dir durchaus ein menschenwürdiges Leben leisten. Wohnung, Auto, regelmäßige Mahlzeiten, ab und an ein Buch oder ein Duschgel. Wahrscheinlich kriegst du um Weihnachten rum einen ganzen Batzen als Abschlagszahlung und zahlst ein Vermögen an Steuern. Mach bloß im Januar gleich deine Steuererklärung, damit du die Kröten zurückkriegst! Da vorne links, oder?“
„Genau. Die Gegend haut einen nicht um, aber die Wohnung ist ganz günstig.“
„Wer schaut denn schon auf die Gegend! Bloß Leute, die sich dann in einem vornehmen Vorort langweilen. Ich finde Selling so schlecht nicht, ich hab hier selbst mal gewohnt.“
„Aber du bist weggezogen, als du genug verdient hast?“
„Ja, weil ich eine größere Wohnung haben wollte, möglichst drei Zimmer. Und hier gab´s nichts, was mir gefallen hätte. Bloß eine mit Ofenheizung, und für solchen Stress hab ich keine Zeit. Wie jetzt?“
„An der zweiten rechts, und das Möchtegern-Hochhaus ist es. Das Legohaus.“
„Da wohnst du? Wie sind da die Wohnungen?“
„Winzig. Aber ideal für arme Leute, sie sind ziemlich komplett möbliert. Geschnitten wie ein billiges Einzelzimmer im Hotel, aber mit Bett, Schrank, Tisch, Kühlschrank und Bad. Man braucht bloß noch einen Wasserkocher und die Sache ist geritzt.“ Nadja lachte. „Bescheidene Ansprüche!“
Ich zuckte die Achseln. „Sachzwänge. Aber man gewöhnt sich an alles, und für das Geld bekäme ich in München nicht mal ein Bett in der Jugendherberge.“ Vor dem Eingang ließ sich mich mit all meinen Tüten und Taschen aussteigen. „Irgendwann musst du mir die Wohnung mal zeigen. Und du kommst mich auch mal besuchen“, schlug sie zum Abschied vor.
In direkt heiterer Stimmung lief ich den Plattenweg entlang und drückte auf den Liftknopf. Hatte ich jetzt so etwas wie eine Freundin im Kollegium gefunden? Hatte sie mich sechs Wochen lang beobachtet und dann beschlossen, gnädig zu sein? Oder hatte ich ihr Leid getan, weil solche Übelkrähen wie die Bernrieder oder dieser doofe Wallner immer auf mir herumhackten?
Egal, Hauptsache, ich hatte mal Ansprache. Der Schulleiter kümmerte sich offenbar um gar nichts, und der Stellvertreter kannte zurzeit nur eine Sorge: Wo nehmen wir weitere Räume her?
Ich fuhr in den fünften Stock, trabte den Gang entlang und schloss meine Tür auf, die wie alles in diesem Stockwerk in einem unbeschreiblichen Lachsrosa prangte. Die Farbzwänge hier waren gewöhnungsbedürftig – man merkte, dass dieses Haus in den Siebzigern das Allerschickste gewesen war, bunt und pflegeleicht.
Meine Wohnung war wirklich winzig, aber geschickt geschnitten. Im Flur waren rechts zwei Schränke eingebaut, die einiges fassten. Natürlich weiß mit lachsrosa Griffen. Links ging es in ein enges, lachsrosa gekacheltes Duschbad, aber es gab immer heißes Wasser in beliebiger Menge. Wenn ich da an früher dachte, an die Klagen meiner Kommilitonen über ihre verkalkten Boiler... Geradeaus kam das Zimmerchen. Links ein schmales Bett mit angenehm harter Matratze, rechts zwei niedrige Regale und ein Schränkchen, in dem sich ein kleiner Kühlschrank verbarg. Geradeaus, unter dem Fenster mit Blick auf weitere Häuser, kahl werdende Bäume und in der Ferne den Stadtring, der Schreibtisch, jungfräulich leer.
Na, das ließ sich ändern! Ich wuchtete vierunddreißig Fünftklasshefte und einunddreißig Neuntklassmappen auf den Tisch und ärgerte mich wieder über meine schlechte Planung: Bis morgen konnte ich unmöglich fünfundsechzig Aufsätze korrigiert haben!
Vor allem, wenn mich jetzt schon wieder tiefe Lustlosigkeit überkam. Außerdem fiel mir ein, dass ich morgen in der 11 b in Geschichte unbedingt ein Ex schreiben sollte. Dann hatte ich ja noch mehr zu tun! Und die Stunden für morgen hatte ich auch noch nicht vorbereitet. Im Seminar hatte ich völlig andere Klassen gehabt, so dass ich praktisch wieder bei Null anfangen musste, was einen besonders freute, wenn man wusste, dass ein neuer Lehrplan kam und die meisten Materialien, die man bastelte, keine lange Lebensdauer haben würden.
Zwei Uhr war es jetzt. Was war am dringendsten? Ich studierte mutlos meinen Stundenplan: Wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das alles machte, hätte ich mir wenigstens andere Fächer gesucht! Drei Deutschklassen, darunter einen Grundkurs (den hatte ich auch noch nie gehabt), das war wirklich ekelhaft viel zu korrigieren. Aber morgen war ein schöner Tag, fast nur Geschichte! Dann musste ich die Neuntklassmappen heute noch gar nicht machen. Wenigstens nicht fertig machen. Okay, drei Hefte und dann würde ich über das Ex in der 11 b nachdenken. Attische Demokratie... was sollte ich fragen? Nein, erst die Hefte! Unsinn, zuerst mal was zu essen!
Ich strich mir ein Leberwurstbrot und füllte den Wasserkocher. Eine Thermoskanne voller Himbeertee war garantiert das Richtige. Und dann würde ich mit den Heften anfangen, ganz bestimmt.
Es war eine mühsame Arbeit, die allerersten Arbeiten der Fünftklässler strotzten vor Aufbaufehlern und einer mehr als kreativen Rechtschreibung. Auch der Gebrauch von Satzzeichen, den wir doch geübt hatten, war so fehlerhaft, dass ich an meiner Arbeit zu zweifeln begann. Hatte ich den Kleinen so wenig beigebracht? Lieber Himmel, wie mochte dann erst die Schulaufgabe ausfallen! Eine passende Bildergeschichte brauchte ich dafür auch noch. Erst nach den Allerheiligenferien, beruhigte ich mich und griff nach dem nächsten Heft.
Nach vier Heften hatte ich endgültig die Lust verloren und schon über eine Stunde gebraucht. Wenn das so weiter ging, musste ich morgen mit den Kindern etwas anderes machen, für die Besprechung ihrer Machwerke war ich noch nicht bereit.
Ich angelte das Geschichtsbuch und meine Unterlagen aus dem Regal neben dem Tisch und überlegte, was ich morgen fragen konnte. Sie sollten die Organe der attischen Demokratie unseren heutigen Gewalten zuordnen... nein, sie brachten die Gewalten ja doch bloß durcheinander. Gerade deshalb! Das war Grundwissen, ermahnte ich mich und schrieb die Frage auf.
Warum hatte sich die Demokratie als Staatsform langfristig nicht halten können? Das hatten wir ausführlich besprochen. Was versteht man unter Diäten? Wehe, einer schrieb Schlankheitskuren! Was sind Metöken? Und was hielten meine Elftklässler vom exklusiven attischen Bürgerrecht? Was machte ich, wenn sie das gut fanden, weil da nicht so viele Ausländer mitreden konnten? Einen Grundsatzvortrag über die Dummheit solcher Parolen halten? Es taktvoll übergehen? Das musste ich eben riskieren. Ich glaubte nicht, dass sie absichtlich Blödsinn schreiben würden, dazu hatten sie viel zu viel Angst um ihre Noten. Obwohl, so ein Ex – das zählte eigentlich nicht allzu viel. Ich schloss meinen etwas altersschwachen Laptop (vor vier Jahren aus einer Konkursmasse günstig geschossen) an, steckte den Drucker ein und fuhr alles hoch.
Als ich die Angabe getippt und nach einigen Verbesserungen so formuliert hatte, wie ich es an der Seminarschule gelernt hatte, druckte ich sie und fand sie schön. Ich verstaute sie sorgfältig in einer Plastikhülle. Hoffentlich war morgen der Kopierer nicht wieder kaputt.
Die nächsten drei Aufsätze brachten mich wieder zum Ächzen und zu der Frage, warum ich nichts Anständiges gelernt hatte, Friseuse zum Beispiel. Da würde ich doch wenigstens bezahlt! Sieben Stück geschafft, noch nicht einmal ein Viertel – und die hilflose Heftführung zu korrigieren, kostete auch Zeit. Welche Fehler die Kleinen von der Tafel abschrieben! Im Seminar kriegte man nie eine fünfte Klasse, also war man darauf auch nicht vorbereitet.
Morgen hatte ich auch noch die 9c, die 7 d und den Grundkurs in Geschichte... Ich suchte mir Material und ein paar Ideen für den Stundenaufbau über die Verfassung des Kaiserreichs zusammen, steckte die Mappe in die Tasche, quälte mich wieder durch zwei Hefte, rechnete aus, dass ich jetzt über ein Viertel korrigiert hatte, fischte eine fertige, wenn auch grottenlangweilige Stunde über die Grundherrschaft aus meinem Seminarordner, ackerte die nächsten beiden Hefte durch (elf! Mehr als zehn! Fast schon ein Drittel!), suchte nach einem Blatt über die Geschichte der SPD (auch im Kaiserreich), fand es nicht mehr und schrieb es neu, füllte eine Druckkopie mit dem aus, was sich die Kollegiaten selbständig notieren sollten und nahm mir das nächste Heft vor.
Draußen wurde es schon dämmerig, und mir knurrte bereits wieder der Magen. Toll, es war schon fast sechs Uhr, in einer Stunde wäre es dunkel. Und ich hatte gerade mal die Vorbereitungen für morgen geschafft (und das nicht einmal besonders gründlich oder originell) und zwölf Hefte durch. Zwölf von vierunddreißig war schon nicht besonders, aber zwölf von fünfundsechzig – das waren ja nicht einmal zwanzig Prozent! Ich arbeitete wirklich zu langsam, andere schafften das bestimmt in der halben Zeit. Noch vier Stunden, dann musste ich ins Bett. Ich hatte weder mein Konto kontrolliert, ob vielleicht eine freundliche Abschlagszahlung eingegangen war, noch gewaschen – und langsam hatte ich nicht mehr viel anzuziehen, vor allem nicht mehr viel Unterwäsche, weil ich das ganze Wochenende mit den Vorbereitungen für heute, mit einem langen Telefonstreit mit meiner Mutter und mit einer ziemlich notwendigen Putzaktion verbracht hatte, wenn ich nicht gerade geschlafen hatte. Wie müde einen das Unterrichten machte! Noch zwei Hefte, dann konnte ich mir einen Sack Wäsche zusammensuchen, beschloss ich.
Vierzehn! Ich kramte Unterwäsche, T-Shirts und Sweatshirts zusammen, warf auch die Handtücher dazu, in denen schon wieder Make-up-Spuren hingen, suchte mir eine Waschpulvertablette und zwei Euro heraus, quälte mich durch das Heft Nr. 15 und fuhr in den Keller, wo die Maschinen natürlich alle besetzt waren. Also trug ich mich für acht Uhr abends ein und fuhr wieder nach oben.
Frust.
Die zwei Euro würden mir anderswo sicher fehlen, aber waschen musste ich schließlich. Ich hatte noch – nein, erst Heft 16! Heft 16 wies zwar ordentliche und orthografisch korrekte Einträge auf, aber die arme kleine Annika hatte die Bildergeschichte nicht verstanden. Was sollte ich jetzt Einfühlsam-Kritisches hinschreiben, damit sie ihren Fehler erkannte, aber nicht sofort entmutigt wurde? Ich kaute am Rotstift und dachte nach, während es draußen immer dunkler wurde. Endlich hatte ich die passende Beurteilung zusammengebastelt und konnte das Heft zuklappen. Fast die Hälfte - es war aber auch schon fast sieben Uhr. Ich konnte unmöglich weiterhin fast eine Stunde pro Heft veranschlagen, dann wurde ich ja nie fertig.
Gut, noch ein oder zwei, dann durfte ich meinen Kontostand checken. Ich schaffte gerade mal ein Heft (Hurra, immerhin die Hälfte!), dann rief Silvia an.
Mit Silvia war ich zur Schule gegangen. Nach dem Abitur, während ich bei der Einschreibung in der Uni Schlange stand, hatte sie sich als Au-pair-Mädchen nach Paris verzogen. Ich hatte mich damals gewundert, weil mir nie aufgefallen war, dass sie besonders kinderlieb gewesen wäre. Aber sie schrieb glückliche Karten über ihr Leben in einer riesigen Familie in einem besseren Vorort von Paris, irgendwo am Bois de Boulogne, kam nach einem Jahr zurück und war fest entschlossen, auch eine große, glückliche Familie zu gründen. Am besten sofort. Meine Frage, wie es denn mit einer Berufsausbildung aussehe, wurde als irrelevant beiseite gewischt. Kinder, viele Kinder, das war wahre Weiblichkeit. Meine nächste Frage, nämlich wer ihr diesen Quatsch eingeredet habe, führte zu einer gewissen Entfremdung.
Mittlerweile war sie - genau wie ich – achtundzwanzig, verheiratet und Mutter von drei Kindern; Annabelle war sieben, Corinne fünf und Noel zwei. Ich fand die Namen ziemlich affig – vor allem der Kleine würde in der Schule einiges zu hören kriegen. Wie konnte man denn auch das ganze Jahr „Weihnachten“ heißen!
Silvia war auf gerade unverschämte Weise glücklich, mit dem perfekten Mann, den perfekten Kindern, dem perfekten Eigenheim mit perfektem Garten, von der perfekten Bank perfekt finanziert. Beruf hatte sie keinen gelernt, aber sie hatte ja ihren Manfred. Manfred war allerdings eine ziemlich sichere Bank; die Idee, dass dieser Langweiler eines Tages mit einer Jüngeren oder Interessanteren durchgehen konnte, war lachhaft.
Sie berichtete mir zuerst von den klugen Aussprüchen ihrer Kinder, von Annabelles Status als Klassenbeste und zugleich hübschestes Mädchen auf dem Klassenfoto, von Corinnes zahllosen kleinen Verehrern im Kindergarten und der Tatsache, dass Noel schon in ganzen Sätzen sprach. Ich bekundete die erwartete Bewunderung und fragte, wie es ihr selbst denn ging.
„Mir? Na prima natürlich. Und dir? Ist was Passendes aufgetaucht?“
Ich lachte. „Ein Mann? Glaubst du, dafür habe ich momentan Zeit und Geld? Wenn ich dich daran erinnern darf – ich habe gerade eine Planstelle angetreten!“
„Selber schuld. Ich sag dir, wenn man zu Hause bleibt, hat man das schönste Leben. Man kann sich alles selbst einteilen, kreativ sein, sich verwirklichen...“
„Wenn einen dauernd die Kinder unterbrechen?“
„Wieso, vormittags ist doch bloß der Kleine da. Und der kann sich schon sehr nett mit sich selbst beschäftigen. Da habe ich Zeit, Weihnachtsgeschenke zu basteln. Und das Haus zu dekorieren.“
Ich unterdrückte ein abfälliges Schnaufen. Grässliche Vorstellung! Aber das konnte daran liegen, dass ich an Manfred und drei kleine Manfreds dachte, und das reizte mich nun weniger.
„Dass deine Mutter dich gar nicht drängt?“, fuhr Silvia fort. „Ich meine, sie ist doch nun sicher auch in einem Alter, wo sie von Enkeln träumt.“
Göttlich! „Meine Mutter? Die ist knapp achtundvierzig, und ihr letzter einschlägiger Vortrag hatte zum Thema, dass ich mir ja nicht so wie sie mit einem Kind das Leben versauen soll.“
„Was? Großer Gott, wie herzlos! Das ist ja geradezu traumatisierend! Ihr solltet mal eine Familientherapie machen. Manfreds Eltern hab ich das auch empfohlen, und die sind jetzt wieder richtig glücklich miteinander.“
„Bei uns hilft das nichts. Ich hab kein Interesse an einer innigen Mutter-Tochter-Beziehung, und meine Mutter auch nicht. Silvia, nicht jeder steht auf Familienglück.“
„Doch. Manche geben es bloß nicht zu, weil sie das uncool finden oder glauben, dass sie ohnehin niemanden abkriegen. Eva, du siehst doch richtig nett aus! Wenn du dich ein bisschen herrichtest... und kochen kannst du doch auch... ich glaube, ich wüsste da schon den Richtigen für dich. Hartmut, ein Kollege von Manfred. Sichere Position, kinderlieb – und schaut eigentlich ganz nett aus. Ein bisschen kahl vielleicht, aber man sagt ja, dass solche Männer ihre Qualitäten haben.“ Sie kicherte anzüglich.
Ich grinste über Silvias matten Versuch, zweideutig zu werden. „Lass stecken. Ich brauch im Moment wirklich keinen Mann, ich wüsste echt nicht, wann ich für den Zeit haben sollte. Du, Silvia... hier stapeln sich die Hefte, ich muss die heute noch durchkriegen. War nett, mal wieder von dir zu hören. Wenn ich ein bisschen Luft habe, dann treffen wir uns mal wieder.“
„Unbedingt! Du hast die Kinder ja schon so lange nicht mehr gesehen, du wirst staunen!“
„Bestimmt“, heuchelte ich Begeisterung und verabschiedete mich. Danach starrte ich eine Zeitlang untätig vor mich hin. Mann und Kinder statt der Quälerei mit diesem Kollegium? In der Schule stand mir nicht einmal ein Stuhl zu, bei einem Mann hätte ich eine eigene Küche... nein, trotzdem nicht. So scharf war ich nicht auf Hausarbeit, und mit Kindern konnte ich mir auch noch etwas Zeit lassen. Erst einmal richtig in dieser Schule anerkannt sein!
Energisch machte ich mich über Heft 18 her und schaffte sogar noch Nummer 19, bevor ich mir doch meinen Kontostand anschaute. Deprimierend! Natürlich war kein müder Cent eingegangen, nur einiges abgebucht worden. Und der Kontostand lag bei 3.864 Euro und ein paar Zerquetschten. Im Minus, das verstand sich von selbst.
Noch von einer kurzen Phase nach dem ersten Examen, in der ich einen ebenso lukrativen wie anstrengenden Job in einer Werbeagentur gehabt hatte, lag mein Disporahmen bei viertausend Euro. Erstens hatte ich diese Grenze schon fast erreicht und zweitens würde es ewig dauern, das wieder abzuzahlen.
Ich nahm mir einen Zettel und rechnete herum. Schätzungsweise Ende November würde ich eine Abschlagszahlung bekommen. Gehalt für zweieinhalb Monate... vielleicht siebentausend brutto, sie würden mehr als die Hälfte als Steuern einbehalten, also vielleicht drei netto... Wenn ich, wie Nadja es mir geraten hatte, sofort im Januar meine Steuererklärung machte, bekam ich vielleicht tausend Euro im Spätsommer zurück (schließlich wollten die ja erst noch daran was verdienen). Schätzungsweise würde ich ab Dezember eineinhalb tausend Euro im Monat kriegen, oder? Als Referendarin hatte ich achthundert verdient, und eine Studienrätin musste doch etwas mehr bekommen, vermutete ich. Miete... zweihundertfünfzig. Krankenversicherung wohl genauso. Sonstige Nebenkosten vielleicht zweihundert. Dann blieben mir noch etwa achthundert übrig. Davon musste ich leben und meine Schulden bezahlen.
Im Moment kam ich ganz gut mit fünf Euro am Tag aus. Gut, zweihundert im Monat. Blieben sechshundert übrig. Fünfhundert sollte ich zur Abzahlung verwenden, dann wäre ich etwa im Juli auf Null. Und für hundert vielleicht einen Sparvertrag, einen sicheren Fonds oder so etwas.
Dann könnte ich am Schuljahrsende im Plus sein und ein Vermögen von rund dreihundert Euro besitzen. Nach dem nächsten Schuljahr hätte ich schon fünfzehnhundert. Und ich könnte etwas üppiger leben.
Ja, sehr nett, aber zum einen sollte ich jetzt endlich das nächste Heft aufschlagen, und zum anderen brauchte ich bis Ende November auch noch etwas Geld. Der Bank konnte ich keine Storys mehr erzählen, und bei der Bezügestelle wurde ich doch nur angeschnauzt, weil ich nicht kostenlos arbeiten wollte.
Ich musste etwa fünfhundert Euro auftreiben. Sparbücher besaß ich schon längst keine mehr, und andere Wertsachen? Ein bisschen Schmuck, noch von der Firmung her. Wahrscheinlich war das Zeug gar nichts wert, aber bevor ich mich an Zinsen dumm und dämlich zahlte... Irgendwo war noch der kunstvoll verzierte Zuckerlöffel von Tante Rotraut. Ich suchte im Schrank herum und fand ihn schließlich in meinem winzigen Schmuckkasten, zusammen mit einem kitschigen Kreuz, das ich ohnehin nie tragen würde, und zwei goldenen Ringen mit winzig kleinen Saphir- und Diamantsplittern.
Morgen würde ich nach der Schule mal zu diesem Gold An-und Verkauf gehen. Vielleicht war der ganze Kram doch wenigstens einen Hunderter wert? Und die beiden Bildbände über China und Brasilien... vielleicht gab es für jeden noch einen Fünfer?
Es war mittlerweile fast acht; ich packte meinen Wäschesack und fuhr nach unten. Bis die Maschine fertig war, musste ich wenigstens die nächsten drei Hefte geschafft haben, nahm ich mir vor, als ich das Zweieurostück einwarf.
Verdammt, woher konnte ich noch Geld bekommen?
Da mich diese Frage deutlich mehr beschäftigte als die Erzähltechnik meiner 5 c, brauchte ich tatsächlich die ganze Stunde, um in den Heften wenigstens bis zweiundzwanzig zu kommen. Mittlerweile war ich auch so müde, dass ich gar nicht mehr unterscheiden konnte, was im aktuellen Heft stand und was die anderen Kinder geboten hatten. Und immer wieder kehrende Fehler („er kamm“ zum Beispiel) übersah ich schon, weil ich mich daran gewöhnt hatte.
Entnervt warf ich den Rotstift hin und fuhr hinunter, die Wäsche holen. Sobald sie auf dem Gestell hing, das nun das letzte bisschen Platz in meinem Zimmer beanspruchte, riss ich mich zusammen. Los, ich hatte schon fast zwei Drittel! Und Hunger, leider. Na gut, ein schrumpeliger Apfel war noch da – man sollte ja abends nicht so schwer essen. Für schweres Essen hatte ich wirklich kein Geld – einen Vorteil hatte meine Finanznot also, ich hatte schon zwei Kilo abgenommen und war jetzt wirklich toll dünn.
Bis sechsundzwanzig kam ich noch, dann schlief ich fast am Schreibtisch ein. Zerschlagen fuhr ich aus dem Dösen wieder hoch und beschloss, ins Bett zu gehen. Vielleicht schaffte ich die übrigen acht ja noch morgen früh, schließlich hatte ich in der ersten Stunde frei. Wenn ich ganz früh aufstand und mich gleich an die Arbeit machte...
DI, 21.10.2003
Ich schaffte es tatsächlich, wenn auch nur mit Müh und Not und in übler Laune, weil auch noch mein Duschgel zur Neige ging. Zu Aldi musste ich also auch mal wieder und dort das Billigste kaufen, was ich finden konnte. Ich strich mir zwischen zwei Heften schnell ein Brot mit dünner Leberwurst und packte es ein, dann eilte ich mit Schultasche und Jutesack voller Hefte zum Bus, stieg am Stadtring um und fuhr zur Schule. Zehn nach acht.
„Sie kommen aber spät“, begrüßte mich die Bernrieder schon an der Lehrerzimmertür. „Ich fange erst zur zweiten Stunde an“, verteidigte ich mich.
„Na und? Pflichtbewusste Kollegen treten jeden Morgen um sieben an. Mir scheint, Sie nehmen diesen Beruf nicht ernst genug. Das ist hier kein billiger Job.“
„Ein billiger Job würde aber wenigstens bezahlt“, fuhr ich sie an und drängte mich an ihr vorbei. „Was wollen Sie damit denn behaupten?“, fragte sie scharf. „Dass ich bis jetzt von diesem Scheißstaat noch keinen Cent gesehen habe. Wenn das so weiter geht, muss ich mir wirklich einen Job suchen. Einen richtigen Job“, fügte ich hinzu.
„Und was ist das, was Sie hier angeblich tun?“
„Eine ehrenamtliche Tätigkeit“, schnappte ich und begann in gebückter Haltung meine Tasche auszupacken. „Was machen Sie denn da? Sie können ihren Krempel doch hier nicht im Weg stehen lassen! Dass junge Kollegen so gar keinen Sinn für Rücksicht haben...“
„Und wo soll ich mit meinem Zeug hin? Ich habe weder einen Platz am Tisch noch einen Stuhl, von einem Schränkchen ganz zu schweigen.“
„Mein Gott, nehmen Sie Ihren unordentlichen Kram eben mit in den Unterricht und bauen Sie hier keine Stolperfallen. Und ein Job, wie Sie sagen, kommt gar nicht in Frage. Nebenberufliche Tätigkeiten müssen Sie genehmigen lassen, und ich werde dafür sorgen, dass Dr. Silberbauer Ihnen diese Genehmigung versagt. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre Arbeit, das schadet Ihnen bestimmt nicht.“
Ich stand da in meinem schäbigen Anorak, beide Taschen umgehängt, und rührte mich nicht. „Und wovon soll ich meine Miete zahlen?“
„Tja... wenn Sie voreilig bereits eine Wohnung mieten, bevor Ihre Position amtlich ist – das ist ja wohl nicht unser Problem, oder? Dass die jungen Leute immer sofort ihre Eltern im Stich lassen müssen... was stehen Sie so dumm da?“
Ich antwortete nicht, sondern starrte aus dem Fenster und hoffte, mich so weit bezähmen zu können, dass ich weder zu heulen anfing noch dieser dummen Schnepfe die verdiente Ohrfeige verpasste.
„Hören Sie nicht? Warum stehen Sie hier so dämlich herum?“
„Was ist denn hier los? Warum setzen Sie sich nicht, Frau Prinz?“ Der Stellvertreter, Jörndl. „Wohin denn? Ich habe hier keinen Platz, und da ich meine Taschen nicht abstellen darf, bleibe ich jetzt hier im Anorak stehen, bis es endlich läutet und ich in meine Klasse gehen kann.“
„Ach so? Naja, dann... Frau Bernrieder, was dieses Sprachlabor betrifft, daraus könnte man ein wunderbares Klassenzi -“
„Kommt nicht in Frage“, unterbrach sie ihn. „das Sprachlabor ist vor wenigen Jahren für teures Geld eingerichtet worden. Daraus machen Sie kein Klassenzimmer!“
„Aber niemand benutzt es! Es ist dreißig Jahre alt! Und wir brauchen den Raum dringendst!“
„Lösen Sie den Videoraum auf. Die ewige Fernseherei ist sowieso schädlich für die Kinder. Und Sie scheren Sich jetzt hier endlich aus dem Weg!“, fuhr sie mich an.
„Der Videoraum wird aber wenigstens genutzt. Und es gibt auch gute Dokumentarfilme“, wandte Jörndl schwächlich ein. Ich stellte mich in eine Ecke, im Anorak schwitzend, und wunderte mich. Wer war hier eigentlich der Chef? Wieso sagten er und Silberbauer nicht einfach: „Das Sprachlabor kommt weg, basta!“
„Mir egal. Das Sprachlabor bleibt. Sie sind ja immer noch da!“
„Wo soll ich auch hin?“, fuhr ich sie an.
„Wir sollten hier noch zwei Tische aufstellen“, dachte Jörndl halblaut nach.
„Nein!“, fauchte die Bernrieder. „Hier ist es voll genug, man kann sich schon kaum noch bewegen, auch ohne dass sich unverschämte neue Kollegen unnötig breit machen.“
„Blöde Kuh“, dachte ich mir. „Wenigstens ein paar zusätzliche Stühle“, schlug Jörndl vor. „Überflüssig!“, behauptete sie, zornrot im Gesicht.
Ich überlegte, was ich der Frau eigentlich getan hatte. Seit der allerersten Konferenz am so genannten nullten Schultag konnte sie mich nicht ausstehen.
„Ach Quatsch“, sagte jemand hinter mir. „Neben mir ist noch ein bisschen Platz. Herr Jörndl, ein paar zusätzliche Stühle wären wirklich nicht schlecht.“
Ich drehte mich um. Frau Tetzner, Latein und Englisch. Sehr mütterlich und ein bisschen verschusselt, soweit ich es bisher mitbekommen hatte. Ich lächelte sie an. „Das wäre natürlich toll. Ich würde Sie auch gar nicht stören, nur meine Sachen aufstapeln. Viel Platz bräuchte ich auch nicht, ganz bestimmt. Korrigieren tue ich zu Hause.“
„Ich sag´s dem Hausmeister!“
Jörndl entfloh, anscheinend hatte er Angst vor der Bernrieder. Sie war aber auch eine formidable Erscheinung: groß, gut aussehend, blondtoupiert, kühle blaue Augen, die arme Schüler sicher in Panik versetzen konnten. Ich schätzte sie auf Anfang vierzig – warum redete sie immer daher, als hätte sie in den Siebzigern hier schon unterrichtet? Sprachlabor – das war doch völlig veraltet, so wie programmiertes Lernen.
Die Tetzner zeigte mir ihren Platz und schob einen Stapel Metamorphosen und mehrere Schulaufgaben, Extemporalien und Rundschreiben zusammen. „So, hier können Sie ihre Sachen ablegen! Fühlen Sie sich ruhig wie zu Hause!“ Selig stellte ich Tasche und Jutebeutel ab und zog endlich den viel zu warmen Anorak aus, hängte ihn in den Schrank (natürlich ohne Bügel, die gehörten bestimmt alle der Bernrieder) und rannte, um die Angabe für die 11 b zu kopieren. Kaum war ich damit fertig, läutete es auch schon. Viertel vor neun, Beginn der zweiten Stunde.
Gott sei Dank! In den Klassenzimmern fühlte ich mich wirklich wohl. Dass ich nach der großen Pause wieder eine Freistunde hatte, stellte direkt ein Problem dar. Ich konnte noch einiges kopieren, aber es war zum Beispiel nicht möglich, schon mit der Korrektur des Extemporale zu beginnen, weil in dieser Stunde Frau Tetzner ihren Tischanteil selbst brauchte. Also streifte ich etwas herrenlos herum, las, was am schwarzen Brett hing (das meiste stammte noch aus dem letzten Schuljahr) und beobachtete unauffällig die herumsitzenden Kollegen. Meine Geißel, Frau Bernrieder, war glücklicherweise im Unterricht.
Frau Neumeister und Frau Geppner unterhielten sich über die örtlichen Großmärkte und die alte Frage Öko oder superbillig?, klagten dann über ihre miesen Gehälter, wie sie sich aus Steuerklasse V ergaben und verglichen, welcher Ehemann die bessere Karriere gemacht und wessen Kinder die schlaueren waren.
Wallner korrigierte etwas. Ich beobachtete ihn unauffällig. Direkt hässlich war er nicht, und ganz offensichtlich auch nicht besonders alt, vielleicht Anfang dreißig. Wieso hatte so jemand es nötig, Anfänger zu schikanieren? Konnte er sich nicht mehr an seine eigene Anfangszeit erinnern?
Jörndl saß in einer Ecke und starrte – eigentlich wie immer – stirnrunzelnd auf den Raumplan. Suchte er immer noch nach zusätzlichen Klassenzimmern, damit die Zehnten nicht mehr wandern mussten? Wieso konnte die Bernrieder ihn so abbürsten? War er denn in solchen Fragen nicht weisungsbefugt? Die Bernrieder schien hier so etwas wie eine heimliche Chefin zu sein, aber warum, verstand ich nicht. Eine besondere offizielle Funktion besaß sie nicht, sie war nicht Fachbetreuerin (das hätte mir auch gerade noch gefehlt, sie gab nämlich wie ich Deutsch und Geschichte, und außerdem noch Englisch) und keine Mitarbeiterin im Direktorat. Dort gab es zwar eine Frau, Anne Hausmann, nicht viel älter als ich, aber die war seit Schuljahrsanfang krank, ich hatte sie noch gar nicht gesehen.
Die Bernrieder machte sich anscheinend hauptsächlich generell wichtig und war außerdem für den Schüleraustausch zuständig. Na, hoffentlich benahm sie sich im Ausland etwas verbindlicher!
In einer anderen Ecke saß Herr Kelchow und las irgendetwas Französisches. Schöner Mann, wirklich. Braune Haare, exzellent geschnitten, an den Schläfen dekorativ angegraut, markante Züge. Und immer so toll angezogen! Alle anderen trugen Jeans, T-Shirt oder Sweatshirt und darüber vielleicht noch ein Jackett, er aber war in einen richtigen Anzug gekleidet, anthrazit mit passendem blassgrauem Hemd und einer grausilbernen Krawatte. Mit Krawattennadel! Sehr elegant.
Er sah auf, als hätte er meinen Blick gespürt, sah blicklos durch mich hindurch und senkte die Augen wieder. Ich war für so einen wohl gar nicht vorhanden? Oder er fand mich schrecklich, was mein Outfit betraf. Gut, ich hatte nun mal rote Haare und ziemlich wilde Locken, aber ich hatte sie doch sowieso schon zurückgebunden. Und Jeans, T-Shirt und einen Blazer trug ich auch. Was hätte ich auch sonst anziehen sollen, so viel gab mein Schrank gar nicht her. Ein Kostüm, wie es die Bernrieder zu tragen pflegte, hatte ich überhaupt nicht, so etwas hatte ich mir nicht einmal fürs Mündliche leisten können. Für die Schule hatte ich drei Hosen, zwei Blazer und einen kleinen Stapel bessere T-Shirts. Die älteren und die Jeans mit der aufgescheuerten Innennaht waren fürs Wochenende gedacht. Für den Januar hatte ich noch zwei Wollpullis in Reserve und für ganz heiße Sommertage ein Blümchenkleid, zu dem ich aber keine passenden Schuhe besaß. Damit war meine Garderobe fertig umrissen.
Aber deshalb musste der Kelchow nicht so tun, als existierte ich nicht!
Die Tetzner lächelte mir zu und vertiefte sich wieder in ihre Korrekturen. Kurz vor dem Ende der Freistunde kam Nadja herein, winkte mir zu und ließ mit einem theatralischen Seufzer einen Stapel Biologiebücher auf einen Tisch fallen.
„Dort sitzt aber Herr Geyer“, monierte Kelchow sofort.
Nadja strich sich die dunklen Haare aus der Stirn. „Im Moment aber nicht, also kann ich den Stapel hier ja wohl parken, bis der Hausmeister zwei Zusatztische aufgestellt hat. So pingelig ist Herr Geyer nun auch wieder nicht.“
Kelchow musterte sie mit gerunzelter Stirn – nicht einmal das entstellte ihn – und vertiefte sich wieder in sein Buch. Die Tür ging auf und Verena Ernst kam herein. „Hi, Nadja. Ich sag dir, diese 8a... unglaublich, die haben bis heute das Ausklammern nicht verstanden. Aber keiner von diesem kuhäugigen Haufen! Guck dir das mal an!“ Sie glitt anmutig zu Boden und begann in ihrer Tasche zu wühlen. Die Bernrieder kam kurz nach ihr herein und zeterte sofort los: „Müssen Sie sich so ordinär auf dem Boden wälzen? Das ist hier doch keine Peepshow!“
Die Ernst sah lieblich zu ihr auf, die langen schwarzen Haare umwallten sie dekorativ. „Kennen Sie sich mit Peepshows so gut aus? Im Übrigen sitze ich hier exakt in der Pose der kleinen Seejungfrau, und der werden Sie doch wohl nichts unterstellen wollen?“
Aus der Ecke, in der Wallner saß, kam ein leises Prusten, aber als ist kurz hinsah, korrigierte er immer noch völlig absorbiert. Musste wohl ein unterdrückter Nieser gewesen sein. Nadja fügte nachdenklich hinzu. „Hat man die kleine Seejungfrau nicht vor kurzem in die Luft gesprengt? Vielleicht war das jemand, dem sie zu ordinär war, so wie sie da mitten im Hafen saß... waren Sie damals nicht gerade in Kopenhagen, Frau Bernrieder?“
Die Bernrieder schnaubte entrüstet und breitete ihren Kram auf ihrem persönlichen Platz aus, der gut für drei Leute gereicht hätte. Die Ernst sah ihr immer noch mit lieblicher Miene nach. Das konnte sie gut, das war mir schon aufgefallen – ein Gesicht wie die Herzkönigin, nur das spöttische Funkeln in den Augen passte nicht dazu. In ihrem schwarzen Anzug saß sie wirklich in fast königlicher Haltung da, es fehlte bloß noch ein Glas Champagner statt des Matheheftes in der erhobenen Hand. Ich amüsierte mich still; laut zu lachen traute ich mich nicht, um den Zorn der Bernrieder nicht auf mich zu ziehen.
Den erregte jetzt Nadja, weil ihre Biobücher auf Geyers Platz lagen.
„Das habe ich ihr auch schon gesagt“, meldete Kelchow sich sofort zu Wort.
„Der Franz ist doch die ganze Woche auf Fortbildung“, mischte sich die Tetzner ein, „da hat er bestimmt nichts dagegen, wenn der arme heimatlose Nachwuchs seinen Platz kurz ausleiht. Aber der Hausmeister bringt ja nachher ein paar weitere Tische.“
„Was?“, regte sich Bernrieder sofort wieder auf. „Ich hab doch deutlich gesagt, dass ich dagegen bin!“
„Roma locuta, causa finita ?“, ließ sich Jörndl in seiner Ecke vernehmen. „Manchmal gibt es eben wichtigere Erwägungen als Ihre persönlichen Vorlieben, Frau Bernrieder.“ Sie starrte ihn mit einem Blick an, unter dem er eigentlich zu Stein hätte erstarren müssen. Ich erwartete, jeden Moment Schlangen aus der wohltoupierten Frisur züngeln zu sehen. Jörndl schluckte, starrte aber tapfer zurück. Der erste Sklave muckte auf? Das war ja hochinteressant!
„Das Zimmer ist aber tatsächlich schon ziemlich überfüllt“, gab Kelchow zu bedenken und warf der Ernst, Nadja und mir einen angewiderten Blick zu.
„Und, was soll ich machen? Alle jungen Kollegen entlassen? Jeder muss hier einen Platz haben. Wenn Sie großzügige Weite wünschen, bauen Sie zu Hause Ihre Arbeitszimmer um. Das Albertinum platzt aus allen Nähten, und das macht vor dem Lehrerzimmer auch nicht Halt. Ich kann´s nicht ändern. Und, Frau Bernrieder -“
„Was denn jetzt noch? Haben Sie nicht schon genug Unheil angerichtet?“, fauchte die zurück. „Das Sprachlabor wird aufgelöst. Anweisung vom Chef.“ Damit stand er auf und wandte sich zur Tür. „Was?“ Das war ein eindeutiges Kreischen. Bröckelte jetzt die damenhafte Tünche? Ich hatte mir ja immer schon gedacht, dass die Megäre bei der Bernrieder verdammt schnell zum Vorschein kam!
„Ich geh sofort zum Chef!“ Jörndl grinste in der Tür. „Der ist bis Donnerstag weg. Direktorentagung. Tut mir ehrlich Leid.“
Wir alle starrten die Bernrieder an und warteten darauf, dass schwarze Wölkchen aus ihren wohlgeformten Ohren quollen, aber wir wurden enttäuscht. Sie straffte sich, packte allerlei Kram in ihren schicken Aktenkoffer und verließ das Lehrerzimmer – in tadelloser Haltung.
Ich sah auf die Uhr. Noch zwei Minuten. Dann sollte ich wohl auch mal...
Mit der neunten Klasse hatte ich wie immer viel Spaß. Sie stellten sich zwar bei der Diskussion über die Vor- und Nachteile der Verfassung von 1871 ein bisschen dumm an und hatten von Wahlrecht noch keinen Schimmer, aber sie bemühten sich redlich und stellten eine Menge Fragen, die ich geduldig beantwortete. Wir trugen Mehrheitswahlrecht, Verhältniswahlrecht und Gewaltenteilung ins Grundwissenheft ein, verfassten einen übersichtlichen Hefteintrag und studierten zwei Quellen, dann enteilte ich, um der Siebten die Freuden der Grundherrschaft nahe zu bringen. Keine leichte Aufgabe – einen normalen Zwölfjährigen konnte das eigentlich nicht interessieren.
Den Fronhof malten sie noch gerne ins Heft. Sie sammelten auch noch willig Einzelheiten zum Leben des abhängigen Bauern aus einem Text im Buch, aber dann kam doch die unvermeidliche Frage: „Wozu brauchen wir´n das?“
„Stellt euch mal vor, jemand macht euch so ein Angebot. Keine Sorgen mehr, ihr werdet ernährt, aber dafür müsst ihr ab und zu für euren Schutzherrn arbeiten.“
„So was wie Schutzgeld?“, fragte Tobias.
„Ja, so ähnlich. Die Mafiastrukturen sind wohl gar nicht so anders. Würdet ihr euch darauf einlassen?“
Hm... Darüber mussten sie erst nachdenken, was aber sehr schnell nach dem Motto Ich hab da mal ´nen Krimi gesehen, da haben sie lauter Chinalokale abgefackelt, weil die Besitzer nicht zahlen wollten aus dem Ruder lief. Ob die Grundherren ihre Bauern auch abgefackelt hätten, wollten sie dann wissen.
„Nein. Den Hof konnten sie doch noch brauchen, für einen anderen Bauern, und den ungehorsamen Vorpächter rauswerfen. Dann konnte er verhungern. Oder doch in den Krieg ziehen. Das war ja wohl hart genug.“
Nein, nicht für die Siebtklässler. Die wollten Blut sehen! Alles in allem eine amüsante Stunde, und sie hatten tatsächlich was zum Nachdenken. Allerdings war ich mir sicher, dass ich bei der nächsten Ausfrage mehr über Chinalokale als über Fronhöfe zu hören kriegen würde. Das Lernziel wohl doch nicht ganz erreicht?
Bis Viertel nach eins unterhielt ich mich im fast ausgestorbenen Lehrerzimmer mit Nadja, die ebenfalls auf ihren Nachmittagsunterricht wartete, über die Frage, wer das Duell gewinnen würde – Jörndl oder Bernrieder. Nadja setzte auf die Bernrieder: „Die hat bis jetzt noch jeden klein gekriegt. Wie, weiß ich auch nicht.“
„Die reinste Medusa“, seufzte ich, „aber der Jörndl war doch wirklich tapfer. Ich setze auf ihn.“
„Um einen Müsliriegel?“
Das war ein fairer Einsatz. „Medusa ist ein guter Name für die Bernrieder“, fand Nadja dann. „Man braucht hier ohnehin für alle Leute Decknamen, sonst kann man sich das Maul nicht in Ruhe über sie zerreißen.“
„Was hast du jetzt noch?“
„K 13, Grundkurs Chemie. Ich hoffe bloß, ich kann noch allen ausreden, ausgerechnet in Chemie schriftlich Abitur zu machen. Die sind so nett, alle miteinander – aber absolut nicht vorzeigbar. Lieb, aber schlicht. Verwechseln Fettsäuren mit Fetten, können kein Periodensystem lesen... ein Trauerspiel. Na, wenigstens tauchen sie im Allgemeinen pünktlich und vollzählig auf.“
„Meine sind ziemlich gut. Ein paar haben wirklich politisches Interesse und stellen intelligente Fragen. Ein paar Dumpfbacken sitzen natürlich auch in der letzten Reihe. Geschichte ist ja Pflicht.“
Nadja nickte. „Und Chemie erspart einem Physik. Du schleppst immer ein paar Desinteressierte mit. Die sitzen hier warm und trocken ihre Zeit ab und kassieren am Ende ihr Abitur fast für lau. Irgendwas stimmt am System nicht.“
Da hatte sie leider nicht ganz Unrecht. Ich sah auf die Uhr und machte mich auf in den obersten Stock, in dem mein Grundkurs auf mich wartete. Die lobenden Worte hätte ich mir sparen können, ärgerte ich mich hinterher, heute hatten die Leistungskurse Mathe und Griechisch Klausur geschrieben, und fast alle meine Teilnehmer waren unkonzentriert und studierten immer noch voller Reue ihre Angaben. An Bismarcks Politik hatten sie heute kein Interesse.
Hinterher stopfte ich wieder alles in meine Tasche, holte im Lehrerzimmer meinen Anorak und schleppte mich zur Bushaltestelle. Ich war schon wieder reif für ein Mittagschläfchen, aber vorher musste ich unbedingt meine letzten Schätze verkaufen und den Erlös auf mein Konto einzahlen. Und die Aufsätze der Neunten lagen auch noch herum, die wollte ich ihnen doch morgen zurückgeben... Und das Ex aus der Elften... gut, die hatte ich erst wieder am Freitag in der achten Stunde. Hatten andere Leute eigentlich auch so einen unmöglichen Stundenplan?
Der Bus kam, und sobald ich eingestiegen war, merkte ich, dass in der letzten Reihe ein Penner überwinterte. Es roch mehr als streng, aber der arme Kerl tat mir doch Leid, also beschwerte ich mich nicht. Ich beschränkte mich darauf, mir einen Platz möglichst weit vorne zu suchen und aus der Anoraktasche ein uraltes, aber extrastarkes Pfefferminz zu fischen, das meinen Geruchssinn vorübergehend lahm legte. Wach machte es auch, stellte ich erfreut fest, stieg am Bahnhof mit neuer Munterkeit um und erwischte tatsächlich noch den Zwölfer nach Selling.
Der Inhaber des Gold- und Silberankaufs betrachtete meine gesammelten Schätze eher verächtlich. „Das ist nur ganz dünnes Gold“, behauptete er von den beiden Ringen. „Und die Steine – das sind ja nur Brösel. Der Zuckerlöffel ist ganz nett, aber Interessenten gibt es dafür zurzeit auch kaum. Sie wissen ja, die Wirtschaftslage. Geht Ihnen wohl selber so?“
„Nicht direkt. Ich arbeite beim Staat, aber der zahlt nicht.“
„Dann könnten Sie Ihre Erbstücke doch auch einfach verpfänden und wieder auslösen, wenn Sie Ihr Gehalt gekriegt haben“, schlug er vor.
Ich überlegte kurz. „Nein. Die bucklige Verwandtschaft hat nie was für mich getan, außer das bisschen Tand abgedrückt, wenn es gar nicht anders ging, und außerdem sind sie alle längst tot und ich mag keinen unnützen Kram rumliegen lassen.“ Ich raffte meine Schätze wieder zusammen. „Können Sie mir jemand anderen empfehlen, der daran Interesse hätte?“
„Ich habe nicht gesagt, dass ich kein Interesse hätte. Ich kann nur nicht besonders viel zahlen. Der Materialwert ist nicht eben berauschend. Hundertsiebzig, insgesamt?“
„Zweihundert“, versuchte ich mich im Feilschen. Er zog verächtlich die Oberlippe hoch. Für ein gut sitzendes Gebiss reichten seine Einkünfte offenbar nicht – was waren das denn für Draculazähne?
„Hundertachtzig“, bot er mir an.
Wir einigten uns auf hundertfünfundachtzig, ich schob ihm die letzten Reste Familienbesitz über den Tresen und sortierte die verknitterten Euroscheine sorgfältig ein, dann bedankte ich mich strahlend und eilte zur Bank, wo ich hundertfünfzig Euro sofort auf mein Konto einzahlte. Fünfunddreißig durfte ich behalten, einundzwanzig hatte ich noch gehabt, machte sechsundsiebzig, also den Lebensunterhalt für fünfzehn Tage. Damit musste ich also bis zum fünften November hinkommen. Wenn ich natürlich pro Tag nur vier Euro ausgab, würde ich bis zum neunten November reichen. Zu essen und zu trinken hatte ich noch – ach ja, Duschbad!
Bei Aldi gab es eine Riesenflasche für 99 Cent, Klasse!
Ich eilte beschwingt nach Hause, angelte mir die kleine Blechdose aus dem Regal, die ein englisches Cottage darstellen sollte – Mitbringsel von irgendeiner Tante aus meinen Kindertagen – stellte fest, dass sie außer ein paar Staubflusen und einer verbogenen Büroklammer nichts enthielt, säuberte sie und legte drei Euro und einen Cent hinein. Wenn ich den Überschuss jeden Tag aufhob – vielleicht reichte ich sogar bis Mitte November? Mein Konto würde das allerdings auch nicht retten. Vielleicht, wenn ich eine Schulbescheinigung bei der Bank vorlegte? Aber wahrscheinlich würde mich Silberbauer nur irritiert mustern. Der schwebte derartig über alltäglichem Kleinkram, er wusste wahrscheinlich gar nicht, was ein Bankkonto war. Jedenfalls sah er aus wie einer, der die niederen Dinge von seiner Frau erledigen ließ.
Ich beschloss, trotzdem morgen einmal nachzufragen. Jetzt stand aber Korrigieren auf dem Programm! Das übliche Leberwurstbrot kauend, machte ich mich an die Mappen, monierte die schlampige Heftführung, fehlende bzw. unausgefüllte Arbeitsblätter und die zum Teil recht klägliche Gestaltung der Protokollversuche. Spaß machte das keinen, und als ich die Hälfte durchhatte und feststellen musste, dass es schon wieder dunkel war, kam ich mir schon sehr ausgebeutet vor. Alle anderen hatten jetzt Feierabend – und ich? Ich hatte noch fünfzehn Mappen vor mir.
Kleine Pause! Hatte ich nicht irgendwo eine Liste des Kollegiums? Wo wohnten Nadja und Verena Ernst eigentlich? Und diese unsägliche Bernrieder? Ich suchte in meiner allgemeinen Mappe herum und förderte die Liste schließlich zutage. Name, Vorname, Dienstrang, Adresse, Telefon, Autokennzeichen – damit sich kein Unbefugter auf dem Lehrerparkplatz breit machte, wahrscheinlich. Nadja Thiemig, StRin, Tiepolostraße 13. Gar nicht so weit weg, zwischen Bahnhof und Malerviertel. Die bezog ja auch schon mindestens seit zwei Jahren ein anständiges Gehalt, da konnte man sich schon eine menschenwürdige Wohnung leisten.
Verena Ernst, StRin z.A., Welsergasse 9. Aha, ein Altstadtfreak. Auch nicht schlecht. Was die Wohnung taugte, konnte man daraus allerdings nicht ablesen, in den Gassen der Altstadt gab es billige, unrenovierte Altbauten genauso wie wunderbar sanierte Riesenwohnungen mit Stuckdecken, imposante Penthousewohnungen und Lofts mit Parkett und Lastenaufzug.
Christa Bernrieder, OStRin, Benediktsweg 4. Das musste in Mönchberg sein. Auch nicht schlecht.
Und ich hauste in diesem winzigen Kabuff in Selling! Andererseits war die Wohnung echt billig und eigentlich ganz nett. Das Haus war in einigermaßen gutem Zustand, wenn auch nicht mehr so wie in den Siebzigern, die Nebenkosten waren niedrig, und der Bus hielt fast vor dem Haus. Außerdem gab es um die Ecke einen Aldi und einen billigen Drogeriemarkt, dazu eine der vier Städtischen Bibliotheken Leisenbergs. Was wollte ich eigentlich mehr? Vollgestopft war die Wohnung auch nicht gerade, weil ich ja kaum etwas besaß. War das nicht ein ziemlich wünschenswerter Zustand? Die Buchhandlungen waren voll von „Entrümpeln Sie Ihr Leben“ - Ratgebern: das Geld konnte ich mir schon mal sparen!
Bügeln sollte ich allerdings.
Nein, erst die nächsten – naja, fünf Mappen. Ich quälte mich von Mappe zu Mappe, entwarf zwischendurch eine Deutschstunde für die Neunte und durfte schließlich mein Bügelbrett aufbauen. Radio hörend bügelte ich meine T-Shirts, räumte alles weg und nahm mir die nächsten fünf Mappen vor.
Hunger! Was hatte ich denn noch im Haus? Ein paar Fertigsuppen, einige Fünfminutenterrinen, die mal im Sonderangebot gewesen waren, Brot und Leberwurst, einen halben Beutel geschälte Minikarotten.
Ich steckte den Wasserkocher ein und riss eine der Terrinen auf, dann kehrte ich mit den Karotten an den Schreibtisch zurück und korrigierte lustlos weiter. Wie sollte das bloß weiter gehen? Ich war noch nicht einmal auf Lebenszeit verbeamtet (das dauerte ja auch noch drei Jahre) und hasste das Korrigieren jetzt schon?
Schluss mit dem Selbstmitleid! Ich war freiwillig Deutschlehrerin geworden, jetzt musste ich da eben durch. In Zukunft würde ich einfach besser planen, damit ich pro Woche nur ein Ex und einen Heftestapel hatte. Und irgendwann würden auch meine Feinde an Macht verlieren und ich bekäme vielleicht einen netten Stundenplan mit nur zwei Deutschklassen...
Eigentlich ging es mir saugut, redete ich mir halblaut vor und schlug die nächste Mappe auf, immerhin hatte ich eine Wohnung, das konnte nicht jeder von sich behaupten. Und einen Job, der mir sicher war! Vor ein paar Jahren kriegten nur die Allerbesten eine Planstelle, jetzt waren die Zeiten wieder etwas besser, und davon hatte ich profitiert. 2,15 war schließlich keine Traumnote. Ich klappte die Mappe zu und nahm mir die nächste vor. Äh, der Wasserkocher! Ich goss die Terrine auf, rührte um und drückte den Aludeckel wieder fest, dann kehrte ich zu meiner Mappe zurück.
Außerdem hätte ich ja auch eine Stelle in München kriegen können, der totale Albtraum. Da hätte ich mir nicht einmal einen Schlafplatz unter den Isarbrücken leisten können! Oder im Bayerischen Wald, da, wo ich ein halbes Jahr als Referendarin gewesen war. Gut, die Mieten waren geschenkt, aber es war schon sehr ländlich gewesen... nicht mein Fall.
Das zweite Halbjahr im Schwäbischen hatte mir eigentlich ganz gut gefallen, eine nette Schule, eine überschaubare hügelige Kleinstadt – und schwäbische Preisgestaltung, was mir sehr entgegenkam. Und dann wieder zurück zur Ausbildung nach Leisenberg, wo ich mir natürlich eine neue Wohnung suchen musste. Das Miniappartement war eigentlich ein Glücksfall gewesen, genauso wie die Ausbildung am Leopoldinum. Da hätte ich gerne eine Stelle gekriegt, aber die hatten leider keinen Bedarf, die hatten schon jede Menge junge Lehrer und niemanden, der in Pension ging und ersetzt werden musste.
Ganz im Gegensatz zum Albertinum mit seinem großenteils überalterten Kollegium! Nächstes Heft... Andererseits war das vielleicht auch wieder ein Glücksfall – in den nächsten Jahren gingen sicher einige Fossilien in Pension.
Wie alt war die Bernrieder eigentlich genau? Vielleicht war sie ja schon viel älter als Anfang vierzig und hatte sich nur gut gehalten? Wo konnte ich das rauskriegen?
Zurück zum Heft! Immerhin war das schon Nummer 27, nur noch vier Mappen lagen neben meinem linken Ellbogen. Und die Terrine musste jetzt auch fertig sein! Ich löffelte langsam und genüsslicher, als es der etwas pampige Inhalt verdiente. Wie immer hatte ich doch nicht gründlich genug umgerührt und stieß auf dem Grund auf einen Klumpen Saucenpulver mit sehr penetrantem Pilzgeschmack.
Satt und einigermaßen zufrieden ackerte ich die letzten vier Mappen durch, steckte den ganzen Stapel in die Jutetasche, notierte mir einige Gedanken zur morgigen Stunde in der K12, freute mich, dass ich die Geschichtsstunde aus der neunten Klasse morgen in der anderen Neunten noch einmal verwenden konnte, und streckte mich wohlig. Eigentlich ging es mir doch wirklich prima – und ich hatte alles korrigiert! War ich nicht gut?
Dafür war es jetzt aber auch schon halb zehn. Das hieß, dass ich noch eine halbe Stunde lesen durfte, um morgen nicht zu müde zu sein.
MI, 22.10.2003
Ich spulte meine Geschichtsstunde recht routiniert ab, weil ich sie ja gestern schon gehalten hatte, und staunte dabei wieder über die Unterschiede zwischen den beiden neunten Klassen: Wo sich gestern mehr oder weniger kenntnisreiche Diskussionen entsponnen hatten, herrschten heute absolute Ruhe und eifriges Mitschreiben, als rechneten die Armen mit einem Extemporale. Das war eigentlich keine so blöde Idee, überlegte ich. Aber am Freitag? Am letzten Schultag vor den Herbstferien? Ach was, Herbstferien, das war doch nichts Besonderes. Ich merkte mir das Ex vor und übte gleich noch ein bisschen das Verständnis von Fragen und die richtige Art der Beantwortung. Das verständnissinnige Grinsen von einigen Mädchen in den vorderen Reihen zeigte mir, dass die Botschaft angekommen war. Ich grinste zurück und wünschte weiter frohes Schaffen, als ich nach dem Läuten und dem obligatorischen Ruf „Tafeldienst!“ das Zimmer verlassen hatte.
Im Sekretariat saß nur Frau Schneider, die „Mutter vons Janze“, wie sie sich selbst einschätzte. „Na, Frau Prinz, was kann ich denn für Sie tun?“
Ich beugte mich vertraulich über den Tresen. „Meinen Sie, Sie könnten mir eine Schulbescheinigung ausstellen?“
„Logisch. Wofür brauchen Sie sie denn?“
„Für meine Bank. Sonst glauben die mir nicht, dass ich wirklich einen Job habe. Ich möchte, dass die mir den Dispo ein bisschen erweitern. Ich meine, irgendwann muss doch mein Gehalt mal anlaufen, oder? Wenigstens im neuen Jahr oder so.“
Sie ließ den Stift fallen, den sie in der Hand gehalten hatte, ihr Doppelkinn zitterte vor Entrüstung. „Soll das heißen, dass Sie noch gar kein Gehalt bekommen haben?“
„Richtig. Ich dachte, das ist normal?“
„Normal? Das ist eine Frechheit ersten Ranges. Aber vereidigt hat man Sie schon, oder?“ Ich schüttelte den Kopf. „Nur am Beginn der Referendarzeit.“
„Mussten Sie im Sommer noch mal zum Gesundheitsamt?“
„Nein, da war alles in Ordnung. Ich meine, was soll auch sein, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe Untergewicht und ich habe während der Referendarzeit keinen Tag gefehlt.“
„Lobenswert – bis auf das Untergewicht.“ Sie musterte mich strafend und musste dann lachen. „Essen kostet Geld“, klagte ich und schaute möglichst erbarmungswürdig drein.
„Ich rufe bei der Bezügestelle an“, verkündete sie finster und griff zum Hörer. In den nächsten Minuten hatte ich das Vergnügen, zuzuhören, wie sie mehrere Sachbearbeiter nach allen Regeln der Kunst zusammenfaltete und so lange herumscheuchte, bis anscheinend ein wichtiges, bisher fehlendes Dokument wie durch Zauberhand wieder aufgetaucht war. „Und warum haben Sie uns nicht informiert? Was glauben Sie eigentlich, wovon unsere Beamten leben sollen, während Sie Ihre Arbeit nicht machen? - Was heißt hier Rücklagen? Haben Sie sich mal angeschaut, mit welchen Almosen Referendare abgespeist werden? Das ist schon nicht mehr die übliche Schikane, das ist schon Grausamkeit. Und da wundern Sie sich, dass Ihnen der Nachwuchs ausgeht? - Sie geben diesen Wisch jetzt auf der Stelle in die Post. Wenn er am Freitagmorgen nicht da ist, haben Sie mich wieder in der Leitung, und dann gibt es erst richtig Ärger. Und eine Abschlagszahlung an Frau Prinz veranlassen Sie auch sofort. - Nein, damit warten Sie nicht mehr, die Unterlagen sind doch vollständig, haben Sie gesagt. Oder? - Na bitte. Nein, jetzt sofort! Wenn sich erst einmal unser Chef einschaltet, droht Ihnen eine Dienstaufsichtsbeschwerde. – Doch, das wissen Sie auch selbst.“
Sie legte wieder auf und sah mich triumphierend an. „So, denen habe ich aber Beine gemacht! Die Bestallungsurkunde wird jetzt sofort ausgefertigt und zur Post gegeben. Sie hatten Ihren Lebenslauf verlegt und waren zu faul, sich deshalb zu rühren.“
Ich schüttelte den Kopf. „Nicht zu fassen! Die hätten doch bloß mal hier anrufen müssen, dass hätte ich ihnen einen neuen Lebenslauf geschickt. Stattdessen lassen die mich verhungern.“
Frau Schneider zog eine Schublade auf und reichte mir eine Mozartkugel. „Hier, zur Überbrückung! Und, wollen Sie die Bescheinigung jetzt immer noch?“
„Sicherheitshalber.“, lutschte ich zufrieden. „Stellen Sie sich vor – die Post...“
„Auch wieder wahr. Also gut!“
Sie zog ihre Tastatur näher heran, rief ein offizielles Briefformular der Schule auf und begann zu tippen. Der Drucker surrte, sie zog das Blatt heraus, unterschrieb schwungvoll und drückte den Schulstempel darunter.
„Und das Dienstsiegel auch noch. Macht ordentlich was her!“ Auch das Staatswappen wurde auf das Blatt gedrückt. „So, hier! Am besten machen Sie sich aber auch ein paar Kopien davon.“ Selig eilte ich zum Kopierer. Das musste die Bank doch beeindrucken! Und vielleicht war das gar nicht mehr nötig?
Im Lehrerzimmer herrschte gewaltige Unruhe: Der Hausmeister hatte zwei weitere Tische hereingestellt und alle anderen etwas dichter zusammen geschoben. An einem der neuen Tische saßen Nadja und Frau Ernst und winkten mir hektisch zu. Ich stürzte mich sofort auf den Platz neben Nadja. „Ist ja Klasse! Ein richtiger Tisch – für uns?“
„Drei Leute passen noch dazu. Mal schauen, wer noch Bedarf hat. Und mal schauen, was die Bernrieder dazu sagt!“ Ich musste kichern. Frau Ernst reichte mir an Nadja vorbei eine kühle Hand. „Hallo, ich bin Verena. Du heißt Eva, nicht?“
„Genau. Und jetzt mit diesem Platz fühle ich mich hier fast schon akzeptiert."
„Jörndl hat anscheinend den Aufstand geprobt“, stellte Nadja zufrieden fest. „Zeit war´s ja auch!“ Ein etwas pummeliger junger Mann mit braunen Locken, den ich bisher immer nur von weitem gesehen hatte, kam heran. „Gibt´s bei euch noch Platz? Der Wackelstuhl in der Ecke ist irgendwie nicht so komfortabel.“
„Hau dich her, Theo“, antwortete Verena. „Mathematiker sind ja eine verträgliche Bande. Aber dein blödes R3-Modell lässt du bitte draußen, sonst können wir uns hier nicht mehr rühren.“
Theo zog ein Gesicht. „Aber ich würde es dir auch mal leihen!“
„Ich brauch´s in diesem Jahr aber nicht. Stell das Ding aufs Fensterbrett, da nervt es nicht so.“
Nadja zog eine Packung Schokokekse aus der Tasche, riss sie auf und legte sie in die Mitte. „Greift zu, schließlich haben wir was zu feiern!“
„Vor allem ich“, verkündete ich, während Theo sich sofort eine Handvoll Kekse schnappte. „Frau Schneider hat die Bezügestelle dermaßen zusammen geschissen, jetzt kommt hoffentlich bald mein Gehalt.“