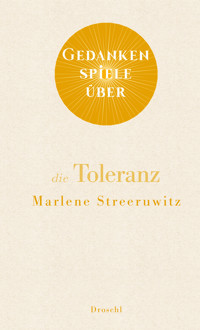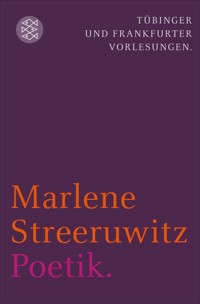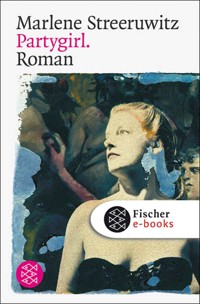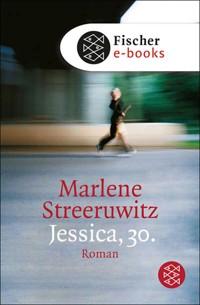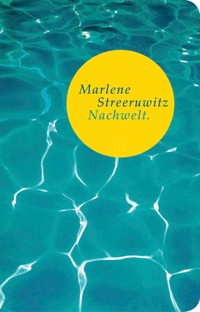9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Nachkommen.‹ ist ein Roman über die Ordnung der Generationen und wie sie durch Gier und Vernachlässigung außer Kraft gesetzt wird. Am Morgen verabschiedet sich die zwanzigjährige Nelia Fehn von ihrem toten Großvater, am Abend sitzt sie als jüngste Autorin bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises. In Frankfurt trifft sie ihren leiblichen Vater das erste Mal. Auf der Buchmesse wird sie gefragt, warum sie denn nun einen Roman geschrieben habe. »Sie hatte nur nicht sagen können, was sie da gemacht hatte. Oder warum. Sie hatte nur einfach geschrieben und jetzt war das ein Roman, und das Leben ging weiter. Sie wußte nicht einmal, ob sie wieder schreiben wollte. Weiter schreiben.« Marlene Streeruwitz gewährt uns einen Insider-Einblick in das Literaturgetriebe, und es gelingt ihr, aus dem Ende der Literatur Literatur zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Marlene Streeruwitz
Nachkommen.
Roman
Über dieses Buch
Frankfurt am Main: Nelia Fehn feiert den Erfolg ihres ersten Romans, der die Shortlist für den Deutschen Buchpreis erreicht hat. Während der Buchmesse lernt sie den Literaturbetrieb von innen kennen und folgt den Spuren ihrer verstorbenen Mutter, der bekannten Schriftstellerin Dora Fehn. Auch ihr unbekannter Vater nimmt Kontakt mit ihr auf und spielt ein verführerisches Spiel der Täuschung mit ihr. ›Nachkommen.‹ erzählt von der zerstörerischen Macht der eigenen Herkunft und der lebenslangen Suche nach einem eigenen Weg.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Covergestaltung: buxdesign, München
Umschlagabbildung: akg-images, Berlin
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402322-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
1
Dieses Mal. Sie wollte alles richtig machen. Sie wollte normal sein. Nicht auffallen. Ihren Platz einnehmen. Dazugehören.
Dieses Mal. Es ging nicht um sie. Nicht so wie damals. Dieses Mal. Sie musste nur funktionieren. Sie musste nur die Zeit an der Hand nehmen und sich führen lassen. Sie musste nur die Angelegenheiten entlanggehen. Dieses Mal war es keine Prüfung. Sie würde den richtigen Abstand bewahren und sich nicht in die Situation zerren lassen. Sie würde nicht am Grund der Situation zu liegen kommen und überrollt werden. Dieses Mal konnte ihr das nicht passieren. Dieses Hineinziehen in das Ereignis und dann überschwemmt sein. Schwimmend und um Auftauchen ringend. Um Luft.
Das Gefühl war sofort wieder da. Damals. Das Gefühl, am Grund einer Flüssigkeit zu schweben. Einer tintigen Flüssigkeit. Geschwommen zu werden. Und sie konnte sich selbst sehen. Ein Präparat. Sie war ein Ausstellungsstück in einem dicken, runden Glas in einem der naturhistorischen Museen, in die die Mami immer gegangen war und wo sie lange auf diese Präparate gestarrt hatte. Langweilig war das gewesen, dabeizustehen und ihr zuzuschauen. Was war da zu sehen gewesen. Sie selber. Sie hatte nie hingesehen. Nie genau. Auch jetzt nicht. Sie hatte nur die Gläser in Erinnerung und Umrisse dahinter und Brösel in der Flüssigkeit. Für sich. Für sich selbst als Ausstellungsstück. Sie hatte sich in ein tintiges Formalin gedacht, und sie war froh darüber. Keine Erinnerung von Eiter oder anderen Körperflüssigkeiten. Durchsichtig dunkelblau. Sie lag zurückgelehnt in diesem Durchsichtig-Dunkelblau, und das war kein Bild in ihrem Kopf. Das war ein Zustand in ihrem Bauch. Sie lag zurückgelehnt in ihrem Bauch, und ein Geschmack davon stieg in ihre Kehle herauf und dann. Sie war an der Reihe.
Sie trat auf den Sarg zu. Sie machte Schritte, aber der Sarg blieb entfernt. Sie musste sich an den Sarg anlehnen. Den Holzrand gegen ihre Rippen scharf einschneiden lassen, um ihn erreicht zu haben. Über den Rand gebeugt. Sie sah in den Sarg. Sah auf das Gesicht hinunter. Auf den Kopf. Sie sah in das Gesicht. Beugte sich über das Gesicht und küsste das Gesicht auf die Stirn. Die Stirn. Wächsern schwitzig. Die gekühlte Leiche von Kondenswasser überzogen. Die Klimaanlage gegen die Föhnhitze draußen nicht ankam. Draußen. Im Leben. Im Leben hatte sie den Opi nie geküsst. Nie richtig. Nie so wie jetzt. Immer nur so die Wangen entlang. Vorbeigestreift. Sie hatte den Opi nie umarmt. Man hatte den Opi nicht umarmen können. Ihr Großvater war kriegsversehrt vom Zweiten Weltkrieg gewesen und hatte nur einen Arm gehabt und hatte niemanden mehr in die Arme nehmen können. Sie hatte ihren Großvater nie schlafen gesehen. Sie hatte nie so von oben auf ihn daliegend hinuntergeschaut, wie man auf kleine Kinder in ihren Betten schaut. Sie trat zurück.
Sie ging zurück. Aber sie drehte sich nicht weg. Sie schritt, ohne sich umzusehen, nach hinten. Ihre Lippen nass vom Kuss auf die Stirn der Leiche. Die Nässe brennend. Aber. Sie durfte keine Reaktion zeigen. Sie durfte die Nässe nicht abstreifen. Sie durfte nicht einmal den Mund verziehen. Sie musste ein steifes Gesicht bewahren. Sie trug einen Leichenmund und musste das nun aushalten. Den Mund abwischen. Es wäre ein Verrat gewesen. Am Kuss. An ihm. An ihr. An der Tochter. An seiner Tochter. Sie musste stellvertreten. Die Mami konnte das ja nicht mehr. Die Mami. Die weiße Rose. Sie hatte die weiße Rose nicht in den Sarg zu ihm gelegt. Sie hatte die weiße Rose vergessen. Sie hielt diese Rose fest umklammert. Mit beiden Händen. Sollte sie noch einmal hingehen und es nachholen. Aber die Schritte nach vorne zum Sarg zurück. Der nasse Mund. Sie durfte keine Regung zeigen, und sie durfte unter keinen Umständen weinen. Sie durfte nicht weinen. Nicht weinen, sagte sie sich vor. Leise. Durch die Nässe auf ihren Lippen hindurch. Nicht weinen. Sie hatte bei ihrer Mami nicht geweint, und sie wollte ihrer Mami die Treue halten. Sie konnte nicht bei der Mami nicht weinen und bei deren Vater aber heulen. Flennen. Es wäre Flennen geworden, wenn sie es zugelassen hätte. Es wäre Flennen geworden und so ein wildes Ausheulen und ungezügelt und kindisch und unbeendbar.
Der Opi. Er war alt geworden. Fast neunzig. Ein langes Leben war zu Ende. Die Mami. Die Mami war mit achtundfünfzig gestorben, und der Opi hatte keine einzige Träne bei ihrem Begräbnis vergossen. Er hatte seiner Tochter nicht nachgeweint. Er hatte Tränen zu einem kostbaren Geschenk gemacht, das er nun auch nicht bekommen sollte. Von ihr nicht. Und es würde ja auch niemand verstehen, wenn sie jetzt zu weinen begänne. Die anderen. Die ganze Familie. Die waren hysterisch. Aber traurig. Traurig. Damit war sie allein. Traurig. Trauer. Das war ein Abstand geworden, den die alle dazwischengelegt hatten. Die hatten Abstand genommen. Die nahmen Abstand. Aber traurig. Das waren die nicht. Das waren die nie. Das kannten die gar nicht. Der Opi hatte ihr wenigstens zugesehen. Bei ihrer Trauer. Mit so einem prüfenden Blick hatte er ihr zugesehen. Wie bei einem Experiment. Aber es war gesehen worden. Wenigstens. Den Blick vom Opi. Diesen Blick hatte sie nun verloren. Das war ihr Verlust. Sie holte tief Luft. Bei solchen Gedanken vergaß sie meistens zu atmen, und dann wurde ihr schwindelig.
In der Leichenhalle. Es war nur der Onkel Stefan mitgekommen. Mit der Großmutter. Die anderen hatten den alten Mann nicht noch einmal sehen wollen. Die Großmutter war schon auf dem Weg aus der Leichenhalle hinaus. Der Onkel Stefan beim Eingang. Er war dort stehen geblieben. Er war nicht einmal an den Sarg gegangen. Sie kam sich dumm vor. Aber auch erhoben. Trotzig sicher. Die Omama hatte ihren toten Mann nicht berührt. Es war sie gewesen, die nun Abschied genommen hatte. Die mit ihrem lebenden Mund die tote Stirn. Die eine Verbindung gesucht hatte. Sie musste die Lippen zusammenpressen gegen die aufsteigende Fremdheit von innen. Die anderen fanden das alles wohl normal. Man gestand ihr ein eigenes Wissen über den Tod und das Sterben zu. Sie war ja eine Waise, und die nahmen an, dass man sich dann auskannte.
Der eine Mann von der Bestattung half der Großmutter die zwei Stufen ins Freie hinaus. Hinaus in den Herbsttag und die wilde Föhnhitze. Die Großmutter blieb stehen. Wandte sich zurück. Ging dann doch einen Schritt weg. Sackte ein. Der Mann nahm sie fest unter dem Arm und führte sie weiter. Der Onkel Stefan überholte die beiden und sagte etwas von Auto holen.
Sie stand in der Aufbahrungshalle. Der andere Mann von der Bestattung begann die Lichter abzudrehen. Sie stand. Sie musste dem Sarg den Rücken kehren. Der Leiche. Dem Großvater. Dem Opi. Wie sollte sie sich abwenden. Das war das letzte Mal. Das war das letzte Mal, dass er gesehen wurde. Sie sah ihn das letzte Mal, und er war dann das letzte Mal gesehen worden, wenn sie hinausgegangen sein würde. Das war das allerletzte Mal. Der Sarg wurde dann verschlossen. Wenn die Verwandten die Totenvisiste gemacht hatten, dann wurde der Sarg verschlossen. Und das war jetzt die Totenvisite. Solange sie dastand und ihn ansah, so lange dauerte dieses letzte Mal. Und sie hatte den Opi nie gefragt, ob er die Totenvisite damals bei der Mami gemacht hatte. Hatte er die Mami noch einmal angeschaut. Hatte irgendjemand die Mami angeschaut. Sie gesehen. War sie ein letztes Mal gesehen worden. Wie war das gewesen. Das alles. Damals. Sie hatte keine Erinnerung. Die Tante Iris war gekommen und hatte ihr ein Valium gegeben, und weil es das erste Mal gewesen war, dass sie so etwas genommen hatte. Sie konnte sich an nichts erinnern. Nicht einmal, dass sie dagewesen wäre. Beim Begräbnis. Diese Erinnerung war vom Valium weggesogen worden und ausgeschieden. Ein 10er-Valium. »Du bist noch nicht einmal fünfzehn. Du brauchst nichts von diesen Sachen wissen.«, hatte die Tante Iris gesagt und ihr das Glas Wasser in die Hand gedrückt. »Da. Nimm das.« Wenn vom Begräbnis ihrer Mutter gesprochen wurde, dann beugte sie den Kopf, damit niemand ihr Gesicht sehen konnte. Sie war so gierig, etwas davon zu hören. Zu hören, wie das gewesen war. Aber es war dann nie wirklich darüber geredet worden. Nur, dass es doch so viele Leute gewesen waren, die da aufgetaucht seien. Und dass es richtig gewesen wäre, dass die Dorothea begraben worden sei. Die Großeltern. Die ganze Familie. Alle waren katholisch und hatten eine Kremation abgelehnt. Die Großeltern hatten keine Vase mit Asche besuchen wollen. Es musste ein Körper in der Erde liegen und zur Auferstehung wieder herauskriechen können. Der Opi hatte sich selbst der Verwesung überantworten wollen, und er hatte das für seine Tochter entschieden. Für ihn war das Gottes Wille, dass man in der Erde verweste, und es hatte schrecklichen Streit gegeben wegen der Verfügung von der Mami. Die Mami hatte verfügt, verbrannt zu werden und dass kein Priester an ihrem Grab reden dürfe. An den Streit konnte sie sich erinnern. Sie konnte sich an ihr tränengetränktes Gesicht erinnern. An ihre Ohnmächtigkeit und die Wut daraus, dass die Verfügung ihrer Mutter nicht eingehalten worden war und ihre Stimme nicht gehört wurde. Ihre tobende Verzweiflung, als der Großvater endgültig entschieden hatte. Als nächster Angehöriger hatte er entschieden, und die Mami war in die Erde gekommen, obwohl sie sich ins Feuer gewünscht hatte. Sie selbst war betäubt worden. Die Tante Iris war in die Lange Gasse gekommen und hatte ihr gleich das Glas Wasser und die Tablette hingehalten. »Da. Nimm das. Ich will keine Hysterien mehr. Wir alle wollen keine Hysterien mehr. Es ist alles schwierig genug.« Sie hatte die Tablette geschluckt. Da hatte sie schon gewusst, dass sie hilflos war. Hierher. Hierher zum Opi jetzt. Da war die Tante Iris nicht mehr gekommen. Jetzt. Da lag die im Bett, und es war gar nicht sicher, ob sie zum Begräbnis kommen konnte. Taumelnd und weinend. Sie sollte zu ihr gehen und ihr jetzt das Valium überreichen. Zum Grab von der Mami war dann keiner von denen je wieder hingegangen. Und der Opi hatte nicht geweint. Das hatte sie gehört. Das hatten alle immer wieder gesagt. Und sie auch nicht. Sie sei starr und verschlossen dagestanden. Tapfer sei sie gewesen. Sehr tapfer. Aber sie wollte mutig sein. Und nicht tapfer. Und deshalb bekam der Großvater auch keine Träne. Deshalb.
Auf einmal war ihr doch schwindelig. Auf einmal war alles erstaunlich. Und fremd. Und weit weg. Und sie musste sich festhalten. Sie brauchte eine Stütze. Es war aber nichts da, und sie ging die drei Schritte zum Sarg zurück und hielt sich da fest. Sie lehnte sich an den Sarg und stand da und musste warten, und dann wurde langsam wieder alles erkennbar. Die Kerzenleuchter. Das Kreuz mit dem Gekreuzigten hinter dem Sarg. Die graue Seide, mit der der Sarg ausgelegt war. Der grauseidene Polster unter seinem Kopf. »Es tut mir so leid.«, flüsterte sie in den Sarg zurück. Sie sagte es so über die Schulter in den Sarg hinunter. Als würde sie vorsagen. In der Schule. Unerlaubt die richtige Antwort an den Prüfling weitergeben. Flüsternd. Sie sah ihn nicht mehr an. Sie schaute nicht mehr zu ihm hinunter. Sie richtete sich auf und ging davon. So war das doch, dachte sie. Man richtet sich auf und geht davon und kehrt den Rücken und verlässt die Person. Das Kondenswasser schmeckt wie Schweiß. Wässrig mit etwas Scharfem dabei. Und am Ende geht man in die Hitze hinaus. In den Tag. Und das Leben geht weiter.
Im Gehen. Sie knickte die Rose gleich unter der Blüte ab. Sie riss die Blüte vom Stängel und steckte die Blüte in die Tasche ihrer Jacke. Dunkelblauer Hosenanzug. Man muss etwas Dunkles zum Anziehen haben. Marineblau. Das steht dir so gut, und man kann es immer tragen. Zum Begräbnis und zur Preisverleihung. Der marineblaue Hosenanzug konnte überallhin mitkommen. Der Hosenanzug das verbindende Element. Alles andere war jetzt zerrissen. Die Elemente. Verbindung. Verbindungen. Sie bekam ja kaum Luft, und der Opi hatte die Rose nicht bekommen. Aber er hatte nicht geweint. Er war nie traurig gewesen. Wegen der Mami. Er war ernst gewesen. Deswegen. Aber er war nie traurig über den Tod seiner Tochter gewesen. Das hatte er ihr überlassen. Er war ernst und ein bisschen vorwurfsvoll an ihrem Bett gestanden. Wenn sie wieder nicht aufstehen hatte können. Das hätte sie nicht machen sollen, hatte sein Blick gesagt. Wie alles andere auch, hatte er den Tod von der Mami kritisiert. Er hatte alles von ihr falsch gefunden und hatte ihre Romane deswegen auch nicht gelesen. Das hatte sie jetzt da drinnen gesehen. Der Opi. Er hatte erleichtert gewirkt. Die Sorgen los. Die Sorge, dass wieder eines seiner Kinder seinem Ratschlag nicht folgen würde und deshalb ins Unglück geraten. Aber auch keine Freude. In seiner Vorstellung. Er würde seine Tochter ja wiedersehen. Ihre Mutter war in die Erde statt ins Feuer gelegt worden, damit sie wiederauferstehen konnte. Und ihre Mami. Die hatte nie eine Sünde begangen. Eine wirkliche Sünde nie, die sie in die Hölle verstoßen hätte können. Da war der Opi schlechter dran. Der Opi war im Krieg gewesen, und sein lieber Gott. Der musste wissen, was er da getan hatte. Was er da wirklich getan hatte. Im Krieg da. Als Soldat. Als Soldat der deutschen Wehrmacht. Und in diesem einen Augenblick. In diesem Augenblick vor dem letzten Richter. Da konnte er ihrer angesichtig werden. Da konnte er wissen, was mit ihr geschehen war. Was aus seiner Tochter geworden. Und es hatte ihn nicht interessiert. Das wusste sie jetzt. Der Opi. Sie konnte sich ihn vorstellen. Der Opi hatte strammgestanden. Gerade und aufrecht und in die Augen seines Richters geschaut. Der Opi. Die alle. Die in seinem Alter. Die nahmen das alles so. Die konnten die Macht so einfach akzeptieren. Die ließen sich nach der Messe segnen. Feuchte Augen und Haltung, und dann standen die alten Männer auf dem Kirchenplatz beieinander und grinsten.
Einen Augenblick. Sie steckte den Rosenstängel mit der weißen Masche in den Papierkorb am Ende des Wegs zur Aufbahrungshalle und ging den anderen zum Auto nach. Einen Augenblick erfüllte sie eine Wut, die sie, sich selbst erstickend, erstarren ließ. Sie konnte sich nicht bewegen. Ein stechender Schmerz unter den Rippen rechts, wenn sie nur atmete. Sie konnte nicht gehen. Stand starr. Musste starr stehen. Sie begann wieder zu gehen. Sie sollte es lernen. Sie sollte lernen, es mit den Lebenden rechtzeitig abzumachen. Die Abrechnungen zu machen, solange die da waren, und sie hätte den Opi alles fragen sollen. Alles und keine Rücksichten und hinter seinem strengen Blick auf die Suche gehen. Aber es war nie Zeit gewesen. Die Großmutter hatte schon darauf geachtet. Die Geheimnisse sollten Geheimnisse bleiben. Und jetzt war es gelungen.
2
Die hintere Autotür stand offen. Der Onkel Stefan saß schon am Steuer. Die Omama auf dem Beifahrersitz. Sie schauten beide nach vorne. Warteten. Sie zwängte sich auf den Sitz hinten. Der Vordersitz für die Großmutter ganz nach hinten geschoben. Sie hatte gerade Platz für ihre Beine. Musste die Beine von oben in den Zwischenraum zwängen. Sie ließ sich auf den Sitz fallen. Lehnte sich in den Sitz. Schaute nach rechts hinaus zurück. Die beiden Männer von der städtischen Bestattung verschlossen die Tür zur Aufbahrungshalle. Der eine verriegelte den einen Türflügel. Der andere stand bereit, den anderen Türflügel zuzuschieben. Sie schaute. Der Onkel Stefan seufzte. Dann richtete er sich auf und drehte den Schlüssel und startete das Auto. Rollte los. Langsam. Sie drehte sich der Tür zu. Es war plötzlich wichtig zu sehen, dass die Tür zur Aufbahrungshalle verschlossen worden war. Geschlossen. Zugesperrt. Gesichert. Die Verlassenheit der Person im Sarg. Der Schmerz unter den Rippen rechts. Einen Augenblick kein Atem. Das Auto rollte über den leeren Parkplatz. Ahornbäume. Lange Reihen von Ahornbäumen. Die Spitzen der Blätter herbstgelb. Sie fuhren vom Schatten der Baumreihen in die Sonnenhelle der Straße. Der Onkel beschleunigte.
»Cornelia.« Die Großmutter wandte den Kopf nach hinten. »Cornelia. Ich habe vergessen, dir zu sagen. Die Etta kann dich, glaube ich, nicht zum Flughafen fahren.« »Was?«, fragte sie. »Und das sagst du.« Sie holte Luft. Der Ton. Sie hatte die alte Frau angefahren. »Warum erfahre ich das erst jetzt.« Sie fand sich vorgebeugt. Zwischen den Vordersitzen nach vorne sprechend. »Ja.«, sagte die Großmutter. »Die Etta hat angerufen, und ich glaube, sie hat das gesagt.«
Sie lehnte sich wieder zurück. Sie musste lachen. Beherrschte sich. Konnte das Glucksen eines Kicherns gerade noch zurückhalten. Das war absurd. Das war alles absurd. Alle diese Diskussionen der letzten Tage waren damit absurd und dumm geworden. Diese ganze Quälerei. Die Selbstbefragungen. Alle diese Bewertungen und Abwägungen. Was war nun wichtig in ihrem Leben. Die ganze Familie hatte auf sie eindiskutiert. Sie in die intimsten Gespräche gezwungen. Man war auf sie eingedrungen. Wem sie nun mehr verpflichtet sei. Sich selbst oder ihrem Großvater, der ihr schließlich ein neues Zuhause gegeben habe. Der sie ins Haus genommen hatte, nachdem ihre Mutter gestorben war. Und es hatte immer so geklungen, als wäre ihre Mutter eine Verräterin, die das Leben verlassen hatte wie eine Ratte ein Schiff. Diese Frau, die hatte schließlich sie, ihre Tochter, verlassen, und sie sollte dem Mann, der sie gerettet hatte, ihre Dankbarkeit erweisen. Gefälligst. Das war die Iris-Fraktion gewesen. Die Iris, der Markus und natürlich der Gerhard. Die hatten plötzlich alles über die Dankbarkeit gewusst. Dem Stefan und dem Georg war das nicht wichtig. Sie war für die nicht wichtig, und das hatten sie auch gesagt. Dass es um die Kinder ginge und dass ein Enkelkind nicht unbedingt beim Begräbnis dabei sein musste. Dass ein Enkelkind doch schon sehr weit von dem Großvater entfernt wäre und die Verpflichtung dementsprechend. Schwach. Ihre Verpflichtung, da hinzukommen, wäre schwach. Sie könne an sich selber denken. Und dann hatten alle darüber geredet, was der Großvater selbst gemacht hätte. Wenn der Großvater eine solche Entscheidung treffen hätte müssen. Da hatte die Iris so zynisch aufgelacht und gemeint, dass der Papa sich für den Preis entschieden hätte. Für die Preisverleihung. Der wäre nicht zum Begräbnis seines Großvaters gegangen. Kalt wie er war. Gewesen war. Sie besserte sich aus. Jedes Mal, wenn die Iris über ihren Vater sprach, besserte sie sich aus der Gegenwart in die Vergangenheit aus. Verschob ihren Vater in die Vergangenheit. Schluchzte dabei. Verzweifelt. Aber man wusste nicht, was für eine Verzweiflung das war.
Und was solle sie nun machen, hatte sie dann gefragt. Sie hatte immer nur gefragt. Sie hatte da in der Wildgansgasse mit keiner Antwort rechnen können. Es war nie zu Ende geredet worden. Es waren die Fragen immer nur aufgeworfen worden. Sie konnte riesige Erdwälle vor sich sehen. Aufgeworfen. Die Sicht verhindernde hohe Wälle. Das war also vorbei. Sie würde das Flugzeug nach Frankfurt nun nicht erreichen können. Es war mit der Etta ausgemacht gewesen, dass sie sie zum Flughafen brachte, damit sie diesen Abschied nehmen konnte.
Dieser Abschied. Die Iris hatte das vorgeschlagen. Aber sie wäre auf jeden Fall hingefahren. Sie hatte den Opi sehen wollen. Sie hatte eine tote Person sehen wollen. Sie hatte wissen wollen, wie das war. Damit sie es von der Mami. Sich vorstellen. Wahrscheinlich hatte sie ihre Mutter da geküsst. Gerade vorhin. Nicht den Opi.
Die Iris und der Markus. Die hatten ihr das als Strafexpedition verpasst. Die hassten sie. Die waren eifersüchtig. Die hatten es nicht ausgehalten, dass sie da als Kind im Haus gelebt haben sollte. Die waren missgünstig. Richtig missgünstig. Und jetzt hatten sie ihr Ziel erreicht. Und die Großmutter war auch zufrieden. Für die war sie nicht mehr existent. Für die lebte sie gar nicht mehr. Mit dem Tod ihres Mannes war für sie auch das Mündel verstorben. Sie konnte nicht mehr sagen, dass ihr Mann die Tochter ihrer Tochter ins Haus nehmen habe müssen. Es wäre ja sonst niemand da. Diese Tochter habe sich ja geweigert, den Vater dieses Kinds einzuspannen. Dem hätte man sie ja auch schicken können. Der hätte nur zahlen dürfen. Die Mindestrate. Sie. Sie hätte den zur Verantwortung gezogen. Aber ihr Mann. Der hätte schon immer an dieser Tochter einen Narren gefressen gehabt. Da könne man nichts machen. Dabei gäbe es noch die Halbgeschwister von der Cornelia. Die anderen Enkelkinder. Die wären auch noch da. Aber da hätte die Cornelia das Gymnasium nicht fertig machen können. Weil die in England und in Griechenland lebten. Verstreut wären die, und man hätte kaum Kontakt. Auch das immer nur Undankbarkeit. Sie hätte immer nur Undankbarkeit geerntet. Und dann hatte sie geseufzt, und jeder hatte die Großmutter als Ehefrau ihres Manns bewundert, wie sie nun diesen Schicksalsschlag wieder ertragen würde. Aber niemand war auf die Idee gekommen, dass die Tochter dieses Vaters auch ihre Tochter gewesen war. Ihre Mutter war wie Athene nur mit dem Vater verbunden gewesen, und der hatte sie als Pflicht angesehen. Der hatte ihre Romane nicht gelesen, weil sie die nicht unter seinem Namen geschrieben hatte. Deswegen stand auf dem Grab Dorothea Holzinger, und niemand konnte Dora Fehn, die Autorin, finden. Ihr Vater hatte sie hinter seinem Namen versteckt. Hatte die Selbstbenennung seiner Tochter aufgehoben.
Sie fuhr sich über den Mund. Ließ die Fensterscheibe hinuntergleiten. Schaute hinaus. Es war nichts anderes zu erwarten gewesen. Sie würde nun nicht zum Deutschen Buchpreis kommen, und damit war sie draußen. Wenn man da nicht anwesend war, dann konnte man nichts bekommen. Und sie hatte sowieso nur Außenseiterchancen. »Außenseiterchancen.«, hatte der Gruhns ins Telefon geschrien. »Wir haben nur Außenseiterchancen, aber die werden wir nutzen. Das kann ich dir versprechen.« Und warum war dieser Mann immer per du mit ihr. Sie sagte Sie. Aber jetzt würde sie gar nichts sagen. Und zum Begräbnis vom Opi würde sie auch nicht gehen. Diesen Sieg. Den konnte sie den Dankbarkeitsfanatikern nicht lassen. Sie musste ein Taxi nehmen. Was kostete ein Taxi nach Schwechat zum Flughafen. Sie hatte noch 400 Euro. Das letzte Geld vom Opi. Vor dem Spital hatte er ihr noch Geld gegeben. Viel Geld. Eigentlich. Aber es hatte für die fünf Monate seiner Krankheit gerade gereicht. Von der Großmutter bekam sie nichts. Die rechnete nach, wie viel sie auf ihrem Konto haben musste. Die Waisenrente. Die Alimente kamen ja nicht mehr. Seit sie achtzehn geworden war, war der gesetzliche Rahmen für einen Deutschen erfüllt gewesen. Den hätte sie auch sehen sollen. Diesen Vater. In Frankfurt. Weil der ein Frankfurter war. Der hatte auch ein plötzliches Interesse entwickelt. Wegen dem Preis. Dachten all diese Leute, dass sie das nicht sah. Hielten die sie für so dumm, dass sie glaubte, die hätten ein echtes Interesse an ihr.
Aber warum hatte die Etta die Fahrt zum Flughafen abgesagt. Dieser Schulfreund des Großvaters musste doch abgeholt werden. Hatte der seine Teilnahme am Begräbnis abgesagt und kam nicht.
Sie war müde. Müde. Das war ein schönes Wort. Da war die Müdigkeit wörtlich eingefangen. Sie war müde. Sie schaute hinaus. Sie fuhren den Bahndamm entlang. Die späte Hitzewelle hatte alle Pflanzen endgültig zu Stroh werden lassen. Nichts Grünes zu sehen, und die Büsche vertrocknet fleckig braune Blätter. Links. Auf der anderen Straßenseite. In den Gärten. Blumen. Sträucher. Bäume. Das Gras. Alles grün und herbstfarben bunt. Auf ihrer Straßenseite nur Trockenheit und Stroh. War das eine Weissagung. War das ein Omen. Für ihr Leben. Oder war das einfach nur die Beschreibung ihres Lebens. Sie trauervertrocknet, und das blühende Leben immer auf der anderen Seite. Da. Wo sie nicht war. Sie sah die ausgetrocknete Böschung hinauf und konnte kein Ende von sich spüren. Die Traurigkeit vor der Brust reichte nach vorne. Ohne Ende weit nach vorne. Sie wünschte sich, sie könnte dieses Gefühl zu einem kleinen Punkt zusammenballen und sie könnte diesen Punkt nehmen und werfen. Eine Bombe und werfen. Eine Waffe. Sie wünschte sich eine Waffe. Sie wünschte sich diese Waffe und wollte sie immer mit sich führen. Zu ihrer Gerechtigkeit. Sie wollte sich Gerechtigkeit verschaffen. Sich und ihrem Leben und aus diesen Umständen hinaus. Sich und ihrer Geschichte Gerechtigkeit verschaffen. Sie hatte gedacht, mit dem Preis für ihren Roman könnte sie das erreichen. Aber diese Leute da. Diese Tanten und Onkel und Großmütter und diese vielen anderen. Die lebten mit einer anderen Währung. Die waren nicht beeindruckt. Die setzten alles außer Kraft mit ihren Bewertungen. Für die galt nichts. Die Iris hatte gesagt, es wäre schön, dass so ein Zufallserfolg die Cornelia getroffen hätte, aber sie. Sie. Die Iris. Sie habe eben noch nicht zu schreiben begonnen, und deshalb habe die Cornelia das Feld. Als hätte sie ihr den Preis überlassen. So hatte sie das gesagt. Zum Markus natürlich. Direkt zu ihr hätte sie nur Freundlichkeiten gesagt. Irgendwelche Freundlichkeiten, die weh taten.
Sie lehnte sich vor und schaute auf die Uhr auf dem Armaturenbrett. Es war 5 Minuten vor 11 Uhr. Der Flug um 14.10 Uhr. Sie war eingecheckt. Sie hatte nur Handgepäck. Wenn sie um 13 Uhr auf dem Flughafen war, dann musste das reichen. Sie hatte den früheren Flug um 12.55 Uhr haben wollen, aber der Gruhns hatte gemeint, dass der spätere Flug schon ausreichen würde. Und außerdem könne man da 40 Euro sparen. Sie hatte drei Stunden. Da musste sie hinkommen können. Der Onkel hielt mit einem Ruck an einer Stopptafel, und sie fiel nach vorne. Über ihre eingeklemmten Beine. Sie setzte sich auf. Plötzlich. Sie hatte große Lust zu töten. Sich. Diese alte Frau. Den Onkel. Alles in die Luft und Schluss. Rotblutige Fetzen in der Luft und aus.
»Mit der S-Bahn müsste es sich ausgehen.«, sagte der Onkel und bog in die Vorrangstraße ein. »Das schaffst du so. Ich. Du weißt. Ich kann nicht.« Sie nickte. Ja. Sie flog nach Frankfurt. Sie war für den wichtigsten Preis im deutschsprachigen Literaturbetrieb nominiert. Sie war die jüngste Person, die da je nominiert worden war. Ihre Mutter hatte das erst mit fünfundfünfzig geschafft gehabt. Jetzt ging es um ihre Zukunft, und alles andere war gleichgültig und nebensächlich, und der Onkel Stefan hatte das verstanden. Sie hätte ihn umarmen mögen. Er bremste vor der Ampel in die Bahnhofstraße.
»Stefan. Pass doch auf. Du bringst uns noch um.« Dass man wirklich keinen Unfall brauchen könne, sagte die alte Frau, und dann seufzte sie wieder.
»Ja.«, sagte der Onkel und wartete auf die Ampelschaltung.
Sie überlegte auszusteigen. Zu gehen. Zu laufen. Sie hätte alles mitnehmen sollen und hier beim Bahnhof aussteigen und wegfahren. Sie schüttelte den Kopf. Sie wusste doch, dass man seine Sachen immer mithaben sollte. Sie hatte einen Roman darüber geschrieben. Warum war sie ohne irgendetwas auf diesen Friedhof mitgefahren. Warum war sie überhaupt hingefahren. Diese Zeit. Diese Leute. Das war Vergangenheit. Sie begann ein neues Leben. Sie hätte sich nicht mit dem Küssen einer Leiche davon verabschieden müssen. Sie war eine theatralische Person. Und. Sie beugte sich vor.
»Was hat die Etta wirklich gesagt.« Sie schaute auf die Großmutter hinunter. Die hob die Achseln. Ließ sich wieder zusammensinken. Sie wüsste es nicht mehr genau, sagte sie. Und dann schwieg sie.
Sie setzte sich wieder nach hinten. Das war es wohl. Sie hätte den Großvater nicht küssen dürfen. Sie konnte am Ton der Großmutter erkennen, dass etwas nicht stimmte, und sie war sicher, es ging um die Totenvisite. Sie hätte es wissen müssen. Niemand drängte sich beim Großvater vor. Und es war eigentlich ein Glück, dass nur der Onkel Stefan mitgewesen war und das alles gesehen hatte. Der Onkel Stefan redete nicht. Nicht viel. Er würde nichts sagen. Aber die beiden Männer von der Leichenbestattung. Die waren Öffentlichkeit. Die konnten reden. Die würden reden, und was geredet wurde, das war wichtig.
Wie war das mit dem alten Direktor Holzinger im Sarg. Wer war denn dagewesen. Bei der Visite. Was hat die Witwe denn gemacht. Wie war es der Witwe ergangen. So traurig. Fast siebzig Jahre verheiratet. Es wird sie jetzt auch bald erwischen. Die wird das nicht lange machen. Ohne ihren Ehemann. Ohne ihren Gatten. Ach, würde dann der eine Mann von der Bestattung sagen können. Wirklich traurig. Wirklich traurig wäre nur diese Enkelin gewesen. Dieses späte Kind von der verstorbenen Tochter. Dieser Spätling von Enkelkind. Die anderen. Die wären gefasster gewesen. Die hätten nur geschaut. Aber die Enkelin. Die hätte ihn noch geküsst. Auf die Stirn. Bewegend. Sehr bewegend wäre das gewesen. Das dachte sich die Omama gerade. Nein. Das dachte sie nicht. Das malte sie sich aus. Das hatte sie sich schon während des Vorgangs ausgemalt. Und jetzt wehrte sie sich gegen das Ergebnis ihrer Ausmalerei und machte sie für etwas verantwortlich, was noch gar nicht exisitierte. Es war schon anstrengend. So ein Kleinstadtdenken. »Möchtest du denn, dass ich dableibe.«, fragte sie nach vorne. Die alte Frau antwortete nicht. Sie schaute auf ihre Hände und schwieg.
Aber es stimmte natürlich auch. Die redeten die ganze Zeit. Die registrierten alles und wussten es dann. Die waren dann sicher in diesem Wissen. Wirklich traurig wäre nur die Enkelin gewesen. Hieß es dann. Jedenfalls hätte nur die es zeigen können. Das würde der andere Mann von der Bestattung erzählen. Die Ehefrau von immerhin siebzig Jahren. Die hätte ihrem Mann ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Aber Abschied genommen. Das hätte nur diese Enkelin. Aber das wäre auch klar. Das müsse man verstehen. Die habe praktisch alles verloren, und der alte Holzinger habe sie ins Haus genommen. Nach diesem plötzlichen Tod seiner Tochter. Das wäre ja nun auch nie geklärt worden, was da geschehen war. Eine Routine-Operation und nicht wieder aufgewacht. Die Frau Direktor Holzinger. Die wäre ja nie so glücklich gewesen über diese Enkelin. Das war ja auch eine Geschichte. Mit dreiundvierzig noch ein uneheliches Kind, das dann nach dem Großvater heißen musste. Weil ein Kind ohne gesetzlichen Vater den Mädchennamen der Mutter tragen musste. Das wäre schon eine Prüfung für das Ehepaar gewesen. Ja. So redeten die. Und am Nachmittag beim Begräbnis. Wenn sie nicht da war. Da würde es schon heißen, dass das ja dann doch keine sooo gute Ehe gewesen sein konnte. Die Frau. Die Gattin. Nicht an den Sarg gegangen. Schau sie dir an. Das hätten wir nicht gedacht. Wer weiß, was da noch alles zutage kommen wird. Diese Junge da. Diese uneheliche Enkelin. Die hat man von der Leiche wegreißen müssen, so ein Schmerz war das für sie. Und jetzt. Sie ist nicht da. Sie hat nicht zum Begräbnis kommen dürfen. Kaum ist der Mann tot, schon hat die Frau das Kommando übernommen. Aber man muss das auch verstehen. Diese Junge. Die hat doch ein Buch über diese alten Leute geschrieben, und das lesen jetzt alle. Das ist doch undankbar. Das ist doch ganz einfach undankbar. Eine Frechheit ist das. Die käme einem auch nicht mehr ins Haus. Lebt da umsonst und schreibt dann über diese Leute, die sie gerettet haben. Sie soll ja Einzelheiten über den Großvater im Krieg ausgegraben haben. Na gut, dass der Waldheim schon tot ist. Der war ja ein Freund von dem Holzinger. Da würden diese beiden alten Herren recht gekränkt sein. Was hätten sie denn tun sollen. Damals. Und die arme Frau Direktor. Die muss das jetzt alles allein aushalten. Da kann man schon sehen, wie das Leben immer den Undankbaren recht gibt. Ungerecht ist das. Eine Ungerechtigkeit. Eine einzige große Ungerechtigkeit.
3
»Du glaubst, sie hat das absichtlich gemacht.« Etta lachte und trat aufs Gas. Sie waren fast schon auf der S6. Sausten an den Pappelalleen und den langen Heckenzügen zwischen den Feldern in der Ebene dahin. Die Autobahn leer. Etta fuhr trotzdem links außen. Sie wolle nicht Spur wechseln müssen, denn sie führe ohnehin am schnellsten. »Strafmandate sind mein einziger Luxus.«, hatte sie gesagt. Lachend.
»Cornelia. Sag schon. Hasst sie dich so sehr.« Etta schüttelte den Kopf. Grinste. Sie sagte nichts. Sie fühlte sich lächeln. Etta schaute kurz herüber und nahm das als Antwort.
»Ja. Ich glaube es sowieso. Na gut, dass ich schon früher da war. Mit der S-Bahn? Na ja. Es wäre sich schon ausgegangen. Aber du hättest halt hetzen müssen. Die Preisverleihung. Die ist doch noch heute. Oder? Und hast du da Zeit, dich umzuziehen? Aber das kannst du gar nicht. In dieser Tasche. Da kannst du gar nichts zum Umziehen mithaben. Aber ja. So ein Hosenanzug. Der geht ja für alles. Den hat dir noch der Opa gekauft. Oder? Da ist doch irgendetwas geredet worden.«
»Die Tante Iris hat ihn zu teuer gefunden.«
Etta schlug mit der Handfläche auf das Lenkrad. »Die Iris!« Die habe es notwendig. Und wie viel der Hosenanzug denn gekostet habe. Und wenn man einer Person nur einen Hosenanzug zugesteht, dann muss man einen ordentlichen kaufen. Dann ist ein Jil Sander das mindeste, und das war ohnehin nur ein Paul Smith. Das war ja geradezu Massenware und mindestens nur ein Drittel so teuer wie ein ordentlicher.
Sie antwortete nicht. Sie schaute hinaus. Sie ließ sich dahinsausen. Sie überlegte nicht einmal, ob die Etta auch eine gute Autofahrerin war. Sie hatte eine Pause gewonnen. Sie wurde zum Flughafen gebracht. Sie musste sich um nichts kümmern. Sie war dabei gewesen, auf ihrem iPhone die Fahrpläne aufzurufen. Auf der Stiege zum Haustor hinunter war ihr dann die Etta entgegengekommen. Warum sie schon auf der Stiege wäre. Sie hätten doch noch Zeit. Die Etta wollte noch kurz ihre Schwiegermutter sehen. Fragen, ob noch etwas zu tun wäre. Vor dem Begräbnis. Sie habe wissen wollen, was die Omama anziehen würde. Zum Begräbnis. Sie habe nicht gewollt, dass die alte Frau schäbig aussähe. Nichts Ordentliches anhabe. Aber die alte Frau hatte sich hingelegt gehabt.
Der Weg vom Auto bis zur Wohnung zurück war eine Tortur gewesen. Die alte Frau war über den Rollator geworfen gegangen, und der Onkel Stefan hatte angeschoben. Eine Prozession des Schreckens war das gewesen. Vor ihr. Der große Mann über die alte Frau über dem Rollator. Sich schleppend. Im Lift. Sie hatte sich nicht mit hineingedrängt. Hatte gewartet. Hatte die zwei Bündel hängender schwarzer Stoffe allein hinauffahren lassen.
Der Onkel Stefan hatte abgenommen. Viel abgenommen. Er hatte in den Monaten der Krankheit des Großvaters selbst einen Magendurchbruch gehabt. Sein dunkler Anzug schlotterte an ihm herunter, und man konnte sehen, dass es ihm gleichgültig war. Dass ihm alles gleichgültig war.
Die alte Frau. Sie hatte durch die Lifttür zugesehen, wie der alten Frau die Tränen aus den Augen quollen. Plötzlich. Und sie selbst hatte auch daran denken müssen, wie oft sie mit dem Großvater hier auf den Lift gewartet hatte und wie er dann so ruhig da gestanden hatte. Ruhig und manchmal lächelnd. Wie doch die Technik die Höflichkeit auf einen verlagere, hatte er dann oft gesagt. Auf eine Person, die sich verspätete, würde man nicht so ruhig warten. So geduldig. Und das war es. Der Opi war geduldig gewesen. Sie hatte ihn nur geduldig gekannt. Seine Frau hatte das nie gelernt und nicht begriffen. An ihm. Seine Frau hatte es nicht verstanden, wenn er so freundlich auf diesen langsamen Lift gewartet hatte. Und dann hatte der Opi wieder ihr zugezwinkert und gemeint, dass die Nelly, die Cornelia die Einzige sei, die dieses Prinzip verstanden hätte. Aber wer wollte auch ein Gefühl an einen Lift verschwenden. Der Onkel Gerhard hatte sich immer aufgeregt und war dann die Stiegen hinaufgelaufen. Der Onkel Georg hatte herumgematschgert. Die Tante Iris hatte Hunderte Male auf den Knopf gedrückt und geschimpft, und der Markus war einfach zu Fuß gegangen. Den Lift gab es seit mehr als dreißig Jahren. Der Lift war zehn Jahre älter als sie. Niemand hatte etwas geändert oder sich gewöhnt. Viele Sonntagabendessen waren mit dem Lift und seinen Unzulänglichkeiten verbracht worden. Was war dieser Lift dann. Der Übervater. Wahrscheinlich war der Lift das eigentliche Prinzip für diese Leute. Und wieder. Erleichterung erfüllte sie. Sie ging da weg. Sie war da weggegangen. Sie hatte sich entschieden.
Die Großmutter. Die war in ihr Schlafzimmer gegangen. Das Mitleid mit ihr. Die Vorstellung, die vor dem Lift aufgestiegen war. Die Ungeheuerlichkeit, dass dieser Mann nicht mehr da war. Nie wieder da sein würde. Einen Augenblick hatte sie das für ihre Großmutter begriffen, und das Mitgefühl hatte sie aufgelöst. Fassungslos gemacht. Sie hatte noch einmal überlegt, dieser Frau beizustehen. Mit ihr zu gehen. Sie nicht allein in dieser furchtbaren Situation zurückzulassen. Aber schon während dieses Beschlusses hatte sie gewusst. Schon währenddessen wiederum dieses Wissen in die Gefühle aufgestiegen war. Sie fuhr nach Frankfurt. An diesem Ort. Hier. Bei der Familie ihrer Mutter. Ihre Gefühle spielten keine Rolle. Ihre Gefühle. Sie selber. Sie selber existierte schon nicht mehr an diesem Ort. Sie hatte selbst einen Verlust erlitten. Ihre Mutter war nun endgültig tot. Niemand in dieser Familie würde je wieder mit ihr die Erinnerung an ihre Mami teilen. Der Großvater hatte das getan. Er hatte ihre Mutter in ihr zur Kenntnis genommen. Schweigend war das gewesen. Stumm. Aber immerhin. Mami, dachte sie. Und sie sollte die Grabinschrift am Grab ändern. Mit dem ersten Geld von diesem Roman. Sie würde ihrer Mutter ihren Namen wiedergeben. Den, den sie sich selbst gegeben hatte. Das würde sie tun. Sie lächelte.
Das wäre gut, dass sie sich das alles nicht so zu Herzen nähme, sagte die Etta. Das wäre gut, dass sie schon wieder lächeln könne. Sie habe den Großvater ja nur am Ende gekannt. Da wäre er ja nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen. Und ob Cornelia diesen Freund von ihm kennen würde, den sie jetzt abholen sollte. Mit seiner Frau. Hätte sie den einmal getroffen. Sie. Etta. Sie fände es ja sehr riskant, dass diese alten Leutchen da aus Zürich herflögen, um an einem Begräbnis teilzunehmen. Für sie mache das gar keinen Sinn. Aber es wären wohl sehr alte Freunde, und der Mann. Der wäre doch. Tja. Der wäre doch Jude. Oder nicht? Oder wie sage man das heute. Man dürfe ja gar nichts mehr so sagen, wie man es dächte. Aber sie wisse einfach nicht, wie man heute einen Juden anzusprechen habe, also sage sie es so frei heraus. Und das sei schon komisch, dass nun der einzige jüdische Freund auch der Einzige sei, der noch am Leben wäre. Da könne man sehen. Sie habe jedenfalls ein Schild gemalt, damit die sie am Ausgang finden könnten. Als Flughafenangestellte habe sie natürlich alle Möglichkeiten, das anders zu machen, aber so wäre es wahrscheinlich am schnellsten, und sie könne am Gehsteig parken und die gleich verladen. Sie müsse nämlich auch noch nach Hause und sich umziehen. Sie habe beim Kleiderbauer in der Shopping City ein preiswertes schwarzes Kleid mit Jacke gefunden. Das könne sie nun die nächsten zwanzig Jahre zu allen Begräbnissen tragen. Sie habe ja keine Figurenprobleme. Nicht so wie die Iris.
»Du kannst froh sein, dass du nicht da bist.«, sagte sie. Zufrieden sagte sie das. Es wären mehrere Skandale zu erwarten. Die Iris könnte hysterisch daherkommen und sich aufführen.
Das Wort »Figurenprobleme« riss sie aus ihren eigenen Gedanken. Sie fuhren längst auf der S6. Fuhren in einen Tunnel. Tauchten in das grelle Licht. Die neonblauen und neonroten Begrenzungsleuchten die Fahrbahn entlang schmolzen zu breiten Bändern von Neonblau und Neonrot seitlich im Blick. Migräne. Das Licht den Kopf zum Taumeln und in den Magen und Übelkeit. Sie waren dann gleich durch. Die Tante Iris. Was war mit der los. Sie wusste so etwas nicht. Sie kannte sich nicht aus. Sie schüttelte den Kopf. Sie schaute immer nur zu. Sie zog zu wenig Schlüsse aus dem, was sie sah. Aber wie erklärte man diese Wechsel bei der Iris. Einmal unglaublich freundlich und mittendrin die bösen Sätze. »Deine Mutter hat es sich ja immer schon leichtgemacht.« »Deine Mutter hat immer Geld vom Vater bekommen.« »Deine Mutter war ein Flitscherl. Du kannst froh sein, dass deine Mutter nicht mehr lebt. Da hättest du noch viele Papis mitmachen müssen.«
Ob sie aufgeregt sei, fragte die Tante. Etta und Markus ließen sich ja nicht Tante und Onkel nennen. Dazu wären sie zu jung, hatten sie zu ihr gesagt. Im Chor sagten sie so etwas. Etta und Markus stellten sich nebeneinander. Die Etta winzig. Der Markus riesengroß. Die Etta blond. Der Markus brünett. Beide braungebrannt. Und dann sagten sie solche Sachen im Chor. »Wir sind zu jung dazu.« »So weit sind wir noch nicht.« »Wir werden nie Figurenprobleme haben.« »Wir sind immer glücklich.« »Wir können nicht verstehen, dass Leute nicht glücklich sind. Die Welt ist doch so schön.«
Sie schaute die Tante an. Sie wisse es nicht. Es sei alles so.
»Ich weiß schon.«, sagte Etta und gab Gas in den nächsten Tunnel. Dass alles so intensiv wäre. Gerade. Sie beneide Cornelia. Sie wolle auch wieder zwanzig sein. Ihre eigene Tochter. Die lasse sie ja nicht teilnehmen. Die wäre ja gerade achtzehn, und sie könnten so viel gemeinsam machen. Etta seufzte auf.
Sie schaute nach rechts zum Fenster hinaus. Wandte sich ab. Sie wollte nichts von Emily hören. Emily war gerade in Australien auf Schüleraustausch. Sie hatte in dieselbe Schule gehen müssen wie Emily. Und die Emily. Die war nett. Die war schon nett. Aber sie hatten nichts gemeinsam. Es waren die Eltern und Großeltern gewesen, die die Kusinen zusammenspannen hatten wollen. Emily war sehr dick. Emily war das, was fettsüchtig genannt wurde. Emily war sehr unglücklich gewesen. Sie fragte dann doch, was Etta von Emily gehört habe. Wie es Emily ginge. Und Etta seufzte noch tiefer. Sie glaube nicht, dass Emily ihre Probleme in den Griff bekommen hätte. Aber sie hätte verboten, dass Emily zum Begräbnis zurückkäme. Sie könne dann an das Grab gehen. Emily habe den Opi ja auch so gern gehabt wie Cornelia. Und dann müsse sie jetzt doch diese Frage stellen. Sie kämen ja gleich am Flughafen an. Wer in ihrem Buch wäre wer in der Familie. Das wollte sie schon die ganze Zeit fragen. Im Übrigen. Sie habe noch keine Zeit gehabt, das Buch zu lesen. Und fände Cornelia es nicht ungeheuer aufregend. Das mit dem Buchpreis.
»Ich werde ihn nicht bekommen.«, sagte sie. Sie lehnte sich noch tiefer in den weißen Ledersitz zurück. Der Mercedes GL Offroader. Man saß hoch oben. Hoch in der Landschaft. Über der Straße. Der Markus und die Etta hatten beide ein solches Auto. Der Markus in Schwarz. Die Etta in Weiß. Der Markus war IT-Millionär. Er hatte Apps entwickelt. Dass man das Wetter auf dem Handy nachschauen konnte, war sein Werk. Und dass kleine Firmen schließen mussten, weil sie sich die Software der 3D-Drucker für die Fassadendichtungen nicht leisten konnten und deshalb nicht mehr konkurrenzfähig waren. Der Markus sah sich als Künstler und hatte zu malen begonnen. Er musste nicht mehr arbeiten. Die Etta gab ihren Beruf aber nicht auf. Wahrscheinlich würden sie im Chor sagen, dass Freiheit etwas sehr Verschiedenes wäre. Für jeden etwas anderes. »Für jeden steht eine eigene Freiheit bereit. Man muss sie nur ergreifen.« Die Mami hatte die Etta einfach uninteressant gefunden. Und den Markus dann auch.
»Hast du nicht noch wahnsinnig viel Zeit.«, fragte sie, und Etta lachte. Sie mache noch einen Besuch, und dann bringe sie diese Leutchen nach Kaiserbad, und dann wäre das Begräbnis. Aber bis dahin waren noch drei Stunden. Aber sie. Cornelia. Sie müsse sich nun auf dem Flughafen langweilen. Etta lachte nicht mehr. Sie war auch nicht besorgt. Sie war nervös geworden. Angespannt. Irgendwie. Sie habe noch etwas vor und könne Cornelia nur aussteigen lassen. Sie führe für die Zwischenzeit auf den Angestelltenparkplatz. Das mache ihr doch nichts aus. Ettas Handy läutete. Sie deutete nach hinten. Ob Cornelia ihr die Tasche geben könnte. Sie nickte. Sie musste sich abschnallen, um auf den Rücksitz reichen zu können. Sie hielt Etta die offene Tasche hin. Die griff nach dem vibrierenden Handy. Sie schaute auf das Display. Sie gab Gas dabei. Das Auto beschleunigte mit einem Satz. Etta sagte »Gleich.« in das Handy und fuhr wieder auf die linke Spur zurück. Sie waren nach rechts geraten, und ein Lastwagen auf der ganz rechten Spur hatte gehupt.
»Hej.«, rief Etta. »Wir sind ja schon da.« Sie fuhr über alle Schwellen ohne zu bremsen. Man spürte sie aber auch nicht in diesem Auto. Etta lächelte wieder. »Also dann.« Sie fuhr die Rampe zum Terminal 3 hinauf. »Mach uns stolz auf dich.«
Etta hielt auf einer Sperrfläche, und sie kletterte so schnell wie möglich aus dem Wagen. Sie winkte. Etta schaute nach links in den Rückspiegel. Sie stellte ihren Rucksack auf einen der Betonkegel, die das Parken auf dem Gehsteig verhindern sollten. »Cornelia.« Das Auto stand noch da. Das Fenster rechts offen. Die Tante hatte sich über den Beifahrersitz herübergebeugt. »Cornelia.« Sie schaute sie an. Das Gesicht der Frau schief verzogen. »Du weißt aber schon, was du zu verlieren hast.« Die Tante beugte sich noch weiter zu dem Fenster herüber. Sie schaute erstaunt. Sie wusste, sie schaute erstaunt und amüsiert. Sie fühlte ihre Mundwinkel in einem amüsierten Lächeln zittern. Die Tante war so wütend. Plötzlich. Zitternd vor Wut. Schnaubend. Sie hatte sich doch nicht zurückhalten können. Konnte es nun doch nicht aushalten, dass die besprochene Person selbst gesprochen hatte. Wie die alle. Sie war wutverzerrt.
»Was verliere ich denn.« Sie fragte nicht einmal. Sie sagte das nur so. Obwohl sie nicht wusste, was gemeint sein könnte.
»Deine Familie.«, zischte die Tante aus dem Auto heraus. »Deine Familie. Denk einmal nach. Darüber.«
Sie stand da und schaute der Frau ins Gesicht. Sie lächelte nicht mehr. Sie fühlte nur das Erstaunen, aber sie beherrschte sich, den Kopf zu schütteln. »Danke fürs Mitnehmen.«, sagte sie zu diesem seitlich im Auto liegenden Gesicht. Sie hob den Arm und wandte sich ihrem Rucksack zu. Sie zippte die Rucksackträger weg und holte den Griff heraus. Der Samsonite-Rollkoffer-wahlweise-Rucksack war ein Erbstück. Die Mami war damit auf Lesereisen gefahren. Wenn sie allein gefahren war, dann hatte sie diesen Rollkoffer-wahlweise-Rucksack von Samsonite genommen. Mami, dachte sie. Die Tante war längst weggefahren. Sie stand einen Augenblick. Dann stellte sie den Rollkoffer auf den Boden und ging zur Drehtür.
4
Sie hätte eine Zeitung kaufen sollen. Oder einen Krimi. Aber dann wieder. Wozu irgendetwas vortäuschen. Für wen. Auf einem Flughafen. Auf einem Flughafen. Da war man ja gar nicht da. Da saß sie und war nicht da und nicht dort. Da war sie dazwischen. In transit. Sie liebte diesen Ausdruck. So wollte sie leben. In transit. Sie hätte den Roman so nennen wollen, aber der Titel zu offensichtlich. Zu platt. Der Gruhns hatte lange herumüberlegt, wie man dieses Buch nennen sollte. Für den Gruhns war es ein Buch. Sie hatte einen Roman geschrieben. Für die Leute in Kaiserbad war es wieder ein Buch. Für die Kritik ein Roman. Wichtig war das nicht. Nicht für sie. Es sagte ja nur etwas über die aus, die einen Roman ein Buch nannten. Oder die, für die ein Roman ein Roman bleiben konnte. Für die Etta war das ein Buch. Nur ein Buch.
Und sie hatte das gut gemacht. Dass sie keine Regung gezeigt hatte. Keine Reaktion. Es war Hass gewesen. Hass war aus dem Autofenster herausgequollen. Wie Miasma. Wie die Baumwollwatte, mit der die Medien das machten. Feuchte Baumwollwatte aus dem Mund quellen lassen. Die Mami hatte ein Buch gehabt. Da waren Fotos aus Wien. Um 1900. Und auf den Fotos war es ganz genau zu sehen. Wie die feuchte Watte aus den Mündern gezogen wurde, weil die Fotos Licht gebraucht hatten. In der Dunkelheit der Seance. Da hatte das echt ausgesehen. Da war das Miasma gewesen. Nicht weiße Baumwollwatte. Sie hätte als Medium rosarote Zuckerwatte genommen. Sie stellte sich die Baumwollwatte im Mund scheußlich vor. Wattig eben. Brechreizauslösend. Und das Miasma von der Etta. Das war wohl das versammelte Miasma der Familie. So klar war ihr das nicht gewesen. Sie hatte gedacht, dass nicht alle. Dass nicht alle sie so. Aber das war auch nur die Etta. Die Etta und ihr Markus und die Iris. Die hatten die Mami schon gehasst. Die hatten ihr ihren Erfolg nicht verzeihen können. Die hatten das betrieben. Die Sachen mit dem Grab und der Bestattung. Die hatten vernichten wollen. Jedenfalls ihre eigene Vernichtung abwehren. Woher das alles kam. Alle diese Vernichtungswünsche. Und sie war getroffen. Sie war von Ettas Ausbruch getroffen. Sie fühlte sich elend. Verlassen. Allein. Verloren. Sie hatte Angst. Aber sie kannte sich auch aus. Sie wusste ja, dass sie das alles schon längst lebte. Und nicht untergegangen war. Bisher. Sie war elend. Verlassen. Allein und verloren. Seit vier Jahren lebte sie so. Hilflos. Der Herbert die einzige Hilfe. Der Herbert. Den sie so blöd gefunden hatte. Solange die Mami mit dem zusammen gewesen war, hatte sie den blöd gefunden, und dann war er der Einzige, der Erinnerungen teilen konnte. Ihre Halbgeschwister auch. Sie hatte ihre eigene Familie. Die konnte sie nicht verlieren. Da konnte die Etta zischen, was sie wollte. Aber Angst hatte sie ihr machen können. Und natürlich hatte sie diese Angst, weil es um etwas ging, das sie nie gehabt hatte. Es ging um die Möglichkeit, eine Familie gehabt zu haben und die nun zu verlieren. Dumme Umkehrungen waren das. Die Katastrophe war doch schon lange vorbei. Für sie war die Katastrophe schon lange geschehen. Aber das hatte ihr niemand lassen wollen. Aber warum. Eigentlich. Warum konnte das sein.
Sie stand auf und setzte sich vom Rand zum Gang an das Fenster zum Flughafen hinaus. Schaute hinaus. Schaute den kleinen Figuren zu. Gepäckswägelchen wurden gefahren. Abwasserleitungen unter den Flugzeugen angeschlossen. Essenslieferungen in die Höhe gefahren. An den Türen angeklopft und Essenscontainer hin und her geschoben. Sie sollte etwas essen. Im Flugzeug würde es nichts geben. Die AUA bot Süßes oder Salziges an. Das waren dann Salzstangen oder Manner-Schnitten. Beides unverträglich. Aber sie wollte nicht aufstehen. Den Platz aufgeben. Sie war fast alleine am Gate. Sie hatte alles schnell erledigen können. Sie war durch die Sicherheitskontrolle ganz allein durchgesegelt. Die Angestellten da über sie hinweg miteinander getratscht hatten. Die waren mit ihrer Winteruniform nicht zufrieden. Die Wolljacken kratzten am Hals, hatte die eine Frau gesagt. Sie müssten Blusen bekommen. Wie die Männer etwas mit Kragen anziehen. Dann wäre es kein Problem. Oder zumindest ein Halstuch. Wie kämen sie dazu, ihre eigenen Halstücher im Dienst tragen zu müssen. Und dass sie das gar nicht dürften. Dass sie keine Accessoires zu ihrer Uniform fügen dürften. Dass das nicht erlaubt sei. Sie hatte ihren Laptop wieder in die Umhängetasche gesteckt. Der Mann am Röntgenschirm hatte sie angeschaut. Sie hatte nur einen Labello in dem Säckchen für die Liquids. Kreislauftropfen. Und eine Zahnpasta. Das passierte ihr immer. Eine junge Frau und keine Schminksachen. Aber das waren Beschwerungen, und sie konnte immer schnell von diesem Sicherheitsgetue weggehen. An den Frauen vorbei, die ihre Beautycases ausräumen mussten. Oder an diesen Männern, die sich vom Sicherheitsdienst ihre Zahnpasten und Rasierwasser in Plastiksäcke stecken ließen. Denen es nichts ausmachte, dass sie lange Schlangen hinter sich anstauten.
Das war also vorbei. Das mit Kaiserbad. Sie würde noch Besuche machen. Ihre Bücher holen. Mehr war da gar nicht. Jeans und Pullover und T-Shirts für den Sommer. Sogar der Badeanzug war in ihrem Rucksackköfferchen mit. Falls es sie zurück nach Griechenland verschlagen sollte. Wenn sie den Preis bekommen sollte, dann gab es ja Geld. Dann konnte sie das ganz einfach machen. Wenn nicht. Sie setzte sich auf. Sie sollte gar nicht nachdenken darüber. Jetzt war die Situation, dass sie auf die Entscheidung warten musste. Wenn sie das nicht tat, dann sollte sie da gar nicht hingehen. Und sie musste lächeln. Sie musste sich zwingen zu lächeln. Durchgehend lächeln. Sie musste eine ebene Außenfläche herstellen, an der alles abgleiten können musste, und wie gut. Sie hätte lachen können. Und wie gut, dass sie gar nichts anderes anziehen konnte. Damit war alles genauso gleich gültig, wie sie das brauchte. Sie würde sich nicht extra umziehen. Die Mami hatte sich für Lesungen noch umgezogen. Hatte sich schön gemacht. Hatte das ernst genommen. Das war vorbei. Alles musste gleich wichtig sein. Dann war es auszuhalten.
Am Vormittag eine Totenvisiste und am Abend eine Preisverleihung. So war das Leben. Ihr Leben ohnehin. Sie hatte ja keine Ruhe mehr gehabt, seit diesem Septembertag vor fünf Jahren. Das war ja das Anstrengende gewesen. Dass es keine Ruhe gibt. Dass eine in jedem Augenblick von einer Erinnerung angefallen werden konnte. Von einer Reue. Von einem Bedauern. Von Zorn und Wut. Dass es innen so eine tobende Wildnis war. Dass alles so riesig war. Da. So viel. So alles. Und dass man außen höchstens dünner werden konnte. Oder schlecht ausschauen. Oder weinen. Sich nicht bewegen können. Nur noch schlafen müssen. Aber das Riesengroße. Innen. Das war außen nicht zu sehen. Nicht zu zeigen. Wenn sie so groß sein hätte sollen wie ihre Gefühle. Sie hätte als Jumbojet herumkurven müssen. Dann wären die Reaktionen auch richtiger geworden. Dann wäre es verständlicher gewesen, wie sie gemieden wurde. Sobald sich ihr Innen außen zeigte. Wie viel Platz sie brauchte, eine Bewegung machen zu können. Und dass es immer kalt war. Dass ihr immer kalt gewesen war. Dass sie heiße Zimmer gebraucht hatte, und dann doch das Fenster aufgerissen und die Kälte von außen hereingelassen.
Ein Flugzeug stieg gerade auf. Flog in Richtung Wienerwald nach Westen. Man würde es im Wald im Luisental hören können. Das Rascheln der Blätter beim Gehen vom Dröhnen des Flugzeugs von ferne unterlegt. Sie hatte das gern. Sie war immer froh, ein Flugzeug zu hören. Da gab es einen Flughafen und Flugzeuge in der Nähe, und man konnte immer weg. Wenn über den Fluglärm geschimpft worden war. Und wenn gesagt worden war, dass es eine Vereinbarung gäbe, dass Kaiserbad nicht überflogen werden dürfte, dann hatte sie nur vor sich hingesehen und sich noch weniger eingemischt. Es war aber auch komisch gewesen. Die alle flogen ununterbrochen in irgendwelche Urlaube auf weitentfernten Inseln. Die Malediven. Maui. Die Balearen. Haiti. Aber sie wollten keine Flugzeuge hören. Sie hatte sich dann ausgemalt, wie man alle diese Leute per Rohrpost durch die Erde hindurch an ihre Urlaubsorte schießen sollte. In Kapseln eingeschlossen durch lange Rohre quer durch die Erdkugel geschossen. Sie selbst. Sie würde immer Flugzeuge wollen.
Ein Mann kam auf sie zu. Er fragte, ob der Platz neben ihr frei sei. Sie schaute sich um. Es waren mittlerweile fast alle Plätze besetzt. Zwei Frauen in der roten Uniform der AUA gingen gerade auf den Counter zu. Sie nickte. Ja. Natürlich. Der Platz wäre frei. Selbstverständlich. Sie kramte ihr iPhone heraus. Wie spät war es denn. Es war 13.20 Uhr. Sie hatte die ganze Zeit verträumt. Sie hatte sich nicht konzentriert. Hatte die Zeit verfliegen lassen. Das war aber ein bedeutender Augenblick. In ihrem Leben war das ein bedeutender Augenblick. Sie war frei. Sie war auf dem Weg zum Erfolg. Sie schaute wieder hinaus. An ihrem Gate war noch kein Flugzeug angedockt. Kam die Maschine so knapp, oder gab es eine Verspätung. Sie schüttelte den Kopf. Sie wollte jetzt nicht in Stress geraten. Sie fühlte sich gerade so perfekt. So sicher. So in dem Allen. Einen Augenblick. Sie wünschte sich ein Gefäß. Eine Thermosflasche. Oder die rotmetallenglänzende Wasserflasche von ihrem kleinen Neffen. Damit sie etwas von ihrem Gefühl jetzt gerade darin aufheben konnte und später davon trinken. Wie bekam sie dieses gute Gefühl in ihrem Körper auf Vorrat. Wie machte man das. Wie konnte das gelingen. Es musste so sein, dass die Erinnerung an dieses Warten auf den Flug nach Frankfurt so lebendig war, dass sie sie vor alle bösen Zustände schieben konnte. Oder sich wenigstens so erinnern, dass die bösen Zustände nur noch im Vergleich dazu wirken konnten. Der Stein der Weisen. Das war wohl so etwas. Aber Harry Potter hatte ihn auch nicht bekommen. Musste immer weiter antreten. Gegen die bösen Zustände.
Sie schaute auf den Boden. Schwarz. Glänzend. Sie schaute noch einmal auf das iPhone. Keine Nachrichten. Das war gut. Mit Marios war erst wieder am Freitag ein Telefontermin. Wenn er es aus dem Haus schaffte. Er musste seine Knöchel schonen. Die zweite Operation am rechten Fuß war erst drei Wochen vorbei, und er sollte nicht belasten. Wenn sie den Preis bekam und das Geld, dann konnte sie ihm richtig helfen. Obwohl. Für eine Operation in Wien würde dieses Geld auch nicht reichen. Der Polizeiwagen war so gegen seine Füße gefahren, dass ziemlich alle Knochen da zertrümmert waren. Und solche Operationen waren unerschwinglich. Ohne Krankenkasse. Oder ging das, dass er als EU-Bürger in Wien doch operiert werden konnte. Da in Athen. Da.
Der Aufruf zum Boarding. Man müsse mit dem Bus zu einer Außenposition. Sie blieb sitzen. Sie sah zu, wie alle sich an die Drehkreuze drängten und sich durchquetschten und dann doch alles zum Stillstand kam. Sie schaute hinunter. Nachdem der erste Bus abgefahren war, ging sie an das Gate. Eine Außenposition, dachte sie. Kein gutes Omen.
Sie musste dann doch in der Schlange stehen. Die Passagiere stauten sich schon auf der Stiege. Sie ließ den Rucksackrollkoffer über die Stufen holpern. Wanderte hinter den Leuten vor ihr her. Im Bus war dann kein Platz. Sie musste den Bus entlanggehen und sich hinten dazudrängen. Dann sah sie, dass der eine Platz zwischen der Tür an der Seite und der Tür nach hinten nicht besetzt war. Sie zwängte sich dahin durch und setzte sich. Doch ein gutes Omen, sagte sie sich. Du nimmst dir den Platz, den niemand sich zu nehmen traut. Rundherum standen jüngere Männer. Eine Gruppe. Sie redeten in steirischer Mundart über technische Dinge. Sie saß, hörte zu und schaute hinaus. Plötzlich fand sie sich erwartungslos. Dahingetragen und ohne etwas zu empfinden. In transit und willenlos. Wunschlos. Sie stieg als Letzte aus. Sie kam als Letzte in die Maschine. Sie hatte einen Platz am Exit belegt, und die Stewardess musste ihren Koffer und ihre Umhängetasche hinten unterbringen. Es war kein Platz gelassen worden. Sie würde ihr das alles gleich nach der Landung bringen, murmelte die Stewardess. Sie setzte sich. Schnallte sich an. Sie streckte ihre Beine lang aus. Lehnte sich tief in den Sitz zurück. Jetzt war es ernst. Es war Wirklichkeit. Sie war auf dem Weg, und nichts konnte sie zurückhalten. Oder zurückholen. Sie hatte ihr Handy gleich abgestellt, als es 2 Uhr gewesen war. Nichts konnte sie aufhalten. Sie schlief während des Starts ein. Beim Weggleiten in das Schlafen. Ein Gefühl des Triumphs brachte sie zum Lächeln. Aber es war eine Schwere darunter.