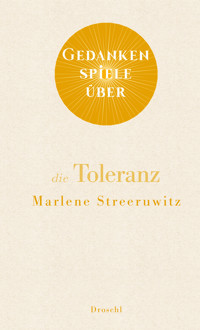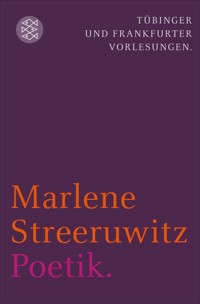
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Wintersemester 1995/96 hielt Marlene Streeruwitz als erste Tübinger Poetikdozentin drei Vorlesungen über die Voraussetzungen ihres Schreibens und schuf damit eine Streitschrift zur feministischen Literaturtheorie und Sprachkritik. Kurze Zeit später, im Wintersemester 1997/98, setzte die Autorin ihre Vorlesungen in Frankfurt fort, wo sie im Rahmen der von Ingeborg Bachmann 1959 eröffneten, traditionsreichen Frankfurter Poetikvorlesungen den Hörsaal betrat. Als Ergänzung zu den theoretischen Auseinandersetzungen der Tübinger Vorlesungen stehen in Frankfurt Ausdifferenzierungen und praktische Umsetzung im Zentrum. Die beiden Vorlesungszyklen werden ergänzt durch ein Gespräch mit Marlene Streeruwitz, das sich mit gegenwärtigen Positionen ihres Schreibens auseinandersetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Marlene Streeruwitz
Poetik.
Tübinger und Frankfurter Vorlesungen.
Über dieses Buch
Im Wintersemester 1995/96 hielt Marlene Streeruwitz als erste Tübinger Poetikdozentin drei Vorlesungen über die Voraussetzungen ihres Schreibens und schuf damit eine Streitschrift zur feministischen Literaturtheorie und Sprachkritik. Kurze Zeit später, im Wintersemester 1997/98, setzte die Autorin ihre Vorlesungen in Frankfurt fort, wo sie im Rahmen der von Ingeborg Bachmann 1959 eröffneten, traditionsreichen Frankfurter Poetikvorlesungen den Hörsaal betrat. Als Ergänzung zu den theoretischen Auseinandersetzungen der Tübinger Vorlesungen stehen in Frankfurt Ausdifferenzierungen und praktische Umsetzung im Zentrum.
Die beiden Vorlesungszyklen werden ergänzt durch ein Gespräch mit Marlene Streeruwitz, das sich mit gegenwärtigen Positionen ihres Schreibens auseinandersetzt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Tübinger Vorlesungen erschienen zuerst 1997, die Frankfurter Vorlesungen 1998 in der edition suhrkamp.
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402395-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Sein. Und Schein. Und Erscheinen.
Sein.
Und Schein.
Und Erscheinen.
Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen.
I.
II
III
IV
V
Statt eines Nachworts.
Sein. Und Schein. Und Erscheinen.
TÜBINGER POETIKVORLESUNGEN
Sein.
In Mittelafrika gibt es einen Stamm, bei dem den jungen Männern zur Initiation der Bauch aufgeschnitten wird. Die Initianten müssen auf ihr und in ihr Inneres in der geöffneten Bauchhöhle blicken. Danach wird der Bauch wieder geschlossen. Und der junge Mann ist in die Gesellschaft aufgenommen. Mit allen Rechten des Mannes. Des Mann-Seins.
Ich hörte diese Geschichte im Radio. In einer Sendung über Medizin bei Naturvölkern. Die Berichterstatterin interessierte es, dass von der Prozedur des Bauchaufschneidens nur nadelspitzenfeine Narben zurückblieben. Dass es keine Infektionen gäbe. Und dass die Initianten aus der Ohnmacht, in die sie beim Anblick ihrer Eingeweide fielen, erfrischt und euphorisch aufwachten. Sie wiesen keine Symptome oder Nachwirkungen eines Schockzustandes auf. Kräuter und die Kraft der Suggestion wurden als medizinische Hilfsmittel angegeben. Dann führte der Bericht weiter zu Kopfoperationen im alten Ägypten. Und ich schaltete das Radio ab.
Ich hatte den Schock, der den Initianten erspart geblieben. Die Vorstellung, die Ältesten meiner Gesellschaft zwängen mich, mir den Bauch aufschneiden zu lassen, den Kopf anzuheben und in mein Inneres zu blicken. Diese Vorstellung macht mich immer noch schaudern. Ich müsste ansehen, wäre gezwungen dazu, das anzusehen, was ich zuinnerst bin, was sich mir aber immer verhüllt. Ich weiß nicht, ob mir eine Ohnmacht reichte, diesen Anblick, diese Situation zu bewältigen. Die 2. Überlegung zu diesem Vorgang ließ und lässt sofort Wut und Empörung in mir hochsteigen: Ich wäre ja ausgeschlossen von dieser Erfahrung. Alles mit ihr Zusammenhängende wäre ein vor mir ängstlich gehütetes und fernzuhaltendes Geheimnis. Ich dürfte mich nicht aufschneiden lassen. Ich dürfte mich auf diese Weise nicht erkennen. Ich bin eine Frau. Und deshalb ausgeschlossen.
Aber. Betrachten wir zuerst einmal den Vorgang dieser Initiation genauer. Nachdem die erste emotionale Abwehr des Bildes abgeklungen ist, lässt sich die ihm innewohnende Poesie zur Kenntnis nehmen. Handelt es sich doch um ein schönes Sinnbild dessen, was wir alle tun müssen. Wir tun es nur in einem anderen Zeitrahmen und in einer anderen Realitätsform. In steter Wiederholung und Neueroberung richten wir diesen Blick auf uns selbst. In uns selbst. Oder versuchen jedenfalls, diesen Blick zu lernen. Und anzuwenden. Auch bei uns sind es die Älteren, die uns unterweisen. Die diesen Blick zulassen. Oder verweigern.
Ich möchte Sie bitten, mir auf einer teilweise umständlich erscheinenden Wanderung zu folgen und mit mir zu untersuchen, wie dieser Blick in unserer Gesellschaft möglich ist. Welche Umstände welche Blicke gestatten oder bedingen.
Die Basis, auf der diese Untersuchung durchgeführt werden wird, ist die Geschichte von der Bauchaufschneiderei. Der Zielkontext, auf den bezogen die Fragen gestellt werden sollen, lautet: Und was bringt mir das beim Frühstück? Ich werde darauf noch genauer eingehen. Fürs Erste schließen Sie richtig, dass diese Frage vermeiden helfen soll, in ein selbstzweckisches Abstrahieren zu geraten. Oder der Versuchung zu erliegen, ästhetisierende Behauptungen um ihrer selbst willen aufzustellen.
Und. Eine weitere Frage erhebt sich an dieser Stelle: Was hat das alles mit Poetik zu tun?
Literarisches Schreiben und Lesen sind, wie alle Prozesse von Sprachfindung, mögliche Formen des In-sich-Hineinblickens. Sind Schnitte in die sichtbare Oberfläche, um tiefere Schichten freizulegen. Sind Forschungsreisen ins Verborgene. Verhüllte. Mitteilungen über die Geheimnisse und das Verbotene. Sind Sprachen, die das Sprechen der Selbstbefragung möglich machen. Und sie so zur Erscheinung bringen.
Im günstigsten Fall führt literarisches Schreiben und Lesen zu Erkenntnis.
Literarisches Lesen steht dem Vorgang der geschilderten Initiation in nichts nach: Wer hat noch nicht, wie vom Blitz getroffen, in ein Buch gestarrt – oder es in die Ecke geschleudert – und, vom Begreifen überfallen, nach Luft gerungen, weil eine Stelle, ein Satz, ja ein Wort in der ganz bestimmten Konfiguration des Textes etwas in ihr oder ihm getroffen hat. Für einen Augenblick wird so die Einsamkeit beim In-den-Bauch-Starren aufgehoben. Und zumindest die tröstliche Erkenntnis wird möglich, nicht allein zu sein. Dass ein anderer oder eine andere ein Gemeinsames wüssten. Das sind Augenblicke, die ich auf allen Ebenen von Literatur gefunden habe. Wenn auch öfter in ihrer Negativversion.
Diese Augenblicke sind dem Lesen vorbehalten. Der Schreiber oder die Schreiberin können das Gemeinsame nicht wissen und werden es gültig aus dem eigenen Text nie erfahren. Sie bleiben mit ihrem Text immer allein. In dieser Getrenntheit der Erfahrungen liegt für mich der Unterschied zwischen Schreiben und Lesen. Ich denke, dass beim Lesen das geschieht, was ich hinter dem Initiationsritus gerne vermuten würde. – Schon deshalb, um mir die Vorstellung davon erträglicher zu machen. – Es wäre ja auch möglich, dass dem Initianten die Operation vorgegaukelt wird. Es gibt einen Schnitt. Aber nur oberflächlich. Es gibt, von der Vorbereitungszeit bis zur Zeremonie, sicher unzählige Berichte über den Vorgang. Möglicherweise verbotene. Es gibt Sagen und Mythen. Es gibt die Angst. Aus einer so hochemotionalisierten Situation heraus dürfte es nicht schwierig sein, dem Initianten in einer Geheimzeremonie glauben zu machen, er hätte sein Inneres gesehen. Die festgelegte und kollektiv vorhandene Vorstellung davon liefert das Bild. Ist dieses Sehen mit einem Tabu belegt, dann darf der Initiant seine Erfahrung nicht verbalisieren. Sie gewinnt keinen Ausdruck. Bleibt so immer die Erfahrung selbst. Bleibt in der Unmittelbarkeit. Befreiung durch In-die-Sprache-Heben dieser Erfahrung wird so unmöglich gemacht.
Schreiben und Lesen sind für mich verschiedene Vorgänge. Eine Kongruenz dieser beiden Formen ist für mich nicht vorhanden. Worauf die formalen Literaturtheorien sich berufen, ist der Begriff einer »literacy«. Dieser Begriff bedeutet, dass in unserem Beispiel nur die Medizinmänner füreinander schreiben und voneinander lesen. Nur ihnen stehen alle Sprachen zu Entschlüsselung der Texte zu Verfügung und damit auch die Möglichkeit, im Lesen den Text vollgültig neu zu schöpfen. Weiterzuschreiben.
Dem Initianten treten die eigenen kontextualen Strukturen zu dominant entgegen, als dass ein störungsfreier Empfang gewährleistet werden könnte. Und meist – und meist absichtlich – sind gar nicht alle Sprachebenen bekannt, die zur Entschlüsselung nötig wären. Aber. Über die Störungen, die im Rahmen des Sendevorgangs »Geschriebenes Lesen« entstehen, wird noch zu sprechen sein.
Dazu muss ich sagen, dass ich selbst formal arbeitete. Ich entwickelte eine strukturale Dramentheorie für meine Dissertation. Auch heute würde ich weiterhin das Operationale einer literaturwissenschaftlichen Arbeit in dieser Richtung suchen. Ich sehe nur, dass die Zeit des Kalten Krieges selbst hier ihre Spuren hinterlassen hat und dass mit dem Ausweg ins rein formal Wissenschaftliche die moralisch-kritische Aussage vollkommen vernachlässigt wurde. Es war doch die Zeit der 60er und 70er Jahre eine Phase, in der man den zu untersuchenden Gegenstand ernst angesehen hat, wohl alles begriffen, aber außer der Beschreibung des Gegenstands dann nichts gemacht hat. Gleichsam um das Gleichgewicht der Bombe zu erhalten, wurde keine wertende Aussage getroffen. Der Rest an zugelassenen Stellungnahmen wurde zwischen akademischer Kritik und Feuilleton aufgeteilt. Für die Erhaltung der jeweiligen Macht war es notwendig, die Sprachen der Älteren, der Medizinmänner der Gesellschaft, nicht in Frage zu stellen. Inhaltliche Kritik war Defätismus.
Hier noch ein Wort zum Literaturbegriff: Ich fasse diesen Begriff so weit wie möglich und beziehe neben der Trivialliteratur auch Dialogisches wie Fernsehserien mit ein. Also alle Texte, die gelesen oder gehört werden. Vornehmlich im Alltag. Literarische Sonntagsmessen in Hochkultur interessieren mich nicht. Wenn – und hier gebe ich der Dekonstruktion recht – jeder im Lesen neu schöpfen kann, dann kann jeder und jede schreiben. Und sollte es auch tun. Über die Beschränkungen, die diesem Tun auferlegt sind, wird noch zu sprechen sein.
Befragen wir uns noch einmal zu unserem Ausgangsbeispiel. Was sieht der junge Mann in seinem Bauchinneren? Warum muss ihm das überhaupt gezeigt werden? Der geschundene Leichnam Jesu, an Klassenwänden hängend. Die zerwühlten Leichen aus Massengräbern, gezerrt in die täglichen TV-Nachrichten. Immer soll an die Möglichkeit des Todes gemahnt werden. Aber allgemein so. Der Blick des Initianten ins eigene Lebensinnere ist dagegen die Enthüllung des Körperinneren in aller Verletzlichkeit. Ist der Blick auf die eigene Endlichkeit. Auf den Tod. Auf den eigenen Tod. Ist der Blick auf jenes Ereignis also, dessen Einschätzung über unsere Einstellung zum Leben entscheidet. Und über die Funktion von Zeit und Freiheit in unserem Leben. Wie wir unseren Tod entwerfen, so wird unser Leben aussehen. Ob in Würde gelebt werden kann, bestimmt sich an dieser Entscheidung.
Unsere Tragödie ist natürlich genau diese Grundkonstellation: Dass auf das Leben der Tod folgt. Um wie viel einfacher sähe die Sache aus, könnte man zuerst sterben und dann leben. Eine Vorstellung übrigens, deren Verführungskraft sich die meisten Religionen zunutze machen. Wie viel einfacher wäre es, könnte man wissen und dann lernen. Erst zahlen und dann genießen. Sich erst voneinander trennen und dann zusammen leben.
Aber. So ist es nicht. Es muss gelernt werden. Und dann wird gewusst. Erst gelebt und dann gestorben. Wir müssen uns also auf diesen Endpunkt hin orientieren.
Dem zu initiierenden jungen Mann wird sein Tod vorgeführt. Er stirbt, bevor er erwachsen wird. Für ihn ist durch den Blick in sich das Sterben fürs Erste erledigt. Warum ist es aber nun so ein Unglück, lernen zu müssen, bevor man etwas wissen kann?
Damit sind wir bei den Medizinmännern unserer Gesellschaft und ihren Einflüsterungen. Wir werden geprägt – wie schon gesagt –, bevor wir beurteilen können, was das ist, was uns prägt, und eine Meinung dazu bilden können. Dazu werden wir uns noch ausführlich mit den verschiedenen Mechanismen auseinandersetzen, die diese Prägungen in den verschiedenen Lernstadien des Kindes betreffen.
Wir lernen, bevor wir der Sprache mächtig sind. Wir werden demnach geprägt von unausgesprochenen Bildern der Verdammnis und des Glücks. Von tabuisierten, weil sprachlosen Aufträgen, die in uns eingepflanzt werden, bevor wir in der Lage sind, diese Aufträge zu erkennen oder überhaupt zu begreifen, dass sie uns erteilt werden.
Lassen Sie mich das anhand eines persönlichen Beispiels erläutern. Einer meiner Medizinmänner war meine Großmutter mütterlicherseits. Ich war ein besonders gut sozialisiertes Kleinkind und wurde deshalb sehr früh in den Kindergarten oder in die Obhut dieser Großmutter gegeben. Meine Brüder beanspruchten die Aufmerksamkeit meiner Mutter vollständig. Sie waren nicht so gut sozialisiert, und man konnte sie nicht in eine Betreuung außer Haus entlassen.
Meine Großmutter war eine Bäurin in der Steiermark. Ich wurde auf dem Bauernhof in eine stark mit archaisch-heidnischen Merkmalen vermischte Katholizität eingesponnen. Mit dem Ergebnis, dass ich mit 5 Jahren wusste, dass ich eine Märtyrerin werden würde. Zu oft und zu begeistert hatten mir die Großmutter und ihre Cousinen von den Märtyrerinnen erzählt, deren Leiden bis ins grausamste kleinste Detail ausgemalt. Zu dominant waren die tiefen Stimmen dieser Frauen gewesen, die mir beim Beten die Hände zusammengepresst und mir die Formeln vorgesagt, mit denen ich mir diese Leiden zur Erreichung höchster und ewiger Glückseligkeit herbeiwünschen musste. Flehentlich.
Mich vergnügte das nicht. Ich erinnere mich noch an lange, heckenrosenbegleitete Wege, die ich entlangstapfte und mir dabei wünschte, eine der Spinnen in den Sträuchern zu sein und Spinnennetze machen zu können, statt dem bangen Schicksal als Märtyrerbraut Christi entgegenzugehen.
Die Notwendigkeit, in die Schule gehen zu müssen, entfernte mich aus dieser Welt. Dass sich dann, viel später, die tief verborgene Aufforderung zur Selbstzerstörung in Rilke-Gedichten dahin ausgewirkt hat, dass ich fürchterlich kitschige Gedichte an »Meinen Bruder Tod« schrieb, lässt sich als weitere Folge der damaligen Einflüsterungen sehen. Ja direkt darauf zurückführen. Rilke wurde ja auch schon aus den gleichen Quellen beeinflusst.
Nun. Dies alles hätte schlimmere Auswirkungen haben können. Ich jedenfalls habe aus dem Schreiben dieser Gedichte, dieser wirklich schlechten Gedichte, gelernt, dass ich, auf Sehnsucht programmiert, der Selbstaufgabe verfallen war. Oder zu verfallen drohte. Diesem von der Lyrik ästhetisierten Ausweg bin ich entkommen. Die Gedichte sind verbrannt. Man kann sich der Erbschaften ja entschlagen.
Um das zu tun. Um eine Erbschaft abzulehnen. Oder auch sie anzunehmen. Muss man wissen, was es ist, was da geerbt werden soll. Lassen Sie uns deshalb – höchst kursorisch – unsere Kultur nach diesen Erbschaften untersuchen.
In unserer Kultur westlich-christlich-jüdischer Prägung behalten wir den Blick dessen, der initiiert werden soll, ein Leben lang bei. Unser Tod ist ja ein Ziel. Ist die Initiation in das neue Leben. Der Blick wird also vom Konkreten ins Abstrakte gerichtet. Auf einen Gott, der den Blick des Initiierten besitzt und diesen Blick auf uns richtet. Dieser Gott kann in uns hineinsehen. Er erkennt uns. Wir aber müssen bis nach dem Sterben auf das Erkennen warten. Gottes Erkennen jedes Einzelnen ist unverwandt und strafend.
Wir leben in Erwartung. Immerhin erwarten wir eine Ewigkeit. Um diese Erwartung aufrechterhalten und beschreiben zu können, wurde der Begriff der Zukunft erfunden. Einer abstrakten Zukunft, in die die Erfüllung jeder Sehnsucht verschoben werden kann. Höchste poetische Anstrengungen werden und wurden unternommen, dieser abstrakten Zukunft ein süßes Bild zu malen. Diese Zukunft ist eine Zeit, die sich immer aus der Vergangenheit begründet, die aber, immer selbst schon Geschichte, nie erlebt werden kann. Sehnsucht und Erwartung sind die Chiffren, die auf den Begriff Zukunft hin gebündelt sind. Die wie Überschriften über den Leben lasten und erst in den Grabinschriften erfüllt werden können.
Den eigenen Blick muss der westlich-christlich-jüdische Mensch auf seinen Gott richten. Er darf sich selbst nicht sehen. Es wird ihm gesagt werden, bedeutet, was er sich vorstellen soll. Glaube heißt das Medium dieser Gottrichtung des Blicks, das die Flucht aus der Gegenwart als Rettung vor einer immer verfehlten Vergangenheit in eine paradiesische Zukunft notwendig macht.
Ich habe alle diese Überlegungen in der Gegenwart gehalten, weil wir heute gar nicht deutlich genug den Anteil von Religion in unseren Lebensmythen herausarbeiten können. Bedenken wir, dass der amerikanische Präsident in Gottes Namen spricht. Folgerichtig trennt er denn auch den Außenhandel von den Menschenrechten. Erinnern wir uns, dass der Sozialist Mitterand in Notre Dame verabschiedet wurde. In allem kirchlichen Prunk. Wieso ist es folgerichtig, im Namen Gottes den Außenhandel von den Menschenrechten zu trennen?
Wir wissen, dass wir es dem Hirten zu verdanken haben, wie es gekommen ist. Die als Herde geführte Menschengruppe musste hoffen lernen. Der Hirte musste das Schaf glauben machen. Glauben, die Weide würde auch am nächsten Tag gesichert sein. Und den Winter über. Das Schaf hätte ja sonst allen Grund gehabt, für sich selbst zu sorgen. Sich seine eigenen Weidegründe zu verschaffen. Sich dem Hirten nicht zu überlassen.
Dem Schritt von der Jagd zur Weidewirtschaft in der Entfernung vom Maß des natürlichen Kreislaufs zum vom Menschen geschaffenen Prinzip der Monokultur haben wir die Herdenorganisation, das Geld, die Sprache und die Stellung der Frau anzurechnen.
Der Schritt von der Jagdgesellschaft zur Herde gibt dem Hirten furchtbare Macht. Anders als in der Jagdgesellschaft, in der Töten das gemeinsame Erlebnis darstellt, wird Töten zum geplanten Akt. Der Hirte bestimmt den Zugang zur Weide. Zugang zur Nahrung. Zugang zum Leben. Und. Damit sind wir schon im Heute angelangt.
Der Hirte bestraft die Streunenden. Und der Hirte bestimmt, wer mit am Tisch sitzen darf. Die Messen unserer Religionen stellen, hochritualisiert, diese Vorgänge dar. Die Frage, wer am Mahl teilnehmen darf, war in allen Zeiten der Grund aller Auseinandersetzungen. Die Asyldebatte handelt davon. Und die Frage, wer am Arbeitsprozess teilnehmen darf, ebenso.
Wer am Mahl teilnehmen darf, bekommt einen Teil seines Gottes zu essen. Was uns daran interessiert, ist die Tatsache, dass der Blick nach oben zu Gott weiterhin als Möglichkeit existiert. Die in den Schulklassen hängenden Kruzifixe sind der konkrete Nachweis. In Österreichs Schulen ist das Morgengebet noch immer Vorschrift. Ist Teil des Konkordats mit Rom. Es wird nur stillschweigend weggelassen.
Die Renaissance eröffnete die Möglichkeit, den Blick auf sich zu richten. Auf die Erde. Auf Irdisches. Auf Natur. Dieser Blick aber ist der Blick des Menschen, des Mannes, der sich mit Gott misst. Ist Gottes Blick, simuliert.
An niemandem lässt sich diese Blickform schöner nachvollziehen als an Shakespeare, der sich das Schaffen von Menschen und ihrer Welten nimmt. Er verfügt dazu über eine Sprache, die auf dem Höhepunkt ihrer Ausdruckskraft ist und für 2 Zeiten Bedeutung zu schaffen vermag. Shakespeare baut sich ein Universum. In quasi göttlicher Haltung. Gnadenlos lässt er seine Helden- und Heldinnenversatzstücke ihr Schicksal entlangtaumeln, als gälte es, den Nachweis für die Unerbittlichkeit der Schöpfung zu erbringen. An der Geworfenheit dieser Figuren kann jeder Theaterregisseur wieder einen objektiven Gott simulieren. Kann zum Leben erwecken. Und die Schauspieler können Lazarus werden. Aus dem Nichts erstehen. Neu beginnen. Das alles ist Anteil an der Macht Gottes. An einer Gewalt, die uns Leben bringt und vorher die Seele kostet. Es kann das Grundschema von Täter und Opfer erkannt werden. Ein Grundschema, in dem jede Ursache von der Wirkung durch den Plan des Hirten getrennt wird. In dem das dunkle Schicksal entworfen wird, in dem das Opfer seinen Mörder nicht kennen kann, weil es erst Jahre nach dem Anschlag sterben wird.
Hirten wie Schafe waren zu allen Zeiten männlich. Es war also der männliche Blick, der sich langsam von einem hingegebenen Hinauf zu einem bewussten Selbst richtete. Der weibliche Blick musste in Passivität erblinden. Sich in sich verschließen. Die arbeitsteilige Gesellschaft hat dieser Passivität im vorigen Jahrhundert in der Hysterie zum reinsten Ausdruck verholfen. Die ohnmächtige Schau des Nichts in der Erstarrung von Astasie und Abasie. Nachdem das Toben und Schreien ein Ende hatte.
In der Geschichte des weiblichen Blicks, oder besser in der Geschichte des weiblichen Nicht-Blicks, spielt die Verbergung eine große Rolle. Während der männliche Blick – wie schon ausgeführt – immer die Simulation des göttlichen Blicks für sich beanspruchen konnte. Das mochte zwar ein Frevel sein, stand aber als Möglichkeit immerhin zu Verfügung. Die Frau wurde in fortschreitende Erblindung gedrängt.
Der Hirte lässt nur Auserwählte an seinen Geheimnissen teilnehmen. Der Hirte möchte immer alles wissen. Seine Herrschaft drängt, gleichsam von seiner Macht über den Zeitpunkt des Todes ausgehend, über das gesamte Leben hin. Als müsste er jederzeit wissen, wo der zum Tod zu Verurteilende sich aufhält, damit er jederzeit abgeurteilt werden kann. Die katholische Ehe, unter deren bedrängenden Nachwirkungen heute immer noch alle Beziehungen leiden, ist als Institution ein Ergebnis solcher Überprüfungsansprüche. Nicht ohne Grund war die maria-theresianische Keuschheitskommission eine geniale Mischung aus Kirche und Polizei plus Zensurbehörde. Die gegenwärtige Auseinandersetzung zur Ehescheidung in Irland zeigt uns, wie sich dies ins Heute drängt. Wir sind in all diesen Chiffren weiterhin mittendrin. Das Chaos dessen, was wir erben, ist bei weitem größer, als es bei erstem Hinsehen den Anschein hat. Denken wir nur daran, dass die »family values« eines Newt Gingrich aus der gleichen patriarchalen Schatzkiste stammen wie der serbisch-kroatisch-bosnische Konflikt. Es geht immer um die Fixierung der Blickrichtung, um die Einsetzung von Hirten in ihre Macht und um die Zulassung zum Mahl durch sie.
Frauen. Frauen hatten also nie einen Blick. Es blieb der Frau immer nur der mittelbare Zugang über den Blick des Mannes zum Blick Gottes. Die beiden imperialen Blickformen, der Blick zu Gott oder Gottes Blick, simuliert, sind heute die beiden dominanten Blickformen, die zur Auswahl stehen. Es sind die Blickformen, in denen uns die Gesellschaft unterweist, noch bevor wir etwas begreifen können. Diese beiden Blickformen haben Sprache, ja sie sind die Sprache und basal verankert.
Die Moderne hat einen radikal anderen Blick entworfen. Einzig die Moderne hat den Blick im konsequenten Auf-sich-selbst-gerichtet-Sein in die Vereinzelung geführt und damit Freiheit ermöglicht. In logischer Konsequenz konnte die Moderne nur jeweils adäquate personale Sprachen entwickeln, die bei jedem Lesen neu dechiffriert werden müssen. Diese personalen Sprachen sind nicht in die Unterweisung in Sprache aufgenommen. Ihre Erringung bedarf immer der Anstrengung, sich der imperialen Blickformen zu entledigen.
Die beiden großen konsensualen, autoritären Sprachen des Blicks zu Gott und Gottes Blick, simuliert, diese beiden großen patriarchal begründeten Blöcke haben sich gegen die notwendig individualistisch zersplitterten Ausdrucksmöglichkeiten der Moderne durchgesetzt. Zwar muss »entfremdet« gelebt werden. Aber um der Frage des Wie des Sterbens aus dem Weg gehen zu können, behält man diese Blickformen zur Beruhigung in der Hinterhand. Heute leben. Gestern oder vorvorgestern denken. In jeder Fernsehserie kann man sich dieses Konzept absegnen lassen.
Doch zurück zu den Erbschaften: Der kirchlich gesteuerte Blick ist weiterhin staatstragend. Der Blick Gottes, den jeder Mann zu simulieren vermag, fand und findet weiterhin seinen Ausdruck. Auch in der Kunst.
Jeder Frau stehen diese Blicke ebenfalls weiterhin zur Nachahmung zu Verfügung. Es gehört zur Logik patriarchal begründeter Systeme, dass man sich über solches aber lustig macht. Mann mokiert sich über Frauen, die so funktionieren wie Männer. Die Geschichten der Heiligen aller Zeiten illustrieren das. Und die KZ-Aufseherinnen, die so gerne als Beispiel angeführt werden, wie grauenhaft Frauen sich aufführen können, haben in ihrem System so gut funktioniert wie die besten Männer.
Wer den vorfabrizierten Blickrichtungen nicht folgen möchte, findet keinen eigenen Blick vor. Männer nicht. Und Frauen nicht. Aber gerade dann, wenn die Suche nach dem eigenen Blick begonnen hat, kommen einem die Erbschaften erst recht in die Quere. Männer sind hier besonders anfällig und fallen in ihre angestammten Blickrichtungen zurück. Denn die Sehnsucht wird die Suchenden plagen. Die Sehnsucht, implantiert als Erinnerung an die Erfindung der nie zu erringenden Zukunft.
Die Sehnsucht nach Erfüllung, nach dem großen, dem einen Ereignis, kaschiert 2 wichtige Erkenntnisse: Erstens, dass das Leben endlich ist und immer nur gegenwärtig erlebt wird. Dass also der Tod auch nur eine Gegenwart von vielen sein wird, die seine Geschichte gebildet haben werden. Und zweitens: Glück ist ebenso nur gegenwärtig zu erleben und in der Aufeinanderfolge solcher Momente episch. Die Sehnsucht behauptet ein dramatisches Glück. Die phallisch blutigen Phantasien des Futurismus sind die gültigsten Ausdrucksformen davon. Es wird uns verschwiegen, dass Glück ein bisschen langweilig ist. Ein bisschen fad vor der Folie der uns eingestanzten sehnsüchtigen Erwartungen. Und an dieser Lüge hat unser Kulturgut, unser Bildungsgut seinen gehörigen Anteil.
Wenn Frauen keinen Blick haben, dann können sie nichts sehen. Dann gibt es nichts zu beschreiben. Wenn also das Gesehene über den Männerblick wahrgenommen wird, dann kann dieses Gesehene auch nur mit der Männersprache beschrieben werden. Alles geborgt. Alles geliehen. Aus zweiter Hand.
Wir haben also diese beiden Blickformen geerbt. Und die Sehnsucht. Ein wolkiges wagnerianisches Gefühl, das uns allen Formen der Ausbeutung zuführt. Ein Gefühl, das immer und jederzeit zu genau diesem Zweck implantiert wurde. Die Ausbeuter haben gewechselt. Das Gefühl nicht.
Es ist eines der größten Vergnügen am Kinderhaben, zuzusehen, wie sich aus der Unzahl der Informationen und der Selbstversuche des Kindes Sprech- und Sprachfähigkeit herausschälen. Man erfährt aber auch die Ohnmacht gegenüber allgemeinen Einflüssen von außen. Ohnmacht vor allem dann, wenn diese Einflüsse Fluchten versprechen, rasche Auswege und Entkommen. Unterschlupf bei Nostalgien, seien es vergangene oder zukünftige. Möglichkeiten, die mit den Überschriften Glaube, Liebe, Hoffnung versehen werden. Reaktionäre Gefühle einer vagen, alles invadierenden Verunsicherung, die unsere Gesellschaft auf stets neue Weise anbietet. Alkohol und Drogen sind davon nur die offenkundigeren Erscheinungsformen.
Das Kind wird also programmiert. Die Aufträge der Gesellschaft werden über die verschiedensten Medien – auch über die Eltern – verankert. Diese Aufträge sind verborgen. Es geht darum, sie aufzuspüren und zu beschreiben. Es geht darum, wie Karl May die Leben beeinflusst und was vom Grafen von Monte Christo zu lernen war.
Heute ist doch alles anders, heißt es. Das ist doch alles nicht mehr so. Denken Sie das jetzt?
Noch bis vor gar nicht so langer Zeit wurden diese Konzepte offen brutal und gewalttätig formuliert. Das Patriarchat hatte noch seine Spielwiese Nationalismus. In unseren Ländern wurde es dann etwas kleinlauter. Durch den verlorenen Krieg.
Heute geht diese Konzeptverwirklichung etwas chamäleonhafter vor sich. Die gewalttätige ödipale Auseinandersetzung wurde durch den sanfteren und meist nicht mehr auftretenden Vater, also den abwesenden Vater, ersetzt. Die sanftere Patriarchalität in allen Bereichen muss so nicht mehr bekämpft werden. Der Umweg in die Anpassung und Übernahme des Patriarchalen über den Kampf wird durch Klonung verkürzt. Die Söhne werden gleich wie die Väter. Eine Phase der Ablehnung ist beim nicht einmal mehr strafenden Vater nicht notwendig. Der Griff zum Blick Gottes, simuliert, kann gleich erfolgen. Die Gesellschaft fördert dieses Selbstbewusstsein durch tausend kleine Hinweise an das männliche Kind.
In Unterhaltungsangelegenheiten wird man neuerdings wieder fromm und geht in die Oper oder in Wagnerverschnitte wie in den »Terminator«, in dem die Sage vom rettenden Ritter fortgeführt wird. »Hasta la vista, Baby!« ist da die formelhaftere Verabschiedung des Mörders von seinem Opfer zum umständlicheren
»Wehe, rief der König, tot von Weibes Hand
Liegt der beste Degen, den man auf Erden fand,
Der je in Stürmen weilte und je den Breitschild trug.
Wie feind ich ihm gewesen, es ist um ihn mir leid genug.«
Die Befreiung von den Eltern ist die erste Auseinandersetzung und neben der kindlich lustvollen Welterfassung die zweite sprachbildende Ebene. Die Nein- und Zornzeiten des Kindes fordern zur Antwort Argumente oder Unterdrückung heraus. Beides komplexe Sprachebenen. Komplizierter als die einfache Lernebene.
Denn irgendwann kommt der Augenblick des Begreifens. Der Augenblick des Abschlusses eines Begreifensprozesses. Irgendwann wird die Selbsthaftigkeit der Person begriffen. – Und sei es nur in depressiver Verstimmung über die Langeweile des Lebens. – In diesem Augenblick wird die Möglichkeit offenbar, dass selbst gelebt werden kann. Also frei.
Stellen wir uns vor, eine Mutter in einem Kaufhaus. Das Kind, auf den Boden geworfen, weigert sich weiterzugehen. Schreit gellend. Der Ausgang dieser Szene entscheidet über die Einstellung der Gesellschaft zu dem Kind und des Kindes zur Gesellschaft. Wird geduldig argumentiert? Wird das Kind zurückgelassen und ihm die Entscheidung überlassen, sich zu beruhigen? Oder nachzukommen? Entscheidungen, zu denen das Kind nicht fähig ist. Wird es einfach abtransportiert? Oder gibt es Schläge? Wie autonom oder angepasst die Mutter auch sein mag. Das Kind holt sich in dieser Szene die Bestätigung seiner Abhängigkeit. Das Kind braucht die Mutter. Die Mutter ist Hauptbestandteil des kindlichen Allanspruchs. Und es hasst die Mutter, weil sie es – nicht zuletzt zur eigenen Sicherheit – in eben diesem Anspruch behindert. Behindern muss.
Untersuchen wir genauer, welche Vorgänge hier ineinandergreifen.
Ich gehe davon aus, dass Erkenntnis von Freiheit möglich ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass alle dominanten Ausdrucksformen unserer Kultur diese Erkenntnis aktiv unterdrücken, indem die ersten Versuche, frei zu sein, in der Abtrennung von der Mutter mit Sprachverboten belegt werden.
Was geschieht in der Kindheit?
Das Kind erkennt seine Unfreiheit. Daneben erfährt es – hoffentlich – Zuwendung und Geborgenheit. Solidarische Lebensbewältigung nach dem guten alten Gesellschaftsvertrag, der in Bezug auf diese weiblichen Pflichten ja nie seine Wirkung verloren hat. Aber der Wille zur Freiheit wird sich durchsetzen. Das Kind wird mehr oder weniger gewalttätig wegstreben.