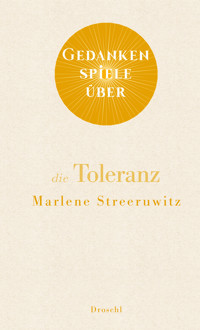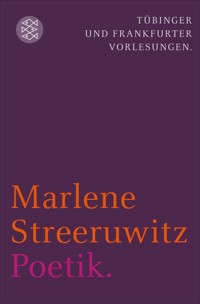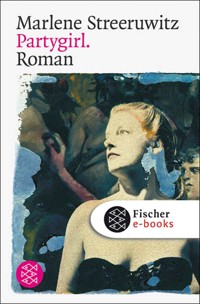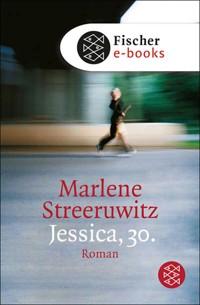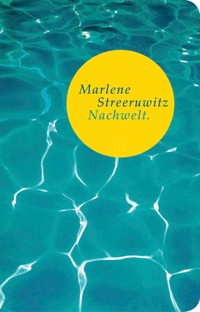
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Mit diesem Buch ist etwas Neues entstanden, auf das wir schon lange gewartet haben.« Die Zeit Eigentlich hätte es eine Liebesreise werden sollen. Die Recherche für die Biographie über Anna Mahler hätte Margarethe nebenbei gemacht. Aber dann kommt er nicht mit, und Margarethe fährt allein nach Los Angeles. »Flüchten Sie, so lange Sie noch können«, raten ihr drei alte Damen in der Shopping Mall, aber zu spät: Zehn atemlose Tage haben schon begonnen. Margarethe interviewt Anna Mahlers Ehemänner, Freunde und Schüler, viele von ihnen wie Anna selbst Emigranten der Nazizeit. Aber Margarethe muss lernen, dass es ihr unmöglich ist, diese vielen Erzählungen in eine »wahre« Geschichte zu verwandeln. Sie selbst lebt in der Nachwelt, aber die Vergangenheit ragt in ihre Gegenwart. Die Reise wird zur doppelten Suche nach Wahrheit, nach der fremden von damals und der eigenen von heute. In der Kulisse von Los Angeles gerät Margarethe zwischen zwei Zeiten und zwei Sprachen. Fremd und allein mit Sehnsucht, Liebe, Enttäuschung und der Wucht der Erinnerung muss sie zusehen, wie die Zerstörungen von damals weiterwirken. Auch an ihr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Marlene Streeruwitz
Nachwelt.
Ein Reisebericht.
Roman
Fischer e-books
Eigentlich hätte es eine Liebesreise werden sollen. Die Recherche für die Biographie über Anna Mahler hätte Margarethe nebenbei gemacht. Aber dann kommt er nicht mit, und Margarethe fährt allein nach Los Angeles. »Flüchten Sie, so lange Sie noch können«, raten ihr drei alte Damen in der Shopping Mall, aber zu spät: Zehn atemlose Tage haben schon begonnen. Margarethe interviewt Anna Mahlers Ehemänner, Freunde und Schüler, viele von ihnen wie Anna selbst Emigranten der Nazizeit. Aber Margarethe muss lernen, dass es ihr unmöglich ist, diese vielen Erzählungen in eine »wahre« Geschichte zu verwandeln. Sie selbst lebt in der Nachwelt, aber die Vergangenheit ragt in ihre Gegenwart. Die Reise wird zur doppelten Suche nach Wahrheit, nach der fremden von damals und der eigenen von heute. In der Kulisse von Los Angeles gerät Margarethe zwischen zwei Zeiten und zwei Sprachen. Fremd und allein mit Sehnsucht, Liebe, Enttäuschung und der Wucht der Erinnerung muss sie zusehen, wie die Zerstörungen von damals weiterwirken. Auch an ihr.
Donnerstag, 1.März 1990
Im Haus war es warm. Roch nach Krankheit. Desinfektionsmittel und Urin. Stechend. Und süß. Manon führte sie durch Zimmer. Sagte, das wäre das Wohnzimmer gewesen. Und da drüben. Da hätte Anna ihr Studio gehabt. Sie kamen in das Schlafzimmer. Auf dem Doppelbett lag ein alter Mann. Er hatte einen hellen Pyjama an, und über seinen Beinen lag eine beige, dünne Decke. Er lag flach. Hatte keinen Polster unter dem Kopf. Auf seiner Brust ein Stofftier. Eine liegende Löwin. Er hielt sie. Streichelte sie. Manon ging zu ihm. Sie zog ihm den Stöpsel eines Kopfhörers aus dem Ohr. Der alte Mann lächelte zu ihr hinauf. Manon setzte sich neben ihn. Sie holte tief Luft. Das wäre die »young lady from Vienna«. Die die Biografie von Anna schreiben wolle. Sie hieße Margaux. Eigentlich ja Margarethe. Aber ob er Margarethe einen schönen Namen gefunden habe? »I don’t know. I don’t think so«, sagte er. Er lächelte Manon wieder an. Sie gab ihm den Stöpsel zurück. Sie müsse in die Küche. Kochen. Albrechts Essen kochen. Der Pfleger. Der koche nicht richtig. Nicht so, wie Albrecht es gerne hätte. Und Margaux solle sich da hinsetzen. Da. In diesen Sessel. Ja. Da. Albrecht werde schon reden mit ihr. Obwohl. Wenn er Musik höre. Man müsse eben geduldig sein. Manon ging. Sie schlug sich mit der linken Hand gegen das Brustbein. Leicht. Den Atem anzutreiben. Mit der anderen Hand stützte sie sich an der Wand und den Möbelstücken ab. Margarethe wollte aufstehen und zu Hilfe eilen. Stützen. Manon wehrte ab. Um Atem ringend ging sie hinaus und schloß die Tür hinter sich. Margarethe saß da. Sah auf den alten Mann auf dem Bett. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen. Die kleine Löwin lag davor. Auf seiner Brust. Er hielt das Stofftier. Streichelte es. Seine Hände groß. Weiß. Er hatte lange breite Finger. Die Finger der einen Hand fuhren den Rücken der Löwin entlang. Hielten dann den Schwanz einen Augenblick. Streichelten dann wieder den Rücken entlang. Mit der anderen Hand hielt er den Kopf der Löwin. Klopfte manchmal einen Rhythmus auf ihren Kopf. Der Musik folgend, die er hörte. Wahrscheinlich. Margarethe saß in einem Holzsessel mit hoher Lehne. Sie hatte ihre Arme auf die Armstützen gelegt. Sah den streichelnden Händen zu. Es war dämmrig im Zimmer. Der Himmel bedeckt und Büsche vor den Fenstern. Die Wärme. Es wurde geheizt. Aus einem Messinggitter im Boden stieg heiße Luft auf. Was sollte sie tun. Was tat man. In solchen Situationen. Was konnte man tun. Im Haus waren Geräusche zu hören. Gedämpft. Weit weg. Und manchmal ein Auto von draußen. Den Berg hinauf. Aber mehr eine Vibration des Holzes, aus dem das Haus gebaut, als ein Geräusch. Sie saß da. Müde. Überwach. In Wien wäre es jetzt zwei Uhr in der Nacht. Der süße Geruch. Er wurde in Wellen stärker und verschwand dann wieder fast ganz. Ihr würde schlecht werden. Elend. Solche Gerüche machten ihr Übelkeit. Migräne. Sie würde hinausmüssen. Aber wie kam sie aus diesem Zimmer ins Freie. Das Haus hatte klein ausgesehen von außen. Aber dann waren sie durch so viele Zimmer gegangen. Halle. Wohnzimmer. Bibliothek. Studio. Schmale Gänge. Wo konnte da noch eine Küche sein. Sie saß still. Hörte sich atmen. Der alte Mann hatte sie sicher vergessen. Hatte sie gar nicht zur Kenntnis genommen. Und. Dieses Haus hier. Das hatte Alma Mahler gekauft. Für Anna. Bis dahin hatte Anna in Los Angeles bei ihrer Mutter gewohnt. 1954. Da war Anna 48 Jahre alt gewesen. Und mit Albrecht Joseph zusammen. Damals schon. 37 Jahre waren die beiden zusammengeblieben. Dann. Im Lebenslauf Anna Mahlers im Katalog zur Ausstellung ihres Werks in Salzburg 1988 war Albrecht Joseph nicht einmal erwähnt gewesen. Sie hätten ihn vergessen, hatte Annas Tochter Marina in London gesagt. Er wäre eben immer dagewesen. Albrecht Joseph streichelte die kleine Löwin. Margarethe sah ihm zu. Und wie er den Rhythmus der Musik in die kleine dunkle Löwenmähne tippte. Schritte draußen. Entfernten sich wieder. Der alte Mann schob das Stofftier über die Brust seinem Mund zu. Küßte den Kopf des Tieres. Schob es wieder auf die Brust zurück. Streichelte es. Ob sie wisse, wie Steifftiere gemacht würden, fragte er. Er sprach englisch. Sprach das th wie s aus. Er glaube, die Steifftiere würden über eine Form genäht. Über eine Tonform. Und würden dann umgestülpt. Wie Handschuhe. Diese kleine Löwin hätte er, seit er fünf Jahre alt gewesen. Sie hätte immer »Löwin« geheißen. »Little lioness.« »Kleine Löwin«, sagte er. Auf deutsch. Mit amerikanischem Akzent. Im Haus seiner Eltern am Starnberger See wäre die Bibliothek unter dem Dach gewesen. Und da hätte es ein eigenes Regal für Stofftiere gegeben. Er hätte alle Steifftiere besessen, die es gab. Am meisten geliebt habe er eine Katze. Diese Katze habe mit einem roten Wollknäuel gespielt. Er hätte diese Katze so geliebt, daß das Wollknäuel und das Fell der Katze am Ende verschwunden gewesen wären. Die Katze hätte dann ausgesehen wie eine Maus. Er sprach laut. Deutlich. Dann schwieg er wieder. Lag da. Streichelte die kleine Löwin auf seiner Brust. Margarethe saß vorgebeugt. Ihn genau hören zu können. Sie sah den alten Mann an. Hörte wieder nur ihren Atem. Die kleine Löwin hatten sie ihm nicht wegnehmen können. Damals. Oder? Manon kam ins Zimmer. Sie müßten fahren. Es würde bald dunkel. Ein großer blonder Mann kam hinter ihr ins Zimmer. Manon fragte ihn, ob alle Fenster gut verschlossen wären. Ob alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten würden. Der Mann nickte. Er trug einen weißen Overall. Er nahm die Decke von Albrechts Beinen und legte sie zusammen. Manon fragte Margarethe, ob sie wisse, daß sie nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus gehen dürfe. Daß gegen eine Fliege, die alle Pflanzen kaputtmache, gesprayt würde. Von Flugzeugen aus würde jede Nacht ein anderer Teil von Los Angeles gesprayt. Mit diesem Gift. Und man dürfe nicht ins Freie und solle die Fenster und Türen dichten und geschlossen halten. Es sei nicht sicher, ob dieses Gift nicht doch auch für den Menschen giftig wäre. Und nicht nur für diese Fliege. Manon war an Albrechts Bett stehengeblieben. »We didn’t live that long in California to be gassed in the end«, sagte sie zu Albrecht, und sie lachten beide. Manon hielt Albrechts Hand. Der Mann im weißen Overall ging an die beiden Fenster. Rüttelte an ihnen und nickte. Manon beugte sich zu Albrecht und küßte ihn. Er bekäme sein Fleisch so, wie er es gerne hätte, sagte sie ihm. Und er solle ordentlich essen. Sie wolle keine Reste finden. Sie winkte Margarethe ans Bett. Margarethe gab dem alten Mann die Hand. Sie lächelte auf ihn hinunter. Er lächelte zu ihr hinauf. Sie solle bald wiederkommen. Es kämen nicht so viele »charming young ladies« zu Besuch. Nicht mehr. Manon versprach, Margaux wieder mitzubringen. Sie gingen. Der Mann im weißen Overall hatte einen Leibstuhl auf Rädern ins Zimmer gerollt. Er begann, Albrecht aus dem Bett zu heben.
Manon ging zum Auto hinaus. Sie stützte sich an den Wänden ab. Margarethe folgte ihr. Ging hinter ihr durch die nun dunklen Zimmer. Die schmalen Gänge. Sie hörte Manons flaches Atmen. Manon setzte sich ins Auto. Sie nestelte sofort die von der Sauerstoffflasche wegführenden farblosen, dünnen Schläuche über ihre Ohren. Schob die Auslässe in die Nase. Drehte am Ventil der Sauerstoffflasche. Hielt die Sauerstoffflasche mit beiden Händen. Sog den Sauerstoff tief ein. Die Hitze in dem Haus. Die brächte sie um. Aber er müßte das so haben. Albrecht decke sich nicht zu. Weigere sich, eine Decke auf sich liegen zu haben. Auch in der Nacht nicht. Also müsse das Haus warm sein. Ob sie geredet hätten. Manons Gesichtsfarbe war wieder rosig. Sie startete. Wendete den riesigen Wagen und fuhr los. Manon fuhr langsam. Oletha Lane war nur ein Hohlweg. Ob Margaux etwas von Albrecht erfahren habe. Margarethe sah in die Büsche. Der breite Cadillac streifte rechts und links die überhängenden Zweige. Stachelige, fleischige Blätter. Raschelten trocken. Nein. Sie hätten nicht geredet, antwortete sie. Albrecht hätte über die Herstellung von Steifftieren gesprochen. »The little lioness«, rief Manon und schlug mit der flachen Hand auf das Lenkrad. »Always the little lioness.« Man könnte eifersüchtig werden. Auf dieses Tier. Eines Tages hätte der Pfleger angerufen. Mark. Ein Pole. Und er hätte gesagt, Albrecht schreibe einen Scheck, und könne sie nicht kommen und sich um alles kümmern. »Why shouldn’t he write a check?« hätte sie gefragt. Es wäre ein Scheck über 10000 Dollar. Also wäre sie hingefahren. Albrecht war immer noch dabei gewesen, den Scheck zu schreiben. Es wäre der dritte gewesen. Er habe jeden Scheck ruiniert. Sie hätte ihn dann gefragt, warum er diesen Scheck schreiben wolle. Er wolle Mark das Geld geben, hatte Albrecht geantwortet. Und Mark solle immer für die kleine Löwin sorgen. Seither kümmere sie sich auch um Albrechts Geldangelegenheiten. Sie waren auf Sunset Boulevard zurück. Der Himmel dunkel. Grau. Die Bäume und Büsche schwarze Silhouetten. Der Verkehr wäre so schlimm, weil alle zu Hause sein wollten, sagte Manon. Wegen des Sprayens. Sie hätte ja alles unterschrieben gegen diesen Unfug. Gift aus dem Flugzeug! Über Wohngebieten! Sie schlug wieder gegen das Lenkrad. Margaux müsse sich dann auch beeilen. Selbst nach Hause zu kommen. Und sie solle den Manager von ihrem Apartment fragen, ob die Fenster auch wirklich dicht seien. Sie fuhren in einer langen Kolonne dahin. Margarethe saß zurückgelehnt. Ließ sich dahintragen. Hörte der alten Frau zu. Würde sie mit einer solchen Krankheit so aktiv sein. Und so nett. Ohne jeden Grant. Und in Wien. Da würde man mit Lungenemphysem im Altersheim sitzen und nicht mit einer Sauerstoffflasche im Arm in einem goldenen Cadillac Baujahr 1968 herumfahren. Der Wagen schaukelte. Schob sich nach vorne. Die Kolonnen gleichmäßig vorwärts. Die entgegenkommenden Autos Ketten heller Scheinwerfer. In ihrer Richtung die Rücklichter rote Bänder den Berg hinauf. Sie redeten nicht mehr. Manon fuhr von Sunset ab. Der Verkehr wurde lebhafter. Nicht mehr dieses geduldige Vorwärts. Manon parkte ihren Wagen wieder in der Seitengasse bei ihrem Haus. Riet Margarethe, in Zukunft auch hier zu parken. Und sie sollten morgen früh telefonieren. Sie hätte Max eingeladen. Dr.Max Hansen. Der wäre mit Anna in China gewesen. Aber er hätte heute noch nicht gewußt, ob er Zeit haben würde. Er arbeite bei einem Aidsprojekt mit. Die Planung sei da nicht so einfach. Wie man sich vorstellen könnte. Manon drehte das Ventil der Sauerstoffflasche zu und legte die Schläuche auf den Sitz. Sie gingen durch den Hintereingang auf den Hof. Um den Swimmingpool herum. Das Wasser von unten beleuchtet. »You hurry.« Manon schickte sie zum Vordereingang. Schob sie weg. Sie solle sich beeilen. Und bis morgen. Margarethe winkte der Frau. Manon stand an der Tür zu ihrem Apartment und winkte zurück. Margarethe lief zu ihrem Auto. Es würde ja nicht gleich mit dem Giftsprayen begonnen werden. Aber sie beeilte sich, ins Auto zu kommen. Bei der Heimfahrt mußte sie bei jeder Ampel stehenbleiben. Dazwischen nur Schrittempo. Sie fuhr. Immer wieder sammelte sich Feuchtigkeit in winzigen Tropfen auf der Windschutzscheibe. Wenn sie die Scheibenwischer einschaltete, verschmierte sich die Scheibe. Luftfeuchtigkeit. Knapp vor dem Regen. Wie bei der Hinfahrt. Aber die Vorstellung des Gifts aus den Flugzeugen. Sie würde in die Garage fahren, und von dort an mußte sie sich nur noch im Haus bewegen. Und heute wäre sie ohnehin dageblieben. Sie mußte schlafen. Und er wollte anrufen. Vorhin. Im Wagen mit Manon. Sie war nicht sicher, ob sie nicht geschlafen hatte. Die Fahrt nach Venice dauerte länger als eine Stunde. Die Autos krochen dicht aneinandergedrängt über die Straßen. In Venice bog sie auf Washington ein und gleich wieder bei Marina Street ab. Sie hätte auch Via Dolce nehmen können. Es wäre einfacher gewesen. Kürzer. Aber dann hätte sie den Verkehrsstrom verlassen müssen. So fuhr sie inmitten der anderen um die Kurven. So schnell wie alle. Ohne Zögern, den Weg zu finden. Sie bog in die Seitengasse. Es begann zu regnen. Die erleuchteten Fenster des Hochhauses auf der linken Seite waren nur undeutlich zu sehen. Verschwammen im Nebel des Regens. Sie war froh, in die Garage zu kommen. Es war gegen acht Uhr. Ihr Genick schmerzte, und die Augen brannten. Sie wäre gerne noch ans Meer gegangen. Aber bei dem Wetter. Und die Sache mit dem Gift. Es war zwar sicher nicht so gefährlich, wie Manon tat. Aber. Und was geschah mit den Obdachlosen. Es waren so viele gewesen, die in der Nacht im Sand geschlafen hatten.
Im Apartment ging sie zuerst ins Badezimmer und sah in den Einbauschrank. Dann sperrte sie beide Türschlösser ab. Drehte die Jalousien zu. Setzte sich auf die Couch. Was sollte sie essen. Sie hatte seit dem Frühstück nichts gegessen. Der Geruch der Spareribs aus dem Supermarkt fiel ihr ein. Sie wusch die Erdbeeren und setzte sich wieder. Die Erdbeeren schmeckten nach nichts und rochen nach dem Chlor des Wassers. Sie stellte sie weg. Ein Kaffee. Einen Kaffee hätte sie gerne getrunken. Für Kaffee war es zu spät. Sie wusch die Weintrauben. Legte sie auf ein Geschirrtuch und tupfte das Wasser ab. Sie aß die Weintrauben. Sie drehte den Fernsehapparat auf und begann, Zeitung zu lesen. Sie blätterte über die ersten Seiten. Über die Erdbeben vom Vortag hatte sie beim Frühstück gelesen. Und daß die Säuglingssterblichkeit in den USA weiter angestiegen wäre. Und daß afroamerikanische Säuglinge betroffen wären. Sie war bis zu Kanzler Kohls Garantie der Polengrenze gekommen. Im Fernsehen betrank Denise sich bei einer Party, und es war vorauszusehen, daß Vater Cosby-Huxtable dazu einige moralische Sprüche zu sagen haben würde. Sie schaltete weiter. Blieb bei einer Folge der Father Dowling Mysteries. Schwester Steve sprach gerade mit der Haushälterin. Margarethe las Zeitung. Die Sowjets erlaubten private Landwirtschaft. In Santa Barbara war das Rasengießen mit Schläuchen verboten. Bäume und Sträucher durften nur noch mit Kübeln gegossen werden. Rasen überhaupt nicht. Die höhere Bestrafung von Ärzten wurde gefordert. Ein Dr.Milos Klvana hatte neun Babys ermordet und weiter praktiziert. 67% der kalifornischen Bevölkerung wären für lebenslängliches Gefängnis statt der Gaskammer. Im Dezember hatten noch achtzig Prozent für die Todesstrafe gestimmt. Sie aß Trauben. Schwester Steve und Pfarrer Dowling fuhren im Auto. Es lag Schnee auf der Straße, und Schwester Steve trug grünwollene Ohrenschützer. Sie holte sich noch ein Glas Wasser und ein Stück Parmesan. Pfarrer Dowling telefonierte an einem Telefonautomaten. Sie las über den fünfjährigen Roy. Ein Erwachsener hatte ihn angehalten, Bourbon zu trinken. »Wie ein Mann«: Das Kind war gestorben. Es hatte einen Blutalkoholspiegel von 55 % gehabt. Sie saß da. Schwester Steve lief über eine Straße. Zerrte eine junge Frau mit sich. Sie versteckten sich hinter Autos. Hockten im Schnee. »I want my baby«, keuchte die junge Frau immer wieder. Sie drehte den Fernsehapparat ab. Ging zum Eiskasten. Holte die Weinflasche heraus. Suchte nach einem Flaschenöffner. Fand ihn an der Wand auf einem Haken hängen. Sie goß sich ein Glas ein. Stoppelte die Flasche zu. Stellte sie in den Eiskasten. Ging zur Couch zurück. Las weiter. Ein Michael Lerner, Herausgeber eines liberalen jüdischen Magazins, bezeichnete die deutsche Wiedervereinigung als tödliche Gefahr für die Welt. Er wende sich gegen die Idee, die Deutschen hätten die Wiedervereinigung verdient, stand da. Er sei entschieden gegen die Vorstellung, die Deutschen hätten ihre Strafe abgedient und dürften jetzt die Vergangenheit vergessen. Sie trank vom Wein. Stand auf. Ging an die Frühstückstheke. Setzte sich auf den Barhocker. Dann auf den anderen beim Telefon. Ging zum Spiegel über den beiden Waschbecken. Sah sich beim Trinken zu. Ging zum Eiskasten. Füllte das Glas. Setzte sich wieder. Drehte den Fernsehapparat wieder auf. Bei den Cosbys gab es gerade die Aussprache. Und die Erklärung von Denise, daß sie nie wieder Alkohol anrühren werde. Und wie sehr sie die Eltern liebte. Und die Eltern sie. Pfarrer Dowling und Schwester Steve standen dann nebeneinander und sahen der jungen Frau nach, die mit ihrem Kind im Arm auf ein Auto zuging. Ein Mann wartete neben dem Wagen auf sie und schloß sie und das Kind in die Arme. Sie drehte den Apparat wieder ab. Einen Augenblick glaubte sie, ihr würde schlecht. Vor Zorn. Dann stiegen die Tränen auf. Die Ungeheuerlichkeit solcher Happy-Ends. Diese Beiläufigkeit der Lüge. Und warum saß sie allein. Hier. Warum war er nun wirklich nicht mitgekommen. War sie schon wieder dabei, sich von ihm etwas einreden zu lassen. Sie hätte ihm die Telefonnummer nicht geben sollen. Zwei Wochen nicht anrufen. Nicht reden können. Aber das hätte sie wieder nicht fertiggebracht. Es war nach neun Uhr. Was sollte sie hier tun. Konnte man wirklich nicht hinaus. Sie konnte doch nicht jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit hier herumsitzen. In der Zeitung war nichts gestanden. Sie blätterte die Los Angeles Times noch einmal von Anfang bis Ende durch. Sie las Roys Geschichte noch einmal. Sah wieder die Großtante vor sich. Und wie sie dem Werner den Most zu trinken gegeben. Und wie die Großtante dann die Männer geholt und alle gelacht hatten. Der kleine Bub hatte schwankend immer wieder versucht, die Stufe zum Eingang hinaufzusteigen. Im Taumeln war er immer an der Stufe vorbeigestiegen. Und er hatte gelächelt dabei. Hilflos. Verloren und süß. Erstaunt. Sie holte sich noch ein Glas Wein. Hatte sie etwas, das sie seit dem fünften Lebensjahr besaß? Was hätte sie zum Mitnehmen gehabt? Damals. Ihr fiel nichts ein. Sie hatte immer alles weggeworfen. Auch vom kleinen Werner. Alles. Es hatte damals geheißen, es wäre besser, sich aller Erinnerungen zu entledigen. Und mit dem Leben weiterzumachen. Mit dem Leben weitermachen, hatte der Pfarrer gesagt. Zu ihrer Mutter. Danach. Aber hätte man etwas retten können. Überhaupt. Und dann. Als Opfer. War es nicht das Schwierigste zu begreifen, daß einem die Auslöschung gewollt worden war. Die vollkommene Auslöschung. Von allen. Daß der Haß einen betroffen. Wie war dem zu entkommen, auch wenn man entkommen war. Und konnte ein Steifftier? Sie trank den Wein aus. Leerte die Flasche. Ging ins Bett. Zog sich aus. Wusch sich. Zog das Nachthemd an. Sie war wolkig im Kopf. Und weinerlich. Es war alles weit weg. Gleichgültig. Sie legte sich hin. Stand wieder auf. Stellte den Anrufbeantworter an und legte einen Stoß Handtücher über das Gerät. Sie wollte nichts hören. Und jetzt würde sie schlafen. Sie konnte nicht warten, bis er um elf Uhr anrief. Er würde sie aus dem ersten Schlaf reißen. Sie würde schlaflos liegen. Dann. Nach dem Gespräch. Und alles tausendmal überlegen müssen. Was er nun ernst gemeint hatte. Was Wahrheit. Was nicht. Sie legte sich hin. Zwischen den Jalousien fiel Licht von draußen herein. Es gab noch den Teddybären. Er hatte Martin geheißen und war in Werner umgetauft worden, nachdem Werner auf die Welt gekommen. Sie hatte dann kaum mit dem Bären gespielt. Es hatte ja den kleinen Werner gegeben. Zuerst.
Freitag, 2.März 1990
Sie wachte um halb sieben Uhr am Morgen wieder auf. Tauchte aus einem leichten Schlaf auf. Fühlte sich elend. Schwindelig. Der Mund war ausgetrocknet. Die Luft schlecht. Abgestanden. Sie riß die Balkontür auf. Kühle, feuchte Luft strömte ins Zimmer. Auf dem Weg zur Toilette sah sie auf den Anrufbeantworter. Kein Anruf. Er hatte nicht angerufen. Sie hätte umsonst gewartet. Wäre dagesessen. Hätte sich ausmalen können. Müssen. Warum er nicht anrief. Nicht. Alle Möglichkeiten in diesem Nicht verborgen. Aller Verrat und Betrug. Und mit einem Anruf aufzuheben gewesen. Sie legte sich wieder ins Bett. Wünschte sich, ein Glas Wasser geholt zu haben. Wickelte sich in die warme Decke. Und dabei wäre es so einfach, nett betrogen zu werden. Anzurufen. Durch einen Anruf ihr Warten aufzulösen. Die Abmachung mit ihr einhalten. Und dann tun, was er wollte. Sie wüßte ja trotzdem nicht, was er tat. Er hätte sie in Ruhe belügen können. Aber in Ruhe. Und freundlich. Aber so. So mußte sie Schlüsse ziehen. Und der eine Schluß. Der war nicht zu umgehen. Er wollte sie verletzen. Er wußte ja, wie schwierig dieses Warten für sie war. In den zwei Jahren war das zu lernen gewesen. Bewußt war ihm diese Grausamkeit nicht. Aber sie war ihm selbstverständlich. Hätte er es doch wenigstens genossen. Sie zu quälen. Das wäre zu verstehen gewesen. Dieses Nebenbei einer Quälerei. Und. Das Warten existierte nur für sie. Er konnte das nicht verstehen. Konnte nichts dazu sagen. Konnte es nur verursachen. Sie sah vom Bett aus auf eine Palme draußen. Der Himmel bedeckt. Die Wolken das Licht fast vollständig abhielten. Tag. Aber dämmrig. Die Farben dunkel. Die Palme schwarzgrün. Ihr Kopf schmerzte. Der kalifornische Chardonnay. Was mußte sie auch eine Flasche trinken. Eine ganze Flasche. Und hinunterstürzen. Was hatte sie sich gedacht. Sie lag da. Eingerollt. Atmete tief die frische Luft. Eingehüllt in die Wärme des Betts. Sie döste. Sah auf die Palme. Schlief kurz. Wachte auf. Der Zorn auf Helmut riß sie aus der Geborgenheit des Betts. Sie stürzte zum Telefon. Wählte die Nummer in seiner Wohnung. Die Ordination hatte er ja an seinen Vertreter übergeben. Für die Reise nach Kalifornien hatte er Urlaub genommen. Sie stand an der Frühstückstheke. Fror. Der Morgenmantel hing im Badezimmer. Das Telefon in Wien läutete. Fünfmal. Siebenmal. Zehnmal. Sie legte auf. Kroch wieder ins Bett zurück. Aber die Kopfschmerzen wurden stärker. Begannen zu klopfen. Sie mußte aufstehen. Kaffee. Sie brauchte Kaffee. Und warum lief der Anrufbeantworter bei ihm nicht. Was bedeutete das nun wieder. Sie holte den Morgenmantel. Füllte Wasser in die Kaffeemaschine. Schaufelte Kaffeepulver in den Filter. Schaltete ein. Sie setzte sich auf die Couch und hörte der Kaffeemaschine zu. Wie das kochende Wasser röchelnd in den Filter spritzte. Gurgelte. Sie saß auf der Couch. Umfing sich mit beiden Armen. Hatte die Füße auf der Couch unter einen Polster geschoben. Sie hätte Schluß machen wollen. Wenn er dagewesen wäre. Am Telefon. Dann wäre jetzt alles überstanden. Sie würde weinen. Aber sie hätte es ihm gesagt. Daß sie das nicht wolle. Nicht so. Daß sie das nicht nötig hatte. Daß sie leben wollte. Und nicht nur warten. Warten auf jemanden, der dann ohnehin nicht dasein würde. Nie da war. Sie hätte es auf den Anrufbeantworter sagen können. Aber seine Unerreichbarkeit. Nicht einmal die Maschine mehr zu erreichen. Hilflose Wut. Und hinter allem die Hoffnung, er hätte ihre Abrechnung unterbrochen. Hätte ihren Redeschwall aufgehalten und gesagt, alles ganz anders. Er hätte ein Ticket für den nächsten Flug nach Los Angeles. Er käme noch heute. Und er ließe sie nie wieder warten. Nie wieder, und sie solle es noch einmal versuchen mit ihm. Bitte! Der Kaffee war fertig. Sie holte sich eine Tasse. Setzte sich ins Bett. Deckte sich zu. Er tat ihr auch leid. Er hatte ihr so deutlich gezeigt, wie er ihre Geschichte einstufte. Und sie las den Subtext nicht. Sah nicht. Wollte nicht sehen, wie er sie beleidigte. Und ihre Liebe. Sich um Sandra kümmern! Deutlicher ging es nicht. Sich um die Stieftochter von der Exfrau kümmern müssen. Das arme Kind. In Dornbirn. Und Schwierigkeiten. Gesundheitliche. Er müsse. Und sie müsse das verstehen. Traude. Traude könnte das nicht allein. Traude konnte nichts allein. Und. Was für ein Gerangel um diesen Mann. Wie widerlich. Und wie nett für ihn. Er gewann in jedem Fall. Wenn sie das alles nicht verstand. Kein Verständnis aufbrachte, dann konnte er sie herzlos nennen. Eifersüchtig. Besitzgierig. Und unreif. Das war neu dazugekommen. Unreife. Es wäre ihre Schuld, daß alles so schwierig. Plötzlich. Und wenn sie sagte, Situationen verlangten Abgrenzungen. Dann dieses mitleidige Lächeln. Biografien, hieß es dann. Das liefe nicht so. Nicht so nach Lehrbuch. Aber. So würde er nicht davonkommen. Er würde es sagen müssen. Er würde ihr sagen müssen, daß er sie nicht liebe. Nicht mehr. Oder nie hatte. Aber so. Irgendwie. Nein. Sich in Luft auflösen. Nicht mit ihr. Sie holte sich eine zweite Tasse Kaffee. Trug die Decke zur Couch. Wickelte sich ein. Drehte den Fernsehapparat auf. Wetterberichte und Nachrichtensendungen. Frühstücksshows. Sie schaltete ab. Sie stand auf. Rief Friedericke an. Ob alles in Ordnung wäre. Ob Gerhard sich kümmere. Um sie? Um alles? Friedericke erzählte aus der Schule. Sie solle sich keine Sorgen machen. Und Helmut hätte angerufen. Hätte sich erkundigt, wie es ihr gehe. Und bis bald. Sie setzte sich wieder auf die Couch. Wickelte sich in die Decke. Der Kopf war etwas besser. Eine Dusche, und es würde wieder gehen. Die Friedl geriet so sehr ihrem Vater nach. Gerhard hatte auch diese beruhigende Art. Das nun in der Tochter wiederzufinden. Es machte sie genauso unruhig und nervös. Wie damals. Was war da zu tun. Und warum rief Helmut das Kind an. Er hatte schon eine Stieftochter, um die er sich kümmern mußte. Er hatte schon Sandra. Sandra. Was für ein Name. Aber eine Mutter, die Traude hieß, die mußte ihr Kind Sandra nennen. Den Anfang eines neuen Lebensabschnitts hatte sie sich anders vorgestellt.
Arbeit. Sie mußte arbeiten. Dazu war sie hierhergefahren. Sie ließ sich wieder ablenken. Sie hatte den Tag gestern schon vertrödelt. Sie saß da. Die Glieder müde. Der Kopf dumpf. Im Bauch. Unter dem Nabel Unruhe. Ein Zwang, sich zu bewegen. Sie trank den Kaffee aus und nahm eine neue Tasse ins Badezimmer mit. Sie stand lange vor dem Spiegel. Wieviel Arbeit es war, bis sie guten Gewissens hinausgehen konnte. Wieviel Überprüfung. Sie mußte kontrollieren, ob ihr nicht ein Haar am Kinn gewachsen war. Über Nacht. Schwarz glänzend abstand. Oder auf der Oberlippe graue Schatten. Ob die Augenbrauen scharfe Ränder und nicht dunkle einzelne Härchen die Form verzogen. Auf ihrer hellen Haut waren alle diese Härchen so deutlich zu sehen. Die Haare unter den Armen und auf den Beinen wuchsen nach. Stoppelig. Sie mußte Enthaarungscreme kaufen. Obwohl. Wenn er nicht da war. Ihn störten die Haare auf den Beinen und in der Achselhöhle. Er hätte sie ganz unbehaart gewollt. Glatt. Aber das machte sie nicht. Hatte sie nicht gemacht. Das Gestichel nach der Geburt von Friedericke. Die Hebamme hatte mit einer Kollegin über eine andere Frau geredet, während sie ihr die Schamhaare abgeschoren. Die andere, hatte die Krankenschwester gesagt. Zwischen ihre aufgestellten Beine gebeugt. Der hohe Bauch die Sicht auf die Hebamme und das Rasiermesser verdeckt hatte. Die andere wäre jetzt bald dran. Jeden Augenblick könnte die jetzt dran sein. Im Badezimmer gab es zwei Waschbecken. Sie hatte das rechte gewählt. Sie beschloß, das linke zum Zähneputzen zu verwenden. Und das rechte zum Waschen. Außer Enthaarungscreme fehlte ihr Duschgel. Sie würde sich ein besonders gut riechendes kaufen. Der einzige Trost für all den Badezimmeraufwand war das Gutriechen am Ende. Nach dem Einseifen, Waschen, Eincremen, Fußcremen, Deodorieren, Wimperntuschen, Make-up-Auflegen, Pudern und Die-frische-Unterwäsche-Anziehen stand sie einen Augenblick vor dem großen Spiegel in diesem Geruch aus frischem Selbst und guten Düften. Aber was sollte sie anziehen. Würde es kühl bleiben. Wieder regnen. Und wann sollte sie Manon anrufen. Wann konnte man. Es war gegen halb neun. Zu früh. Und wo sollte sie frühstücken. Hier. Knäckebrot und Butter. Oder wieder zum Sidewalk Café. Sie sollte hinaus. Sie drehte den Fernsehapparat auf. Morgenshows. Filme. Keine Wetterberichte mehr. Auf dem Wetterkanal ging es gerade um Afrika. Sie zog Jeans, Bluse und Pullover an. Die Regenjacke. Sie ging hinaus. Sie überlegte, ob sie den Anrufbeantworter ausgeschaltet lassen sollte. Wäre es nicht besser, unerreichbar zu sein. Aber Manon würde anrufen. Sie schaltete ein. Draußen war es kühl. Angenehm zu gehen. Sie ging am Swimmingpool vorbei. Ein älterer Mann schwamm auf und ab. Das hätte sie auch tun sollen. Sie hätte auch schwimmen sollen. Sie ging unter den Palmen durch. Sah in die Baumkronen hinauf. Der graue Himmel hinter ihnen. Ein leichter Wind ließ die Palmwedel nicken. Sie ging durch die Halle. Nach dem Steinboden das tonlose Gehen auf dem Teppichboden und draußen ihre Schritte wieder fest auf dem Pflaster. Sie ging rasch. Hatte die Hände frei. Das Geld in der Innentasche der Jacke. In den Büros der niedrigen Holzhäuser auf Washington Boulevard wurde aufgeräumt. Eine Frau hantierte mit dem Staubsauger. Eine andere trug einen Spray in der Hand. Spritzte Putzmittel auf eine Schreibtischplatte und polierte die Fläche mit einem weißen, flauschigen Tuch. Beide Frauen trugen Gummihandschuhe. Das Orange der Handschuhe hob sich scharf gegen das Dunkelbraun ihrer Haut ab. Ein Mann und eine Frau standen bei der Kaffeemaschine. Schenkten sich Kaffee ein. Sie redeten miteinander. Die Frau sagte etwas. Sie hielt einen Löffel mit Zucker über den Kaffee und sah zu dem Mann auf. Sie waren beide blau gekleidet. Blauer Anzug er. Blauer Hosenanzug sie. Europäer. Die Makler? Auf den Messingschildern vor den Häusern waren Maklerfirmen angekündigt. Sie ging über Via Dolce. Über die Brücke. Über den Kanal. Der Kanal leer. Nur in der Mitte ein Rinnsal Wasser. Schwarz. Und der Boden des Kanals schwarze Erde. Aufgewühlter Schlamm. Enten liefen im Schlamm. Sie kaufte die Los Angeles Times wieder in dem kleinen Geschäft bei der Asiatin und legte gleich einen Dollar hin. Sie sammelte die Münzen des Wechselgelds ein. Zählte nicht nach. Sie sollte das Kleingeld erkennen lernen. Mit der Zeitung in der Hand ging sie vor bis zum Frontwalk. Bog nach rechts ein. Das Meer lag schwarzgrau. Ging in den hellgrauen Himmel über. Wieder keine klare Grenze zwischen Himmel und Wasser. Der Wind stärker hier. Wehte vom Meer her. Möwen kreischten. Sie ging weiter. Traf nur Hundebesitzer mit ihren Hunden. Das Sidewalk Café war schon offen. Leer. Sie ging zuerst zur Buchhandlung daneben. Sie mußte Bücher kaufen. Dann. Nach dem Frühstück. Die Buchhandlung machte erst um zehn Uhr auf.
Sie setzte sich an denselben Tisch wie am Vortag. Am Zaun zum Frontwalk. Sie stützte den Ellbogen auf dem Zaun auf und sah zwischen den Palmen auf das Meer hinaus. Der Kellner brachte Kaffee. Sie bestellte Scrambled eggs, Bacon, Toast und Butter. Faltete die Zeitung auseinander. Die Folgen der Erdbeben von vor zwei Tagen wurden beseitigt. Die Bay Area seufze erleichtert auf, stand da. Es war alles noch glimpflich abgelaufen. In Ägypten waren 16 Personen in einem Luxushotel verbrannt. Kanzler Kohl bestätigte seinen Standpunkt zu Polen. Und Madonna stellte drei neue Kostümversionen für ihre Auftritte vor. Neue Bevölkerungsdaten zeigten ein starkes Anwachsen der Latino-Bevölkerung. Einwanderung und eine hohe Geburtenrate waren die Gründe dafür. Die afroamerikanische Bevölkerung hatte eine doppelt so hohe Geburtenrate wie die weiße Bevölkerung. Die Eierspeise kam. Sie begann zu essen. Sie sah auf das Meer hinaus. Eierspeise war ein Kinderessen gewesen. Nichts zu kauen. Die warmen, weichen Eier mit den Schinkenstückchen nur gegen den Gaumen zu drücken. Eierspeise die Krankenmahlzeit gewesen. Als Kind. Und die farbigen Babys. Die mußten ja gegen schlechtere Überlebenschancen geboren werden. Und 76 % der Amerikaner waren immer noch Non-Latino-Whites. Der Wind fuhr in die Zeitung. Blähte die Seiten auf. Sie stellte den Korb mit dem Toast auf die Zeitung. ASS weiter. Menschen gingen vorbei. Fuhren auf Fahrrädern oder Rollerblades auf dem Fahrweg zwischen den Palmen. Liefen. Es waren nicht viele. Alle bewegten sich schnell. Sie fühlte sich mit ihrer dunklen Kleidung nicht so falsch wie am Vortag in der Sonne. Aber sie mußte Kleider kaufen. Nein. Sie sollte fertig frühstücken und dann zurück. Termine festlegen. Einen Arbeitsplan machen. Und dann einkaufen. Sie konnte sich auch die Haare färben. Hier. Warum sollte sie nicht als perfekte Blondine zurückkommen. Sie konnte ihr Leben als Brünette aufgeben. Oder sich dunkler färben und zum Nachdunkeln stehen. In der Volksschule war sie noch weißblond gewesen. Mit zwanzig immerhin noch aschblond. In Wien müßte jetzt bald die Abendprobe beginnen. Und was für ein Glück, hier zu sitzen. Sie hätte kichern können. Sie strich sich noch einen Toast und leerte die Erdbeermarmelade aus einer runden kleinen Kunststoffpackung auf die Butter. Es schmeckte nur süß. Keine Erinnerung an Erdbeeren. Der Wind ließ die Serviette davonflattern. Sie lief der Serviette nach. Setzte sich wieder. Zog die Jacke enger um sich. Lang war in diesem Wetter hier nicht zu bleiben. Die Bücher mußte sie am Nachmittag kaufen. Außer ihr war noch ein anderer Gast da. Er saß an der Mauer. Geschützter. Sie holte ihre Geldbörse aus der Innentasche. Knöpfte sie heraus. Rief den Kellner. Zahlte. Nahm ihre Zeitung und ging. Sie ging bis Venice Boulevard. Überquerte Pacific Avenue und bog in den Weg entlang des Kanals ein. Sie ging die kleinen Häuschen entlang. Viele sahen unbewohnt aus. Waren wohl Sommersitze. Vor allen Häuschen steckten Schilder im Gras oder in Blumenbeeten. »Armed response« wurde versprochen. Waren das Selbstschußanlagen. Oder kam ein Team von einer Sicherheitsfirma. Jedes Schildchen war von einer anderen Firma. So viele Verteidiger wie Bewohner. Vor einem Haus gruben Männer im Garten. Steinplatten lagen hochgestapelt an der Seite. Drei Häuser weiter sah sie einen Mann im Haus. Der Mann schlief. Er saß in einem Fauteuil. Der breiten Glastür zum Weg zugewandt. Sein Kopf hing nach hinten über die Rückenlehne. Sein Mund stand offen. Arme und Beine hatte er von sich gestreckt. Breit. Er schlief tief. Ihr Blick störte ihn nicht. Sie ging rasch weiter. Rund um ihn waren braune Pappkartons gestanden. Auszug oder Einzug. Der Mann hatte erschöpft dagelegen. Hatte in seiner Übermüdung nicht mehr ein Zimmer aufgesucht. Vor Blicken sicher zu sein. Oder Vorhänge vorgezogen. Rollos heruntergelassen. Vielleicht war es ihm auch gleichgültig. Aber das Gefühl, diesen Mann belauscht zu haben. Sie ging schneller. Sie hörte Musik. Das Wohltemperierte Klavier. Die Musik kam aus der offenen Tür eines Hauses. Sie wollte nicht in Richtung der Glastüren schauen. Nicht wieder. Tat es aber doch. Licht brannte. Eine rote Couch stand in der Mitte. Bunte Polster. Fauteuils. Pfauenblau. Pflanzen. Zimmerhoch. Goldfäden in den Stoffen glitzernd. Nach hinten ein Wandschirm. Bunt. Indisch. Eine indische Gottheit. War das Kali mit den vielen Armen. Sie ging weiter. Hätte gern der Musik länger zugehört. Der Wind kam eine Seitengasse vom Meer herauf. Sie ging weiter. Ein Mann kam aus einem Garten. Schloß die hüfthohe weiße Gartentür. Sagte etwas in den Garten zurück. Kam ihr entgegen. Grüßte sie. Freundlich. Sah ihr aufmerksam ins Gesicht. Sie grüßte zurück. Ihr »Hi« erstaunt. Lächelte dann. Der Mann hob grüßend die Hand. Lächelnd. Hier wohnen. Hieß das, einander so grüßen. Und im bunten Zimmer einen Besuch machen. Im Hippieparadies. Und Aufrufe an Masten heften, die Enten in den Kanälen gut zu behandeln. Hieß das, ans Meer gehen. Morgens. Mittags. Und abends. Und in der Nacht. Sie sah sich selbst. Groß und dünn. Weite Röcke und Westen oder T-Shirts. Tennisschuhe. Die Haut braun und gegerbt. Und allein. Das Leben nur noch das Leben und zufrieden damit. Sie hatte wieder diesen Klumpen Sehnsucht in sich. Hinter dem Nabel. In die Brust hochdrängend. Drückend. Die Musik. Das leere rote Zimmer. Der schlafende Mann. Und sie wußte gar nicht, wonach sie Sehnsucht haben sollte. Nichts Bestimmtes und niemand. Aber etwas Großes. Und drohend gegen sie. Verliebt sein bis jetzt die einzige Möglichkeit gewesen, dieses Gefühl niederzuringen. Auszufüllen. Aufzufüllen. Zu verdrängen. Sie kam zur Washington Avenue. Ging über den Kanal. Sie blieb auf dieser Seite der Straße. Das mexikanische Restaurant geschlossen. Der Parkplatz leer. Ein Mann Papierfetzen und Zigarettenpackungen auf einem Spieß einsammelte. Sie ging an Hotels vorbei. Ein anderes Apartmenthaus. Ein hoher weißer Bau. Ein kleiner Supermarkt. Wohnhäuser. Fußpflege und Computerkurse in einem Häuschen an der Ecke zu Marina Street. Sie ging über die Kreuzung und Marina Street hinauf. Der Himmel war dunkel geblieben. In der Halle der Oakwood Apartments waren alle Rolläden oben. Hinter der Theke der Rezeption zwei Reihen Schreibtische und die Angestellten beschäftigt. Gäste an der Rezeption. Oder sie saßen in den Sitzgarnituren. Plauderten. Lasen Zeitung. Es waren ältere Personen. Alle in Freizeitkleidung. Hell. Beige. Hinter der Glastür, auf der Manager in Goldbuchstaben standen, saß eine Frau am Schreibtisch. Sie telefonierte. Sie war schwarzhaarig. Ihre Nägel leuchtend rot und lang. Sie trug eine blaue Kostümjacke. Die Frau war in ihrem Alter. Ungefähr. Wie gut man aussehen konnte. Wenn frau wollte, fügte sie hinzu. Diese Frau trug sicherlich ordentliche Schuhe. Pumps. Mit hohen Absätzen. Wann hatte sie damit aufgehört. Und warum. Eigentlich.
Auf dem Anrufbeantworter waren zwei Nachrichten. Manon wartete auf ihren Rückruf. Und Helmut hatte sie nicht früher angerufen. Er hatte sie schlafen lassen wollen. Und er hoffte, sie riefe ihn zurück. Er sei jetzt gerade zu Hause. Und ob es ihr gutginge. Sie rief bei Manon an. Dr.Hansen hätte Zeit, sagte die. Ob sie um drei Uhr bei ihr sein könne. Dr.Hansen käme dann, und sie könnte mit ihm reden. Bei ihr. Das wäre doch netter. Sie müsse ihr Enkelkind von der Schule abholen und zu Albrecht fahren. Sie wären dann ungestört. Dr.Hansen und sie. Und danach könnten dann sie beide reden. Ob ihr das recht wäre. Margarethe mußte lachen. Natürlich wäre ihr das recht. Manon machte doch alle Arbeit für sie. Anna wäre ihre beste und liebste Freundin gewesen, sagte Manon. Und sie wolle, daß die Welt sich an Anna Mahler erinnere. Daß die Welt sie nicht vergäße. Und sie könne es nur wiederholen. Es wäre traurig. Schade. Sie hätte Anna kennenlernen müssen. Es hätte niemanden gegeben, der sie nicht gemocht. Und bis dann. »Take care.« »You too, Manon«, sagte Margarethe. Sie wußte nicht, ob das richtig war. Wahrscheinlich war dieses »take care« eine Formel. So wie »How do you do«. An das hatte sie sich auch nie gewöhnt und gab noch immer Auskunft, wie sie sich fühlte. Sie wählte seine Nummer. Sie hörte dem Zwitschern in der Leitung zu. Wie sich das Summen eine Bahn schlug. Das Telefon läutete fünfmal. Dann legte sie wieder auf. Es hatte ja doch keinen Sinn. Was sollte sie mit ihm reden. Es wäre besser, sie schriebe ihm einen Brief. Sie stand da. Das Bett war nicht gemacht. Das Zimmermädchen würde noch kommen. Besser wieder weggehen. Sie stopfte die Zeitung und ihr Notizbuch in die Tasche und ging. Sie fuhr nach Santa Monica. Der Himmel unverändert dunkel. Das Meer schwarz. Der Wind fuhr in die Palmen und ließ die Palmwedel flattern. Aber es regnete nicht. Und keine Feuchtigkeit sammelte sich an den Scheiben. Es war kühl geblieben. Nur wenig Verkehr. Sie konnte rasch fahren. Kaum Menschen auf der Straße in Venice. Würde sie von Anna Mahler bezaubert sein. Bis jetzt hatte sie keinen Grund dafür gefunden. Die Tochter in Wien. Alma II. Sie hatte so lieb gesprochen von ihrer Mutter. Hatte geschwärmt von ihr. Hatte ihre Tochter benannt nach ihr. So. Wie sie nach der Mutter genannt worden war. Und dann war diese junge Anna gekommen. Anna II. Die Enkelin von Anna. In der Küche war die Butter angebrannt, die Alma auf die Herdplatte gelegt hatte. Damit die Butter weich würde und sie ihr ein Butterbrot streichen könnte. Margarethe war zu Alma in Wien mit einem großen Radio mit Kassettenteil gekommen, um das Interview aufzuzeichnen. Sie hätte ein kleines Aufnahmegerät kaufen sollen. Aber das Geld dafür war einfach nicht dagewesen. In diesem Jahr hatte sie freie Dramaturgin bei Franz Wagenberger sein müssen. Die Subventionen für die kleineren Theater waren so gekürzt worden. Die Dramaturgie für die noch möglichen drei Projekte hatte nur frei bezahlt werden können. Das Geld war nicht gekommen. Sie war nicht bezahlt worden. Die Anna Mahler-Biografie war ein Versuch gewesen, einen Ausweg zu finden. Kein Geld gehabt hatte. Zu der Zeit. Und Alma II war entsetzt gewesen. Daß es so etwas gäbe. 1988 nicht einmal das Geld für ein kleines Aufnahmegerät. Sie hatte ihr ein Butterbrot angeboten. Und Tee. Sie hatte wahrscheinlich gedacht, sie müsse diese arme Person füttern. Und dann war die Butter verbrannt. Schwarzer stinkender Rauch war aus der Küche gekommen. Aber die Frau hatte das nicht gestört. Margarethe dürfe nicht gehen, bevor sie nicht Tee getrunken habe. Ach, ihre Mutter. Sie hätte ihre Mutter unendlich geliebt. Gelebt bei ihr? Nein. Das nicht. Eigentlich. Am Anfang. Nach der Scheidung dann. Der Vater eher. Aber. Sie hätte mit ihrer Mutter eine wunderbare Zeit in Vancouver verbracht. Die hätte da auf ihre Aufenthaltsgenehmigung für die USA warten müssen. Das wäre die verrückteste Zeit ihres Lebens gewesen. Die schönste. Sie wäre dann wieder nach Wien. Und die Kinder. Ja. Sie habe noch eine andere Tochter. Irene. Die lebe in England. Glücklich. Sie hätte auch weggemußt. Damals. In der Kriegszeit hätte sie auch in England sein müssen. Ob sie bei der Mutter gelebt habe? Die wäre doch auch in London gewesen. Nein, hatte Alma II gesagt. Sie wäre in einem Internat gewesen. Im Süden Englands. Der Vater wäre gekommen. Zu Besuch. Die Mutter nicht, hatte sie gefragt. Die Mutter nicht, hatte die Frau geantwortet. Aber in den Ferien? Und sie konnte sich noch erinnern, wie sie »Nie? In vier Jahren kein einziges Mal?« ausgerufen hatte. Aber die Frau hatte nur genickt und es normal gefunden. Jedenfalls nicht ungewöhnlich. Und was hätte es geholfen. Aber sie hatte sich das 14jährige Mädchen Alma vorstellen müssen, das in vier Jahren englischen Internats die Mutter nie gesehen hatte. Auch in den Ferien nicht. Und zu der Zeit war Anna Mahler in London gewesen. Hatte den Dirigenten Fistoulari geheiratet. Seine Opernprojekte gefördert. 1943 ihre zweite Tochter Marina bekommen. Und während dieser Zeit hatte die Tochter aus der Ehe mit Zsolnay im Internat gelebt. War aus dem Weg gewesen. War es das Privatleben? Die Liebesgeschichte? Die neue Liebesgeschichte, die diese Entfernung verlangte. Oder einfach eine Unliebe? Ganz allgemein kein Platz für Kinder. Und hatte Anna Mahler da nachgestellt, was sie von ihrer Mutter Alma gelernt hatte? Kinder als Abfall von Lieben? Sie suchte einen Parkplatz auf der 3 rd Street und dann auf der 4th. Sie wollte in Santa Monica Place einkaufen. Einen Hosenanzug. Etwas Leichtes. Sie warf Münzen in die Parkuhr. Hoffte, mit einer Stunde Parkzeit auskommen zu können, und ging in Richtung der Shopping mall. Hatte sie übertriebene Vorstellungen vom Kinderhaben. Oder war das Unglück gewesen, daß es immer Mädchen geworden waren. Alma hatte nur Töchter gehabt. Anna Töchter. Alma, die Enkelin, Töchter. Anna, die Urenkelin, eine Tochter Alma. Alma Mahler hatte von Werfel einen Sohn erwartet. Aber der hatte dem Vater weichen müssen. Der hatte sterben müssen. Der war nach einer Liebesnacht der Eltern zu früh geboren worden und bald gestorben. Und der Vater berichtete ganz zufrieden und mit dem entsprechenden Pathos in seinem Tagebuch. Nach dem Lesen dieser Stelle war ihr Werfel endgültig widerlich gewesen. Aber. Keine dieser Frauen hatte einen Sohn gehabt. Sich ins Männliche transponiert. Auch Marina Mahler-Fistoulari hatte eine Tochter. Und es hatte keine Wiedergeburt Gustav Mahlers gegeben, der, immer im Namen getragen, im Sohn jeden Mannes eine Auferstehung gefunden hätte. Sie ging auf 3 rd Street. Langsam. Der Wind war feucht und kalt. Die Menschen gingen rasch. Eilten. Diese vielen Mädchen. Und alle Mahler heißen hatten müssen. Nur so viel wert. Wahrscheinlich. Und. Dieses kleine Mädchen in England. Sie war ja dann doppelt vertrieben gewesen. Aus Wien. Und aus dem Leben der Mutter. Und durch ein anderes Kind ersetzt worden. Sie lief bei Rot über die Straße. Riß die Glastür zur Shopping mall auf. Sie wollte sich so ein Elend nicht vorstellen müssen. Andere waren in dieser Zeit getrennt worden. Konnte man sich in einer solchen Zeit von jemandem trennen? Freiwillig?
Die Gänge und Plätze der Shopping mall waren überfüllt. Menschen gingen. Standen vor den Imbißständen an. Saßen essend an den Tischen gegenüber den Ständen. Gingen die Stiegen hinauf und hinunter. Fuhren auf den Rolltreppen. Strömten durch die Türen der großen Geschäfte. Schlenderten an den Auslagen der Boutiquen vorbei. Trugen Becher mit Kaffee und Cola und tranken daraus, während sie vor den Auslagen standen. Es war laut. Kinder liefen umher. Am Eingang war es dunkel. In der Mitte des großen Atriums hell. Als schiene die Sonne dort. Sie ging eine Runde. Die kleinen Geschäfte boten Kleidung für sehr junge Mädchen an. Technomusik. Sie sollte hier etwas für ihre Friedl suchen. Die könnte dann zu ihren Freundinnen sagen, das wäre aus L. A. Hätte ihre Mutter von da mitgebracht. Trügen da alle. Sie würde das später machen. Einkaufen. Die Geschenke. Sie mußte auch Gerhard etwas mitbringen. Für die Übernahme von Friedericke. Aber es war ja noch Zeit dafür. Und sie mußte erst einmal fragen, welche Marke es sein sollte. Sie hatte einmal Diesel-Jeans nach Hause gebracht. Die Friedl hatte sie nie angezogen. Levis 501 waren notwendig gewesen. Die Diesel-Jeans waren in die Caritas-Altkleidersammlung gekommen. Diese Marke wäre auch secondhand nicht zu verkaufen, hatte sie zu hören bekommen. Vorwurfsvoll. In einer Boutique im oberen Stock wurde nur Weißes verkauft. Weiße Kleider. Weiße Tischwäsche. Weiße Einrichtungsgegenstände. Weißes Geschirr. Alle Sorten von Weiß. Und viel weiße Spitze auf den Kleidern und Tischtüchern und Servietten und Polstern. Gegenüber Sportschuhe. Athlete’s Foot. Sie ging hinein. Sie fragte nach weißen Tennisschuhen. Der Mann schaute auf ihre Füße. Sie bräuchte ein Männermodell, sagte er. Sie sah den Mann an. Warum war er unfreundlich. Der Mann sah weiter auf ihre Füße. Skeptisch. Stand da. Lehnte sich gegen die Kassentheke und wiederholte. »You need a man’s size.« »Thank you«, sagte sie, drehte sich um und ging hinaus. Der Mann hatte zufrieden genickt. Über seine Feststellung. Hatte zufrieden genickt dazu. Dann sollte er seine Schuhe an jemand anderen verkaufen. Hatte er sich lustig gemacht. Weil sie weiß war? Er hatte schmale Füße gehabt. War ein hochgewachsener Afroamerikaner gewesen. Es hatte ihm Spaß gemacht, ihr zu sagen, wie ungeschlacht sie war. Zufrieden. In Wien zählte sie zu den Schlanken. Und immer hatte es geheißen, für ihre Größe hätte sie zarte Füße. Und hier hatte sie breite. Sie ging zu Saks Fifth Avenue. In der Ecke. Kosmetika. Taschen. Kleider. Sie ging von Kleiderständer zu Kleiderständer. Kostüme. Die Röcke kurz. In hellen Farben. Pastell. Würde sie darin überzeugender sein. Würde Franz ihr mehr glauben als in Jeans und Pullover. Oder würde er über sie dann auch mit dieser Handbewegung hinweggehen. Wie er über diese Frauen in ihren Kenzo-Kostümen hinwegging. Über die, die seine Premieren bevölkerten und bei den Premierenfeiern herumstanden und zu jedem sagten: »Ich habe das ganz toll gefunden.« Die ihm nach dem Sommernachtstraum um den Hals fallen und ein Küßchen geben würden. Daß es ganz besonders gelungen sei, würden sie zwitschern. Wahrscheinlich mußte man in so einem Kostüm nichts auf sich beziehen. Wie im weißen Mantel. Jedenfalls nicht die Schändlichkeiten des Mißbrauchs, die dann Irrungen und Wirrungen der Liebe genannt wurden. Von Franz vor allem. Arme Titania. Und arme Sylvia Klein. Die mußte spielen, was ein Franz Wagenberger sich unter Liebe vorstellte. Mußte sich von ihm in der Liebe inszenieren lassen. Obwohl. Es war eine saubere Verbindung. Der Intendant und die Schauspielerin. Der Intendant und die Dramaturgin. Das war nicht so glatt verlaufen. Nicht so einfach nur Inspiration. Da war es schon einfacher, die Schauspielerin in dieses Bühnengeschöpf zu verwandeln. Was war es mit Franz mittlerweile noch. War es Haß. Verachtung? Und Wut. Und was war das für eine Liebe gewesen. Damals. Hosen. Hosenanzüge. Kleider. Lange, weite, gemusterte Kleider hingen da. Ob die Friedl so eines wollte. Sie nahm einen beigen Hosenanzug zum Probieren. Ging zu einer Umkleidekabine. Pullover lagen auf einem Tisch. Dunkle Pullover. Blau. Grün. Schwarz. Aus Baumwollgarn. Lang. Mit V-Ausschnitt. Aber solche Pullover hatte sie. Und alle dunkel. Sie sollte einmal etwas Helleres tragen. Freundlicheres. Versuchen wenigstens. Die Umkleidekabine war von innen zu versperren. Wie eine Toilettentür zu verriegeln. Rundum Spiegel. Über den Haken an der Wand ein Schild. Die Kundinnen wurden aufgefordert, nichts in der Kabine zurückzulassen und niemand Unbekanntem die Kabinentür zu öffnen. War das notwendig. Sie hatte Sicherheitsbeamte am Eingang gesehen. Und die herumgehenden Frauen. Jede auf das Einkaufen konzentriert. Aber solche Sicherheitsmaßnahmen. Die gab es nur, wenn sie wirklich notwendig waren. Oder war das einfach Standard. Sie zog sich aus. Hängte die Jacke auf. Die Jeans. Legte den Pullover auf den Hocker. Die Bluse. Sie mußte abnehmen. Der Oberkörper ging ja. Aber die Hüften. Sie waren so breit wie die Schultern. Mindestens. Und die Oberschenkel. Früher waren sie gleich unter den Hüften schmal. Sport. Ihr fehlte Bewegung. Seit die Friedl groß geworden. Sie machte ja nicht einmal mehr Spaziergänge. Sie zog die beige Hose an. Die Hose war zu weit. Sie hatte die falsche Größe genommen. Größe 12. Sie brauchte eine in Größe 10. Sie zog die Jacke an. Die Jacke war ohne Bluse oder T-Shirt nicht zu tragen. Zu weit ausgeschnitten. Sie sah sich in den Spiegeln. Von vorne. Von der Seite. Brauchte sie nicht kräftigere Farben. Dunklere. Sie sah sich an. Unbedeutend. In dieser Farbe sah sie unbedeutend aus. Sie ging einen Schritt in die Ecke der Umkleidekabine, sich von weiter weg zu sehen. Sie hatte das Gefühl, von weit hinter den Augen zu sehen. Die Welt glitt von ihr weg und wieder auf sie zu. Zurück. Sie setzte sich auf den Hocker. Übelkeit stieg vom Magen gegen den Hals. Im Sitzen das Sehen nicht besser. Sie lehnte den Kopf gegen die Wand. Den Spiegel hinter sich. Schloß die Augen. Der Brechreiz stärker. Mit offenen Augen besser. Sich hinlegen mußte. Sie legte sich auf den Teppichboden. Ließ sich vom Hocker gleiten. Kniete erst und legte sich dann auf die Seite. Rollte sich ein. Schloß die Augen. Wartete, bis der ziehende Schmerz im Kopf vorbei war. Sie atmete kurz. Versuchte tief zu atmen. Atemübungen. Rauschen in den Ohren. Das Herz. Einzelne Schläge. Sie lag. Eins. Zwei. Drei. Einatmen. Eins. Zwei. Drei. Ausatmen. Sie konnte dann die Augen wieder aufmachen. Sie sah sich in den Spiegeln auf dem Boden liegen. Sah auf dem Teppichboden vor sich eine Stecknadel. Sie setzte sich vorsichtig auf. Sie mußte hinaus. Aus diesem Raum hinaus. Sie war froh, nicht geschrien zu haben. Nicht um Hilfe gerufen zu haben. Wahrscheinlich war keine Luft hier herinnen. Und sie hatte doch etwas gegessen. Hatte gefrühstückt. So war es immer gewesen, wenn sie in der Kirche gestanden und nichts gegessen hatte. Vorher. Sie hatte die Regeln ernst genommen. Zu dieser Zeit. Vor der heiligen Kommunion war keine Nahrung erlaubt gewesen. Die Ohnmachten waren der Beweis für ihre Gesetzestreue. Und es war kränkend gewesen, wie wenig Verständnis sie gefunden hatte. Niemand hatte sie bewundert dafür. Oder gelobt. Die Pfarrschwester. Die Schwester Agnes. Sie hatte immer ein wenig angewidert geschaut, wenn sie aus der Kirche hinausgeführt hatte werden müssen. Und sich dann an der Kirchenmauer übergeben hatte. Galle in den Schnee gespuckt. Und auf das Katzenkopfpflaster. Wahrscheinlich hätte sie sich in der Kirche auf den Steinboden legen sollen. Die Wangen gegen die kühlen Steinplatten. Und die Stirn. War das eigentlich Marmor gewesen. Der Boden in der Pfarrkirche Parsch. Sie saß auf dem Boden. Der Kopf leer. Hohl. Sie legte die Stecknadel an die Bodenleisten. Unter den Spiegel. Saß da. Umgeben von ihrem Bild. Wie sie dasaß. Die Schultern hängend. Nach vorne über ihre Schenkel gebeugt. Den Kopf in den Händen. Sie mußte hier hinaus. Rasch. Ihre Gliedmaßen schwer. Konnte das vom Jetlag kommen. Oder war sie krank. Sie begann, die beigen Sachen auszuziehen. Die Jeans anzuziehen. Es ging nur langsam. Sie war zittrig. Mußte nach allem zweimal greifen. Sie zerrte die Jeans hinauf. Schloß sie. Warf den Hosenanzug über den Hocker. Zog den Pullover über. Sie stopfte die Bluse in die Handtasche. Nahm ihre Jacke vom Haken. Sie schlüpfte in die Schuhe und ging hinaus. Durch das Kaufhaus. Es roch nach Parfums und Kosmetika. In der Shopping mall draußen nach Essen. Sie ging schnell. So schnell es ging. Sie mußte sich jeden Schritt diktieren. Hinaus auf die Straße. Sie ging 3 rd Street vor bis Santa Monica Boulevard. Ging hinunter. Über Ocean Avenue in die Grünanlage auf der Seite zum Meer. Sie setzte sich auf die erste Bank. Saß da. Sah hinaus. Aufs Meer. Es war kalt. Sie fror. Zog die Jacke so eng wie möglich um sich. Atmete tief. Der Wind war stärker geworden. Im Gras lagen zwei Männer. Gleich neben einer Palme. Die Männer hatten eine dunkelblaue Plastikplane über sich gespannt. Sie lagen mit dem Gesicht einander zugewandt. Sie schliefen. Die Plane hatten sie unter ihre Rücken und die Füße gestopft. Sonst sah sie niemanden.
Im Apartment rief sie Helmut an. Was denn los sei, fragte er. Warum sie nicht anriefe. Er habe sich Sorgen gemacht. Sie erzählte ihm von dem Schwindelanfall. Daß sie auf dem Boden liegen hatte müssen. In einer Umkleidekabine. Wie die Welt auf sie zugekippt und wieder weg. Wie die Wellen des Meeres am Strand. Nur geometrischer. Und wie das Herz geschlagen. Als grabe es sich in den Brustkorb. Mit langsamen Schlägen, zwischen denen so lange Pausen gewesen. Und ob sie nun krank sei. Jetlag, sagte er. Umstellungsprobleme. Kreislauf. Ob sie erbrochen habe. Durchfall. Ob sie Schmerzen in der Brust gespürt hätte. Ein Stechen. Ob sie ihre Tage habe und wie stark. Und ob sie ein Schlafmittel genommen habe. Am Abend. Gestern. Nein. Das wäre es alles nicht, antwortete sie. Es sei so gewesen wie früher. Als Mädchen. Nur schlimmer. Und sie hätte immer einen niedrigen Blutdruck gehabt. »Ach. Meine Arme«, rief er aus. Und wie leid es ihm täte, ihr nicht beistehen zu können. Aber er werde herausfinden, welches Kreislaufmittel sie im Drugstore besorgen solle. Allerdings könne er das erst morgen machen. Bei ihm wäre ja Nacht. Und ob sie genug äße. Sie solle sich ganz einfach schonen. Ein bißchen Urlaub machen. Während er sprach, dachte sie, daß er ja nur mitfahren hätte müssen, wie es ausgemacht gewesen. Dann wäre er jetzt da. Sie könnten gemeinsam in den Drugstore gehen und ein Mittel suchen. Oder er würde das machen und es ihr bringen. Oder er hätte etwas in seinem Nottäschchen. Und wahrscheinlich ginge es ihr dann gar nicht schlecht. Wenn er mitgekommen wäre. Sie sagte nichts. Sie solle ihm sagen, ob sie etwas zu Mittag gegessen habe. Oder ein Frühstück. Hätte sie gefrühstückt? Sie äße ja nie ein Frühstück. Nein. Nein, erwiderte sie. Sie habe gefrühstückt. Aber als Frau allein. Das Essengehen mache da doch keinen Spaß. Und kochen. Für sich allein? Sie war wieder traurig. Verärgert über ihn. In seiner ärztlichen Sorge hatte sie sich ihm nah gefühlt. Sie liebte es, wenn er mit ihr wie mit einer Patientin sprach. Sie müsse sich eben an die Bar setzen, sagte er. In den Delis, Cafés und im Diner. Nirgendwo könne man allein so gut durchkommen wie in L. A. Wo doch jeder andere auch ein Single sei. »Bin ich für dich jetzt schon ein Single.« Das habe er nicht so gemeint. Für sich. Für sie beide. Natürlich sei sie kein Single. Aber in L. A. Da sähe es doch so aus. Er habe das wirklich nicht so gemeint. Sie fühlte sich von ihm entfernt. Er sah sie nicht mehr als die Seine. Sie konnten eben nicht mehr. Miteinander. Konnten nicht mehr in einer gemeinsamen Stimmung bleiben. Nicht einmal am Telefon. Sie redeten verschieden über dasselbe. Meinten anderes. Und es hatte nicht einmal Sinn mehr, es zu sagen. Sie fragte ihn, ob es ihm gutging. So? »Nein«, sagte er. Er hätte sich diese zwei Wochen auch anders vorgestellt. Sandra hätte wieder Nierenkoliken gehabt und in Dornbirn im Spital gelegen. Er wäre dagewesen. Hingeflogen. Sie käme in den nächsten Tagen nach Wien. Zu Traude. Und dann könne er ja vielleicht noch nachkommen. »Ja. Dann alles Gute. Schlaf gut.« Er sagte »Greterl. Ich liebe dich doch.« Sie legte auf. Das »doch«. Er liebte sie nicht mehr. Er liebte sie »doch«. Er konnte sie nicht brauchen. Gerade. Niemand brauchte sie. Eigentlich brauchte sie niemand. Nicht einmal ihr Kind. Und das war das Leben gewesen. Bisher. Gebraucht werden. Aus Liebe. Wie sollte das weitergehen. Sie legte sich auf die Couch. Sinn. Wo sollte sie einen Sinn hernehmen. Bisher war sie ohne einen ausgekommen. Von einer großen Liebe zur nächsten. Das hatte gereicht. Aber neue Liebe war keine in Sicht, und die Geschichte mit Helmut war längst nicht mehr groß. Wenn sie überhaupt noch. Und Geld hatte sie auch keines. Der Job bei Wagenberger. Das war so nicht mehr möglich. Nicht nach der Diskussion über seine Auffassung von Shakespeare. Nur Trümmer rund um sich. Und sie hatte gar nicht bis 40 warten müssen. Auf die Krise. Sie war schon mit 39 da angelangt. Sie lag auf der Couch. Sah auf die Palmen vor dem Haus. Lang nach zwei Uhr wachte sie auf. Sie schreckte hoch. Stürzte davon. Lief zur Garage. Manon mußte das Kind von der Schule abholen. Sie hatte gar nichts von einem Enkelkind gewußt. Aber Manon als Großmutter. Das mußte wunderbar sein. Sie schaffte es. Sie war zwei Minuten nach drei Uhr bei Manon. Manon stellte ihr Dr.Hansen vor. Er war groß. Schlank. Ein schmales Gesicht. Graue Haare, zurückgekämmt. Fast weiß. Leicht gewellt. Er trug eine gestreifte Krawatte zu einem dunklen Tweedsakko und Cordhosen. Ja, sagte er, er wüßte eigentlich nicht so genau, wie er behilflich sein könnte. Er sprach Englisch ohne Akzent. Es wäre Manons Idee gewesen. Aber er erzähle natürlich gerne alles, was er über Anna wisse. Er habe sie sehr geschätzt. Verehrt. Manon hatte den Eßtisch abgeräumt und hieß sie, da Platz zu nehmen. Der Tisch stand am Fenster zum Hof. Dr.Hansen setzte sich mit dem Rücken zum Fenster. Manon ging. Margaux solle warten, bis sie zurück sei. Aber sie hätte sicher lange mit Max zu reden. Margarethe setzte sich, legte ihr Aufnahmegerät auf den Tisch. Dr.Hansen fragte, ob sie Deutsch oder Englisch sprechen wolle. Ihm sei es gleichgültig. Sie schaltete das Gerät ein. Er spräche gerne Deutsch, sagte er auf englisch. Aber ganz wie sie wolle. Sie sprachen dann Deutsch miteinander. Sein Deutsch hatte einen ganz leichten amerikanischen Unterton. Während des Gesprächs konnte Margarethe sehen, wie Leute im Swimmingpool auf und ab schwammen.
Dr.Hansens Geschichte.
Mein Name ist Max Hansen. – Ich bin halb englisch und halb deutsch. – Ich wuchs in England auf und kam mit elf Jahren nach dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland. 1921 für sechs Wochen. – Ich habe dann Jura studiert. In Freiburg, München und Göttingen. – Dann kam Hitler an die Macht. Wir haben die ersten Proteste gegen Hitler an den Universitäten gemacht. – Ich habe mein Jura-Doktorat in Göttingen gemacht und dann hier in Kalifornien Medizin studiert. – Ich war dann immer in L. A. – Ich lebe hier gerne. Obwohl die Politik in den letzten Jahren hier in L. A. fürchterlich ist. – Ich fühle mich in den letzten Jahren hier in L. A. so unwohl wie in Hitler-Deutschland. Sie wissen, wie hier über die Todesstrafe abgestimmt worden ist. – Ich kam in der zweiten Periode Roosevelt hierher. – Ich lebe 50 Jahre in der Sonne. Ich kann nicht weg von hier. Ich bin zwar nicht mehr berufstätig. I am retired. Aber ich arbeite hier in der Aidshilfe. Ich kenne die Politik hier. Ich kenne mich hier aus. – Anna Mahler lernte ich durch Gina Kaus kennen. Sie war eine Schriftstellerin aus Berlin, die lange hier gelebt hat. – Die Chinareise war Albrechts Idee. Albrecht reiste ja nicht gerne, und er sagte, daß wir beide doch fahren könnten. – Wir machten diese Reise dann 1985. Albrecht meinte, daß ich mich als Arzt besonders gut als Reisebegleiter eignen würde. – 1985