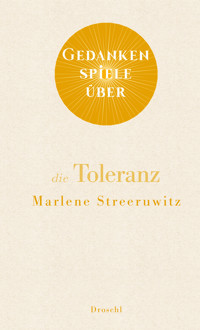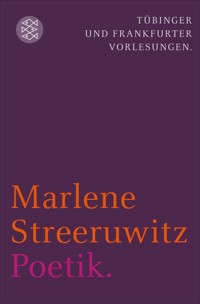22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Konstanze ist Übersetzerin und tastet nach den Corona-Lockdowns wieder nach ihrem Leben. Veronica hat ihr Studium abgebrochen, sie stellt sich einer Zukunft ohne Glücksversprechen. Die Gewissheit in der Verbindung zwischen Mutter und Tochter scheint zerbrochen, ein Gespräch nur noch über gemeinsame Netflix-Abende möglich. Marlene Streeruwitz' »Tage im Mai.« ist ein virtuoser Roman, der mit wechselnden Perspektiven von der Entfremdung erzählt, von einer Welt, in der Krieg und Verschwörung wieder zum Alltag werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marlene Streeruwitz
Tage im Mai.
Roman dialogué.
Über dieses Buch
Aus dem Prater schallt vergnügtes Lachen herüber. Konstanze nimmt es wahr wie ein Echo aus ferner Zeit, als sie noch nicht wegen Corona und dem Urkaine-Krieg vom Leben abgeschnitten war.
Jeden Tag einen Clip auf TikTok. Veronica hat den Job als Rezeptionistin gegen ihr Studium eingetauscht und sucht ihren Ort in einer Welt ohne Zukunft.
Nur noch gemeinsame Netflix-Abende führen Mutter und Tochter zusammen und befördern einen Dialog über die Grenze der Generationen hinweg.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Marlene Streeruwitz, in Baden bei Wien geboren, studierte Slawistik und Kunstgeschichte und begann als Regisseurin und Autorin von Theaterstücken und Hörspielen. Für ihre Romane erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter zuletzt den Bremer Literaturpreis und den Preis der Literaturhäuser. Ihr Roman »Die Schmerzmacherin.« stand 2011 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschienen der Roman »Flammenwand.« (Longlist Deutscher Buchpreis) und die Breitbach-Poetikvorlesung »Geschlecht. Zahl. Fall.« .
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Coverabbildung: plainpicture/Anne Schubert
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491399-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
I.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
Veronica.
Konstanze.
II.
Serie 1. Episode 1.
Serie 1. Episode 2.
Serie 1. Episode 3.
Serie 1. Episode 4.
Serie 1. Episode 5.
Serie 1. Episode 6.
Serie 1. Episode 7.
Serie 1. Episode 8.
Serie 1. Episode 9.
Serie 1. Episode 10.
Serie 1. Episode 11.
Serie 2. Episode 1.
Serie 4. Episode 4.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
I.
Konstanze.
»Ich sterbe.«, rief sie. Warf das Handy auf die Couch. Ging davon. Sie hörte ihn reden. Fragen. Die Wohnungstür fiel hinter ihr zu. Sie lief die Stiegen zum Lift hinunter. Lief weiter. Stieg hinunter. Stock für Stock. Sie stemmte die Wohnungstür auf. Auf der Straße. Die Rosen im Vorgarten. Sie hatten am Vortag zu blühen begonnen. Sie rochen nicht. Sie hatte es versucht. Sie hatte sich einen Blütenzweig heruntergebogen und an einer Blüte gerochen. Rosaweich die Blütenblätter. Aber kein Duft. Sie ging nach links. An die Kreuzung zum Prater hinüber. Sie wartete nicht. Sie ging bei Rot über die Straße. Sie wollte nicht warten. Sie konnte nicht warten. Es wurde gehupt. Sie ging weiter. An dem riesigen rosa Schweinchen vorbei, das ein Bankomat war. Vorne der Bankomat. Hinten. Im Rücken. Mitten im Schweinekarree. Da war der Zugang zum Bankomat. Jemand hatte versucht, dieses Türchen aufzubrechen. Der Rücken des Schweinchens war zersplittert und angekratzt. Das Türchen intakt geblieben. Am Wochenende. Sie konnte von ihrem Fenster oben zuschauen wie sich lange Schlangen bildeten. Wie eine Person nach der anderen Geld für die Pratersensationen abhob. Mitten aus dem Bauch des Schweinchens.
Sie ging schnell. Zufahrtstraße hieß es da. Ihr war die Stimme gekippt. Schon beim ersten e von sterben war ihr die Stimme gekippt, und sie hätte zu weinen begonnen. Beim nächsten Wort hätte sie zu weinen begonnen und nie wieder aufhören können. Das war die wichtige Frage geworden. Wie mit dem Weinen aufhören. Wenn es einmal begonnen hatte. Das Weinen. Und es war fast so weit gewesen. Sie hatte sich mit dem Wegschleudern des Handys noch einmal gerettet. Das Elend. Wie immer. Es war in der Brust versammelt gewesen. Im Begriff, in den Kopf hinauf. Zu schwappen. Hinaufzuschwappen. Die Tränen kamen dann von diesem Drängen. Es war zuerst nur der Druck und unbestimmt. Jetzt. Im Gehen. Es war der Schmerz über alles. Über alles, was nicht gewesen und was gewesen. Der Schmerz über das Leben insgesamt. Über alles, was schmerzte. Überhaupt. Der Krieg. Der Krieg gerade. Der verstärkte das. Verschärfte die Konturen. Zerschnitt mit den Erinnerungen das Erhoffte. Kreuzte die Wünsche gegen die Wirklichkeiten. War das Altern? War das Alt-Werden? Aber sie war nicht alt. Sie war 56 und wollte leben. Sie hatte leben gewollt. Schon in der Pandemie. Es war klargeworden. Die Wünsche galten nichts. Galten nichts mehr.
Und jetzt. Sie ging schneller. Der Gedanke an einen Atomkrieg. Sie sah sich. Sie sah alle. Sie alle lagen wie Alexander Walterowitsch Litwinenko da. Auf diesem Spitalsbett. So hochgelagert. Mit grünen Tüchern zugedeckt. Und warten. Wie der. Auf den sicheren Tod. Auf den unabwendbaren Tod durch Strahlung. Das war 2006 gewesen. Da war sie 40 gewesen. Die Veronica 4. Da hatten sie in Zürich gelebt. Sie hatte diesen Job gehabt. Noch. Sie hatte nur Mitleid gehabt. Mit diesem Mann. Sie konnte sich erinnern. Wie die Augen dieses Manns sie angeschaut hatten. Wie dieser Mann aus den Bildern herausgeschaut hatte. Vorwurfsvoll verurteilt. Rettungslos verloren. Und nun. Sie lachte laut auf. Nun schauten sie alle vorwurfsvoll verurteilt vor sich hin. Kurz. Einen Augenblick lang. Sie wünschte sich. Einen Augenblick und dann gleich nicht mehr. Eine Verurteilung. Standrechtlich. Von allen. Auch von denen hier. In Wien. In Europa. In den USA. In England. Eine Verurteilung von all denen, die es dahin gebracht hatten. Dahin, dass sie sich dieses Bild ausmalen musste. Dass sie sich selbst als strahlenverseuchten Leib vorstellen musste. Dass ihr ihr Körper in einen Leib verwandelt wurde. Und ihr nicht mehr gehörte. Dass sie von denen, die es dahin gebracht hatten. Dass die sie ihres Körpers enteignet hatten. Ihr nur einen Leib überließen, der verseucht wurde. Oder auch nicht. Aber sie war ausgeliefert. Ohne ihr Zutun. Und vor allem. Das Kind. Ihr Kind mit dazu. Ihr Kind …
Sie holte Luft. Tief. Sie stieg fester auf. Schritt weiter aus. Sie hätte trampeln mögen. Sie hatte dieses Kind nicht bekommen, damit man es ihr in diese Bedrohung entführen sollte. Sie hatte dieses Kind bekommen, weil es ein glückliches Leben geben hätte sollen. Und weil es so gekommen war. Wie konnte es sein, dass sie ihre Entscheidung, dieses Kind bekommen zu wollen. Dass sie diese Entscheidung nun. Bereuen? Bezweifeln? Sie konnte ihre Mutter deshalb nicht sehen. Die. Sie blieb stehen. Ging weiter. Ihre Mutter hatte nun alle Triumphe. Ihre Mutter war die wahre Kriegsgewinnlerin. Die hatte den Triumph, recht behalten zu haben. Ihre Mutter hatte ihr zur Abtreibung geraten. Sie hatte schon den Termin in Bad Reichenhall besorgt gehabt. In Salzburg war das nicht gegangen. Der Erzbischof. Die Kirche. Die katholische Kirche. Im Salzburger Landeskrankenhaus wurden keine Abtreibungen durchgeführt. So etwas war da nicht vorgekommen. Obwohl es Gesetz war. Und sie. Sie war der Mutter nicht gefolgt. Und niemand war glücklicher darüber als diese Frau. Ihre Mutter. Sie hatte sich in die perfekte Großmutter verwandelt. Hatte sich diesem Kind so vollkommen zugewandt. Sich wichtig gemacht. Das Kind gegen sie. Ausgespielt. Sie zur übersprungenen Generation machen wollen. Sie. Die Tochter ihrer Mutter. Sie war ja selbst schon unehelich. Die Mutter hatte sagen können, sie wisse, was das bedeute. Und sie hätte es auch wissen sollen und es dem Kind ersparen. Ihre Unehelichkeit. Ein Makel. Vor allem für ihre Mutter. Die Unehelichkeit der Enkelin dann das Glück dieser Frau, die auf Abtreibung gedrängt hatte. Und so. Die hatte alles. Ihre Mutter hatte alles. Die Oma Christl. Sie hatte die Weisheit der Erfahrung vorgelegt. Besser kein Kind in die Welt. Unter diesen Umständen. »Hab ich dir doch gesagt.« Noch dazu das Kind eines Italieners, der schon verheiratet war. »Das kann nicht gut gehen.« Und das Glück der Existenz der Person. Veronica. Ihre Nizzi. Die das Lebensglück dieser alten Frau geworden war. »Wenn sie nun einmal da ist.« Und jetzt. Die Gefahr. Die Gefährdungen. Und es war die Pandemie schlimm genug gewesen. Für das Kind besonders.
Ihr war die Stimme gekippt. Sie hätte ohnehin nicht weitersprechen können. Und schluchzen am Handy? Früher hätte eine sich entschuldigen können. Sie müsse ein Taschentuch suchen. Weggehen. Vom Festnetztelefon. Taschentuch suchen. Das Handy. Das war immer so dabei. Aber sie musste den Stieglitz anrufen. Wenn sie wieder ruhig war. Wenn sie sich beruhigt hatte. Es war zu dumm. Der Stieglitz war der Netteste. Der war ihre lifeline. Wenn sie vom Stieglitz keine Aufträge mehr bekam? Und er war immer nett. Es war nett gewesen, sie zu fragen, wie es ihr ginge. So. Insgesamt? In der neuen Wohnung? In der neuen Umgebung? Sie hatte ja nur zu weinen begonnen, weil sie nun schon ein halbes Jahr in der Wohnung lebte und noch nie Besuch gehabt hatte. Nur die Nizzi. Und einmal der Opa Franz. Sonst niemand. Von ihrer alten Wohnung. Und der Stieglitz kannte alle Geschichten davon. Er hatte ihr beigestanden. Rechtlich. Aber von der alten Wohnung. Da hatte sie nur die Pandemie-Einsamkeit mitgenommen. Keine Möbel. Nicht einmal die Vasen. Nur die Einsamkeit. Alles andere bei Ben in der Lange Gasse geblieben. Auch die Personen. Sie war sofort aus der WhatsApp-Gruppe entfernt worden. Ihr Facebook-Account sehr klein. Verkleinert worden. Sie musste sich zwingen. Leute einladen und nicht nur Picknicks und Parkbänke. Es ging ja längst alles. Obwohl. Gerade. Es waren alle krank. Alle geimpft. Alle krank. Und sie wollte niemanden sehen. Sie wollte nicht krank werden. Sie hatte Angst in dieser Wohnung zu liegen. Krank. Das Geschrei und die Musikfetzen vom Prater herüber. Und wenn es warm wurde. Es musste ja endlich wärmer werden. Sie wusste noch gar nicht, wie diese Wohnung. Wie die bei Hitze. Nein. Sie konnte niemanden zu sich lassen. Noch nicht. Aber wann dann? Wann war normal?
Veronica.
Die Tränen rannen. Die Tränen rannen über die Wangen, und sie konnte nichts dagegen tun. Die Frau schrie sie an. Die Frau stand über den Tisch zu ihr herübergebeugt. Das Gesicht der Frau dicht vor ihrem. Das Gesicht der Frau so nahe. Sie hätte den Atem riechen müssen, wenn sie nicht die Maske aufgehabt hätte. Sie setzte die Maske immer gleich auf, wenn jemand in die Rezeption hereinkam. Sie schaute auf. Schaute zu der Frau hinauf. Saß. Von der Frau festgenagelt. Sie müsse nur dasitzen, hatte der Küchenreither gesagt. Hinter dem Tisch der Rezeption sitzen. Auskunft geben. Die Post einordnen. Und er müsse sie warnen. Es wäre nicht immer nett, wie Leute sie behandeln würden. Es gäbe fürchterliche Leute. Leute, die glaubten, es gehöre alles ihnen. Kühlen Abstand solle sie halten, hatte er gemeint. Und so gegrinst dazu. So vertraulich.
Sie war froh über die Maske. Die Frau beugte sich weit in ihren space. Diese Frau hielt sich nicht an die Abstandsregeln. Diese Frau zischte und sprühte auf sie herunter. Und sie stand doch auf. Da war das mit dem Weinen auch gleich vorbei. Sie war größer als diese Frau. Die musste zu ihr hinaufschauen. Die Frau schimpfte weiter. Und es ging gar nicht um sie. Es war der Atem gewesen. Dass sie in diesen Atem gezwungen worden war. In den Atemstrahl dieser Person gebannt. Stehend. Die Frau beschimpfte nur die Leute von »open up«. Nicht sie. Sie war gar nicht gemeint. »Open up«. Das war ein Aufsperrdienst. Die waren nur telefonisch erreichbar. Oder per E-Mail. Die hatten keine feste Adresse mehr. Nur ein Brieffach hier.
Sie hatte alles richtig gemacht. Sie hatte lächelnd aufgeschaut. Während des Maskenaufsetzens. Sie hatte der Frau die Visitkarte von »open up« hingehalten. Auf der fände sie die Telefonnummer, hatte sie gesagt. Freundlich. Sie hatte das alles freundlich gesagt. Das war mit der Maske nicht so selbstverständlich zu sehen. Eine Person wäre hier nicht anzutreffen. Auf der Website von »open up« könne sie das auch lesen. Sie hatte der Frau vorgeschlagen, ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Sie würde dann zurückgerufen werden. Das war nett von ihr gewesen. Das musste sie nicht tun. Die Frau hatte sie aber nur angeschaut. Stumm. Da hatte die Frau selber noch die Maske aufgehabt. Die hatte sie abgenommen. Beim Schimpfen. Beim Auf-sie-herunterSchimpfen. Ein Überfall. Das war ein Überfall gewesen. Die Frau war teuer angezogen. Goldglänzend. Die Hose goldglänzend. Goldglitzernde Edelsneaker. Solche Sneaker hatte sie im Prada-Geschäft nebenan gesehen. Die Jacke im Chanel-Stil. Mit Goldtressen. Vor dem Tisch. Die Frau war an den Tisch gekommen. Und sie. Sie hatte gedacht, sie solle die Telefonnummer notieren, und hatte auf dem Bildschirm schon nach der Website von »open up« gesucht. Da hatte die Frau die Maske abgenommen.
»Es ist eine Schande. Ihr wollt doch nur noch das Geld.« Die Frau hatte sich immer näher zu ihr heruntergebeugt. »Ich gehe extra hierher. Es gibt nirgends mehr einen Schlüsseldienst. Es ist kein Schlüsseldienst oder ein Schlosser in der Innenstadt zu finden. Der hier. Dieses Ding da. Das steht in den Gelben Seiten. Das habe ich auf den Gelben Seiten gefunden. Und was ist dann? Nichts. Nichts ist. Nada.«
Da war die Frau knapp über ihr gewesen. Sie hätte schneller aufstehen sollen. Diese Covid-Viecher von oben in ihre Maske hinein.
»Betrüger seid’s es.«, hatte sie ihr in die Maske gezischt. »Scheiße. Absolute Scheiße. Und du. Du deppate Funsna. Du glaubst a, weist jung bist und a bissl guat ausschaust. Aber ihr seid’s alle gleich. Du bist a nur a Officeprostituierte. Glaub net, dass des net jeda waß. Wie is er denn? Der Herr Chef?«
Im Stehen. Sie hatte keine Sorge mehr, die Frau könne auf sie einschlagen. Das hatte so gewirkt. Kurz. Sollte sie nach hinten gehen. Die Stufen hinauf und in den Vorraum zur Toilette. Aber sie musste auf die Post aufpassen. Sie durfte die Post nicht unbeaufsichtigt lassen. Dazu war sie da. Und es lag Post in den Brieffächern. Von den Vortagen. Manche holten ihre Post nur einmal in der Woche ab. Oder sie musste nachschicken. Der Briefträger. Er konnte jeden Augenblick kommen. Dann war sie nicht allein. Mit dieser Person. Diese Frau. Diese Wut. Alle Sicherheitskameras waren angesprungen. Unter jeder Kamera blinkte das rote Licht. Die Szene war aufgezeichnet. Sie musste sich nicht sorgen. Es gab diese Dokumentation. Sie setzte sich wieder. Sie setzte sich sehr aufrecht hin. Im rechten Augenwinkel. Die Tränen juckten. Sie wischte sich die Tränen nicht weg.
»Ich kann Ihre Telefonnummer notieren und Sie werden zurückgerufen. Mehr kann ich für Sie nicht tun.«
Ihre Stimme war wieder fest. Sie hatte befürchtet, verweint zu klingen. Kühl und bestimmt hatte sie geredet. Kompetent. Die Frau drehte sich weg. Ging hinaus. Sagte nichts. Sie blieb sitzen. Sie zwang sich, sich die Tränen nicht wegzuwischen. Sie wartete, bis die Kameras nicht mehr rot blinkten. Still standen. Sie stellte ihr Handy auf. Klickte auf Aufnahme. Video. Sie saß still. Sie atmete so flach wie möglich. Unbewegt. Ließ sich zu Stein werden. In Stein verwandeln. Schaute vor sich auf den Eingangsbogen zur Rezeption hinauf. Die Geräusche von draußen. Vom Kohlmarkt. Der Lärm ein schmaler Rand zur Stille herinnen. Wie tot, fiel ihr ein. Aber das stimmte nicht. Das konnte sie sich nicht vorstellen. Sie fühlte sich ja. Fühlte sich in der Mitte von dieser Stille in der Mitte der Stadt. Sie seufzte.
Das Kontrolllicht der Kamera vor ihr. Es begann sofort wieder zu blinken. Sie war nicht bewegungslos genug gewesen. Sie musste von vorne anfangen. Sie rückte das Handy zurecht. Setzte sich zurecht. Legte den rechten Arm auf den Tisch. Drückte wieder auf Video. Bewegte nicht einmal den Finger. Konzentrierte sich. Sie dachte sich doch tot. Sie dachte sich tot wie Gabby Petito. Sie stellte sich vor, wie alle Instagram-Postings von Gabby Petito von einer Toten waren. Wie diese Postings sich vom verwesenden Körper der Person entfernten. Wie Gabby Petito nur noch auf diesen Postings lächelte oder aß oder saß oder lief. Gabby Petito war längst begraben und als YouTube-Sensation und auf Instagram und auf Twitter schon längst vom Prozess Johnny Depp/Amber Heard ersetzt worden.
Sie saß bewegungslos. Sie hielt Gabby Petito die Treue. Sie hatte mit dem Jonas auch so eine Reise geplant gehabt. Aber sie. Sie hatte selbst abgesagt. Und sie konnte es niemandem sagen. Niemand würde ihr glauben. Sie wusste ja selbst. Es gab keinen Grund. Keine Anhaltspunkte. Aber sie wollte nicht. Wollte nicht mit ihm. Irgendwie. Sie hatte Angst bekommen. Oder nicht Angst. Der Jonas. Er war. So groß. Er schien größer geworden zu sein. Und sein Bauch. Der Bauch. Das hatte ja dann. Und er hatte sie belogen. Richtig blöd angelogen. Sie seufzte. Musste Luft holen. Tief Luft holen. Sie hatte zu flach geatmet. Und sah sie wirklich dieser Person ähnlich. Sie war doch nicht blond.
Die Kamera hatte wieder zu blinken begonnen. Sie setzte sich auf. Streckte sich. Dieses Posting musste fertig werden. Die Post würde gleich kommen. Und dann die Leute. Die Post abholen. Tratschen. Ob der Poldi in Wien wäre oder wo er sich herumtriebe. Die vollkommene Unbewegtheit. Fast-Tot-Sein. Das konnte sie nur am Morgen machen. Und dann posten. Jeden Tag. Jeden Morgen. Sie nannte es »TikTok eingefroren«. Das ewige Leben auf Instagram. 43 Follower warteten. Sie tippte wieder auf Aufnahme. Begann von neuem. Gabby. Sie dachte sich Gabby. Unbeweglich wie die. Sie saß. Die Sessellehne gegen den Rücken. Die Arme schwer hängend. Das dünne Atmen wurde wieder schwieriger. Sie zwang sich, mit dem tiefen Atmen zu warten. Nur noch kurz. Es war wichtig. Dann hatte sie es für den Tag geschafft. Dann hatte sie die Aufnahme für den Tag. Es war wichtig, Ankündigungen einzuhalten. Gabby hatte das gemacht. Sie stellte sich Gabbys Postings vor. Gabby zwischen Felsen. Gabby gegen den Abendhimmel am Meer und wie sie ihrem Mörder zuwinkt. Wie sie ein Tuch hochhält und etwas sagt. Sie hatte den Ton abgeschaltet. Weil Gabbys Leiche gefunden worden war, hatte sie den Ton abgeschaltet. Von Anfang an. Sie hatte diese Geschichte erst zu sehen bekommen, da war Gabbys Leiche schon gefunden gewesen. Der Mörder war da noch herumgefahren. Der mutmaßliche Mörder. Da war ja noch nichts klar gewesen. Eine Vermutung. Die Ermordete und ihr Mörder immer noch auf der Reise. Auf Instagram. Sie hatte die Stimme nicht hören wollen. Die Stimme einer Toten. Deshalb. Sie sagte nie etwas in ihren Postings. Sie ließ ihre Stimme nicht so gefangennehmen. Auf ewig.
War es das gewesen? Der Jonas. Der hatte immer gemeinsam auf Instagram sein wollen. Selfies gemeinsam und etwas sagen. Wo sie waren. Was sie machten. Wie schön es wäre. Wie gut das Essen. Wohin sie geradelt waren. Lauter so Klumpert. Wen interessierte das. Gabby schauten alle an, weil sie ein Mordopfer war. Ein hübsches Mordopfer. Verzweifelt und hübsch. Sie saß. Vom Nicht-so-richtig-Atmen. Graue Schleier vor den Augen. Nur noch ein bisschen. Durchhalten. Aushalten. Das war ihr Opfer an die Ewigkeit des toten Mädchens. Und sie hatte es geschafft. Sie war für 2 Minuten und 7 Sekunden erstarrt gewesen. Die Kameras hatten das Blinken aufgegeben. Sie war für 2 Minuten und 7 Sekunden verschwunden gewesen. Nicht dokumentiert. Es hatte sie nicht gegeben. Für diese Zeit. An diesem Platz. Sie hatte die Kameras abgeschaltet. Überlistet. Sie schnitt die Aufnahme auf dem Handy zurecht. Den Anfang weg. Stellte die 2 Minuten und 7 Sekunden Unbeweglichkeit auf TikTok. »Bei der Arbeit Nummer 9« nannte sie es. Sie musste lachen. Sie sah wirklich fast tot aus.
Konstanze.
Die Kastanien waren im Aufblühen. Alles war im Aufblühen. Das kühle Wetter. Das kühle, regnerische Wetter. Es hatte alles Blühen angehalten, und nun drängten alle Blüten zur gleichen Zeit ans Licht. Erwartung, dachte sie. So ist Erwartung. Sie hätte lachen können. Hell war das. Frühlingshell. Zum Tanzen. Klingelnd hell und zum Sommer hin. Sie blieb stehen. Holte Atem. Tief. Sie hätte die Arme hochhalten und sich drehen mögen. Sie stand auf dem breiten Gehsteig. Vor der Geisterbahn. Nach rechts die Hütten der Restaurants zwischen dem Gestänge der Falltürme der Pratersensationen. Nach der Geisterbahn nach links der Cortina-Bob. Die älteste Hochschaubahn im Prater. Die Bäume die Sicht verdeckten. Neubauten dahinter. Auf den Balkonen Gartenmöbel und Fahrräder. Das war vor einer Woche noch alles leer gewesen. Die Bewohner hatten sich erst ausstatten müssen.
Sie ging weiter. Seufzend. Die Kastanien würden blühen. Spätestens in einer Woche. In drei Tagen. Die Kerzen der Kastanien würden aufgeblüht sein, und die Bäume so feierlich damit. Das ging alles weiter. Das ging alles seinen Gang. Sie. Sie hatte wieder einmal umsonst gearbeitet. Die Anthologie mit den Texten zur Pandemie. Es sollten italienische Erfahrungen und österreichische Erfahrungen in der Pandemie nebeneinandergestellt werden. Waren das unterschiedliche Erfahrungen gewesen? Ließ sich das vergleichen? Oder waren es unterschiedliche Erfahrungen gewesen, die zu denselben Folgerungen geführt hatten? Sie hatte die Übersetzungen gemacht. Aus dem Deutschen ins Italienische. Dann lange nichts. Und heute die E-Mail. Der Verleger war gestorben. Jetzt noch. Am Ende. Covid. Und niemand wusste, wie es weitergehen sollte. Die Covid-Anthologie durch Covid zerstört. Und jetzt einmal. Kein Honorar. Das müsse sie verstehen. Lei deve capirlo. Aber was war da zu verstehen. So ein leeres Bankkonto. Dafür musste niemand Verständnis aufbringen. So ein leeres Bankkonto. Die reine Wahrheit. Die blanke Realität. Sie musste lachen. So viele Wahrheiten. Mit einem Mal lebte sie in einem Wahrheitsparadies. Keine Täuschungen mehr. Nur die reine Enttäuschung. Kein Geld. Kein Leben. Keine Zukunft. Es war noch ein bisschen theoretisch. Dieses Wahrheitsparadies. Aber es gab jetzt manchmal keine Nudeln im Supermarkt. Und keinen Zucker. Acciughe waren überhaupt nicht mehr zu finden. Der Brief war gestern gekommen. Die Ankündigung der Heizkostenerhöhung. Einengungen. Die Wände rückten näher. Die Wände …
Hatte sie wirklich gesagt »Ich sterbe.«? Was war ihr da eingefallen. Der Stieglitz. Ihr Bollwerk. Der hatte immer alles gemacht für sie. Die Unterhaltspflicht von Veronicas Vater und die Gerichtsübersetzungen für sie. Und das war lang hin und her gegangen. Zwischen den italienischen Gerichten und den österreichischen. Und der Stieglitz hatte nicht lockergelassen. Bekam die Veronica das noch? Die machten sich das alleine aus. Und wenn sie fragte. Wenn sie die Nizzi fragte. Nach solchen Dingen. Keine Antwort. Das mit dem Erbe von der Nonna. Darüber wusste sie auch nichts. Die Nizzi. Sie hatte nicht einmal irgendetwas zur Erinnerung bekommen. Von der Nonna. Alles in Covid-Maßnahmen untergegangen, und hinreisen unmöglich gewesen. Und wenn die Nizzi ihren Vater wirklich nicht mehr sehen wollte. »Nie mehr.« Wollte sie das wirklich? Er war ihr Vater. Aber dieses ganze Familienzeugs. Es hatte dann ohnehin nur die Nonna gegeben. Der Beppo hätte das Kind nicht so aufgenommen. Der schob die Ricarda vor und hielt sich heraus. Wahrscheinlich. Sie hatte immer vermutet, dass die Nonna die Alimente bezahlt hatte. Dass die die Verantwortung übernommen hatte. Wahrscheinlich war der Dauerauftrag vom Konto der Nonna gekommen, und weil die tot war. Die Nizzi musste jedes Mal anrufen und das Geld verlangen. Der Stieglitz musste das richten. Sich darum kümmern. Sie musste mit ihm reden. Ihn anrufen. Und dann mit der Nizzi. Am Abend. Bei Gelegenheit. Vorsichtig. Sie durfte nicht so. Nicht alles so dringlich machen. Und sie musste einkaufen. Etwas Gutes kochen. Etwas alltäglich Gutes, das die Nizzi essen konnte. Und nichts fragen. Sie musste sich das vornehmen. Nichts fragen. Nicht direkt fragen. Abwarten. Wenn sie das nur besser könnte.
Sie schüttelte den Kopf. Ging weiter. Blieb stehen. Setzte sich auf die erste Bank mit Blick auf die große Wiese. Geduld. Wie bekam sie die notwendige Geduld zusammen? Dieses Kind. Ihre Veronica. Nizzi. Sie war in einer Krise. Aber in welcher? War es die normale Mutter-Tochter-Kalamität? War es wegen dieses Kerls da? War es das Studium? Es war alles wegen der Pandemie. Natürlich. Und wenigstens war die Nizzi mit dem Opa Franz gut. Mit dem redete sie. Mit ihr ja auch. Es war keine Trennung. Es war eine Abtrennung. Und sie durfte nicht über die Zukunft reden. Sie durfte nicht fragen, warum sie in dieses katholische Mädchenheim gezogen war. Warum sie nicht mehr studierte. Warum sie sich vom Jonas getrennt hatte. Warum sie nicht mehr zu ihrem Vater nach Italien fahren wollte. Wie sonst jeden Sommer. Sie musste ruhig und gelassen sein. Sie musste so tun, als säße sie ruhig in der Mitte ihres eigenen Lebens und hätte alles im Griff.
Sie wünschte sich ja, die Nizzi würde wieder bei ihr leben. Aber das war auch theoretisch. Sie hatte es sich eingerichtet. Allein. Sie hatte es gelernt. Lernen müssen. Vom eigenen Kind verlassen zu werden. Hinter sich gelassen zu werden von ihr. Zurückgelassen. Eigentlich. Schwer zu ertragen. Vor allem wenn es die eigene Mutter über sich triumphieren ließ. »Bei mir will sie schon wohnen.« Für das Kind. Es hatte ausgehalten werden müssen. Die Veronica in der Mansardenwohnung im Haus der Großmutter in Salzburg. Mit diesem Jonas zusammen. Weil das im ersten Lockdown gerade alles so gewesen war. Dieser Augenblick pandemisch verfestigt. Das Kind in einer eheähnlichen Beziehung im Haus ihrer Großmutter. Sie hatte das verstehen müssen. Sie hatte so etwas nicht bieten können. Bieten. Das klang gleich wie bitter. Sie. Sie hatte das nicht bieten können. Sie hatte es eben nicht zu einem Mann gebracht. Wie die Mutter. Zu einem Mann, der ihr alles bieten konnte. Aber sie hätte das nicht gewollt. Die Gebieterin zu sein. Und einen Mann, der sich selbst aufgegeben hatte. Auch wenn sie den Opa Franz mochte. Auch wenn der das Ähnlichste war, was sie an Vater kannte. Sie mochte diesen Mann und ihre Mutter nicht. Aber eine solche Konstellation. Nein. Das wäre nicht gegangen. Ihre Tochter musste sie nehmen, wie sie war. Das hatte man früher zu einem Geliebten gesagt. Als Liebesprobe. So wie ich bin, will ich geliebt werden. Dieser Satz. Der hatte sich immer schon mit dem Wirtschaftlichen gespießt. Mit dem Stand. Und das war nicht vorbei.
Die Nizzi. Hätte die eine unwürdige Situation für ihre Mutter in Kauf genommen, wenn das ihre Situation erleichtert hätte? Für die Großmutter genierte sie sich ja nicht. Die über diesen Mann herrschte und ihn triezte. Diese Szenen. In Lokalen. »Nicht einmal einen ordentlichen Tisch.« Unwürdig. Aber es war nichts zu ändern. Nicht mehr. Sie. Eine Übersetzerin. Mager. Das war mager. Und hätte sie in der Redaktion bleiben sollen und nicht mit den anderen zurücktreten? In Zürich bleiben? Im unwürdigen Abstieg von einer freien Redaktion in ein PR-Team? Wäre das viel unwürdiger als jetzt? So prekär. Die Haltung wahren. Ohne Geld war das schwierig, wenn das eigene Kind unzufrieden war. Mit einer. Sie stand auf. Schüttelte sich. Abschließen, sagte sie sich vor. Move on. Das war das notwendige Motto. Move on. Und gleich der Nebel im Kopf. Wohin? Wohin sich fortbewegen?
Sie kehrte um. Ging den Weg zurück. Sie musste etwas essen. Sie war dünn im Kopf. Sie hatte noch keinen Kaffee gehabt. Bei der Covid-Teststation. Da gab es guten Kaffee. Oder doch etwas essen? Vom Würstelgasthaus weiter unten roch es herüber. Bratwurst. Sie blieb stehen. Sie hatte kein Geld mit. Sie hatte nur den Wohnungsschlüssel in der Jackentasche. Sie musste lachen. Wie konnte sie an Essen denken? Wie konnte sie Lust auf Würstel haben? Sollte sie zurückgehen. Sie hatte auch kein Geld zu Hause. Sie musste abheben. Sie musste zum rosa Riesenschwein gehen und Geld herausziehen. Aus dem Bauch. Und sie sollte keine Würstel essen. Das hatte sie doch aufgegeben. Auch wegen der Nizzi. Der Geruch von Frankfurtern. Oder Käsekrainern. Das war ihr doch widerlich gewesen. Sie hatte doch nur noch gesund gegessen. Hatte es ernst genommen. Das mit dem Essen. Aber das war auch vorbei. Sie aß nicht mehr gesund. Überhaupt nicht mehr. Es war ihr gleichgültig geworden. Sie stopfte in sich hinein. Irgendetwas. Sie hatte jedes Interesse am Essen verloren. Sie hatte die Mahlzeiten aufgegeben. Sie aß irgendwann irgendetwas. Die Nizzi durfte das nicht wissen. Ihre Veronica, mit c geschrieben, vegan und ernsthaft. Und sie aß alles. War das Selbstzerstörung? Aber warum? Und wem sollte das wichtig sein? In einem Staat, in dem es bis vor kurzem nur um Geimpfte und Ungeimpfte gegangen war. Und nicht um Bürgerinnen oder Bürger. Es war vorstellbar gemacht worden, dass Ungeimpfte nicht zur Wahl gehen durften. Einfach mit einem Betretungsverbot für Ungeimpfte das Wahlrecht ausgesetzt. Schleichendes Unrecht war das. Auch nur Infektionen. Aber keine Impfung gegen schleichendes Unrecht möglich. War ihr ungesundes Essen? War das ihre Art, eine Ketzerin zu sein? Konnte sie sich immer noch nicht einfinden? Wie in Zürich? »Nein. Dazu können wir uns nicht hergeben.« Und wie gleichgültig das geworden war. Diese Tapferkeit. Diese Verteidigung des freien Worts. Wie gleichgültig gemacht. Finanzkrisen und Pandemien. Sie hörte Schritte hinter sich. Trat zur Seite. Ein Mann ging an ihr vorbei. Kam neben sie.
»Konstanze.«, sagte er. »Nein so etwas.«
Veronica.
Sie hörte die Frau Wallin kommen. Das schnarrende Drehen der Schlüssel in den beiden Schlössern in der Tür zur Kellerstiege. Die anderen Schlüssel vom Schlüsselbund schlugen gegen die Tür. Veronica hätte gerne gewusst, welche Schlösser alle diese vielen verschiedenen Schlüssel aufsperren konnten. Sie hatte sich nicht getraut. Fragte lieber nicht. Die Frau Wallin. Als Hausmeisterin hatte sie wahrscheinlich die Schlüssel zu allen Wohnungen und Büros im Haus. Die Tür schwang auf. Frau Wallin trat durch die Tür. Hinter ihr. Einen Augenblick. Der dunkle Einstieg in die Kellerstiege. Das Licht schon abgedreht. »Licht sparen.« Frau Wallin sagte es. Veronica dachte wieder, dass sie nichts sehen sollte. Dass die Frau Wallin nicht wollte, dass irgendjemand einen Blick in ihre Unterwelt erhaschen solle. Sie versperrte die Tür auch immer gleich hinter sich. Die Frau Wallin war dick. Durch die schmale Tür schob sie sich seitlich herein. Aber sie war nicht langsam. Die dicke Frau Wallin war behende.
»Gehen Sie schon?«, fragte sie.
Die Frau Wallin kam die Stufen zur Rezeption herauf. Blieb gleich wieder stehen. Schüttelte den Kopf. Nein. Sie ginge nicht. Heute sei doch Stiegentag.
»Frau Soardi«, sagte sie. »Frau Soardi. Sie wissen doch. Donnerstag ist Stiegentag.«
Veronica nickte. Sie sagte nichts. Sie hatte auch schon gehört, der Montag sei der Stiegentag. Oder der Mittwoch. Sie hatte den Küchenreither gefragt, wie das sei mit der Frau Wallin. Aber der hatte nur mit den Achseln gezuckt. Vielleicht, dachte sie. Vielleicht gehörte das ganze Haus der Frau Wallin. So wie sie herumging. Alle Türen aufsperrte. Zusperrte. Sie nannte den Küchenreither »Chef«. Aber das sagte nichts. Vielleicht sagte sie zu allen Männern »Chef«. Jedenfalls war immer alles sauber. Der Marmorboden in der Rezeption glänzte jeden Morgen wie neu. Die Spiegel im Gang vom Kohlmarkt herein spiegelten. Schon zu Mittag oder am Nachmittag. Wenn sie ging. Es gab sehr oft Geschmiere auf den Spiegeln. Graffiti und Burgerschachteln auf dem Boden. Hundekot. Aber bis zu ihr. Um die Ecke. In die Rezeption. Da kam niemand. Und da waren dann ja die Sicherheitskameras und jede Überschreitung wurde aufgezeichnet. Das war kein Schutz. Das war eine Sicherheitsmaßnahme. Das sei ein Unterschied, sagte der Küchenreither. Aber sie solle sich keine Gedanken machen. Sie sei sicher hier.
Die Frau Wallin holte ihre Putzgeräte aus dem Kämmerchen neben der Toilette. Veronica stand auf. Ging ihr nach. Sie blieb an den Stufen zum Büro vom Küchenreither und der Toilette stehen. Hörte zu, wie das Wasser in den Kübel donnerte. Frau Wallin zog die Wischtuchpresse aus dem Kämmerchen heraus. Auf den Stiegenabsatz. Das Wasser im Kübel schwappte. Was sie denn für Reinigungsmittel verwende, fragte Veronica. Frau Wallin blieb stehen. »Ja. Also.« Da habe sie so einen Starkreiniger. Von dem reichten ein paar Tropfen ins Wischwasser und der schlimmste Fettfleck wäre weg. Auch Kaugummis wären so wegzubringen. Das wäre aber nur im Gang draußen notwendig. Im Haus sonst. Da kämen nur ordentliche Leute herein. Zu den Ärzten im Hochparterre zum Beispiel. Aber die kümmerten sie hier nicht. Die gingen ja nach hinten zum Lift. Den Reiniger. Den gäbe es nur im Internet. Wenn sie wieder eine Bestellung machen müsse. Das Paket käme dann hierher. An die Postadresse vom Dr. Küchenreither. Und jetzt. Sie müsse weitertun. Sie könne nicht so lange tratschen.
Die Frau zog ihre Putzgeräte hinter sich zum Lift zum Dachgeschoss. Von der Rezeption konnte man nur ins Dachgeschoss hinauf. Für die Hausstiege und den Lift zu den anderen Etagen musste man den Gang weitergehen. Nicht zur Rezeption nach rechts abbiegen. Im Dachgeschoss die Wohnung. Die war gerade frei und niemand kam vorbei. Nur der Küchenreither fuhr da manchmal hinauf. Sie seufzte. Es dauerte, bis man alle diese Sachen wissen konnte. Die paar Wochen hier. Die reichten nicht, alle Geheimnisse herauszufinden. Frau Wallin winkte ihr und verschwand in den Lift. Sie hörte die innere Lifttür schließen. Der Lift fuhr hinauf. Es war wieder still. Draußen. Weit draußen auf der Straße. Jemand schrie. Schimpfte. Der Kohlmarkt war sicher voller Menschen. Wie sie angefangen hatte. Da war noch Lockdown gewesen. Wie lang das her schien. Da war niemand draußen gegangen. Die meisten Geschäfte geschlossen. Alle mit Masken. Auch auf der Straße. Da hatte sie sich nicht so einsam gefühlt. Hier. Jetzt. Und alle wieder unterwegs. Weggerückt. Sie war wie weggerückt. Und dass sie die Maske aufsetzte. Wenn jemand hereinkam. Sie wurde gefragt, wovor sie denn Angst habe. Sie sei doch eine junge Person. Keine Gefahr. Aber es war so sauber. Mit Maske. Sie saß gerne im 40er Bus und schaute über den Maskenrand zum Fenster hinaus. Schweigen. Die Maske machte Schweigen selbstverständlich. Lieber nicht reden. Hinter der Maske. Deshalb war diese schimpfende Person so. So unmöglich gewesen.
Hatte sie das richtig gemacht? Hätte sie etwas sagen sollen? Die Firma vom Küchenreither verteidigen? »Letterbox limited«. Sie waren ein Dienstleistungsunternehmen für andere Unternehmen. Das hätte sie dieser Frau sagen sollen. Wenn der Küchenreither die Sicherheitsvideos anschaute? Würde er sagen, sie habe es nicht gut gemacht? Und sie entlassen? Das ging nicht. Sie war nicht angestellt. Sie wurde stundenweise bezahlt. Er konnte sie wegschicken. Hinausschmeißen. Und ging sich dann alles aus? Reichte das Geld vom Opa Franz? Und blieb die Vereinbarung für das Zimmer aufrecht? Das Zimmer? Das billige Zimmer. Würde der Mayerhoff die Berger anrufen? Und die Berger? Ihr das Zimmer wegnehmen? Die Berger wollte sie ohnehin nicht dahaben. Widerstrebend. Die Berger reagierte widerstrebend. Und in Salzburg. In der Katharinen-Buchhandlung. Es hatte so easy ausgesehen. Der Küchenreither braucht eine Rezeptionistin in Wien. Sie wollte von Salzburg weg. Sie wollte nach Wien. Wollte aber nicht bei ihrer Mutter einziehen. Der Mayerhoff hatte Verbindungen zu diesem Studentinnenheim in Wien. Der Küchenreither fragte den Mayerhoff, die Berger anzurufen, und der Kaplan Chrobath bürgte für sie. Ein nettes Mädchen. Eine verlässliche Person. Und wie schön, hatte der Kaplan Chrobath gesagt. Er werde sie dann ja wiedersehen. Im Mädchenheim. Und alle hatten sich gefreut. Zur Mami. Schlimmstenfalls musste sie zur Mami. Die wollte das sowieso. Nur. In der neuen Wohnung. Da war nicht Platz. Warum sie die Lange Gasse aufgegeben hatte? Aber die würde sich freuen. Ja. Die würde sich freuen.
Nein. Sie musste diesen Job hier behalten. Jetzt einmal. Sie seufzte. Sie setzte sich auf. Wedelte mit den Händen. Sie rutschte auf dem Sessel hin und her. Sie beugte sich vor und zurück. Sie rollte mit dem Sessel an den Tisch und wieder weg. Rollte bis zu den Stufen zum Gang hinunter und zurück. Sie schob die Computertastatur hin und her. Sie holte ihre Tasche aus der Lade und legte sie wieder zurück. Sie verschob den Computermonitor. Sie stand auf und schob den Papierkorb hinter den Tisch und dann wieder neben den Tisch und dann unter den Tisch. Sie holte die Tasche wieder aus der Lade. Holte ein Taschentuch heraus. Öffnete ein Taschentuch und stecke es in die Tasche zurück. Sie überlegte. Was für Bewegungen waren noch unverdächtig? Sie begann auf dem Computer zu schreiben. Aber sie hob die Hände nach jedem Wort hoch in die Luft. Die Sicherheitskameras. Alle drei Kameras blinkten. Sie musste das nur eine halbe Stunde durchhalten. Dann war die Szene mit der wütenden Frau überschrieben.
Sie hörte den Lift. Sie hörte zu schreiben auf. Sie hatte die Einkaufsliste für das Wolkenkostüm begonnen. Die Lifttür ging auf. Frau Wallin. Sie brauche mehr Küchenrolle, sagte die und ging an ihr vorbei zum Putzkämmerchen hinauf. Wie schaute eine Wolke aus, fragte Veronica sich. Frau Wallin kam herunter zurück. Eine dicke Küchenrolle unter dem Arm. Sie blieb neben ihr stehen.
»Ja. Frau Wallin. Ich werde eine Wolke.«
»Da sieht man ja deine Figur gar nicht.«, sagte Frau Wallin und ging zum Lift. Der Mann von »open up« kam um die Ecke in die Rezeption.
»Die Post ist noch nicht da.«, sagte sie schnell. Der Mann drehte sich um und ging. Der grüßte auch nie. Sie schaute auf dem Handy nach, wie spät es war. Die Post sollte längst gebracht worden sein. Wenn die Post so spät kam. Sie musste sich dann immer anhören, dass der Küchenreither ein Postfach bei der Post einrichten und sie die Post selber holen sollte. Dass der Küchenreither eben ein geiziger Ausbeuter sei und lieber eine junge Frau herumsitzen hatte. Dass die Miete für so ein Postfach hoch genug sei. Dass könne der sich schon leisten. Besonders die Frau vom »Reiseclub. Ihre individuelle Reiseplanung« beklagte sich, wenn sie ohne Post davongehen musste. Am schlimmsten war es, wenn Amtsbriefe abgeholt werden mussten. Sie durfte keine solchen Briefe annehmen. Sie durfte nur die Verständigungen in die Brieffächer legen. Sie war froh. Sie hätte zum Fleischmarkt gehen müssen, wenn sie die Post abholen hätte müssen. Ihr war der Geiz vom Küchenreither recht. Der blieb sehr ruhig, wenn er solche Vorwürfe bekam. Jeder könne sich ein Brieffach mieten, sagte er dann. Wenn es um eine gute Postadresse und den Service dazu ginge, dann koste das eben. Er habe genügend Anfragen. Es gäbe eine Warteliste. Sie hatte eine solche Warteliste noch nie gesehen. Und eigentlich. Es gab keine Beschränkungen. Man konnte ganz einfach noch ein solches Regal mit Brieffächern aufstellen. Aber es wirkte immer. Der Küchenreither wurde kein zweites Mal gefragt. Sie wurde angeraunzt. Aber sie war der Service, wie der Küchenreither das nannte. Angegrantelt zu werden. Das gehörte dazu.
Konstanze.
»Siebenstein.«, rief sie.
Der Mann musterte sie. »Ich wohne hier. Und du?« Sie wollte antworten. Er sprach schnell weiter. »Ich habe hier ein Dach ausgebaut. Da.« Er wandte sich um und wies zur Ausstellungsstraße zurück. »Da. Da oben. Aber das ist jetzt schon länger her.« Sie schaute ihn an. Es war peinlich. Sie konnte sich an nichts erinnern. Sie wusste nur, dass sie miteinander. Vor langer Zeit. Sie musste lachen.
»Ich wohne seit einem halben Jahr hier.«, sagte sie. Wie hatte der geheißen. Der Vorname. Wie war der gewesen? Sie lächelte. Es war eine von diesen verhuschten Geschichten gewesen. Von denen niemand wusste. Wissen sollte. Er war verheiratet gewesen. Sie gerade nicht. Obwohl. Nein. Sie war auch noch nicht geschieden gewesen. Und von der Nizzi war noch lange nicht die Rede. Aber sie hatte allein gelebt. Das war schon in der Lange Gasse gewesen. Getrennt. Sie hatte getrennt gelebt, und der Siebenstein war manchmal aufgetaucht. Nächstens. Mehr? Sie konnte sich nicht erinnern. Sie musste lachen.
»Wie geht es dir denn so?«, fragte sie. Sie standen einander gegenüber. Der Mann schaute sie ernst an.
»Du hast dich nicht verändert.«, sagte er. Er trat einen Schritt zurück.
War er beleidigt? Er wirkte beleidigt. Nein. Vorwurfsvoll. Hatte er bemerkt, dass sie nach seinem Vornamen suchte? Das konnte nicht sein. Sie zuckte mit den Achseln. Wollten sie nicht alle ewig gleichbleiben, sagte sie dann. Sie hatte jung sagen wollen. Aber dann hatte sie in sein ältliches Gesicht geschaut. Lange Falten von der Nase zum Kinn. Die Mundwinkel nach unten gezogen. Tiefe Furchen auf der Stirn und eine steile Zornesfalte. Vielleicht war es das? Vielleicht waren es nur diese Falten, die ihn so moros erscheinen ließen. Aber alterte man gegen die eigenen Eigenschaften? Jedenfalls konnte sie nicht jung sagen. Zu diesem alten Gesicht.
»Du schon. Du scheinst das zu können.« Er trat einen Schritt auf sie zu. Sie machte einen Schritt weg. »Was treibst du so?« Er fragte das gar nicht. Er musterte sie. Sie begann in Richtung des Würstelgasthauses weiter zu gehen. Sie war wütend. Nicht sehr. Aber doch wütend. Dachte der, er könne da anknüpfen, wo sie aufgehört hatten? Dachte der, er könne den Faden wieder aufnehmen? Es schien so. Es schien so, als dächte er, sie sei ihm etwas schuldig. »Wir haben uns eigentlich nie getrennt.«, sagte sie. Er schüttelte den Kopf.
»Nein.« Er dachte nach. Hob den Kopf. Grinste sie an. »Wir sind sozusagen in aufrechter Beziehung geblieben.«, sagte er. Sie musste nicken. Ja. Das war der Siebenstein. Charmant grinsend. Sie erinnerte sich besser. Er war einer von denen gewesen, die davon ausgingen, dass alle für ihren eigenen Spaß verantwortlich waren. Er war deshalb niemandem etwas schuldig. Und das war ja auch so. Und trotzdem war ihr diese Begegnung unbehaglich. So glatt war diese Rechnung also doch nicht. Sie schaute vor sich auf den Boden. Dann jetzt Schluss machen, fragte sie sich. Aber wie langweilig. Wie pingelig. Sie sagte nichts. Sie standen. Die Sonnenflecken auf dem Asphalt der Zufahrtstraße im Wind spielend.
»Weißt du was.«, wandte sie sich an ihn. »Ich habe mein Geld oben vergessen. Kannst du mir 10 Euro borgen. Ich gebe es dir dann gleich wieder zurück.«
»Wozu brauchst du 10 Euro?« Er stand ihr gegenüber. Sein Kopf fragend schief. Sie seufzte.
»Ich bin hungrig.«, antwortete sie. Sie wollte sich wegdrehen. Aber glaubte er dann, das wäre wichtig für sie? Diese Begegnung? Dass er die 10 Euro nicht herausrückte? Warum gab er ihr das Geld nicht? Glaubte er, sie wolle sich seine Adresse erschleichen? So? Ihn aufsuchen müssen? Wie die vergessenen Handschuhe in einem altmodischen Roman? Sie hätte ihn gleich abwehren sollen. Sagen, sie wüsste nicht, wer er sei. Wie sie das erlebte. Sogar der Herbert war an ihr vorbeigegangen. Unlängst. Am Graben. Und mit dem war sie verheiratet gewesen. Aber das hatte sie nicht getroffen. Warum war sie hier verwirrt? War das doch wichtig? War das schon wieder diese Nostalgie? Diese Eigennostalgie? Sie waren jung gewesen. Um die 30. Von heute aus. Da war das jung. Sie konnte das an der Nizzi sehen. Die kam ihr wie ein Baby vor. Mit ihren 20. Und es war so. Sie schaute dem Mann ins Gesicht. Es war alles so mit Leben vollgestopft gewesen. In den 90ern. Es war alles so hoffnungsvoll gewesen. Die Geschichte mit ihm. Die war nur aus dem Schwung von damals zu verstehen. Die Welt war nicht mehr geteilt gewesen und nur Aufschwung vorstellbar. Der Siebenstein war ein Phänomen der Zeit gewesen. Sie hatte dann das Kind bekommen. Weil alles so gut ausgeschaut hatte. Alles bewältigbar. Alles machbar. Sie hatte sich stark gefühlt. Stärker als so ein Siebenstein. Sie hatte ein wirkliches Leben beginnen wollen. Den Schwung in Ernsthaftigkeit verwandeln. Die Versprechungen der Globalisierung umsetzen. Nach Zürich gehen. In die Welt. Und ernsthaft. Nicht so vor sich hin. Wie mit dem da. Jetzt. Sie musste lachen. Jetzt war sie vorwurfsvoll.
»Bist du noch nie aus dem Haus gegangen und hast dein Geld vergessen?« Sie lachte ihn an. »Du kannst heute mein Glück sein.«, schaute sie ihn an. Er war irgendeiner. Mit einem Mal war er irgendeine Person, die sie kannte. Kein Schatten einer Intimität zwischen ihnen. Das war das Katholische an ihr. Sie musste sich vorbeugen, ihr Gesicht zu verbergen. Sie erhoffte immer noch Scham. Sie erhoffte immer noch, dass solche Erinnerungen etwas Besonderes waren. Aber das waren sie nicht. Das war auch eine Lüge dieser Erziehung. Sex blieb nicht in Erinnerung. Jedenfalls nicht mehr und nicht weniger als andere Dinge. Es war eben nichts Besonderes. Sie hing dem nach, damit sie selbst etwas Besonderes sein sollte. Aber das ging so nicht. Sie war auch darin betrogen worden. Hätte sie andere Erinnerungen, wenn sie nicht so kämpfen hätte müssen? Mit dieser Markierung des Sexuellen. Würde sie dann diesen Mann an der Hand nehmen und einen kleinen Tanz auf den zackig geränderten Sonnenflecken auf der Straße aufführen? In Feier der Erinnerung? Und wahrscheinlich. Wahrscheinlich lief in seinem Kopf die gleiche verzweifelte Suche nach den Erinnerungen ab. Obwohl. Er hatte ihren Vornamen gewusst. Das war mehr, als sie bieten konnte.
»Aber selbstverständlich.«, murmelte er und griff in die Brusttasche seines Sakkos. Dunkles Leinen. Er war schon sommerlich. Er öffnete die Brieftasche. »Da.«, sagte er. »Mein letzter.« und hielt ihr einen 10-Euro-Schein hin. Die Brieftasche war mit 100-Euro-Scheinen gefüllt. Sie musste wieder lachen. Sie sagte aber nichts und ging, den 10-Euro-Schein schwenkend, zum Gasthaus. Siebenstein kam ihr nach. Er stellte sich neben sie und schaute zu. Sie bestellte ein Paar Frankfurter. Sie ließ sich die Würstel auf einen Pappteller geben.
»Take away?«, hatte der Mann hinter der Schank gefragt. Sie nickte.
»Zum Mitnehmen.«, korrigierte Siebenstein. Sie wollte »Besserwisser« sagen, aber ihr war der Vorname immer noch nicht eingefallen.
»Viel scharfer Senf.«, verlangte sie. Wartete auf einen Siebenstein-Kommentar. Sie ließ sich eine Semmel geben.
»Willst du nichts trinken?« Siebenstein blieb an der Schank stehen. Sie zahlte und ging. Sie trug den viereckigen Pappteller zu der Bank, auf der sie vorhin gesessen war. Sie setzte sich. Schaute auf die Wiese hinaus. Es waren kaum Leute unterwegs. Es war gegen Mittag. Sie war also am Vormittag gestorben. Wieder einmal. Sie begann zu essen. Tauchte das Würstchen in den Senfberg. Biss ab. Sie nestelte die Semmel aus dem Papiersäckchen. Biss von der Semmel ab. Siebenstein hatte sich neben sie gesetzt. Sie rutschte ein Stück nach links. Machte ihm Platz. Machte Abstand. Sie konnte sich nicht stören lassen. Sie aß. Sie kaute Senf und Würstchen und Semmel zu einem süßlichen Brei und genoss das. Schaute sich selber zu. So war das also. Sie aß Frankfurter mit Senf und Semmel und war glücklich. Ein bisschen. Sie aß langsam. Sie saß zurückgelehnt und kaute. Zufrieden. Vollkommen zufrieden. Baby, dache sie. Sie war auf Baby reduziert. Es fehlte nur noch das glückliche Herumschlagen des Babys. Das gefütterte Baby und wie die glücklich krähen konnten. Sollte sie das nachholen? Sollte sie diesem Mann das Schauspiel befriedigten Glücks bieten? Sich auf die Wiese werfen und sich glücklich krähend im Gras wälzen? Dieser Mann hatte mit ihr geschlafen. Er hätte sich erinnern können. An ihren Körper. Aber dann musste sie wieder lachen. Es war jetzt alles richtig. Einen Augenblick lang. Einen Augenblick lang waren alle Drohungen gebannt. Sie konnte an nichts Schreckliches denken. Und der Siebenstein. Der hieß Michael und wurde Mike gerufen.
»Du. Mike.«, sagte sie. Sie wollte sich bedanken. The kindness of strangers fiel ihr ein. Vestire gli ignudi. Er hatte ihr geholfen. Diese Begegnung. Sie war aus ihrem Elend herausgerissen worden. Sie war satt. Sie schaute auf eine grüne Wiese. Die Kastanien waren im Aufblühen. Alles war ruhig und sie konnte sich zurücklehnen. Die Sirenen wegen des Atomschlags. Sie wartete nicht darauf. Hatte das Warten verlassen. Jetzt einmal. Sie saß da und kein Krampf in der Magengrube.
»Ich bin ein bisschen hysterisch. Zur Zeit.« Sie sagte es vor sich hin.
»Das sind wir alle.« Er hatte sich vorgelehnt.
»Magst du zu mir kommen, dir dein Geld holen?«, fragte sie ihn. »Heute geht es nicht. Da kommt meine Tochter. Morgen bin ich in Zürich. Aber am Samstag. Am Nachmittag. Nummer 27. Der Name steht auf der Klingel.«
Er richtete sich auf. Wollte etwas sagen. Sie war aufgestanden. Ging über die Wiese. Zum Papierkorb. Mit leeren Händen dann. Du wirst noch zu tanzen anfangen, sagte sie zu sich und ging in den Auwald davon.