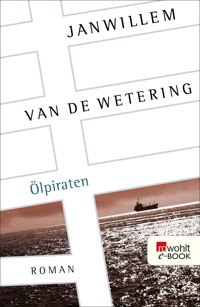4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Amsterdam-Polizisten
- Sprache: Deutsch
Im Rückspiegel des Rennrades sieht Cardozo drei radfahrende Chinesen. Und als er nach vorne blickt, kommen ihm plötzlich auch drei radfahrende Chinesen entgegen. Ein merkwürdiges Zusammentreffen, denkt Cardozo. Er ahnt nicht, dass es sich um rivalisierende Banden handelt, die ihn für einen wichtigen Kurier halten … «Die glücklichste Neuentdeckung der letzten Zeit ist der Holländer Janwillem van de Wetering, der sich, wie es schon bei Sjöwall/Wahlöö zu beobachten war, von Buch zu Buch steigert.» (Esslinger Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Janwillem van de Wetering
Rattenfang
Roman
Aus dem Niederländischen von Erwin Peters
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Eins
Doeke Algra, vor achtundzwanzig Jahren in Menaldum geboren, fühlte sich einen Augenblick lang glücklich. Dieses Gefühl hatte er schon öfters gehabt, wenn er auf Vaters Schoß saß und nach den kleinen Hunden schaute. Es gab da überhaupt keine Hunde, aber sie gehörten nun mal zum Glück. Der alte Doeke Algra, damals ein Mann in den besten Jahren, kehrte abends müde heim, und der kleine Doeke war ein richtiger Wirbelwind. Er wollte nur dann ruhig auf dem Schoß sitzen, wenn es etwas Besonderes gab. «Gleich kommen die kleinen Hundchen», sagte Vater Algra dann und umarmte seinen Sohn.
Zusammen sahen sie anschließend zum schmalen Fenster des zwischen knorrigen Weiden stehenden winzigen Arbeiterhäuschens hinaus und versanken träumend in der Körperwärme des anderen, aber nie kamen die kleinen Hunde.
Es war eine Wärme der Geborgenheit, die jetzt noch einmal kurz zurückkehrte, während Hoofdagent Algra von der Prins Hendrikkade aus über das Wasser des Oosterdocks blickte. Polizist Doeke, der zum Revier Warmoesstraat gehörte, war jetzt, irgendwann zwischen zwei und fünf Uhr morgens, nicht im Dienst. Oder eigentlich schon, denn ein Untersuchungsbeamter sollte täglich vierundzwanzig Stunden lang im Dienst sein, oder wenigstens dienstbereit, und Doeke hatte deshalb Waffe und Dienstausweis bei sich, auch wenn er keine Uniform trug. Er war mit einer Lederjacke und einer eng anliegenden Hose bekleidet. Die Pistole steckte im Schulterhalfter. Den Ausweis aus Plastik mit rot-weiß-blauen Strichen, den Nachweis, dass er tatsächlich zur Polizei gehörte, hatte er in die Brusttasche geschoben. Sein zu allen Zeiten waches soziales Gewissen schwamm in einem Rausch aus Bier, vor einer Stunde noch in der Kneipe von Jelle Troelstra gezapft, Doekes Freund, der seine Spelunke am Oudezijds Kolk hatte. Wenn Doeke an Heimweh litt, besuchte er Jelle.
«Gooden», sagte Jelle dann. Doeke sagte das Gleiche. Sie wünschten einander guten Abend in ihrer eigenen Sprache; dadurch wurde das Heimweh erträglicher. Jelle war ein guter Zuhörer, der dem vereinsamten Doeke seine Aufmerksamkeit schenkte. Der fluchte manchmal ein bisschen, über das gottverdammichte Elend bei der Warmoesstraat, über die Wieven und die Schwarten, und Jelle hörte geduldig zu. Während er lauschte, schenkte er das erste und das letzte Bier auf Rechnung des Wirts ein. Zuweilen schwitzte Jelle, denn er litt an Malaria, und manchmal fasste er sich ans Bein, denn er litt immer noch an den Folgen einer Schusswunde. Die Malaria stammte aus Neuguinea, und der Schuss war von einem berittenen Kosaken abgefeuert worden. Sowohl Jelle als auch Doeke waren streitbare Friesen, aber Jelle sprach nicht mehr gerne über den Kampf, denn er hatte auf der falschen Seite gestanden, die ihm als die richtige erschienen war, so hatte er damals tatsächlich geglaubt. Wachtmeester bei der Niederländischen Legion war Jelle gewesen, und er hatte die Flanken eines deutschen Transportes gegen über den Schnee galoppierende Partisanen verteidigt. Zur «Belohnung» durfte er später eine Straße durch einen kolonialen Urwald mitbauen, das heißt, er durfte sogar als Aufseher fungieren, denn er war nicht mehr gut zu Fuß. Jelle hatte einmal für Groß-Europa gekämpft, Doeke kämpfte jetzt für Ruhe im Stadtzentrum von Amsterdam. Das war ein sinnloser Kampf; Jelle wusste das bereits, Doeke noch nicht. Doeke wusste auch nicht, dass Jelle auf der falschen Seite gestanden hatte und dass er in Hallum, einem Dorf bei Menaldum, geboren war. Auf Doekes Frage hatte Jelle behauptet, aus Anjum zu stammen. Das war etwas weiter entfernt, und Doeke kannte dort niemanden.
Der nie zurückgekehrte Jelle tröstete Doeke, der, fern von seiner Heimat, seinem Lande diente. Jelle tröstete in aller Stille, und das tat Doeke gut.
Jelles geduldige Ruhe und der herbe Geschmack des Bieres erwärmten Doekes Seele noch, wobei die Wärme vom Bauch her ausging. Gemächlich schlendernd erreichte er das Oosterdock, wo es außer plätscherndem grauem Wasser nichts zu sehen gab. Die graue Fläche ließ ihn an die Nebelschwaden denken, die an den Fenstern seines Elternhauses vorbeigestrichen waren, lange, lange war’s her, als er noch sicher auf Vaters Schoß träumte.
Da stand er jetzt, breitbeinig, die Hände auf dem Rücken, und schaute bedächtig auf die leichten Wellen.
Jetzt müsste einmal etwas passieren, dachte Doeke, etwas Angenehmes. Vielleicht erwartete er eine Vision. Alkohol enthemmt, befreit verborgene, schöne Geheimnisse, die plötzlich auflodern, sodass der Schmerz des Alltags darin verbrennen kann.
Hatte er zu diesem Zeitpunkt schon das Feuer gesehen? Das wusste Doeke später nicht mehr, als er beim Verhör in seiner eigenen Dienststelle kleinlaut zugeben musste, dass er ganz schön blau gewesen war.
Egal wie oder was, etwas hatte gebrannt, mit grell auflodernden Flammen, und dieses Etwas hatte sich im plätschernden Wasser bewegt. Doeke war streng religiös erzogen worden, und in seiner Kindheit war der liebe Gott über das Wasser gelaufen, und dann hatte es auch die Geschichte vom brennenden Dornenbusch gegeben und vom Engel mit dem Flammenschwert. So merkwürdig war es deshalb auch nicht, dass Doeke zunächst an eine himmlische Offenbarung gedacht hatte und erst später an ein ganz normales Feuer. Feuer auf einem Schiff, nein, denn er schaute jetzt etwas genauer hin. Feuer auf einem Ruderboot?
Weshalb sollte ein Ruderboot brennen?
Jetzt wurde Doeke nüchtern und begann logisch zu denken. Es fiel ihm ein, dass er noch immer Hoofdagent war, auch jetzt, in der Frühe seines freien Morgens und in Zivilkleidung und leider ziemlich betrunken. Was sich da vor ihm abspielte, war nicht in Ordnung, und deshalb musste er anrufen. Wo war das nächste Telefon?
Am Hauptbahnhof. Doeke rannte in langen, federnden Sätzen. Von der Oosterdockskade aus konnte er das brennende Boot noch sehen. Doeke taumelte ein wenig, während er lief, aber bei seiner Körpergröße ließ die Wirkung des Alkohols allmählich nach. In der Telefonzelle am Bahnhof wählte er sechsmal die Zwei und berichtete, kurz und bündig, wie sich das gehört. Auch seinen Namen und Dienstrang nannte er. Der Kollege vom Dienst brauchte nur auf einen Knopf zu drücken, um die Wasserschutzpolizei zu informieren. Und auch da brauchte man nur auf einen Knopf zu drücken, um ein Polizeiboot zu benachrichtigen. Nach weniger als drei Minuten wurde Doeke in seiner Telefonzelle zurückgerufen.
«Ja?», meldete er sich.
«Verstanden», antwortete er gleich darauf. Und wieder rannte er los, noch immer leicht schwankend. Zehn Minuten später sprang er von der Brücke an der Ruyterkade in das flache graue Motorboot, das er beinahe verfehlte, denn er war immer noch nicht ganz nüchtern. Die Wachtmeester griffen dem Kollegen vom Festland hilfreich unter die Arme. Der Motor ihres Bootes brummte laut.
«Oosterdock», rief Doeke.
Über dem Boot huschten die Brücken hinweg. Die Wachtmeester blickten freundlich streng drein, froh, etwas zu tun zu haben, aber sie rechneten mit einem blinden Alarm. Feuer auf dem Wasser, gemeldet von einem besoffenen Festlandpolizisten? Ach ja, so geht’s nun mal.
«Wo genau hast du denn das Feuer gesehen, Kollege?»
Doekes Finger glitt unsicher über die Wasserkarte. «Na, hier wohl? Ich stand da an der Prins Hendrikkade, ungefähr dort. Es war ein Ruderboot, glaube ich, aus dem die Flammen schlugen, es qualmte auch – eine schwarze Rauchwolke.»
Eine halbe Stunde lang suchten sie vergebens. Doeke wurde wieder an Land gebracht, Am Singel, dort wohnte er in einer Mansarde. «Angenehmen Dienst, weiterhin», rief Doeke noch, und die Kollegen von der Wasserschutzpolizei wünschten ihm eine gute Nacht.
Was mochte es nur gewesen sein? Blitz? Zwar hatte es ein Gewitter gegeben, aber das war am frühen Nachmittag gewesen. Bei schwülwarmem Sommerwetter konnte es plötzlich Blitze geben. Die Wachtmeester glaubten es nicht. Sie hatten keinen Blitz gesehen, und sie waren doch die ganze Nacht auf dem Wasser gewesen. Ein paar Jugendliche etwa? Die spielen zuweilen gern mit Feuer. Eine treibende Kiste mit Papier? Oder doch nur Einbildung? Wer wenig schläft und ständig auf den Beinen ist, der kann schon mal Gespenster sehen. Doeke hatte in den letzten Tagen und Nächten eine ganze Menge Überstunden gemacht, und in seiner knappen Freizeit hatte er noch für das Brigadiersexamen gepaukt. Hinzu kamen der Alkohol und die Nachwehen einer aufgelösten Verlobung, der Besuch bei einer zwar hübschen, aber eiskalten Hure – entgegengesetzte Spannungen, die sich nicht in Entspannung auflösen konnten, was sieht man dann schließlich? Feuer auf dem Wasser?
Die Männer der Wasserschutzpolizei schrieben den ungeklärten Vorfall in ihren Bericht, und im Senderaum des Polizeifunks blieb eine Notiz auf dem Schreibtisch liegen. Die Nacht wechselte über in den Morgen.
Waling Wiarda war am nächsten Morgen schon früh auf den Beinen, nicht ohne Grund, denn Waling arbeitete. Als Chef des städtischen Gartenamtes gehörte das Spazierengehen zu seiner Arbeit, schließlich musste er ja alles, was da in der Stadt grünt und blüht, im Auge behalten. Während er so lief, deklamierte er halblaut ein Gedicht. Zwischen den Kaimauern des Oosterdocks sollten (o wilde, unverfälschte Pracht … der Blumen an der Wassergracht) Vogelbeerbäume wachsen. Der städtische Beamte Wiarda, gekleidet im khakifarbenen Cord des Gartenamtes, versuchte, sich an die restlichen Zeilen des Gedichtes zu erinnern, aber sie wollten ihm nicht einfallen, und deshalb dichtete er sich selbst einfach etwas über die Pracht der Blumen zusammen. Die Ingenieure des Wasserstraßenamtes hatten keinen Grund zum Meckern, meinte Wiarda. Die Vogelbeerbäume sollten nur ruhig weiterwachsen, auch wenn sie recht hoch wurden und ihre Wurzeln sich zwischen den Basaltblöcken des Kais breitmachten. Die Kaimauern wurden dadurch nicht geschwächt, aber selbst wenn, was ging es ihn an. Seine Aufgabe war es, in der Stadt für Grün zu sorgen. Mehr Grün in der Stadt, mehr Blumen (und jetzt begann er zu summen) und Tulpen aus Amsterdam. Durch Blumen bekamen die Amsterdamer bessere Laune. Und dafür zu sorgen, das war seine Aufgabe. Eine soziale Aufgabe. Er bückte sich, um einen großen Busch von goldgelbem Mauerpfeffer zu bewundern. Fettkraut mit saftigen Blättern. Herrlich, nicht wahr? O wilde, unverfälschte Pracht. Aber jetzt muss man sich doch nur wundern, was für ein Dreck da wieder auf dem Wasser treibt! Sollte er die Müllabfuhr anrufen? Stinkender Müll, Kunststoff, auch noch in so widerlichen Farben, aneinander festgebundener Abfall, ganze Kubikmeter von sich zersetzendem Unrat und, nicht einmal das Schlimmste, ein ausgebranntes Ruderboot. Ein ganzes Boot, vier Meter lang, das ständig mit seinem abgeblätterten Bug gegen die Basaltmauer schlug und dabei die blühenden Sträucher beschädigte. Wiarda kletterte vorsichtig nach unten und hielt sich dabei an den Ästen des Vogelbeerbaumes fest. Er mochte ein typischer Landbewohner sein, über den die Städter ihre Witzchen machten, aber daheim in Friesland gab es solche Ballungen von Schmutz und Unrat nicht. Und dank ihm, dem Landbewohner, der sich bereitgefunden hatte, für den verkommensten Teil des Landes zu arbeiten, war es hier jedenfalls eher auszuhalten, als es das ohne ihn wäre. Im Kampf gegen den Schmutz wollte er die Oberhand behalten. Heute noch würde er seinen soundsovielten Bericht schreiben, und den wollte er dem Chef des Stadtreinigungsamtes persönlich aushändigen.
«Reinigung», brummte Wiarda verächtlich, Gammelmoakers wäre der richtige Name für diese Leute. Sie machten Gammel, vielleicht entleerten sie sogar ihre Müllwagen abends heimlich in die Grachten.
«Teufel noch mal», stöhnte Wiarda. Waling Wiarda lebte in einer Vorstellungswelt christlicher Bilder. Wodurch hatte er nur so gesündigt, dass der Himmel ihn jetzt mit einem Anblick aus der Hölle strafte? Aber die Bestrafung war noch nicht zu Ende. Wiarda erschrak so sehr, dass er ausglitt und mit seinen glänzend geputzten Schuhen im Morast landete, der das Ruderboot umgab. Verzweifelt krallte er sich mit den Fingern an der Kaimauer fest und zog sich nach oben zur Prins Hendrikkade.
Ein Motorradpolizist fuhr vorbei und bremste, als er den wild gestikulierenden Wiarda sah. Nachdem er den Sturzhelm abgenommen hatte, hielt er die Hand hinter das Ohr. «Was sagen Sie?»
«Eine Leiche», flüsterte Wiarda heiser. «Verkohlt, da unten.»
Gemeinsam starrten die beiden Beamten, sich am Vogelbeerbaum festklammernd, auf das Boot.
«Ich werd’s gleich melden», sagte der Polizist entsetzt.
Die Wasserpolizei kam wieder, diesmal mit einem anderen Boot und mit anderer Besatzung, Kriminalpolizisten kamen in einem Zivilauto und Streifenwagen mit Uniformierten, um den Kai abzuriegeln, und ein langes schwarzes Auto mit gutgekleideten Herren, die zahllose Geräte heranschleppten, um das Geschehene auf Video zu bannen.
Und was sahen alle diese Leute? Die Überreste eines Menschen in einem ausgebrannten Aluminiumboot. Auch das Boot wurde von den Kriminalbeamten mitgenommen. Doeke Algra wurde abgeholt und schrieb seinen Bericht neben Waling Wiarda; Adjutant Grijpstra von der Mordkommission schaute den beiden Schreibenden zu, und sein Assistent, der Brigadier De Gier, sorgte für Kaffee.
«Braucht nicht unbedingt Mord zu sein», meinte der Adjutant. «Kann auch ein Unfall sein», ergänzte der Brigadier. «Ein Sportfischer? Offener Benzinkanister? Ein unbedacht weggeworfenes Streichholz?»
Doeke und Waling dachten beide. Die Sache war offensichtlich nicht ganz astrein. Doeke mit seinem gespenstisch treibenden Feuer, das sein Glücksgefühl in der vergangenen Nacht so abrupt beendet hatte, und Waling, den der verkohlte Schädel aus der schmierigen Brühe dieser verdammten Stadt heraus so grauenerregend angestarrt hatte.
«Bisschen unheimlich, wie?», fragte Grijpstra. «Merkwürdig, dass ihr beide Friesen seid. Ich bin’s übrigens auch, meine Eltern stammen aus Harlingen.»
«Jetzt kriegen wir friesische Dorfgeschichten», sagte Brigadier De Gier. «Ich würde ja gerne mitreden, aber ich komme nun mal aus Rotterdam.»
Weshalb er seine Heimatstadt erwähnte, wusste De Gier selbst nicht, vielleicht wollte er sich gegen die plötzliche Übermacht von Friesen zur Wehr setzen? Ein instinktiver Widerstand?
Doeke Algra, Waling Wiarda und Henk Grijpstra blickten Rinus de Gier einmütig an.
«It Heitelân», sagte Wiarda feierlich. Doeke senkte den Kopf. Grijpstra lächelte gerührt. Hoofdagent Algra und der Chef des Gartenamtes, Wiarda, durften das nüchterne Polizeirevier verlassen.
«Mord, wie?», fragte Grijpstra.
De Gier glaubte das auch, aber es erschien ihm verfrüht, etwas dazu zu sagen.
«Du hast ihn nicht verstanden?», fragte De Gier.
Grijpstra wollte es nicht zugeben.
«Bei uns daheim», erklärte De Gier. «Friesen hängen nun mal mehr an ihrer Heimat als wir holländischen Städter. Du solltest das doch wissen, schließlich stammst du doch auch daher.»
«Klugscheißer», antwortete Grijpstra schulterzuckend.
«Wir müssen zum Leichenschauhaus», sagte De Gier, streckte seinen schlanken, muskulösen Körper, fuhr sich mit der Hand durch die braunen Locken und rieb seinen Schnauzbart nach oben. Der Brigadier war knapp vierzig, der Adjutant gut fünfzig. Grijpstra kratzte seinen grauen Bürstenschnitt, zupfte Weste und Jacke zurecht und wischte die Asche von seinen ausgebeulten Hosen ab. «Lass es bitte nicht Mord sein», ließ Grijpstra ein Stoßgebet hören. Es sollte nicht erhört werden, das war ihm klar; schließlich war er ja lange genug bei der Polizei.
Gemeinsam stiegen sie in den alten Volkswagen.
«Weißt du, was mir jetzt so gut gefällt?», fragte De Gier. «Dass wir einstweilen nichts zu tun brauchen. Wir brauchen bloß zu warten. Warten kann ich gut. Gehst du gleich mit Kaffee trinken?»
Grijpstra nickte. «Irgendwo werden sie jemanden vermissen.»
«Der Schädel hatte noch Zähne», brummte De Gier. «Zähne lassen sich leicht identifizieren. Schick einen Gebissabdruck zum Zahnarzt des Vermissten, und schon weißt du, wer wer ist.»
«Und dann schnappen wir uns den anderen», sagte der Adjutant.
«Den, der’s getan hat», nickte der Brigadier.
Aber so einfach war’s nicht.
Zwei
«Immer diese übertriebene Hast», schimpfte der Pathologe, der wie ein Vogel aussah, aber nicht wie ein sympathischer Vogel. Ein Leichenpicker, dachte De Gier, eine neurotische Krähe, halb lahm, schräg hüpfend. Der Pathologe bewegte sich tatsächlich schräg und konnte seinen schmalen Kopf nicht gerade halten, man hörte die Halswirbel knacken, während die Augen irgendwie drohend lauerten.
«Was wollt ihr denn noch?», fragte der Pathologe unwirsch und sah auf die Armbanduhr. «Ich habe Feierabend. Also, was gibt’s noch?»
«Wie weit sind Sie mit dem Fall von dem Mann, der im Boot verbrannt ist?», erkundigte sich Grijpstra gelassen.
«Ach, das Häufchen Elend», meinte der Pathologe. «Das Zeugs liegt hier irgendwo rum.» Seine Klauen zogen ein paar Plastiktücher zur Seite. «Versengte Knochen und halbverbrannter Schädel. Ein Mann. Weit in den Fünfzigern. Ein Meter siebzig, wenn er aufrecht stünde, aber er ging offenbar in gebückter Haltung. Straßenarbeiter? Bauer vielleicht? Hat wohl anscheinend ständig einen Schubkarren geschoben. Konnte ich an den Resten von der Wirbelsäule erkennen. Ich kann hier bloß raten, meine Herren, ihr müsst mir schon etwas besseres Material liefern.»
«Kleider?», fragte De Gier. «Schuhe?»
Der Pathologenhals knackte laut. «Andere Abteilung. Ich hab nur mit dem bloßen Körper zu tun. Alles andere wird ins Labor weitergeleitet.»
«Zähne?», beharrte Grijpstra.
«Zähne gehören zum Körper. Liegen dort. Im Plastikbeutel.»
Grijpstra runzelte die Stirn. «Ist das Gold?»
«Eine Menge Gold», antwortete der Pathologe, «und Brücken, aber ich bin kein Zahnarzt. Ihr habt ja kein Geld mehr für einen Zahnarzt, überall wird nur noch gespart.»
«Ein armer Bauer, der sein Leben lang Schubkarren schob, mit so viel Gold im Mund? Ein Vermögen in Zahnbrücken investiert?»
«Hören Sie, Adjutant», brummte der Pathologe verärgert, «ich arbeite hier nur als Arzt. Die Lösung des Falles ist Ihre Aufgabe.»
De Gier schauderte. Die Überbleibsel des Schädels blickten ihn an, denn die Augenhöhlen waren noch erhalten, und sie starrten rußgeschwärzt zu ihm hoch. Wie ist es nur möglich, dachte der Brigadier, dass etwas, was es nicht mehr gibt, mich so flehend ansehen kann?
«Wird Ihnen etwa übel?», höhnte der Pathologe.
De Gier bedeckte seinen Mund mit einer zitternden Hand. «Daran kann ich mich einfach nicht gewöhnen, nie und nimmer. Es gibt ihn nicht mehr, aber er ist hier und beschäftigt sich mit uns, die wir uns mit ihm beschäftigen. Was ist ein Schädel? Der Kopf des Todes? Ist der Tod also lebendig?»
«Verzeihung», schnauzte der Leichenbeschauer hämisch. «Beschäftigen wir uns hier etwa mit Philosophie? Hier zählen doch nur Tatsachen; eine durch körperliche Schwerarbeit verkrümmte Wirbelsäule, teure Kunstzähne auf verkohlten Wurzeln. Ich liefere Ihnen die logischen Folgerungen, die auf empirisch gewonnenen Erkenntnissen beruhen. Ein toter Schwerarbeiter von etwa sechzig Jahren mit einem Mund voller Goldzähne. Mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Aber das ist auf dem Boden der Tatsachen gewachsen, nicht auf dem der Philosophie.»
«Herr Doktor», lenkte Grijpstra ein, «unsere Aufgabe ist im Grunde die gleiche. Sagen Sie mir bitte, wurde dieser Mann ermordet?»
«Sehen Sie sich das an», die Vogelklaue hob ein Röntgenbild hoch, «hübsches Foto, nicht wahr?»
Im Grau der Aufnahme zeichneten sich Flächen und Punkte ab.
«Was sehe ich denn da?», fragte Grijpstra stirnrunzelnd.
«Die Rückseite des Schädels», antwortete der Pathologe herablassend. «Soweit vorhanden, bis hierhin verbrannt, aber dort, sehen Sie, da ist ein kleines rundes Loch entstanden, hier, direkt am Rand.»
«Kugel?», fragte De Gier. «Kann ich die Aufnahme haben?»
«Dann nehme ich die Zähne mit», sagte Grijpstra. «Danke schön, Doktor.»
«Ja», sagte ein Laborant eine Stunde später, «das Loch könnte von einer Kugel stammen. Durch den Hinterkopf eingetreten und zur Augenhöhle wieder heraus. Aber das ist noch Spekulation. Wir helfen euch gerne weiter, wenn ihr uns etwas gebt, mit dem auch etwas anzufangen ist.»
«Kleinkaliber», sagte der Ballistikexperte, «aber was bedeutet das schon? Heutzutage gibt es doch schon vollautomatische Militärgewehre mit kleinem Kaliber. Aber der Mann wurde jedenfalls erschossen, das dürfte wohl feststehen.»
«Kleider? Schuhe?»
«Die hatte er an», meinte der Laborant. «Keinesfalls ist er nackt gestorben. Diese Asche, hier in dem Becher, war einmal Stoff, und die Asche im Becher daneben war zweifellos einmal Leder. Aber was für Stoff und was für Leder? Ich habe keine Ahnung, und das ist auch nicht mehr herauszubekommen.»
«Und was ist das in diesem Becher?», fragte De Gier.
«Ein Orl», antwortete der Laborant. «Sie können doch wohl lesen? Hier steht noch ganz deutlich ‹orl›.»
«Beim Judo», brummte De Gier stirnrunzelnd, «lernt man Selbstbeherrschung, aber man lernt auch noch mehr. Zum Beispiel, wie man einen albernen Laboranten aufs Kreuz legen kann. Ich bin recht gut im Judo.»
Der Laborant grinste unterwürfig. «Überreste eines Kugelschreibers, Brigadier, billiger Stift mit einer Reklameaufschrift. Die Buchstaben sind verbrannt, bis auf ‹orl›.»
De Gier nahm den Behälter mit.
«Und jetzt?», fragte Grijpstra in der Kantine. Er beantwortete seine Frage selbst. «Und jetzt gar nichts. Du hast recht. Wir warten.» Bedächtig rührte er seinen Kaffee um. Dann deutete er über De Giers Schulter. «Sieh mal, da geht Sjaan.»
De Gier wandte sich um, dann schüttelte er den Kopf. «Sjaan war das nicht, aber du frisst meinen Kuchen.»
«Ich bin doch ein raffiniertes Kerlchen», grinste Grijpstra. «Wie kommt es nur, dass ich dich immer wieder reinlegen kann? Und dabei habe ich dich doch selber ausgebildet. Die simpelste Sache der Welt. Sjaan ist schön, und du stehst auf schöne Weiber. Ich brauche nur ‹Sjaan› zu sagen, dann vergisst du alles andere.»
«Du hättest auch sagen können, dass du Kuchen willst, dann hätte ich dir welchen mitgebracht.»
«Dich reinzulegen macht mir mehr Spaß», meinte Grijpstra grinsend.
De Gier ging Kuchen holen.
«Obwohl’s ja eigentlich egal ist», sagte Grijpstra, als De Gier zurückkam, «aber was willst du machen? Die Zähne oder den Orl?»
«Ist mir egal», antwortete De Gier.
Grijpstra warf einen Gulden in die Luft, fing ihn auf und knallte ihn mit der flachen Hand auf den Puls. «Die Königin ist Orl.»
Die Seite mit dem Bild der Königin lag oben. «Du machst Orl.»
«Kleine Fische», sagte De Gier. «Geh schon los, ich bin gleich fertig. Wenn du so weit bist, kommst du zum Commissaris, da warte ich auf dich, und dann wissen wir wohl mehr.»
«Herein», rief der Commissaris. Bis jetzt hatte er in dieser Sache noch keine brauchbare Idee. Er saß, tadellos gekleidet, aber sonst unscheinbar, auf seinem mit Löwenköpfen verzierten Stuhl hinter einem auf Löwenpfoten stehenden Schreibtisch. Die geöffnete Tür verursachte Zugluft, und diese bewegte die Blätter der Zimmerpflanzen. Mit seinen zarten Händen, deren Haut sich durchsichtig über die feinen Knöchel spannte, schlug der Commissaris auf Papier, das gerade aufflattern wollte. Erschreckt blickte er auf. «Tür zu, verdammt noch mal. Guten Tag, Adjutant, Tag, Brigadier. Setzen Sie sich.»
Also doch, vielleicht hatte der Commissaris doch eine brauchbare Idee? In den Berichten wurden nur friesische Namen genannt. Algra und Wiarda. Der Commissaris hielt sich selbst für einen Friesen, schließlich war er doch in Joure geboren.
«Die Friesensache», sagte der Commissaris bedächtig. «Also. Haben Sie schon etwas herausgefunden?»
Adjutant und Brigadier legten ihre Mitbringsel auf den Schreibtisch. «Zähne», sagte Grijpstra. «Orl», sagte De Gier.
«Also, mal in der Reihenfolge des Dienstranges», meinte der Commissaris. «Was gibt’s, Adjutant Grijpstra?»
«Zähne von der Leiche», begann Grijpstra, «von einem Experten begutachtet. Mein Zahnarzt sagt, dass dies die Überreste eines vollständigen Kunstgebisses seien. Sehr gut gemacht, vor allem aber auch sehr teuer. Eine technisch wohl durchdachte Arbeit, die an hier und da noch nicht verfaulten Wurzeln befestigt wurde. Mein Zahnarzt meint, dass dieses Gebiss gut und gerne dreißigtausend gekostet haben dürfte. Nach Ansicht des Pathologen hat der Tote zeit seines Lebens schwer gearbeitet, er war möglicherweise Bauer oder Straßenarbeiter. Das sind doch recht widersprüchliche Fakten. Vielleicht sollten wir das besonders beachten?»
Draußen fuhren zwei Straßenbahnen mit lautem Quietschen und Klingeln vorüber. Grijpstra sprach noch, so sah es wenigstens aus, denn sein Mund bewegte sich.
«Wie?», fragte der Commissaris.
«Ein Bauer oder Straßenarbeiter mit Zähnen für dreißigtausend.»
«Wer?», fragte der Commissaris.
«Das wissen wir doch noch nicht.»
«Ich meinte den Zahnarzt», sagte der Commissaris. «Den, der Millionärsgebisse macht. So viele können das doch nicht sein.»
Grijpstras stumpfer Zeigefinger blätterte in einem zerfledderten Notizbuch. «Hier gibt es nur einen einzigen, aber sein Anrufbeantworter sagt, dass er heute fort ist. Morgen ist er wieder zu sprechen.»
«Dann zeigen Sie ihm diese Zähne, und dann wissen wir wohl auch, wer die Leiche ist. So viel Zeit haben wir wohl noch. Gute Arbeit, Adjutant. Hat der Brigadier auch noch etwas herausgefunden?»
De Gier nickte bescheiden.
«Also, De Gier?»
«Orl», sagte de Gier, «sind drei Buchstaben aus dem Wort ‹Horlogemaker›, also Uhrmacher, und da es sich um die Überreste eines im verbrannten Boot gefundenen Kugelschreibers handelte, habe ich die Uhrmacher in der Gegend aufgesucht. Beim fünften hatte ich schon Glück. Er hat sein Geschäft in der Haarlemerstraat und gibt allen Kunden so einen Kugelschreiber als Reklame, das heißt natürlich nicht allen, sondern nur denen, die eine sehr teure Uhr kaufen, und das sind zum Glück nicht so viele.»
«Sag bloß, du wüsstest schon etwas», spottete Grijpstra.
«Du wirst dich wundern», antwortete De Gier. «Der Goldschmied, bei dem ich gerade war, denn er ist Uhrmacher und Goldschmied zugleich, hat ein Notizbuch mit den Namen seiner besseren Kundschaft, und darin konnte ich den Namen Douwe Scherjoen lesen, und das ist ein friesischer Name.»
«Ach was», meinte Grijpstra wegwerfend, «du solltest nicht gleich anfangen zu phantasieren. Einstweilen wissen wir noch gar nichts, aber morgen, wenn dieser teure Zahnarzt wieder zu erreichen ist …»
«Dann heißt der Patient möglicherweise auch Scherjoen. Meinst du nicht?», fragte De Gier. «Möglich wär’s doch.»
«Und weiter?», drängte der Commissaris mit leiser Stimme. Er stützte sich auf seine zartgliedrige Faust, und seine blassblauen Augen schauten freundlich, aber wachsam durch die randlose Brille. «Was war weiter?»
«Und dann», fuhr De Gier fort, «hörte ich von meinem Uhrmacher, dass Herr Scherjoen bei ihm eine Armbanduhr für sechzehnhundert Gulden gekauft hatte, vorige Woche, und dass das Uhrwerk in dieser Woche schon kaputt war und dass ebenderselbe Scherjoen darüber sehr wütend war und seine Uhr unverzüglich auf Garantie repariert bekommen wollte und dass er sie heute früh holen wollte und dass er nicht aufgetaucht ist.»
Grijpstras Blick verdüsterte sich.
«Und dann», sagte De Gier hastig, «wurde mir dieser Scherjoen beschrieben als ein etwa sechzigjähriger, recht derbe wirkender Mann mit ungebildeter Ausdrucksweise, er sprach eine Art Kauderwelsch. Der Uhrmacher meinte, es sei Stadtfriesisch, ein niederländischer Dialekt, den man in Leeuwarden spricht. Und», fügte De Gier nach einer kleinen Pause hinzu, «dieser Douwe Scherjoen hat, so sagt der Goldschmied, einen krummen Gang, als ob er immer einen Karren schiebe, und zu alledem mache er einen recht wohlhabenden Eindruck, denn er trug einen teuren Maßanzug, und das passt schließlich auch zur Armbanduhr für sechzehnhundert Gulden, denn das ist ja immerhin ein ganz schöner Batzen Geld für ein Chronometer.»
«Verreck!», fluchte Grijpstra.
«Ich fürchte, dass er das inzwischen bereits gemacht hat», sagte De Gier, «ja mehr noch, ich vermute mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit, dass Scherjoen gestern Nacht verbrannt ist, und zwar in einem Aluminiumboot, das im Oosterdock trieb, von Hoofdagent Algra gesehen und von Herrn Wiarda heute früh entdeckt wurde.»
«Ein Friese», brummte der Commissaris. «Und wo wohnt dieser Mijnheer Scherjoen, oder wohnte, aber vielleicht wohnt seine Frau ja noch da?»
«Dingjum», antwortete De Gier. «Was für ein Name. Dingjum! Das sagte der Goldschmied. Ich hab gleich angerufen. Mevrouw Scherjoen sagte, ihr Mann sei auf Geschäftsreise, und sie wisse nicht, wann er heimkomme.»
«Sie haben’s dabei belassen?»
«Ja, Mijnheer.»
«Nicht gesagt, dass Sie von der Polizei sind?»
«Nein, ich habe nur meinen Namen genannt. Ich würde mich später noch einmal melden.»
«Eine alte Frau?»
«Eher mittelalterliche Stimme. Ehe sie den Hörer auflegte, sagte sie tschüs.»
«Arme Frau», seufzte der Commissaris.
«Braucht ja nicht unbedingt so zu sein», protestierte Grijpstra. «Was wissen wir denn bis jetzt? Das alles können doch auch einfach zusammengefummelte Zufälle sein?»
Der Commissaris streichelte sein Bäuchlein. «Es sei denn, dass Ihr teurer Gebissklempner morgen bestätigt, dass die in Ihren Händen befindlichen Zähne einmal von seinen Händen geschaffen wurden.»
Das bestätigte der Zahnarzt am nächsten Morgen.
«Meine Arbeit, tatsächlich. Das Beste vom Teuersten. Ohne Zweifel, eine so hervorragende Arbeit kann nur von mir stammen.»
«Wie teuer war’s?»
«Sehr teuer.»
«Und wem gehören diese Zähne?»
«Einem meiner Patienten.»
«Scherjoen etwa?», flüsterte Grijpstra.
Der Zahnarzt entnahm seinem vergoldeten Karteikasten eine Karte. «Douwe Scherjoen? Siebenunddreißig Mille.»
«Wie sah dieser Herr Scherjoen aus?»
«Klein», antwortete der Zahnarzt. «Das heißt, er wirkte klein, denn er ging gebückt. Trotzdem recht energisch. Ein richtiger Schachtelteufel. Kam hier hereingesprungen und wieder fort, zweimal die Woche, Monat für Monat. Merkwürdiger Typ mit einem primitiven Gesicht. Ich traute ihm nicht und ließ ihn im Voraus bezahlen.»
«Bar?»
«In Tausendern, aus einer altmodischen Geldbörse, an einer Kupferkette unter seiner Weste befestigt. Wurde er ermordet?»
«So ist es.»
«So leben diese Kerle», brummte der Zahnarzt kopfschüttelnd. «Und dafür arbeite ich nun. Man bringt so einen Mund wieder in Ordnung, viel schöner als er je war, aber die Kerle nehmen sich einfach nicht in Acht. Ist mir schon öfters passiert.»
«Wollen Sie sich meinen Mund mal ansehen?», sagte Grijpstra.
Der Zahnarzt sah ihn sich an. «Sie können den Mund wieder schließen.»
«Ist das zu machen?», fragte Grijpstra.
«Nein.»
«Sie sind doch ein so guter Zahnarzt?» Grijpstra wunderte sich. «Warum lachen Sie?»
«Bei Ihrem Gehalt?», der Zahnarzt grinste. «Sonst noch irgendwelche Fragen? Dann können Sie wohl gehen? Ich bin sehr beschäftigt.»
Drei
«Aber, meine Liebe», sagte der Commissaris und schüttelte sich. «Liebling?»
Das Telefon schwieg.
«Bist du noch dran?»
«Ja, ich bin noch dran», antwortete seine Frau, «und Endivien habe ich auch besorgt. Du wolltest doch heute Abend Endiviensalat essen. Weißt du noch? Weißt du auch, was Endivien im Augenblick kosten?»
«Morgen», sagte der Commissaris.
«Nein, heute. Endivien schmecken am nächsten Tag zu bitter.»
Der Blick des Commissaris wanderte hilfesuchend von der Spitze seiner aufglühenden Zigarette zu den Begonien auf der Fensterbank, dann auf die ermutigend grinsenden Löwenköpfe an seinem Stuhl. Er stand neben dem Schreibtisch und versuchte, mit einem flotten Sprung auf die Schreibfläche zu hüpfen, aber er sprang nicht hoch genug und stieß seine Hüfte an. «Au.»
«Hast du dich verletzt?»
«Wenn ich daran denke, dass ich einmal ein recht guter Turner war», sagte der Commissaris. «Ich habe die Riesenfelge am Reck immer mit einem fehlerfreien Abgang gemacht. Hättest mal hören sollen, wie das Publikum klatschte. Au!» Er atmete tief durch.
«Tut’s weh?»
«Nein», sagte der Commissaris, «aber ich muss nach Friesland, wirklich. Hier ist ein Friese ermordet worden, und der Fall muss möglichst schnell geklärt werden.»
«Du kommst zum Essen nach Hause. Schick den Grijpstra.»
«Der hat etwas anderes zu tun.»
«Dann De Gier.»
«Hat auch eine andere Aufgabe.»
«Also jedenfalls schickst du jemanden», sagte die Frau des Commissaris, «ich lege jetzt auf. Um sieben Uhr bist du hier. Ich arbeite doch nicht für nichts und wieder nichts den ganzen Tag lang in der Küche!» Das Telefon knackte. Der Commissaris seufzte. Mit spitzem Finger wählte er eine zweistellige Nummer. «Hallo?»
«Mijnheer?»
«Lassen Sie Grijpstra ausrufen, er soll mich zurückrufen.» Der Commissaris wartete. Das Telefon blieb ruhig. «Hallo?»
«Mijnheer?»
«Haben Sie mich verstanden?»
«Sie wollten doch gewiss noch etwas sagen?»
«Ich habe alles gesagt.»
«Nein», sagte die leise Frauenstimme, «Sie haben noch nicht ‹bitte› gesagt, und darauf hatte ich noch gewartet. Das ist heutzutage so üblich.»
«Was ist denn mit Ihnen los?», fragte der Commissaris. «Sind Sie Kommunistin oder Feministin? Ich habe etwas angeordnet, und dazu brauche ich nicht zu bitten.»
«Ich bin nun mal eine Frau.»
«Also bitte», seufzte der Commissaris, «meine Liebe.»
«Danke schön», hauchte die Sekretärin. «Ich finde es nett, wenn auch Vorgesetzte ein bisschen charmant sind.»
«Ah ja? Ich werd mir Mühe geben.»
«Jedenfalls können Sie nett sein, das höre ich doch», sagte die leise Stimme. Das Telefon knackte.
Der Commissaris begoss seine Begonien, während er leise vor sich hin murmelte. Eigentlich hatte sie ja recht. Man hat die Frauen seit Menschengedenken missbraucht, geplagt, unterdrückt, unterbezahlt und ausgebeutet. Einmal musste damit Schluss sein, aber wieso gerade heute? Heute wollte er nach Friesland. Er schaute zum Fenster hinaus. Ein strahlender Tag. Und heute hatte er sein neues Auto nur betrachten können, ein silberfarbenes Auto, das auf dem Innenhof stand und vor sich hin glänzte. Wenn er mit diesem Auto endlich mal eine lange Strecke fahren könnte, das müsste ein reines Vergnügen sein.
Das Telefon klingelte.
«Grijpstra», meldete der Anrufer sich. «Die Zähne stammen von Douwe Scherjoen aus Dingjum, und dieser feine Mijnheer ist auch unsere Leiche.»
«Wo sind Sie jetzt?»
«In einer Wirtschaft, Mijnheer.»
«Und De Gier?»
«Den habe ich hier gerade getroffen.»
«Nach Dinges», sagte der Commissaris, «da wird wohl auch die Rijkspolitie sein. Setzen Sie sich mit der in Verbindung, aber es ist und bleibt unser Fall. Die Kollegen dürfen trotzdem ein bisschen helfen. Wissen Sie, wo Dinges liegt?»
«Noch nicht, Mijnheer.»
«Die Sache bedingt einige Eile», sagte der Commissaris. «De Gier kann mitfahren. Alles klar?»
Das Telefon schwieg.
«Bitte?»
«Unser Auto ist hinüber.»
«Wieso hinüber? Kaputt? Unfall?»
«Die Kupplung», sagte Grijpstra, «die rutscht, und den zweiten Gang, den gibt’s überhaupt nicht mehr, und der Auspuff, der ist lose, der rumpelt. Und sonst klappert es auch an allen Ecken und Enden.»
Der Commissaris seufzte.
«Mijnheer?»
«Auf dem Innenhof», sagte der Commissaris, «steht ein neuer Citroën. Nagelneu, Adjutant. Aber Sie lassen De Gier nicht ans Steuer, ist das klar? Also, in Gottes Namen dann.»
«Ihren neuen Wagen?»
«Den Schlüssel gibt Ihnen der Portier», sagte der Commissaris. Seine Stimme klang ein wenig schrill. «Ich werde ihm Bescheid sagen. Also, machen Sie’s gut, Adjutant. Ich werde Sie von hier aus nach bester Möglichkeit unterstützen.»
«Was hat er nur?», fragte De Gier.
«Rheumatismus im Bein.»
«Sagte er das?»
«Ich konnt’s hören.»
«Wenn er sich nur nicht vorzeitig pensionieren lässt», brummte De Gier. «Wir müssen ihn schonen.»
«Die Sache eilt», sagte Grijpstra, «und der Volkswagen muss auch noch zurückgebracht werden. Bis zur Elandsgracht wird er’s wohl noch schaffen. Ob die ihn noch einmal zusammenflicken können?»
«Wieso?» De Gier zuckte die Schultern. «Kleinigkeiten.»
«Der Werkstattleiter will ihn längst verschrotten.»
«Kommt nicht in Frage», protestierte De Gier. «Ich werde Sjaan mal auf ihn ansetzen.»
«Sjaan spricht nicht mehr mit dir.»
«Nicht mal, wenn sie mir einen kollegialen Dienst erweisen soll?», meinte De Gier.
«Du forderst zu viel», antwortete Grijpstra, «und du bietest zu wenig. Du musst mit so einem Mädchen zuerst mal ausgehen und sie erst danach in deine Wohnung mitnehmen. Nicht umgekehrt, und vor allem darfst du sie nicht auch noch fürs Essen zahlen lassen.»
«Hat das Miststück sich etwa bei dir beschwert?»
«Miststück?» Grijpstras Stimme klang verärgert. «Das meinst du doch wohl nicht im Ernst?»
«Miststück», sagte De Gier, «und dabei hat sie mir am laufenden Band Körbe gegeben. Sie wollte nicht mitkommen in meine Wohnung, sie wollte nicht essen, und sie wollte auch nicht zahlen. Übrigens war das in der Mittagspause. Da geht man nicht zuerst noch lange essen. Es regnete auch. Meine Wohnung ist trocken, und schließlich war’s kurz vor Monatsende, sodass ich keinen Cent mehr hatte.»
De Gier durfte den Kaffee bezahlen. Grijpstra ging schon vor und wartete am Volkswagen. Mit unbewegtem Gesicht stieg De Gier ein. «Also hör mal», sagte Grijpstra durch das Wagenfenster, «wenn du dieses Auto behalten willst, dann musst du nett zu Sjaan sein. Und zwar ganz schnell, nämlich ehe wir nach Dingjum fahren.»
«Ich weiß nicht mal, wo dieses Nest ist.»
«Kein Mensch weiß, wo das ist, aber ich komme schon dahinter, während du Sjaan abfängst und sie zum Werkstattleiter bringst, und zwar mit dem Wagen hier. Ist das klar?»
«Leck mich am Arsch», fluchte De Gier.
«Wie bitte?»
«Wenn du mir so kommst …»
«Genau, so komm ich dir», sagte Grijpstra gelassen. «Und du hast gefälligst zu tun, was dir befohlen wird. Verstanden? Also bitte.»
«Das ist doch einfach ein Traumwagen», sagte De Gier. «Wie schnell fährt dieser Citroën?»
Grijpstra blickte auf den Tacho. «Hundert.»
«Schafft er auch zweihundert?»
«Laut Tacho schon. Sogar noch mehr. Das ist nun mal ein schneller Wagen.»
«Glaub ich nicht», widersprach De Gier.
«Und jetzt?», konterte Grijpstra und trat aufs Gaspedal.
De Gier lehnte sich nach links herüber. «Ist der Zeiger auch in Ordnung? Ich kann den Motor kaum hören. Gib mal ’n bisschen mehr Gas.»
«Gut so?», fragte Grijpstra. «Zweimal die polizeilich zugelassene Höchstgeschwindigkeit.»
«Der Commissaris sagte, dass die Sache höchste Eile erfordert», sagte De Gier. «Die Schädelaugen von diesem Scherjoen sehen mich noch immer an. Fahr so schnell du kannst, dann sind wir früher da. Wir wissen noch immer nichts. Erst wenn wir etwas wissen, können wir etwas unternehmen. Der Mörder läuft schließlich noch immer frei herum.»
«Warum nur in Amsterdam?», fragte Grijpstra kopfschüttelnd. «Dass diese Leiche da eine Armbanduhr kauft, na schön, das kann ich verstehen, auch dass sie ihr Gebiss restaurieren lässt, aber weshalb hat sie sich ausgerechnet bei uns umbringen lassen? Friesen sind starke, reine Leute aus einem freien, sauberen Land. Wie kommt die Leiche nur in unseren Amsterdamer Stadtdreck, was mag dahinterstecken?»
«Du bist doch selber Friese?»
«Das schon», antwortete Grijpstra.
«Du bist aber weder stark noch rein noch frei noch sauber.»
«Weil ich in Amsterdam aufgewachsen bin», sagte Grijpstra, «nur mein Kern taugt noch etwas, aber dieser Scherjoen blieb von alledem verschont. Trotzdem wurde er erschossen und überdies noch verbrannt.»
«Ich möchte nicht mit seiner Witwe reden», sagte De Gier. «So etwas ist mir zuwider. Mach du das lieber.»
«Ich mache alles», brummte Grijpstra. «Du darfst nichts. Du darfst nicht mal an das Lenkrad dieses Wagens kommen.»
«Hörst du etwas?», fragte De Gier.
Eine Sirene heulte auf. Das Geheul wurde zunehmend schneidender.
«Tolles Motorrad», sagte De Gier, während er über die Schulter blickte. «Sieh dir diese Maschine mal an. Eine Guzzi. Ich fuhr früher eine BMW, die war nicht so schnell.»
Grijpstra bremste und winkte. Das Motorrad fuhr an die Straßenseite, und der Polizist kam gewichtig auf sie zu, während er aus der Seitentasche seiner weißen Jacke ein Notizbuch herauszog.
Grijpstra kurbelte das Wagenfenster herunter.
«Wollen Sie bitte aussteigen?», forderte der Polizist auf. «Auf der anderen Seite. Die Straße ist hier zu schmal. Wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie gefahren sind?»
De Gier war schon ausgestiegen. Grijpstra rutschte über die Sitze und stellte sich ebenfalls neben den Wagen. Sie waren beide größer als der Polizist, der recht zart wirkte, rote Lippen und Lidschatten auf den Augen hatte.
«Sie sind also eine Kollegin?», sagte Grijpstra mit einer leichten Verbeugung.
Die Polizistin blickte auf den vorgezeigten Führerschein.
«Adjutant?», fragte die Polizistin und reichte Grijpstra die Hand. «Ich bin Wachtmeester Hilarius. Weshalb fahren Sie so schnell?»
Grijpstras Blick überflog das Ijsselmeer, auf dem Schwäne schaukelten, weiße Federbälle mit zierlich schwingenden Hälsen. Hinter den Schwänen schaukelte ein Fischerboot mit in gelben Jacken gehüllten Männern, die sich über die Reling beugten und eine Reuse heraufzogen. «Was für eine herrliche Ruhe ist das hier», sagte Grijpstra.
«Aber wir sind dienstlich unterwegs», warf De Gier ein. «Nach Dingjum müssen wir. Kapitalverbrechen, Mord. Die Sache eilt.»
«Bei uns?», fragte die Polizistin und nahm ihren Sturzhelm ab, aus dem blonde, sanft geschwungene Locken hervorkamen. Der Helm hatte eine grellorange Farbe. Grijpstra war von dem Farbenspiel gefesselt, das sich seinen Augen bot. Das Gelb der Fischerjacken und das zarte Weiß der Schwäne, das Orange des Helmes und die zartgoldene Tönung des Frauenhaares, waren das nicht Kontraste, die einander wunderbar ergänzten? Die raue Stimme der Polizistin gehörte auch dazu. Solche Gefühlserlebnisse inspirierten Grijpstra, aber war dies alles nicht etwas zu hoch gegriffen für ihn? Konnte er diese abstrakten, einander ergänzenden Impressionen überhaupt in seiner Sonntagsmalerei wiedergeben? Wie malt man den Klang einer Stimme?
«Der Mord wurde bei uns in Amsterdam verübt, aber das Opfer wohnte hier bei euch. Wir verfolgen die Spur, und die führt hierher. Wir müssen mit seiner Frau sprechen.»
Die Polizistin Hilarius hatte in der Zeitung über das brennende Ruderboot gelesen. Auf derselben Seite, auf der auch der Bericht über die Maul- und Klauenseuche gestanden hatte.
«Die Deichstraße ist völlig blockiert, ein Stück weiter, von hier aus noch nicht zu sehen. Die Seuche ist in Wieringermeer, und wir versuchen, ein Einschleppen nach Friesland zu verhindern. Sämtliche Last- und Lieferwagen werden von den Kollegen auf Viehtransporte hin überprüft. Der Verkehr stockt.»
«Wir haben’s aber eilig», sagte De Gier. «Können Sie uns nicht durchschleusen?»
Aus einer Wolke senkte sich ein schwarzer Punkt herab. Vom Motorrad her dröhnte das Funkgerät. «Streife siebzehn? Bitte melden.»
Die Polizistin angelte in ihrer Maschine nach einem Mikrophon. «Siebzehn. Was gibt’s?»
«Was machen Sie denn da so lange?», fragte der Hubschrauber. «Verpassen Sie dem Citroën einen Strafzettel, und fahren Sie anschließend an die Spitze des Verkehrsstaues. Sonst geht’s da überhaupt nicht mehr weiter. Verstanden?»
«Wir haben’s eilig», sagte De Gier flehend und zeigte seine kräftigen weißen Zähne in einem geschulten Grinsen. «Wir haben Anweisung von unserem Commissaris. Nur wenn wir ganz schnell sind, kann der Fall gelöst werden.»
«Ja, der Commissaris», sagte Grijpstra. «In den Polizeimitteilungen wurde er gerade interviewt. Vielleicht haben Sie’s gelesen? Das ist nun unser Commissaris.»
Die Polizistin sprach eindringlich in ihr Mikrophon.
«Verstanden», antwortete jemand aus dem Hubschrauber. «Parken Sie den Citroën meinethalben auf dem Fahrradweg, so kann er nämlich nicht stehen bleiben. Ende.»
Die Polizistin stoppte den Verkehr, und De Gier fuhr den Citroën über vier Fahrbahnen, um ihn auf der anderen Seite laut Anweisung zu parken. Der Hubschrauber wurde größer. Grijpstra und De Gier rannten auf das landende blau-weiße Ei zu. Eine Tür wurde aufgeklappt, und ein in Leder gehüllter Arm forderte gebieterisch zum Einsteigen auf.
«Ich habe Höhenangst», sagte Grijpstra, «und so furchtbar eilig haben wir’s andererseits auch wieder nicht», aber der Arm zog, und De Gier und die Polizistin stemmten das Adjutantengesäß nach oben. De Gier bedankte sich bei der netten Kollegin, die mit ihrer rauen Stimme antwortete, dass es ihr ein Vergnügen gewesen sei. Dann schwang De Gier sich nach oben. Die Tür des Hubschraubers schloss sich, die Maschine hob ab. Der Pilot schob einen Hebel nach hinten, und der Helikopter schoss auf eine Wolkenlücke zu. Man überblickte jetzt den ganzen Autostau. «Dingjum?», fragte der Pilot brüllend. Grijpstra und De Gier grinsten, der Adjutant ängstlich und der Brigadier vergnügt. Unter ihnen endete der Deich. Das Blau des Meeres ging in ein fruchtbares Grün über, das bald darauf in das Ziegelrot von Gebäuden überwechselte. «Franeker», brüllte der Pilot, «das schönste Dorf der Niederlande.» Der Hubschrauber durchstieß eine niedrige Wolke. Grijpstra traute sich nicht mehr hinunterzusehen. Einen kurzen Blick wagte er dennoch, schließlich konnte man ja nie wissen. Hatte er überlebt? Ja, tatsächlich, und da, da war auch schon wieder Mutter Erde. Der Hubschrauber berührte die Erde ganz sanft mit den Landekufen, er stand, er ruhte.
Der Pilot salutierte zum Abschied. De Gier war schon draußen und fing seinen taumelnden Vorgesetzten auf. Gemeinsam liefen sie los. Der Hubschrauber stieg wieder auf und drehte seine stumpfe Nase nach Süden.
Grijpstra stöhnte leise.
«Haben wir’s denn jetzt nicht mehr eilig?», fragte De Gier. «Du hast es doch selbst behauptet, und ich wiederum hab’s dieser Motorradschönheit erzählt, denn die hättest du bestimmt nicht rumgekriegt. Wenn wir keinen triftigen Grund gehabt hätten, dann hätten wir ein Knöllchen gekriegt, ohne Rücksicht auf unsere Zugehörigkeit zur Polizei, denn schließlich sind wir ja mit zweihundertzehn über die Straße gefegt. Dabei wäre sogar dein Führerschein fällig gewesen. Ein Adjutant von der Kripo zu Fuß? Siehste mal wieder, ohne mich wärst du jetzt aufgeschmissen.»
«Nichts zu danken», brummte Grijpstra.
Sie standen auf einer Wiese inmitten von laufenden Schafen. Ein Bock rannte auf sie zu. «Hau ab!», brüllte Grijpstra, aber der Bock gehorchte nicht. Hier war er der Chef, und dies war eine einmalige Gelegenheit, seine Frauen von seiner Macht und Stärke zu überzeugen. Mit nach unten gerichteten Hörnern stürmte er auf Grijpstra zu. Du oder ich! «Hilfe», brüllte Grijpstra.
De Gier sprang zu Hilfe. Er rannte von der Seite her auf den Bock zu, packte ihn an Vorder- und Hinterbeinen, und das Tier fiel um.
Keuchend kletterte Grijpstra über den Zaun. De Gier folgte ihm mit einem Sprung, der einem Hürdenläufer alle Ehre gemacht hätte.
«Und jetzt?», wollte Grijpstra wissen.
De Gier deutete auf ein Schild der Rijkspolitie, das unter zwei zusammengewachsenen Linden vor einem verwitterten Häuschen stand. Grijpstra ordnete seine Gedanken, ging hinein und winkte den Kollegen hinter sich her.
Ein Opperwachtmeester stand seinen Kollegen von außerhalb Rede und Antwort. Grijpstra erklärte ihm, um was es ging.
«Sie sind hier der Chef?», fragte De Gier.
«Das ist Luitenant Sudema, aber der hat seinen freien Tag.»
«Also sind Sie der Chef vom Dienst?», sagte Grijpstra.
Der Opperwachtmeester war anderer Meinung. Er sprach in ein Funksprechgerät und verschloss dann die Tür seines Schreibtisches. «Folgen Sie mir bitte, meine Herren.» Die Reise wurde in einem Landrover fortgesetzt, den der Wachtmeester mit stur geradeaus gerichtetem Blick lenkte. An einem Gewächshaus hielt er an. Luitenant Sudema war ein ruhiger großer Mann in einem geflickten Overall. Er legte gerade schöne große Tomaten in durchsichtige kleine Dosen. Grijpstra erklärte ihm das Geschehene.
Der Luitenant füllte noch drei Dosen. «Douwe Scherjoen?»
«Jawohl, Luitenant.»
«Unser Douwe? Bei euch in einem Boot? Erschossen und verbrannt?»
«Sein Schädel hat mich angesehen», sagte De Gier. Er krümmte seine Finger um die Augen und senkte den Kopf nach vorn. «So ungefähr, aber in Wirklichkeit noch viel schlimmer, denn er blickte von ganz weit weg zu mir her.»
«Wir haben ihn bis jetzt nicht in den Akten gehabt», sagte Grijpstra. «War der Mann bei euch bekannt?»
Der Luitenant stapelte seine Tomatendosen. «Mevrouw Scherjoen ist mit meiner Frau, mit Gyske, bekannt. Die Steuerfahndung war hinter Scherjoen her, zwar noch in einer Ermittlung, aber die Sache schien für Scherjoen nicht gerade günstig zu stehen.»
«Sie kennen die Beamten von der Steuerfahndung?»
«Ich lege keinen Wert darauf, sie kennenzulernen», sagte Luitenant Sudema, und seine stahlblauen Augen blitzten kalt. «Blutsauger sind das, aber als Mörder betätigen sie sich meines Wissens nicht.»
«Scherjoen hat sein Einkommen nicht versteuert?»
«Na, jetzt übertreiben Sie», sagte Sudema. Er führte seine Besucher zu den Kastanienbäumen hinter dem Gewächshaus. Unter den riesigen Bäumen verbarg sich ein kleines Haus. Sie gingen hinein, und während der Luitenant seine Kleidung wechselte, schenkte Gyske Sudema Tee ein. Gyske war ebenso kräftig gebaut und jung wie ihr Ehemann. Ihre Beine steckten in einer langen Lederhose, während ihre enge weiße Bluse prall gefüllt war. Ihr Gesicht wirkte vornehm, ihr Augenaufschlag schüchtern. Verführerisch schüchtern, dachte De Gier, dessen Gedanken schon wieder abschweiften. Also stimmte es, was er über die friesischen Frauen gehört, aber nicht so recht geglaubt hatte.
«Uns Douwe ist also dea?», fragte Gyske leise.
«Wir glauben schon», antwortete Grijpstra und berichtete über den ‹Orl› und die teuren Zähne. De Gier wollte Trost spenden und versuchte einzuwenden, dass nichts unumstößlich bewiesen sei und dass ebenso gut ein Denkfehler im Spiel sein könne.
«Dea ôf net dea?», fragte Gyske nochmals.
«Dea», antwortete De Gier.
Gyske wirkte nicht so betrübt, wie man das eigentlich erwarten sollte, eher blickte sie zornig drein. «Meintswegen könn ihn alle Düwels holn. Douwe is een Spitzbube.»
«Wer soll ihn holen?», fragte Grijpstra. Er witterte eine Spur. Sie deutete auf den Fußboden. «De Düwels außer Hölle.»
«Ach die», sagte Grijpstra.
Gyske sprach noch weiter.
«Wie meinen Sie, Mevrouw Sudema?», fragte Grijpstra.
Gyske mäßigte ihren Dialekt. «Dat der Douwe einen schlechten Menschen ist. Een Chauvinist. Ich kann gerne auf ihn verzichten.» Tränen liefen ihr über die Wangen. «Jetzt ist Mem wenigstens frei.»
«Mem?»
«Mevrouw Scherjoen heißt mit Vornamen zwar Krista, aber wir nennen sie Mem, weil sie so mütterlich ist», erklärte Luitenant Sudema.
«Ja», sagte Gyske, «und Mem musste viel leiden. Douwe war genau so schlecht, wie alle übrigen Menschen zusammen.»
«Douwe is dea», sagte De Gier noch einmal im Bewusstsein, damit etwas Tröstendes zu sagen. Gyske runzelte die Stirn. «Ist der Dood denn wohl Strafe genug?»
De Gier wusste das nicht. Weshalb musste es überhaupt Strafen geben? Reichte die Entfernung aus der Gesellschaft nicht aus? Wenn Douwe schlecht war und jetzt tot, dann war doch eigentlich alles wieder in Ordnung?
«Strafe muss doch wohl sein?», fragte Gyske beharrlich.
«Ich weiß es beim besten Willen nicht», antwortete De Gier. «Wissen Sie’s denn nicht? Welcher Religion gehören Sie an?»
Gyske war Reformierte. «Und Sie?»
De Gier war nichts. «Nichts», sagte er deshalb einfach.
Luitenant Sudema schnallte sein Koppel um und schob die Dienstpistole zurecht. In seiner Uniform sah er noch besser, noch männlicher aus.
«Pedes apostolorum, Fahrrad oder Auto?», fragte er. «Laufen? Gute Viertelstunde. Dann können wir uns unterwegs noch unterhalten. Die Scherjoens wohnen in einem Landhaus, ein wenig außerhalb des Dorfes. Das schönste Landgut weit und breit. Es steht auch unter Denkmalschutz.»
Luitenant Sudema lief mit langen Schritten neben De Gier her. Beide waren sie gleich groß. Grijpstra, der hinterherlief, konnte kaum Schritt halten. Das wollte er ändern, und deshalb schob er sich zwischen die beiden. «Wie denken Sie denn über Douwe Scherjoen?»
«Ein Schurke», antwortete der Luitenant. «Ein Egoist, der niemals an andere dachte. Einfach ein Lump.»
De Gier blickte nach oben zur Blätterpracht, die den schmalen Weg überdachte. «Was für schöne Bäume.»
«Buchen», sagte Sudema. «Douwe wollte sie fällen. Bäume seien überflüssig, meinte er. Sehen Sie dahinten die Eiche auf der Weide? Die ist durch Viehfraß abgestorben. Wenn ein Baum auf der Viehweide steht, dann zäunen wir ihn ein. Eine Kleinigkeit, aber für Douwe war das ein Verlustposten. Douwe machte das also nicht, und die Eiche ist abgestorben.»
Grijpstra genoss den Anblick der Bäume am nahe gelegenen Bach. «Weshalb fällt man überhaupt Bäume? Die strahlen doch Ruhe aus, und Ruhe ist für uns Menschen gesund.»
«Aber Buchenholz bringt nun einmal einen ganz schönen Batzen Geld pro Festmeter», warf Luitenant Sudema ein. «Buchen lassen sich leicht in Gulden umrechnen.»
«Klingt recht habgierig» meinte De Gier. «Sagte Douwe das?»