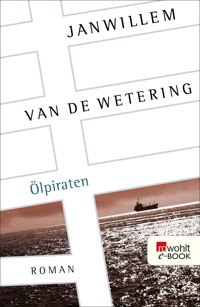4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Amsterdam-Polizisten
- Sprache: Deutsch
Abe Rogge ist tot. Der wohlhabende Straßenhändler starb durch eine Waffe, durch die seit Jahrhunderten kein Mensch mehr zu Tode kam – einen Morgenstern. Adjudant Grijpstra und Brigadier de Gier müssen sich durch eine Straßenschlacht zwischen Polizei und Demonstranten kämpfen, um an den Tatort zu gelangen. Wer hat Abe Rogge ermordet? Ein Transvestit versucht die Antwort zu finden, doch das kostet ihn das Leben. Der Fall ist so kompliziert, dass die Ermittler zu ungewöhnlichen Methoden greifen müssen ... «Wetering ist der Zen-Meister des Kriminalromans.» (die tageszeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Janwillem van de Wetering
Tod eines Straßenhändlers
Roman
Aus dem Englischen von Hubert Deymann
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Eins
«Ja, Mevrouw», sagte der Konstabel ruhig. «Würden Sie mir bitte sagen, wer Sie sind? Und wo Sie sich befinden?»
«Er ist tot», sagte die sanfte, belegte Stimme, «tot. Er liegt auf dem Fußboden. Sein Kopf ist ganz blutig. Als ich ins Zimmer kam, atmete er noch, aber jetzt ist er tot.»
Sie hatte es bereits dreimal gesagt.
«Ja, Mevrouw», sagte der Konstabel noch einmal. In seiner Stimme schwang Geduld und Verständnis mit. Vielleicht Liebe. Aber der Konstabel spielte ihr etwas vor. Er hatte eine gute Ausbildung hinter sich. Ihm ging es nur darum, zu erfahren, wer mit ihm sprach und woher der Anruf kam. Der Konstabel arbeitete schon seit Jahren in der Funkzentrale des Amsterdamer Polizeipräsidiums. Er nahm viele Anrufe entgegen. Jeder, der sechsmal die Zwei wählt, erreicht die Funkzentrale. Jeder – das sind viele Menschen. Einige von ihnen sind seriöse Bürger, einige sind verrückt. Und einige sind vorübergehend übergeschnappt; sie haben etwas gesehen, eine Sensation erlebt. Das Erlebnis hat sie vielleicht mit einem Schlag von ihrer üblichen Routine befreit, oft bis zu dem Punkt, da sie unter einem Schock leiden. Oder sie sind betrunken. Oder sie wollen nur mit jemand sprechen, um zu wissen, dass sie nicht allein sind und es unter den eine Million Einwohnern der niederländischen Hauptstadt einen gibt, der für sie da ist und ihnen zuhört. Jemand, der lebt, nicht nur eine Stimme vom Tonband, die ihnen sagt, dass Gott gut und alles in Ordnung ist.
«Sie sagten, er ist tot», sagte der Konstabel ruhig. «Das tut mir sehr leid, aber ich kann nur zu Ihnen kommen, wenn ich weiß, wo Sie sind. Ich kann Ihnen helfen, Mevrouw, aber wohin soll ich kommen? Von wo aus rufen Sie an, Mevrouw?»
Der Konstabel hatte nicht vor, die Dame aufzusuchen. Es war fünf Uhr nachmittags, und er würde in fünfzehn Minuten Feierabend machen. Er wollte nach Hause, etwas essen und ins Bett gehen. Er hatte an diesem Tag lang und hart gearbeitet, viel mehr als sonst. Die Funkzentrale war unterbesetzt, es fehlten drei Eerste Konstabels und ein Brigadier. Der Konstabel dachte an seine Kollegen und lächelte grimmig. Er konnte sie sich gut genug vorstellen, denn er hatte beobachtet, wie sie morgens den großen Hof des Präsidiums verlassen hatten. Weiß behelmt, einen Schutzschild und einen langen, ledernen Schlagstock in der Hand, nur ein Teil von einem der vielen Mannschaftszüge, die in blauen, gepanzerten Transportwagen davongedonnert waren. In Amsterdam war wieder einmal die Zeit der Unruhen angebrochen. Seit Jahren hatte es keine gegeben, und man hatte den schreienden Pöbel, die fliegenden Ziegelsteine, die brüllenden Fanatiker, die die schwankenden Mengen führten, die explodierenden Gasgranaten, die blutigen Gesichter, die Sirenen von Ambulanzen und Polizeifahrzeugen schon fast vergessen. Jetzt hatte alles wieder von vorn angefangen. Der Konstabel hatte sich für den Dienst zur Bekämpfung der Unruhen freiwillig gemeldet, aber jemand musste das Telefon bedienen. Deshalb war er noch hier und hörte der Dame zu. Die Dame erwartete, dass er kam und sie aufsuchte. Das würde er nicht tun. Aber sobald er wusste, wo sie war, würde ein Polizeiwagen hinrasen. Und die Dame würde mit der Polizei sprechen. Polizei ist Polizei.
Der Konstabel sah auf sein Formular. Name: punktierte Linie. Adresse: punktierte Linie. Anlass: toter Mann. Zeitpunkt: 17.00 Uhr. Sie war vermutlich hinaufgegangen, um den Mann zum Tee oder zu einem frühen Abendessen zu rufen. Sie hatte ihn vom Korridor oder vom Esszimmer aus gerufen. Er hatte nicht geantwortet. Also war sie in sein Zimmer gegangen.
«Ihren Namen bitte, Mevrouw», sagte der Konstabel noch einmal. Seine Stimme hatte sich nicht geändert. Er drängte sie nicht.
«Esther Rogge», sagte die Frau.
«Ihre Adresse, Mevrouw?»
«Recht Boomssloot vier.»
«Wer ist der Tote, Mevrouw?»
«Mein Bruder Abe.»
«Sind Sie sicher, dass er tot ist, Mevrouw?»
«Ja. Er ist tot. Er liegt auf dem Fußboden. Sein Kopf ist ganz blutig.» Das hatte sie alles schon erzählt.
«Ich verstehe», sagte der Konstabel munter. «Wir kommen sofort, Mevrouw. Machen Sie sich jetzt keine Sorgen mehr, Mevrouw. Wir werden gleich dort sein.»
Der Konstabel steckte das kleine Formular durch einen Schlitz in der Glasscheibe, die ihn vom Funker trennte. Er winkte dem Funker zu. Dieser nickte und schob zwei andere Formulare zur Seite.
«Drei eins», sagte der Funker.
«Drei eins», sagte Kriminalbrigadier de Gier.
«Recht Boomssloot vier. Toter Mann. Blutiger Kopf. Sein Name ist Abe Rogge. Frag nach seiner Schwester Esther Rogge. Ende.»
Brigadier de Gier starrte auf den kleinen Lautsprecher unter dem Armaturenbrett des grauen VW, den er fuhr.
«Recht Boomssloot?», fragte er mit hoher Stimme. «Was glaubst du wohl, wie ich dort hinkomme? In dem Stadtteil prügeln sich Tausende von Menschen. Hast du noch nichts von den Unruhen gehört?»
Der Funker zuckte die Achseln. «Bist du noch da?», fragte de Gier.
«Ich bin hier», sagte der Funker. «Fahr nur hin. Ich glaube, der Tod hat mit den Unruhen nichts zu tun.»
«Verstanden», sagte de Gier mit immer noch hoher Stimme.
«Viel Glück», sagte der Funker. «Ende.»
De Gier gab Gas, Kriminaladjudant Grijpstra setzte sich aufrecht hin. «Langsam», sagte Grijpstra. «Wir sitzen in einem Zivilwagen, und die Ampel ist rot. Die hätten uns einen Polizeiwagen geben sollen, ein Auto mit Sirene.»
«Ich glaube nicht, dass noch welche da sind», sagte de Gier und stoppte an der Ampel. «Bis zum letzten Mann sind alle dort draußen. Und außerdem eine Menge Militärpolizisten. Ich habe den ganzen Tag noch kein Polizeiauto gesehen.» Er seufzte. «Die Leute werden uns in dem Augenblick verprügeln, in dem sie sehen, wie wir die Straßensperre durchfahren.»
Die Ampel sprang um. Der Wagen schoss davon.
«Langsam», sagte Grijpstra.
«Nein», sagte de Gier. «Lass uns nach Hause fahren. Heute ist nicht der richtige Tag, um Kriminalpolizist zu spielen.»
Grijpstra grinste und brachte seinen schweren Körper in eine bequemere Position, wobei er sich am Wagendach und am Armaturenbrett festhielt. «Du hast recht», sagte er. «Du siehst nicht wie ein Polizist aus. Die werden auf mich losgehen. Die Leute gehen immer auf mich los.»
De Gier nahm eine Kurve und wich einem geparkten Lastwagen aus, indem er mit den rechten Rädern des VW auf den Fußweg fuhr. Sie befanden sich in einer engen Gasse, die zum Nieuwmarkt führte, dem Zentrum der Unruhen. Niemand war zu sehen. Die Unruhen hatten die Menschen in ihren Strudel gezogen, andere waren dagegen drinnen geblieben und zogen die kleinen Zimmer ihrer Häuser aus dem 17. Jahrhundert der drohenden Gefahr gewalttätiger Hysterie vor, die durch die Straßen schlich und offenbar normale Menschen in Roboter mit schwingenden Fäusten und primitiven Waffen verwandelte, darauf erpicht, den Staat anzugreifen und zu zerstören, der in ihren blutunterlaufenen und vorquellenden Augen von der Polizei repräsentiert wurde. Als Reihen über Reihen blau uniformierter und weiß behelmter Krieger, unmenschlich, Maschinen der Unterdrückung. Sie sahen die Bereitschaftspolizei, die den Ausgang der Gasse bewachte, und eine befehlende behandschuhte Hand hob sich, um den Wagen anzuhalten. De Gier drehte sein Fenster herunter und zeigte seinen Ausweis.
Das Gesicht unter dem Helm war ihm unbekannt. De Gier las die Worte auf der Marke, die an der Jacke des Mannes befestigt war. «DEN HAAG» stand auf der Marke.
«Aus Den Haag seid ihr?», fragte de Gier erstaunt.
«Ja, Brigadier, wir sind etwa fünfzig. Wir wurden heute Morgen rausgebracht.»
«Polizisten aus Den Haag», sagte de Gier erstaunt. «Und als Nächstes?»
«Rotterdam, nehme ich an», sagte der Konstabel. «Es gibt viele Städte in den Niederlanden. Wir werden alle kommen und euch an einem so schönen Tag wie heute helfen. Ihr braucht nur Bescheid zu geben. Wollt ihr weiterfahren?»
«Ja», sagte de Gier. «Wir sollen auf der anderen Seite des Platzes einen Totschlag untersuchen.»
Der Konstabel schüttelte den Kopf. «Ich lasse euch durch, aber ihr werdet sowieso stecken bleiben. Der Wasserwerfer ist eben eingesetzt worden, und die Leute sind jetzt ganz schön böse. Einer meiner Kollegen hat einen Ziegelstein mitten ins Gesicht gekriegt, und sie haben sich auf ihn gestürzt, als er umfiel. Wir haben ihn gerade noch rechtzeitig zur Ambulanz geschafft. Vielleicht solltet ihr versuchen, zu Fuß hinzugehen.»
De Gier drehte sich zur Seite und sah Grijpstra an, der beruhigend lächelte. Angesteckt von der Ruhe seines Vorgesetzten, nickte er dem Konstabel zu. «Wir werden hier parken.»
«Gut», sagte der Konstabel und wandte sich ab. Die Menge kam auf sie zu, zurückgetrieben von einem Angriff nicht sichtbarer Polizisten auf der anderen Seite des Platzes. Der Konstabel straffte sich und hob seinen Schild, um einen Ziegelstein abzuwehren. Ein schwerer Mann taumelte plötzlich nach vorn, und der Konstabel schlug ihn mit dem Stock auf die Schulter. Der Schlag machte ein dumpfes Geräusch, der schwere Mann knickte zusammen. Zwischen der Menge und den Kriminalbeamten waren jetzt ein Dutzend Polizisten, Grijpstra zog de Gier auf eine Veranda.
«Wir warten wohl besser, bis sich die Schlägerei gelegt hat.»
Sie sahen, wie ein Ziegelstein das Dach ihres Wagens einbeulte.
«Zigarre?», fragte Grijpstra.
De Gier schüttelte den Kopf und drehte sich eine Zigarette. Seine Hände zitterten. Was, um Himmels willen, ging in diesen Menschen vor? Er kannte die offiziellen Gründe für diese Unruhen, die kannte jeder. Die U-Bahn, Amsterdams neues Verkehrsmittel, hatte ihren Tunnel bis zu diesem alten und geschützten Teil der Innenstadt vorgetrieben, und einige Häuser mussten abgerissen werden, um dem Ungeheuer Platz zu machen, das sich unten in der Erde vorwärts fraß. Hier würde es irgendwann einen Bahnhof geben. Die meisten Amsterdamer akzeptierten die U-Bahn; sie musste kommen, um den unmöglichen Verkehr zu entlasten, der sich durch die engen Straßen voranquälte und die Luft verpestete. Aber die Bewohner der Gegend am Nieuwmarkt hatten protestiert. Sie wollten, dass der Bahnhof woanders gebaut würde. Sie hatten dem Bürgermeister geschrieben, waren durch die Stadt gezogen, hatten Zehntausende von Plakaten gedruckt und überall angeklebt, hatten die Büros des Baudezernats bedrängt. Und der Bürgermeister und seine Stadträte hatten versucht, die Protestierenden zu besänftigen. Sie hatten manchmal «ja» und manchmal «nein» gesagt. Und eines Tages war dann die Abbruchfirma gekommen, die bei der Ausschreibung der Stadt den Auftrag erhalten hatte, und hatte mit dem Abreißen der Häuser begonnen. Die Bürger hatten sich mit den Abbrucharbeitern geschlagen und diese verjagt und sich, zunächst erfolgreich, mit der Polizei angelegt.
Jetzt waren die Abbrucharbeiter wieder da und die Polizisten in Massen angerückt. Die Bürger würden selbstverständlich verlieren. Aber sie waren inzwischen organisiert. Sie hatten Sprechfunkgeräte gekauft und Posten aufgestellt. Sie hatten ihre Verteidigung organisiert und Barrikaden errichtet. Sie trugen Motorradhelme und hatten sich mit Stöcken bewaffnet. Angeblich hatten sie sogar gepanzerte Wagen. Aber warum? Sie würden ohnehin verlieren.
Grijpstra, der an seinem Zigarillo zog, hörte das Gebrüll der Menge. Der Haufen war jetzt sehr nahe, die Spitze nur noch drei Meter entfernt. Die Polizisten bekamen Verstärkung durch einen Zug, der durch die Gasse herbeieilte, und behaupteten ihren Platz. Drei Polizisten blieben stehen, als sie die beiden auf der Veranda versteckten Zivilisten sahen, aber Grijpstras Polizeiausweis veranlasste sie zum Weitergehen. Warum?, fragte sich Grijpstra, obgleich er die Antwort kannte. Dies war nicht nur ein Protest gegen den Bau einer U-Bahn-Station. Es hatte immer Gewalttätigkeiten in der Stadt gegeben. Amsterdam zieht wegen seiner Toleranz für unkonventionelles Verhalten die seltsamsten Typen an. Die Niederlande sind ein konventionelles Land; aber seltsame Typen müssen auch irgendwohin. Sie kommen in die Hauptstadt, wo die herrlichen Grachten, Tausende und Abertausende von Giebelhäusern, Hunderte von Brücken aller Art, Reihen alter Bäume, zahllose Bars und Cafés abseits vom Verkehr, Dutzende kleiner Kinos und Theater die Außenseiter ermutigen und schützen. Die seltsamen Typen sind eine besondere Sorte Mensch. Sie tragen den Genius des Landes, seinen Drang, etwas zu erschaffen, neue Wege zu finden. Der Staat lächelt und ist stolz auf seine seltsamen Typen. Aber der Staat duldet keinen Anarchismus. Er zwingt die Außenseiter in die Schranken.
Die Gegend um den Nieuwmarkt war die Heimat dieser Leute. Und jetzt, da die Außenseiter versuchten, gegen den vom Staat gewählten Standort für eine U-Bahn-Station zu kämpfen, und sie diesen Kampf verloren und zur Gewalt Zuflucht nahmen, verlor der Staat sein Lächeln und demonstrierte seine Macht, die Macht der blau uniformierten städtischen Polizei und der schwarz uniformierten Militärpolizei, mit glänzend weißen und silbernen Litzen, gestärkt durch Stahlhelme und Gummiknüppel, unterstützt durch gepanzerte Wagen und Fahrzeuge mit Wasserwerfern, die Tausende Liter Wasser mit hohem Druck auf und gegen schreiende bärtige Strolche schleuderten, die noch heute Morgen Künstler und Kunsthandwerker, Dichter oder arbeitslose Intellektuelle, sanftmütige Asoziale oder unschuldige Träumer gewesen waren.
De Gier seufzte. Eine Papiertüte mit pulverisiertem Seifenstein war in die Gasse geflogen und auf dem Straßenpflaster zerplatzt. Die rechte Seite seines modischen Anzugs, angefertigt von einem billigen türkischen Schneider aus blauem Jeansstoff, war mit der weißen, klebrigen Substanz beschmiert. De Gier war ein eleganter Mann und stolz auf seine Erscheinung. Er war auch ein hübscher Mann und hatte nicht gern Pulver in seinem Schnurrbart. Etwas davon würde auch auf seinem dichten, lockigen Haar sein. Ihm behagte der Gedanke nicht, für den Rest des Tages einen weißen Schnurrbart zu haben. Grijpstra lachte.
«Du hast auch was abbekommen», sagte de Gier.
Grijpstra schaute auf seine Hose, aber es war ihm egal. Seine Anzüge waren alle gleich, ausgebeult und aus englischem gestreiftem Stoff, weiße Nadelstreifen auf blauem Untergrund. Der Anzug war alt, ebenso die graue Krawatte, er würde den Verlust nicht betrauern. Sein Hemd war neu, aber die Polizei würde es ersetzen, wenn er einen Bericht machte. Grijpstra lehnte sich an die Tür hinten auf der Terrasse und faltete die Hände vor dem Bauch. Er sah sehr gelassen aus.
«Wir sollten versuchen durchzukommen», sagte de Gier. «Die Dame wird auf uns warten.»
«Bald», sagte Grijpstra. «Wenn wir es jetzt versuchen, kann uns hinterher nur noch die Ambulanz fortkarren, und wenn uns die Strolche nicht erwischen, dann die Polizisten. Sie werden sich nicht die Zeit nehmen, unseren Ausweis zu betrachten. Die sind auch unheimlich nervös.»
De Gier rauchte und hörte zu. Die Massen hatten sich anscheinend verzogen. Die Schreie waren nur noch entfernt zu hören.
«Jetzt», sagte er und trat hinaus auf die Gasse. Die Polizisten ließen sie passieren. Sie rannten über den Platz und wichen einem schweren Motorrad mit Beiwagen aus, das direkt auf sie zukam. Der Brigadier im Beiwagen schlug mit dem Gummiknüppel auf die Metallseiten seines Gefährts. Kratzspuren von Fingernägeln verunzierten sein Gesicht; das Blut war ihm auf die Uniformjacke gelaufen. Der Konstabel, der die Maschine fuhr, war grau vom Staub, und der Schweiß hatte Streifen in seinem Gesicht hinterlassen.
«Polizei», dröhnte Grijpstra.
Das Motorrad bog ab und griff die Menge an, die sich hinter den beiden Kriminalbeamten wieder neu formiert hatte.
Grijpstra fiel hin. Zwei Jugendliche hatten gehört, wie er «Polizei» rief, und ihn gemeinsam angegriffen und ihm gegen die Schienbeine getreten. De Gier war schnell, aber nicht schnell genug. Er traf den ersten Jugendlichen seitlich am Kinn, der mit einem Seufzer zusammenbrach. Den anderen hatte er mit derselben Bewegung getroffen: Die Spitze seines Ellenbogens traf den Jungen seitlich am Gesicht, der vor Schmerzen aufheulte und davonrannte.
«Alles in Ordnung?», fragte de Gier und half Grijpstra auf die Beine. Sie liefen weiter, aber jetzt stand ihnen ein gepanzerter Transporter im Wege, und von hinten traf sie ein Wasserstrahl. De Gier fiel hin. Jetzt änderte der Wasserwerfer seine Position und zielte auf Grijpstras massigen Körper, als der Mann am Werfer die roten Streifen auf dem Polizeiausweis sah, mit dem der Adjudant winkte.
«Haut ab», schrie ein Polizeioffizier die Kriminalbeamten an. «Was, zum Teufel, habt ihr hier eigentlich zu suchen? Wir wollen keine Kriminalbeamten hier.»
«Verzeihung, Mijnheer», sagte Grijpstra. «Wir hatten einen Anruf vom Recht Boomssloot; dies ist der einzige Weg, um hinzukommen.»
«Die sollen warten», brüllte der Inspecteur, das Gesicht bleich vor Angst.
«Das geht nicht. Es handelt sich um einen Totschlag.»
«Schon gut, schon gut. Ich gebe euch Begleitschutz mit, obwohl ich keinen Mann entbehren kann. He! Du und du da. Bringt diese Männer auf die andere Seite. Sie gehören zu uns.»
Zwei stämmige Militärpolizisten kamen auf den Befehl herbei, zerrissene Litzen baumelten von den Schultern.
«Scheiße», sagte der erste der beiden. «Wir haben heute schon alles gehabt, fehlt nur noch eine Schießerei, und die kriegen wir auch, wenn das noch lange so weitergeht.»
«Hat bis jetzt noch keiner sein Schießeisen gezogen?», fragte Grijpstra.
«Einer von euren jungen Burschen hat danach gegriffen», sagte der Militärpolizist, «aber wir haben ihn beruhigt. Sein Kollege hat einen Ziegelstein ins Gesicht gekriegt. Darüber hat er sich aufgeregt. Wir mussten ihm schließlich die Pistole wegnehmen; er sagte, er werde den Kerl erschießen, der seinen Kollegen erwischt hat.»
Grijpstra wollte eine beruhigende Bemerkung machen, da wurde er von einer Tüte mit Specksteinpulver getroffen und konnte für eine Weile nichts sehen.
«Mist, nicht wahr?», sagte der Militärpolizist. «Die müssen Tonnen von diesem verdammten Pulver haben. Wir haben auf dem Dach einen Mann erwischt, der ein schweres Katapult benutzte; er war unser erster Gefangener. Ich möchte die Anzeige lesen, mit der wir kommen werden. Als Nächstes bringen die noch Armbrüste und mechanische Steinschleudern mit. Habt ihr die gepanzerten Wagen von denen gesehen?»
«Nein», sagte de Gier. «Wo?»
«Wir haben sie glücklicherweise bald erwischt, zwei waren es. Man kann nichts tun, wenn sie auf einen zufahren. Ein Freund von mir ist in die Gracht gesprungen, um zu entkommen. Die Menge hatte großen Spaß daran.»
«Habt ihr den Fahrer erwischt?»
«Na klar. Ich hab ihn selbst aus der Fahrerkabine gezogen. Ich musste das Fenster einschlagen, weil er sich eingeschlossen hatte. Das ist eine der Anzeigen, die ich selbst schreiben werde. Er wird drei Monate bekommen.»
«Ein feiner Tag», sagte Grijpstra. «Gehen wir. Auf uns wartet eine Dame.»
Zehn Minuten später waren sie bei der Dame, nachdem sie eine Prügelei überstanden hatten. Grijpstra wurde dabei in die Hand gebissen. De Gier zog die Frau an den Haaren weg. Die Militärpolizisten nahmen sie fest. Ihr fiel das Gebiss aus dem Mund, als man sie in den Transportwagen warf. Sie hoben die Zähne auf und warfen sie ihr hinterher.
Zwei
Der Recht Boomssloot ist eine enge Gracht, flankiert von zwei schmalen Uferstraßen und im Schatten von Ulmenreihen, die an diesem Frühlingsabend das Licht durch den Schleier ihrer frischen hellgrünen Blätter filterten. Die hübschen alten Häuser, die sich in ihrem hohen Alter gegenseitig stützen, spiegeln sich im Wasser der Gracht. Und jeder Besucher, der von den ausgetretenen Touristenpfaden abirrt und sich plötzlich im jahrhundertealten Frieden dieser abgeschiedenen Gegend befindet, wird zustimmen, dass Amsterdam von sich zu Recht behaupten kann, eine schöne Stadt zu sein.
Aber unsere Kriminalbeamten waren nicht in der Stimmung, diese Schönheit zu würdigen. Grijpstra schmerzten die Schienbeine, und die Wunde an seiner Hand sah böse aus. Sein kurzes Bürstenhaar war weiß vom Seifensteinpulver, seine Jacke zerrissen, er hatte überhaupt nicht gemerkt, wie es passierte. De Gier hinkte neben ihm und knurrte einen Polizisten an, der sie aufforderte zu verschwinden. Zivilisten gab es hier nicht mehr, denn die Gracht bot keinen Platz für die Menge. Aber die Polizei hatte den Eingang gesperrt, um den Zugang zum Nieuwmarkt zu verwehren. Man hatte hastig rote und weiße Holzbarrieren errichtet, und Bereitschaftspolizisten, die den Straßenzug bewachten, starrten die Neugierigen an, die schweigend herumstanden und zurückstarrten. Es war nichts zu sehen, da das Handgemenge auf dem Platz durch hohe Giebelhäuser abgeschirmt wurde. Die Atmosphäre an der Gracht war drückend, geladen mit Gewalttätigkeit und Misstrauen. Die Polizisten, zum Nichtstun gezwungen, schlugen mit den Gummiknüppeln an die Stiefelschäfte und brachen so die Stille. In der Ferne waren das Aufheulen der Motorräder und Lastwagen zu hören, das Wimmern des Wasserwerfers und die gedämpften Schreie der tobenden Demonstranten, die sich unheimlich von dem Lärm der Maschinen abhoben. Der Abbruch ging weiter, denn die Häuser mussten abgerissen werden – je früher, desto besser –, und die Kräne, Bulldozer, Presslufthämmer und -bohrer trugen mit ihrem Dröhnen zur allgemeinen Unruhe bei.
«Wir sind Polizisten, Kumpel», sagte de Gier zu dem Bullen und zeigte seinen Ausweis, der zerknittert worden war, als de Gier vorhin hinfiel.
«Verzeihung, Brigadier», sagte der Konstabel, «heute trauen wir keinem. Wie steht es dort drüben?»
«Wir gewinnen», sagte Grijpstra.
«Wir gewinnen immer», sagte der Konstabel. «Es ist langweilig. Ich sähe lieber Fußball.»
«Nummer vier», sagte de Gier. «Wir sind da.»
Der Konstabel ging davon und schlug mit dem Gummiknüppel auf das gusseiserne Geländer an der Gracht. Grijpstra schaute an dem viergeschossigen Haus empor, das einem ordentlich gemalten Schild neben der Eingangstür zufolge Nummer vier war. «Rogge» stand auf einem anderen Schild.
«Eine Dreiviertelstunde haben wir gebraucht», sagte de Gier. «Hervorragende Dienstleistungen liefern wir heutzutage, und dort drinnen ist angeblich ein Toter mit blutigem Gesicht.»
«Vielleicht auch nicht», sagte Grijpstra. «Die Leute übertreiben, weißt du. Adjudant Geurts hat mir erzählt, dass er gestern Abend gerufen wurde, um einen Selbstmord zu untersuchen. Und als er zu der Adresse kam, aß die alte Dame gerade einen leckeren frischen Toast mit Matjes und gehackten Zwiebeln. Sie hatte es sich anders überlegt. Das Leben war am Ende doch nicht so schlecht.»
«Ein Mann mit blutigem Kopf kann es sich nicht mehr anders überlegen», sagte de Gier.
Grijpstra nickte. «Stimmt. Und er wird kein Selbstmörder sein.»
Er klingelte. Niemand antwortete. Er klingelte noch einmal. Die Tür wurde geöffnet. Der Korridor war dunkel. Sie konnten die Frau erst sehen, als sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte.
«Er liegt oben», sagte die Frau. «Ich geh mal voraus.»
In der ersten Etage bogen sie in einen anderen Korridor ein. Die Frau öffnete die Tür zu einem Zimmer, das der Gracht gegenüberlag. Der Mann lag rücklings auf dem Fußboden, das Gesicht zerschmettert.
«Tot», sagte die Frau. «Er war mein Bruder. Abe Rogge.»
Grijpstra schob die Frau sanft zur Seite und bückte sich, um das Gesicht des Toten zu betrachten. «Wissen Sie, was passiert ist?», fragte er. Die Frau bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Grijpstra legte ihr den Arm um die Schultern. «Wissen Sie irgendwas, Juffrouw?»
«Nein, nein. Ich kam herein, und da lag er so.»
Grijpstra sah de Gier an und zeigte mit der freien Hand auf ein Telefon. De Gier wählte. Grijpstra zog seinen Arm von den Schultern der Frau und nahm de Gier das Telefon aus der schlaffen Hand.
«Bring sie raus», murmelte er, «und schau nicht auf die Leiche. Trinkt beide ’n Kaffee. Ich komme später zu euch in die Küche.»
De Gier war weiß im Gesicht, als er die Frau hinausführte. Er musste sich am Türpfosten stützen. Grijpstra lächelte. Er hatte es schon oft gesehen. Der Brigadier hatte eine Allergie gegen Blut, aber er würde es bald überwunden haben.
«Der Mann hat eine tödliche Schädelverletzung», sagte er am Telefon. «Veranlagt alles Notwendige und schafft uns den Commissaris her.»
«Ihr steckt im Demonstrationsgebiet, nicht wahr?», fragte die Stimme in der Funkzentrale. «Da werden die Wagen nie durchkommen.»
«Besorgt eine Barkasse von der Wasserschutzpolizei», sagte Grijpstra. «Wir hätten eine haben sollen. Vergesst nicht den Commissaris. Er ist zu Hause.»
Er legte den Hörer auf und steckte die Hände in die Taschen. Die Fenster im Zimmer waren geöffnet. Die Ulmen verdeckten den blassblauen Himmel. Für eine Weile ließ er den Blick auf dem zarten jungen Grün ruhen, und er bewunderte eine Amsel, die, unbekümmert um die unheimliche Atmosphäre ihrer Umgebung, plötzlich ein Lied angestimmt hatte. Ein Spatz hüpfte auf der Fensterbank umher und schaute zur Leiche hinüber, den winzigen Kopf zur Seite geneigt. Grijpstra ging ans Fenster. Die Amsel und der Spatz flogen fort, aber Möwen stürzten sich immer wieder auf die Wasseroberfläche der Gracht und suchten nach Brotresten und toten Fischen. Es war der Beginn eines Frühlingsabends, an dem der Bewohner des Zimmers nicht mehr teilhatte.
Wie ist das passiert?, fragte sich Grijpstra. Das Gesicht des Mannes war eine Masse aus zerbrochenen Knochen und geronnenem leuchtend rotem Blut. Ein großer Mann, vielleicht in den Dreißigern. Er trug Jeans und eine blaue, halb lange Jacke mit Gürtel. Um den muskulösen, sonnengebräunten Hals hatte er eine schwere goldene Kette. Er ist im Urlaub gewesen, dachte Grijpstra, vermutlich gerade erst wiedergekommen. Spanien. Vielleicht Nordafrika oder irgendwo auf einer Insel. Er muss wochenlang in der Sonne gewesen sein. Kein Mensch wird braun im niederländischen Frühling.
Er sah die kurzen gelbblonden Locken, gebleicht in der frischen Luft, und den Bart, der von genau der gleichen Beschaffenheit war. Das Haar schmiegte sich dem Kopf des Mannes an wie ein Helm. Ein starker Kerl, dachte Grijpstra, er hätte ein Pferd stemmen können. Schwere Handgelenke, schwellende Armmuskeln.
Er hockte sich hin, betrachtete das Gesicht des Mannes noch einmal und sah sich dann im Zimmer um. Da er nicht fand, was er suchte, begann er umherzugehen, vorsichtig, die Hände immer noch in den Taschen. Aber der Ziegel oder Stein war nicht da. Es hätte eine so schlichte und einfache Lösung sein können. Der Mann schaut zum Fenster hinaus. Draußen Unruhen. Jemand wirft einen Ziegel. Der Ziegel trifft den Mann im Gesicht. Der Mann fällt hintenüber. Der Ziegel fällt ins Zimmer. Aber hier war kein Ziegel. Er ging zum Fenster und sah hinaus auf die Straße. Er sah immer noch keinen Ziegel. Der behelmte Polizist, der sie vorher angehalten hatte, lehnte an einem Baum und starrte auf das Wasser.
«He, du», rief Grijpstra. Der Polizist schaute nach oben. «Hat man hier heute Nachmittag mit Steinen geworfen?»
«Nein», rief der Konstabel zurück. «Warum?»
«Dem Burschen hier hat man das Gesicht zerschmettert. Es könnte ein Stein gewesen sein.»
Der Konstabel kratzte sich am Hals. «Ich werde gehen und die anderen fragen», rief er nach einer Weile. «Ich bin nicht den ganzen Nachmittag hier gewesen.»
«Der Stein könnte vom Gesicht des Mannes abgeprallt und wieder auf die Straße gefallen sein. Hol bitte ein paar von deinen Kollegen und sucht die Straße ab, ja?»
Der Konstabel winkte und lief davon. Grijpstra drehte sich um. Es konnte selbstverständlich eine Waffe gewesen sein oder sogar eine Faust. Vielleicht mehrere Schläge. Kein Messer. Ein Hammer? Vielleicht ein Hammer, dachte Grijpstra und setzte sich auf den einzigen Sessel, einen großen Korbsessel mit hohem Rücken. Er hatte vor einigen Tagen in einem Schaufenster einen ähnlichen Sessel gesehen und erinnerte sich an den Preis. Es war ein hoher Preis. Der Tisch im Zimmer war ebenfalls kostspielig, antik und schwer, mit einem einzigen verzierten Bein. Auf dem Tisch lag ein Buch, ein französisches Buch. Grijpstra las den Titel. Zazie dans le Métro. Auf dem Schutzumschlag war das Bild eines kleinen Mädchens. Irgendein kleines Mädchen, das in der U-Bahn ein Abenteuer erlebt. Französisch verstand Grijpstra nicht. Viel mehr war im Zimmer nicht zu sehen. Ein niedriger Tisch mit Telefon sowie ein Telefonbuch und einige andere französische Bücher in einem Stapel auf dem Fußboden. Die Zimmerwände waren leer, bis auf ein ziemlich großes ungerahmtes Gemälde. Er betrachtete das Gemälde mit Interesse. Es dauerte eine Weile, ehe er sagen konnte, was er sah. Das Bild schien aus einem großen schwarzen Punkt oder einer Konstellation von Punkten auf blauem Untergrund zu bestehen, aber es musste ein Boot sein, stellte er schließlich fest. Ein kleines Boot, ein Kanu oder Dingi, das auf einem fluoreszierenden Meer schwimmt. Und im Boot befanden sich zwei Männer. Das Bild war nicht so traurig, wie es auf den ersten Blick schien. Das Fluoreszieren des Meeres, angedeutet durch weiße Streifen seitlich vom Boot und in dessen Kielwasser, erweckte eine gewisse Heiterkeit. Das Gemälde beeindruckte ihn, er schaute es immer wieder an. Andere Gegenstände im Zimmer fesselten seine Aufmerksamkeit für einen Augenblick, aber das Bild zog ihn magisch an. Wäre die Leiche nicht gewesen, die den Raum durch ihre erschreckende und groteske Gegenwart beherrschte, würde das Zimmer die perfekte Umgebung für das Gemälde sein. Grijpstra besaß selbst einiges Talent und hatte ernsthaft vor, eines Tages zu malen. Als junger Mann hatte er gemalt, aber die Ehe und die sich plötzlich um ihn ausbreitende Familie und das kleine unbehagliche Haus – in der Lijnbaansgracht gegenüber dem Polizeipräsidium –, erfüllt vom vernichtenden Lärm eines Fernsehgeräts, das seine taube Frau nie abstellen wollte, und die immer gegenwärtige Existenz dieser schlaffen Frau, die ihn und die Kinder anschrie, hatten seinen Ehrgeiz frustriert und fast umgebracht. Wie würde er ein kleines Boot malen, das allein auf dem unermesslichen Meer schwimmt? Er würde mehr Farben verwenden, aber mehr Farben würden den Traum verderben. Denn das Bild war ein Traum, ein Traum, den zwei Freunde gleichzeitig träumen, zwei Männer, schwebend im Raum, gezeichnet als zwei kleine, miteinander verbundene Linienstrukturen.
Er streckte die Beine aus, lehnte sich zurück und atmete schwer. Dies wäre ein Zimmer, in dem er leben könnte. Das Leben würde zum Vergnügen werden, denn ein schwerer Tag würde nicht so schwer sein, wenn er wusste, dass er in dieses Zimmer zurückkehren konnte. Und der Tote hatte in diesem Zimmer gewohnt. Er seufzte noch einmal. Er schaute auf das niedrige Bett beim Fenster. Auf dem Bett lagen drei Schlafsäcke mit Reißverschluss, einer geschlossen und zwei offen. Der Mann hatte vermutlich in dem einen Sack geschlafen und die beiden als Zudecke benutzt, falls es nötig war. Sehr vernünftig. Keine Umstände mit Laken. Wenn ein Mann Laken will, braucht er eine Frau. Die Frau muss das Bett machen und die Laken wechseln und sich um die anderen hunderttausend Dinge kümmern, die ein Mann zu brauchen glaubt.
Grijpstra würde gern auf einer Pritsche schlafen und sich mit einem offenen Schlafsack zudecken. Morgens steht er auf und lässt das Bett, wie es ist. Kein Staubsauger. Das Zimmer einmal wöchentlich ausfegen. Kein Fernsehen. Keine Zeitungen. Vielleicht nur einige Bücher und Schallplatten, aber nicht zu viele. Nichts kaufen. Alles, was dich fesselt, verwirrt dein Leben. Selbstverständlich könnte er eine Frau zu sich einladen, aber nur, wenn er absolut sicher sein konnte, dass sie wieder gehen und nie mit Plastikwicklern im Haar schlafen würde. Er betastete sein Gesicht. Es hatte einen Kratzer, der schon dort gewesen war, ehe er sich den Weg durch die aufrührerischen Massen freigekämpft hatte. Mevrouw Grijpstra hatte sein Gesicht mit einem ihrer Lockenwickler geritzt; sie hatte sich umgedreht, er hatte vor Schmerzen aufgeschrien, aber sie war nicht wach geworden. Sein Schrei hatte ihr Schnarchen halb unterbrochen; sie hatte einige Male mit den Lippen geschmatzt und den Schnarcher beendet. Und als er ihre Schulter geschüttelt hatte, da hatte sie ein wässriges Auge geöffnet und gesagt, er solle die Schnauze halten. Bloß keine Kinder mehr. Es gibt schon genug Kinder in Holland.
«Warum, zum Teufel …», sagte er jetzt laut, machte sich jedoch nicht die Mühe, die Frage zu beenden. Er war so allmählich in diese Patsche geraten, dass er nie anhalten und sich ihr entwinden konnte. Das Mädchen hatte ganz gut ausgesehen, als es ihm über den Weg gelaufen war, und dessen Eltern auch. Und er machte ein bisschen Karriere bei der Polizei, und es stimmte alles genau. Sein ältester Sohn war allmählich zum Taugenichts geworden, mit langen, schmutzig glatten Haaren, vorstehenden Zähnen und einem glänzenden, brüllenden Motorrad. Die beiden Kleinen waren noch sehr nett. Er liebte sie. Daran gab es keinen Zweifel. Er würde sie nicht verlassen. Also war es nichts mit einem Zimmer wie diesem. Alles sehr logisch. Er schaute noch einmal auf die Leiche. War jemand gekommen und hatte den Riesen mit einem Hammer geschlagen, mitten ins Gesicht? Und hatte der Riese dort gestanden, den Hammer kommen sehen und dessen Wucht voll auf die Nase gekriegt, ohne auch nur zu versuchen, sich zu verteidigen? War er vielleicht betrunken gewesen? Er stand auf und ging zum Fenster. Drei Polizisten stocherten mit ihren langen Schlagstöcken zwischen den Kopfsteinen herum.
«Irgendwas gefunden?»
Sie schauten hinauf. «Nichts.»
«Habt ihr etwas über Steinewerfer erfahren?»
«Ja», rief der Konstabel, der zuvor dort gewesen war. «Hier ist es den ganzen Tag über ruhig gewesen. Wir waren nur hier, um die Leute daran zu hindern, zum Unruheherd zu gelangen.»
«Habt ihr jemand durchgelassen?»
Die Polizisten sahen einander an, dann schaute der erste wieder hinauf zu Grijpstra.
«Viele. Jeden, der hier zu tun hatte.»
«Hier ist ein Mann ermordet worden», rief Grijpstra. «Habt ihr jemand gesehen, der herumgelaufen ist? Der sich sonderbar benahm?»
Die Polizisten schüttelten den Kopf.
«Danke», rief Grijpstra und zog den Kopf ein. Er setzte sich wieder und schloss die Augen, um die Atmosphäre des Zimmers zu spüren, aber allmählich schlief er ein. Das Geräusch einer Schiffsmaschine weckte ihn. Er schaute hinaus und sah, dass draußen eine niedrige Barkasse der Wasserschutzpolizei festgemacht wurde. Sechs Mann kamen herunter, der Commissaris, ein kleiner, nett aussehender älterer Mann, als Erster. Grijpstra winkte, die Männer marschierten zur Tür.
«Guter Kaffee», hatte de Gier unterdessen gesagt. «Vielen Dank. Trinken Sie auch einen, Sie brauchen ihn. Sagen Sie mir bitte, was geschehen ist. Fühlen Sie sich jetzt besser?»
Die Frau, die ihm am Küchentisch gegenübersaß, versuchte zu lächeln. Eine schlanke Frau mit dunklem, zu einem Knoten aufgestecktem Haar, schwarzer Hose und schwarzer Bluse und einem Halsschmuck aus kleinen roten Muscheln. Sie trug keine Ringe.
«Ich bin seine Schwester», sagte sie. «Esther Rogge. Nennen Sie mich bitte Esther, das tun alle. Wir wohnen hier jetzt seit fünf Jahren. Ich hatte eine Wohnung, aber Abe kaufte dieses Haus und wollte, dass ich zu ihm ziehe.»
«Sie haben sich um Ihren Bruder gekümmert», sagte de Gier. «Ich verstehe.»
«Nein. Abe brauchte keinen, der sich um ihn kümmerte. Wir haben nur das Haus miteinander geteilt. Ich hab das Erdgeschoss und Abe die erste Etage. Wir haben sogar kaum zusammen gegessen.»
«Warum nicht?», fragte de Gier und gab ihr Feuer für die Zigarette. Sie hatte lange Hände, keinen Lack auf den Nägeln, ein Nagel war abgebrochen.
«Wir zogen es vor, nicht viel Aufhebens miteinander zu machen. Abe sorgte für einen gefüllten Kühlschrank und aß nur, was ihm gefiel. Wenn wir zufällig beide zu Hause waren, kochte ich schon mal für ihn, aber er hat mich nie darum gebeten. Er aß viel außerhalb. Wir führten jeder unser eigenes Leben.»
«Wovon hat er gelebt?», fragte de Gier.
Esther versuchte wieder zu lächeln. Ihr Gesicht war noch blass, die Schatten unter den Augen zeigten sich als dunkelrote Flecken, aber es war wieder etwas Leben in ihren Mund gekommen, der kein Schlitz mehr in einer Maske war.
«Er war Händler, er verkaufte Sachen auf der Straße. Auf dem Straßenmarkt in der Albert Cuypstraat. Sie kennen sicherlich die Albert Cuypstraat?»
«Ja, Juffrouw.»
«Nennen Sie mich bitte Esther. Manchmal bin ich zu ihm in die Albert Cuypstraat gegangen. Ich hab ihm auch geholfen, wenn ich einen freien Tag hatte. Er verkaufte Glasperlen und alle Arten von Tuch und Wolle und bunte Bänder und Litzen. An Leute, die sich ihre Sachen gern selbst machen.»
«Sozusagen an kreative Leute», sagte de Gier.
«Ja. Kreativ zu sein ist jetzt sehr modern.»
«Sie sagen, Ihr Bruder hat dieses Haus gekauft? Das muss ihn eine schöne Stange Geld gekostet haben, oder hat er eine große Hypothek aufgenommen?»
«Nein, es gehört ihm ganz. Er hat viel Geld verdient. Er hat nicht nur Sachen auf der Straße verhökert, wissen Sie, sondern auch im Großhandel mitgemischt. Er fuhr immer mit dem Lastwagen in die Tschechoslowakei und kaufte dort tonnenweise Glasperlen direkt von der Fabrik, die er an andere Straßenhändler und auch an große Geschäfte verkaufte. Und er kaufte und verkaufte auch andere Waren. Der Straßenmarkt war nur so zum Spaß, er ging immer nur montags hin.»
«Und Sie, was tun Sie?»
«Ich arbeite an der Universität; ich habe einen akademischen Grad in Literatur.»
De Gier machte ein beeindrucktes Gesicht.
«Wie heißen Sie?», fragte Esther.
«De Gier. Brigadier de Gier. Rinus de Gier.»
«Darf ich Sie Rinus nennen?»
«Gern», sagte de Gier und schenkte sich Kaffee nach. «Haben Sie eine Ahnung, warum dies passiert ist? Meinen Sie, es besteht eine Verbindung zu den Unruhen?»
«Nein», sagte sie. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. De Gier streckte die Hand aus und hielt ihre Hand fest.
«Man hat mit irgendeinem Ding nach ihm geworfen», sagte der Commissaris und schaute nach unten auf die Leiche. «Und zwar mit beträchtlicher Kraft. Aus der Wucht des Aufschlags könnte man fast schließen, er sei beschossen worden. Vielleicht mit einem Stein. Aber wo ist er?»
Grijpstra erläuterte, was er aus seinen bisherigen Ermittlungen schließen konnte.
«Ich verstehe», sagte der Commissaris nachdenklich. «Kein Stein, sagst du. Und keine Ziegelbrocken. Ich verstehe. Auf dem Nieuwmarkt haben sie mit Ziegeln geworfen, wie man mir sagte. Mit roten Ziegeln. Sie zerbrechen und fallen auseinander, wenn sie etwas treffen. Hier auf dem Fußboden ist kein roter Staub. Es könnte jedoch ein richtiger Stein gewesen sein, den dann jemand gefunden und in die Gracht geworfen hat.»
«Es hätte ein platschendes Geräusch gegeben, Mijnheer, und die Straße ist den ganzen Tag über bewacht worden.»
Der Commissaris lachte. «Ja. Totschlag, und wir sitzen direkt davor, schon den ganzen Tag, und haben nichts gemerkt. Sonderbar, nicht wahr?»
«Ja, Mijnheer.»
«Und er kann noch nicht lange tot sein. Seit Stunden, länger nicht. Seit einigen Stunden, würde ich sagen. Der Arzt wird jeden Augenblick hier sein; die Barkasse ist zurückgefahren, um ihn zu holen. Er wird es wissen. Wo ist de Gier?»
«Unten, Mijnheer, er spricht mit der Schwester des Mannes.»
«Er konnte das Blut nicht ertragen, nicht wahr? Meinst du, er wird sich je daran gewöhnen?»
«Nein, Mijnheer. Nicht wenn er gezwungen ist, es für eine Weile anzusehen. Wir waren mitten in den Unruhen, und er hat sich gut geschlagen, und das Blut an meiner Hand hat ihm nichts ausgemacht, aber wenn Blut mit Tod verbunden ist, scheint es ihn zu erwischen. Er muss sich übergeben. Ich hab ihn noch rechtzeitig nach unten geschickt.»
«Jeder Mensch hat seine eigene Furcht», sagte der Commissaris leise. «Aber ich frage mich, wodurch dies hier angerichtet worden ist. Eine Schusswaffenkugel kann es nicht gewesen sein, weil kein Loch da ist, aber anscheinend ist jeder Knochen im Gesicht zerschmettert. He! Wer sind Sie?»