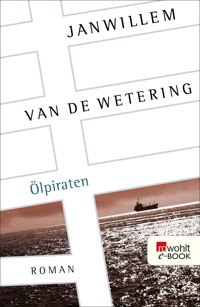7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Zen-Geschichten
- Sprache: Deutsch
Die Frage nach dem Sinn des Lebens hat Janwillem van de Wetering nie losgelassen. Auf seiner Suche begegnet er ehemaligen Klosterschülern, machthungrigen Zen-Meistern, enttäuschten Anhängern oder einem alkoholabhängigen tibetischen Rimpoche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Janwillem van de Wetering
Reine Leere
Erfahrungen eines respektlosen Zen-Schülers
Deutsch von Klaus Schomburg
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
1Das Abschieds-Koan
Koans werden mächtig überschätzt. Das sagte ein Hindu-Lehrer, den ich Baba nennen will, ein Inder in weißer Kleidung, den ich während einer langen schneebedingten Wartezeit auf dem Bostoner Flughafen traf, aber andererseits könnte er selbst auch überschätzt worden sein. Es gibt eine Menge Konkurrenz auf dem Gebiet der Religion. Auch Neid. Neid ist eine Tatsache des Lebens. Das sagte einer meiner Zen-Lehrer, kurz bevor sein Zentrum einging und wir, die Schüler, uns in der großen, schlechten Welt wiederfanden. Die meisten von uns verließen die Gegend, um nie wieder etwas von sich hören zu lassen, doch einen meiner früheren Kumpel fand ich wieder, als ich in einer kleinen Maschine über die Wälder Maines flog.
Dieser Mann, den ich Ben-san nennen werde, war einst ein Idealist gewesen, der in den idealistischen sechziger Jahren nach Japan reiste, um Zen zu studieren. Durch Zufall gelangte er in denselben Tempel wie ich, aber wir verpassten uns. Ich reiste, ein paar Wochen bevor er eintraf, ab. Ihm später in Amerika zu begegnen war ein ziemliches Ereignis, denn wir kannten dieselben Leute, damals in Kioto. Denselben Abt, denselben Klostervorsteher, dieselben Mönche. Dieselben Bars in Kiotos Weidenviertel, die wir an unseren freien Abenden besucht hatten.
Wie ich blieb Ben ein paar Jahre in dem japanischen Zen-Tempel, erhielt das Mu-Koan, löste es nie und reiste ab. Es gab noch weitere Übereinstimmungen: Wir hatten beide das gleiche Alter, wir waren beide weißhäutige Männer mit protestantischem, in seinem Fall fundamentalistischem, Hintergrund, wir tranken beide. Beide schienen wir eine ähnliche künstlerische Veranlagung zu haben, die ihn dazu trieb, Pagoden in orientalisch angelegten Gärten zu errichten, und mich, Geschichten zu schreiben und Skulpturen aus Gerümpel zu bauen, wenn mein Rücken das Bedürfnis hatte, sich zu strecken. In Amerika, in den frühen siebziger Jahren, landeten wir beide bei demselben Lehrer, den ich hier Sensei nenne. Sensei hatte viele Jahre in Japan verbracht, und laut Zen-Gerüchteküche waren seine Einsichten von qualifizierten Autoritäten bestätigt worden. Ben und ich traten in Senseis nordamerikanisches Zen-Zentrum ein, praktizierten den weglosen Weg und studierten Koans.
Dieselben Koans, von denen der indische Guru Baba, den ich auf dem Logan Airport traf, sagte, er habe sie aus hinduistischer Perspektive studiert und sie mit ein paar Ausnahmen geistreich, ein wenig gekünstelt und auf jeden Fall unzureichend gefunden. Baba lächelte entschuldigend. «In Anbetracht der Reputation des Zen hatte ich wahrhaftig etwas mehr erwartet.» Ich musste lachen. Das waren genau die Worte, die Sensei gern nach einer anstrengenden Meditationswoche zu sagen pflegte, aber er sagte es ernst. Sensei schien über das Versagen seiner Schüler immer aufrichtig enttäuscht zu sein.
Als ich mich während eines Blizzards auf dem Logan Airport herumtrieb – alle Stühle waren besetzt, die Toiletten quollen über –, entdeckte ich Baba, dessen ungewöhnliches Aussehen ihn aus der Menge hervorhob. Immer begierig zu lernen, näherte ich mich dieser Gestalt in fließenden Gewändern und mit wallendem Haar.
«Sind Sie ein Guru, Sir?»
«Gewiss doch.» Baba sprach mit einem scharfen, hohen indischen Akzent. «Sind Sie ein Wahrheitssucher?»
«Ich war Zen-Schüler, Sir.»
«Sie haben aufgegeben?»
«Nicht, was meine Fragen betrifft, Sir.»
«Aber Zen haben Sie aufgegeben?»
«Eigentlich nicht, Sir. Aber ich bin jetzt, glaube ich, auf meinem eigenen Weg.»
Baba nickte. Er wusste alles über Zen. Über die Praxis des «Zazen», die Meditation, das Koan-Studium und das Lösen von Dharma-Rätseln beim «Sanzen», der frühen morgendlichen Begegnung im Tempel des Meisters, während man einem Lehrer gegenübersitzt.
Ich sagte, dass ich das viele Jahre lang getan hätte, an Abenden und Wochenenden, denn gewöhnlich wäre ich tagsüber einem Beruf nachgegangen. «Wie kommt es, dass Sie ein Guru sind, Baba?»
Er sah mich unter eindrucksvoll buschigen Augenbrauen hervor hochmütig an. Hatte ich dieses entwickelte Wesen falsch angeredet? Ich hatte ihn nicht beleidigen wollen. «Shrih Baba? Shrih Baba Maharaj? Haben Sie einen Titel, Sir? Eure Heiligkeit, vielleicht?»
Er lächelte und verbeugte sich. «Kümmern Sie sich nicht um meine Titel. Heilige Titel sind Quatsch, mein Freund.»
Das gefiel mir. Das war eine Bemerkung, die Bodhidharma dem Kaiser von China gegenüber hätte machen können, bevor er aus dem kaiserlichen Palast schritt, um weitere neun Jahre in seiner Höhle zu meditieren.
Frische dreißig Zentimeter Schnee bedeckten die Start- und Landebahnen Bostons. Baba hatte Zeit zum Plaudern. Er erzählte mir, dass er sich auf Flughäfen wohl fühle, denn er habe seine Karriere auch auf einem Flughafen, dem JFK in New York, begonnen. Vor seiner Zeit als Guru war Baba ein illegaler Ausländer gewesen und hatte mit dem Säubern von Restauranttischen seinen Lebensunterhalt verdient. Auch dies waren wieder die sechziger Jahre, eine spirituelle Zeit. Amerika entwickelte eine Nachfrage nach Esoteriklehrern. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ließ heilige Männer ins Land kommen. Kellner Baba fiel auf, dass die Lehrer, die aus seinem Heimatland zum JFK strömten, weiße Kleider und viel Haar im Gesicht trugen. Sie waren Hindus. Sie hatten große, ausdrucksvolle Augen und scharfe Gesichtszüge. Sie zitierten die Baghavatgita. Sie rezitierten Mantras, mit heiligen Kräften versehene Sanskritsilben, und hielten ihre Hände in bestimmten Stellungen, die als «Mudras» bekannt sind. Sie wurden stets von gutgekleideten Damen und ihren langhaarigen männlichen Begleitern abgeholt, von Paaren mit teuren Autos, die auf dem Flughafenparkplatz auf sie warteten.
«Was», fragte mich Baba, «hielt mich davon ab, mich selbst zum Guru zu erklären?» Der Titel ist nicht geschützt. Baba hatte mitteilenswerte Einsichten in rauen Mengen gesammelt, in früheren Leben und in der Armut und im Leid der Gegenwart. Um seinen wahren Status zu zeigen, brauchte er einen weißen Dhoti und eine passende Jacke sowie Sandalen, um mit seinen langen, muskulösen Zehen anzugeben, Dinge, die nicht schwer zu bekommen waren. Die anderen Attribute nannte er bereits rechtmäßig sein eigen. Er war in einer frommen (wenn auch hungernden) Familie der hohen Brahmanenkaste aufgewachsen, kannte die Hinduschriften auswendig, unterhielt einen Hausaltar, brannte Weihrauch und warf sich täglich beim Beten zu Boden. Er meditierte sogar von Zeit zu Zeit, obwohl Meditation, so sagte Baba, auch nicht so toll sei, wie es immer hieß. Wenn man es übertreibe, tue einem der Arsch weh. Ob mir das aufgefallen war?
Das war es. Durch langes Zazen hatte ich chronische Hämorrhoiden bekommen. Baba erklärte mir, der menschliche Körper sei nicht dafür geschaffen, über lange Zeiträume hinweg im vollen oder auch nur im halben Lotos zu sitzen. Die Haltung übe einen übermäßigen Druck auf das Rektum aus. Es fiel mir leicht, das zu glauben. Präparat H gehört zur Grundausstattung in Zen-Klöstern, zusammen mit Malox, denn das zu schnelle Essen zu heißer Mahlzeiten, der Druck gleichgesinnter Zeloten, zu wenig Schlaf, das unaufhörliche, ständige Drängen des Meisters, ein Koan zu lösen, erzeugen mentale Spannungen, die in Zen-Mägen Geschwüre hervorrufen.
«Richtig», sagte Baba. «Vergessen Sie das alles. Ihr eigener geschätzter Buddha empfahl seinen Schülern, den mittleren Weg zu gehen, Exzesse zu vermeiden.»
«Keine spirituellen Übungen?»
«Nur das tägliche Leben», sagte Baba. «Dazu ein bisschen Achtsamkeit. Nehmen Sie sich täglich Zeit, ein kurzes Ritual Ihrer Wahl zu praktizieren, im übrigen einfach nur sein, mein Freund.» Er senkte seine Stimme und starrte mich hypnotisierend an. «Nur sein.»
«Aber was ist mit dem Leiden?»
Er zuckte die Schultern. «Was soll damit sein?»
Ich sagte, Leiden sei nicht schön.
«Leiden Sie?», fragte Baba mich.
Ich musste zugeben, dass es mir gutging, danke. Es schien mein Karma zu sein, dass es mir gutging. Ich sollte mich nicht beklagen, um Himmels willen, aber mein gewöhnliches Schicksal war doch vielleicht manchmal ein bisschen langweilig. Was ich auch tat, wohin ich auch ging, es schien mir einfach gutzugehen. Sehen Sie mich jetzt an: neue Tweedjacke und genau die richtigen Reißverschlussstiefel, ein guterhaltenes, allradgetriebenes Auto auf dem Parkplatz meines Heimatflughafens, eine wundervolle Frau, die mich in einem komfortablen Haus auf gärtnerisch gestalteten Ländereien erwartete, ordentliches Einkommen, alles in allem gute Gesundheit, die kompletten CDs von Miles Davis und eine gute Hi-Fi-Anlage auf dem Regal neben dem Computer, nun sehen Sie sich andere Leute an. Ich zeigte Baba ein zweiseitiges Farbfoto von der Küste Bangladeschs, das in einer Zeitschrift, die ich mir soeben gekauft hatte, abgebildet war. Bei jüngsten Überschwemmungen waren zahllose Menschen und Tiere ertrunken; als das Meer sich zurückzog, hoben sich über viele Kilometer ein weißer und ein brauner Streifen von der Küste ab, der weiße bestand aus toten Menschen in weißen Baumwollgewändern, der braune aus totem Vieh.
«Und?», fragte Baba.
«Das Leiden dieser Bangladeschianer lässt mich zweifeln.»
«Zweifeln woran?»
«Ob es einen Sinn gibt.»
«Im Leiden?»
«Ja», sagte ich, «im Leben.»
«Einen Sinn im Leben?» Baba klopfte mir auf die Schulter. «Es gibt keinen.»
«Dann ist all dies nur schmerzhaftes Chaos?»
Baba hob eine Hand, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und zitierte dann mit seiner hohen Stimme: «Es gibt kein Leiden, keinen Grund für das Leiden, kein Ende des Leidens …»
«… und keinen Weg», vollendete ich.
«Sie kennen das Herz-Sutra», sagte Baba. «Es ist nicht hinduistisch, aber auch der Buddhismus ist indisch, und alles, was Buddha tat, war, einen Teil unserer ursprünglichen Religion wiederzubeleben. Ja, Sie haben recht. Kein Weg, vergessen Sie den ‹Weg›. Der ‹Weg› wird völlig überbewertet.»
Ich fing an, Baba zu mögen. Er schien ein Meister der fernöstlichen Methode der Negation zu sein. Neti, neti. Das, was nicht ist. Vernichte alle Konstruktionen, dann genieße den leeren Raum. «Haben Sie einen Tempel?», fragte ich.
Er hatte einen, in den Catskill Mountains, meinte aber, dass ich dort nichts Besonderes finden würde. Ich solle mir lieber das gegenwärtige Fehlen eines Status zunutze machen. Warum mich für die Bürde einer weiteren Disziplin interessieren? Baba, in seinem spirituellen Zentrum, beschäftigte die Leute nur mit einer garantiert unschädlichen Routine wie zum Beispiel begrenzter Meditation und dem Singen der Schriften. Sein Kollektiv wurde zum Teil als Farm betrieben, sodass es Arbeit zur Bewältigung von Depression und Stress gab. Regeln halfen den Schülern, standhaft zu bleiben. Alle mussten weiße Dhotis und Jacken und offene Sandalen auf dem Gelände tragen (die meisten Schüler kamen zum Wochenende, manchmal auch für «Übungswochen»), das Herumspielen mit bewusstseinsverändernden Substanzen war nicht erlaubt, ferner keine Gitarrenmusik nach vorgeschriebenen Zeiten, kein Müßiggang außer für diejenigen mit Guru- oder Guru-Begleitstatus, keine exzessiven Geschenke, um sich beim Lehrer einzuschmeicheln; und während der Abschiedszeremonien (privat, wenn die Schüler das Zentrum verließen, um für eine Weile nach Hause zu fahren) verteilte er Lob und Plätzchen.
«Mit Schokoladensplittern», sagte Baba. «Ich selbst mache mir nichts daraus, aber Amerikaner assoziieren sie mit liebevoller elterlicher Fürsorge. Den englischen Schülern gebe ich verdauungsfördernde Kekse.»
«Backen Sie Ihre Geschenke selbst?»
Baba kaufte sie bei Stop and Shop.
Er hatte eine gewisse Durchtriebenheit an sich, die ich, mit einem Kaufmannshintergrund aus der holländischen Stadt Rotterdam stammend, wiedererkannte. Ich versuchte, mich mit einer höflichen Formulierung zu erkundigen, ob Baba vielleicht in Geschäften tätig sei. Ob er seinen dummen Schafen das Fell über die Ohren zog. Er schnitt mir das Wort ab, sobald ich das Wort «Geld» gebrauchte.
«Sie meinen Habgier?» Eine interessante Schwäche, aber er habe sie überwunden. Die Versuchung war da, denn er sei so lange arm gewesen. In den frühen Tagen seiner spirituellen Gesundheitsfarm hatte er dieser Versuchung nachgegeben. Baba fuhr eine Zeitlang einen Jaguar, aß Gourmetgerichte, verlangte hohe Honorare für spezielle Interviews, erhielt den Status der Steuerfreiheit, erhöhte sein Einkommen sogar, indem er mit der kostenlosen Arbeit seiner Schüler ein Bio-Restaurant betrieb, doch eine Überdosis an materiellem Erfolg hatte ihn nervös gemacht. Er schloss das Restaurant und reduzierte die monatlichen Beiträge seiner Schüler. Der Jaguar wurde jetzt von seiner «Lady Nummer eins» gefahren, die ihn benutzte, um für die Gemeinschaft einzukaufen. Baba fuhr ein Fahrrad, wie damals in Kalkutta, aber dieses hatte zehn Gänge.
«Und Sex?»
«Sex», er nickte weise. «Auch den gibt es.»
Ich erzählte ihm, dass sexuelle Begierde, zuerst frustriert, später pervertiert, dazu beitrug, das buddhistische Zentrum, in dem ich studiert hatte, zu ruinieren. Baba nickte mitfühlend. Er konnte das verstehen. Schließlich ist ein heiliger Mann immer noch ein Mann, und ein Mann hat Bedürfnisse. Er wollte nicht nach Manhattan fahren, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Es war schöner, wenn der Sex zu ihm in seinen Tempel kam. Er hatte nie ein sich selbst verleugnender Einsiedler sein wollen. Eine junge Dame hatte sich in Geschenkpapier gewickelt und kam in einem Einkaufswagen, den zwei Freundinnen im Bikini schoben, in seine Unterkunft gerollt. War es falsch, wenn ein erleuchteter Lehrer das Geschenk eines attraktiven Schüler-Egos akzeptierte? Das Ich ist die Maske, die herunter muss, um reines Sein hervortreten zu lassen. Nur im Zustand des reinen Seins kann göttliche Einsicht klar und unverfälscht sein.
Sensei sagte immer: «Wenn mir jemand seinen schönen Geist schenkt, warum sollte ich dann nicht auch seinen schönen Körper haben können?», erzählte ich Baba.
«Wie interessant», meinte Baba. «Jetzt erzählen Sie mir von den Koans, die Sie in den vielen Jahren Ihrer Zen-Praxis gelöst haben, mein Freund.»
Es war keine Zeit mehr, eine Startbahn war geöffnet worden, und Babas Flugzeug wartete. Er gab mir seine Karte. «Kommen Sie mich mal besuchen.» Er streichelte meine Schulter. «Aber bringen Sie mir nicht Ihre persönlichen Probleme mit. Ich kann Leuten nicht helfen, ihre Ego-Bürde zu tragen.» Er drückte mir die Hand. «Ich will es auch nicht.»
Er ging davon, ein Bündel menschlichen Lichts. Würde es nicht Spaß machen, einige Zeit in seinem Schokoladensplitterplätzchen-Himmel zu verbringen? Aber nein. Baba hatte wahrscheinlich recht. Es ist für einen Mann in den Fünfzigern schwer, wieder auf der Wiese zu tanzen, Daddy und seinem zahlenmäßig begrenzten, egolosen Gefolge gefallen zu wollen.
Fühlte ich mich jetzt nicht zufrieden, allein auf mich gestellt? Tat ich nicht genau das, was Baba empfahl, indem ich das tägliche Leben als meine Übung, mein «Sadana», benutzte, jeden Morgen an meinem Altar das Herz-Sutra sang und vor dem kleinen Plastikskelett eines Dinosauriers – einer ausgestorbenen Spezies, zu der der Homo sapiens auch ziemlich bald gehören würde –, das ich in einer offenen Schachtel zwischen Zeremonialkerzen aufbewahrte, Weihrauch verbrannte?
Das buddhistische Zentrum zu verlassen hatte mir nichts ausgemacht, aber manchmal vermisste ich meine Kumpel, vor allem Ben-san. Ich fragte mich, wie er wohl zurechtkam.
Leiden wird durch Begehren verursacht, und ich wollte Ben-san zweifellos wiedersehen. Ich würde mich nicht speziell darum bemühen, aber Wünsche, deutlich zum Ausdruck gebracht, haben es an sich, erfüllt zu werden, meistens noch zu Lebzeiten.
Ein Techniker im Dorf hatte sich ein Flugzeug gebaut und fragte mich an einem sonnigen Wintertag, ob ich ihn auf einer kleinen Spritztour begleiten wolle. Wir flogen um den Mount Kathadin herum und entdeckten auf unserem Rückweg, über Flüsse und Seen hinweggleitend und riesige Flächen wilder Wälder überquerend, nicht weit von der Behelfslandebahn bei Purple Hill entfernt, eine Pagode. Mein Pilotenfreund umkreiste das Bauwerk und fand einen langen gewundenen Pfad, der dorthin führte. Wir waren beide beeindruckt. Die Pagode war, wie ich erkannte, die Miniversion eines berühmten Tempels in Kioto. Sie hatte drei Stockwerke, in deren erstem sich die Wohnräume zu befinden schienen. Es gab auch einen Landschaftsgarten, dessen Umrisse unter dem Schnee erkennbar waren. Am Fuße dekorativer Riesenfelsblöcke konnte ich die Moosflecken erahnen, die sich zweifellos als glühend orange und gelbe Flechten zeigen würden, wenn das Tauwetter einsetzte. Es gab auch eine etwa zehn Quadratmeter große, leicht geriffelte Fläche mit drei Felsblöcken neben dem Zentrum, die so aussah, als würde sie in der milderen Jahreszeit täglich geharkt. Und ein gefrorener Teich war da, in dem, wie ich vermutete, große bunte Karpfen unter dem Eis überwinterten. Ein sehr Zen-ähnlicher Garten. Der Pilot hatte Ben-san ebenfalls gekannt. «Das muss Bens Anwesen sein, hier versteckt der sich jetzt also.» Wir umkreisten die Pagode noch einmal, viel niedriger als die erlaubten zweihundert Meter, und sahen, wie ein Mann herauskam und mit einer Schrotflinte fuchtelte.
«Tatsächlich Ben», sagte der Pilot.
«Muss ihn mal besuchen», sagte ich.
Der Pilot überprüfte seine Instrumententafel und reichte mir eine Notiz mit den Koordinaten des Standortes. «Sollte nicht schwer zu finden sein. Du kannst dir mein tragbares Ortungsgerät ausleihen. Der Pfad dorthin verläuft im wesentlichen in Nord-Süd-Richtung und führt aus Sorry heraus. Beginnt bei Blackberry Brook. Du kannst ihn nicht verfehlen, wenn du einen Kompass und mein GPS mitnimmst. Pass aber lieber auf, dass du nicht erschossen wirst.»
Sorry ist ein Vorort der Küstenstadt Rotworth in Maine, wo ich nun schon eine ganze Weile lebe. Ich wartete auf einen weiteren schönen, klaren Tag mit der richtigen Sorte Schnee für meine Schneeschuhe. Nach meiner Karte betrug die Entfernung von Sorry aus ungefähr zehn Meilen. Ich brach früh auf und erreichte Bens Pagode gegen Mittag.
Er kam mit seiner Schrotflinte heraus, ließ sie jedoch sinken und umarmte mich flüchtig. «Du riechst jetzt besser», sagte er. «Im Zendo hast du gestunken.»
Er musste es wissen, wir saßen viele badlose Wochen lang nebeneinander. Auch ich erinnerte mich an seinen Duft.
«Bist du jetzt ein Eremit?», fragte ich.
Ben-san sagte, das gefalle ihm besser als die Schulung in unserem buddhistischen Zentrum. Das Alleinleben in der Pagode habe ihm auch geholfen, mit dem Trinken aufzuhören. Ich hatte ebenfalls mit dem Trinken aufgehört. Ich sagte, Alkohol erfülle meine Bedürfnisse nicht mehr. Er hielt das für eine alberne Ausdrucksweise, und wahrscheinlich sei es auch unwahr. «Deine Frau hat dir die Pistole auf die Brust gesetzt. Dir gesagt, entweder hörst du auf, oder sie geht. Jetzt brauchst du eine Macho-Entschuldigung. Versuchst immer, das Publikum zu beeindrucken. Hast dich nicht sehr geändert, was?»
«Womit verdienst du denn jetzt dein Geld, Ben?»
Er tue nicht viel, erwiderte er. Er sei nicht immer in der Pagode. In manchen Sommern arbeite er in New Hampshire, wohne umsonst bei seinen Arbeitgebern, spare ein paar Dollars. Im Frühjahr, Herbst und Winter lebe er von seinen Vorräten und führe ein Einsiedlerleben, umgeben von den Tieren in der Natur.
Mehrere Eichelhäher waren in der Nähe, ein oder zwei Eichhörnchen, eine Gruppe Meisen, ein paar Finken. Ich sah, dass sich an strategischen Plätzen Futterstellen befanden, die wie kleine Tempel geformt waren. Ben-san war immer noch von der Bauleidenschaft gepackt. Er kam mir einsam vor.
«Besorg dir eine Frau», sagte ich, «irgendeine freundliche, fürsorgliche Seele, die es leid ist, von ihrem sadistischen Freund missbraucht zu werden. Lies sie an einem Freitagabend im Lazy Loon in Rotworth auf. Du wirst der König im Schloss sein. Diese Frauen haben seit Jahren keinen nüchternen Mann mehr gesehen.»
Er war nicht daran interessiert, Frauen glücklich zu machen.
«Vielleicht ein männliches Wesen als Seelengefährten? Einen liebenswerten Zen-Schüler?»
Er sagte, er habe die Menschen aufgegeben. Ben-san, der Misanthrop. Er verschränkte abwehrend seine Arme. Ich überließ ihn seiner Pose und bewunderte den Hintergrund. Die Pagode war eine eindrucksvolle Konstruktion, gebaut aus ungleichen handbearbeiteten Stämmen und mit Schwalbenschwänzen zusammengefügt wie ein chinesisches Puzzle. Alles Holzzapfen, nirgendwo Nägel. Die knifflige Handarbeit musste Monate einsamer Winterzeit gekostet haben. Die zierlich abfallenden Dächer waren von altmodischen, mit einem Riesenmeißel behauenen Zederschindeln bedeckt. Ein Juwel in den Wäldern. Ich verneigte mich und rezitierte das alte tibetische Mantra: Om mani padme hum, Heil dem Juwel im Lotos.
«Habe nie verstanden, was das bedeutet», sagte Ben.
«Praktizierst du immer noch Zen?», fragte ich, als er schließlich die Arme von der Brust nahm.
Er nickte. «Sicher.»
«Zazen?»
Ein bisschen Zazen. Nicht zuviel. «Ich habe es nie gemocht. Eine halbe Stunde am Morgen, eine halbe Stunde am Abend. Mehr kann ich jetzt nicht mehr ab. Das endlose Zen-Sitzen hat mir einen Scheißdreck gebracht.»
Ich bemerkte eine Fernsehschüssel auf dem Pagodendach und in einem Anbau einen rostigen Honda-Generator.
«Ich sehe den Kultfilmkanal», sagte Ben. «Manchmal auch Opern. Aber nicht zu lang hintereinander. Es ist mühsam, das Gas für den Generator hereinzutragen.»
Ich glaubte ihm nicht. Da waren mehrere 55-Gallonen-Zylinder, etwas vom Haus entfernt unter einem eigenen Dach, und ich entdeckte einen Schlitten und ein altes, aber funktionstüchtig aussehendes Schneemobil. Ben-san ist ein kräftig gebauter Mann, es würde ihm nicht einmal Mühe bereiten, ein schweres Gewicht zehn Meilen mit der Hand zu tragen.
Ich konnte es nicht lassen, ein bisschen Peergroup-Druck auszuüben. «Betreibst du noch dein Koan-Studium? Muss schwer sein ohne Sensei, der dir sagt, wo’s langgeht.»
«Sensei.» Er zuckte die Achseln. «Bin froh, diesen verdrehten Unsinn los zu sein.»
«Aber du arbeitest immer noch an einem Koan, Ben?»
Die Arme kreuzten sich wieder vor einer geschwellten Brust. «Was geht dich mein Koan-Studium an?»
«Aber, Ben-san, wir sind Dharma-Brüder.» Ich erinnerte ihn daran, in welch ferne Vergangenheit das zurückreichte. Dass wir Trinkkumpel gewesen waren. Dass wir uns geschworen hatten, unser Leben gegenseitig als Spiegel zu benutzen. «Sake für zwei», sang ich nach der «Tea-for-two»-Melodie, während ich um ihn herumhüpfte.
Er taute ein bisschen auf. Nur an einem Koan arbeite er noch, erzählte Ben mir über gebackenen Bohnen mit Tofu, über Reis mit Chili-Sauce und eingelegtem Daikon, einem japanischen Rettich. An dem Koan, das er, ein paar Monate bevor Senseis Einsiedelei wieder in den Naturzustand zurückverfiel, erhalten hatte. Die Anhänger der Disziplin sollten eigentlich nicht über ihre Koans sprechen, aber da wir beide, Ben und ich, entlassen worden waren, konnten wir uns jetzt als davon entbunden betrachten. «Erzähl mir von deinem letzten Koan», sagte ich, in dem Glauben, hier ein wenig Überlegenheit zeigen zu können. Nicht, dass er sich von mir würde helfen lassen wollen. Zen-Schüler halten sich für die Creme des buddhistischen Haufens, die, die den kurzen, steilen Weg gehen. Wir sind potentielle Bodhisattwas erster Klasse, nur noch ein weiteres Koan, und wir kommen direkt ins Nirwana.
«Erzähl mir von deinem Koan, lieber Ben-san.»
«Nö.»
Okay. Ich war auf den Eingangsstufen der Pagode und schob meine Stiefel in die Schneeschuhe. Zum Teufel mit Mr. Selbst-ist-der-Mann. Er konnte in seiner Pagode verrotten. Trotzdem war es ein hübsches Gebäude. Ich hatte Ben erzählt, dass seine Schöpfung mich an eine Spielzeugpagode erinnerte, die meine Mutter in den zwanziger Jahren aus Indonesien, aus Niederländisch-Indien, wie sie das Land immer noch nannte, mitgebracht hatte.
Die kleine Pagode war aus einem Elefantenstoßzahn hergestellt worden und hatte wie Bens drei Stockwerke. Meine Mutter sagte, sie habe sie im Borobudur gekauft, Javas größtem buddhistischen Tempel, der eine ganze Hügelspitze bedeckt, ein kunstvolles Stück Architektur, das aufgegeben wurde, nachdem der Islam an die Stelle des Buddhismus getreten war. Jedes Stockwerk hatte eine Reihe an Angeln befestigter winziger Türen. Es machte mir Spaß, sie zu öffnen und hineinzuschauen. In jeder Kammer waren Buddhastatuen gewesen, doch da sie herausgenommen werden konnten, gingen sie verloren. Meine Mutter beweinte ihr Verschwinden, aber ein chinesischer Buddhistenfreund tröstete uns, die Pagode mache mehr Sinn ohne ihre früheren Bewohner. «Form ist Leere. Es ist besser, nichts zu zeigen.»
Das zweite und dritte Stockwerk von Ben-sans Pagode waren ebenfalls leer. Sie hatten nicht einmal Türen. Der Wind strich ungehindert unter ihren aufgeschwungenen Dächern hindurch. Nur das untere Stockwerk hatte Wände, war isoliert und mit Türen und Sturmtüren versehen. «Irgendwo muss ich schließlich leben», sagte Ben, als er mir seine spärlichen Möbel zeigte. Er runzelte wieder die Stirn. «Füllst du deine ganzen Nebengebäude immer noch mit Besitztümern? Die Villa? Die Doppelgarage? Die Studios? Den Pavillon? Das Gästehaus?»
Er wusste, wovon er sprach. Er hatte meine Anlage entworfen und gebaut. In jenen Tagen brauchte er mehr Geld, um seine Reisen in den Zen-trainingsfreien Zeiten zu finanzieren, und ich versorgte ihn mit Arbeit.
«Danke für den Tofu», sagte ich. «Ich gehe jetzt.»
Er hielt mich zurück. «Ich arbeite am Stier-Koan.»
In den verschiedenen Zen-Sekten sind wahrscheinlich ein Dutzend Stier-Koans in Gebrauch. «Welcher Stier?»
«Das Warum-kommt-der-Schwanz-nicht-durch-Koan», erwiderte Ben-san. «Es macht mich verrückt.»
Es ist die Absicht des Koans, den Zen-Schüler verrückt zu machen. Ich schüttelte meine Schneeschuhe ab und gestattete Ben, mich wieder in seine Wohnräume zu führen. Wir tranken Kaffee.
«Gozo En Zenji», sagte ich. «Das ist der Zen-Meister, den Sensei zitierte. Ich erinnere mich an Gozos Geschichte. Hat etwas damit zu tun, dass man sich im Zazen-Raum befindet, früh am Morgen, und Sensei hockt dir auf seinen Kissen gegenüber, in seinem japanischen Roshi-Gewand, das ihm zu klein geworden ist, seit er zugenommen hat. Er deutet auf das kleine Fenster über seinem Kopf und sagt, es ist wie mit Gozos Büffelstier, der durch dieses Fenster kommt – sein riesiger Kopf, seine großen Hörner, seine vier Beine gehen durch, aber das ist alles, der Schwanz zeigt sich nie. Was bedeutet das, na?»
«Richtig», bestätigte Ben. «Du hattest das Koan also auch?»
Ben-san und ich arbeiteten in den Tagen unserer Zen-Schulung wahrscheinlich immer an denselben Koans.
Was sind nun Koans? Es sind Rätsel, die absichtlich unklar formuliert sind. Teile fehlen. Kein Zen-Schüler, weder vor zweitausend Jahren in China noch vor tausend Jahren in Japan noch heute in den Wäldern von Maine oder in einem kalifornischen Tal oder auf einer Mesa in Arizona, kann ein bestimmtes Koan verstehen, wenn der Lehrer vorher nicht ein paar Erklärungen gibt. Und das wird er nicht tun. Er will, dass man sich in seiner Dummheit windet. Selbst Sensei, der, als ich ihm in Japan begegnete, ein fortgeschrittener Schüler und schon lange dabei war und viele Jahre Sanzen hinter sich hatte, beklagte sich über Koans, er nannte sie «Wortlabyrinthe». Er arbeitete an einer langen Geschichte, in der ein weißer Kranich vorkam, und ein weißer Kranich hat eine bestimmte Bedeutung in der chinesischen Mythologie (ich habe jetzt vergessen, welche), und wenn man nicht weiß, was er bedeutet, wird man nie herausfinden, was der weiße Kranich in dem langen Koan tut, und man wird das Zen-Rätsel nicht lösen. In Senseis Fall wusste sein japanischer Lehrer nicht, dass Sensei, ein Amerikaner, die esoterische Bedeutung von «weißer Kranich» nicht kannte, mit dem Ergebnis, dass Meister und Schüler im Sanzen-Raum mit den Köpfen zusammenstießen und «wertvolle Zeit verloren wurde». Damals dachte ich, dass jene Beschwerde auch keinen Sinn machte. Hatte Sensei es eilig? Wollte er seinen Titel morgen? War er scharf darauf, seinen eigenen Laden als Lehrer aufzumachen?
Vermutlich war er das. Ben-san jedoch hatte nie Interesse an einer buddhistischen Karriere gezeigt. Höchstwahrscheinlich wollte er nur so Dinge wissen wie zum Beispiel, ob sich ein Sinn darin verbarg, dass er in eine fundamentalistische Protestantengemeinschaft, die einer strengen und unversöhnlichen Gottheit diente, der Ben nur entkommen wollte, hineingeboren wurde? Und was war mit dem Wunder des Lebens, dem er sich, bei seiner Liebe zu den Tieren in der Natur und seiner Bewunderung für schöne Strukturen, nahe fühlte, das er aber nie festhalten konnte, nicht einmal nach dem dritten Becher Sake? Warum gab es den Vietnamkrieg? Warum musste es sein, dass ein vollkommen guter Planet verschmutzt wurde? Jedes Mal, wenn er ein neues Koan erhielt, dachte er, die Antwort könnte vielleicht seine Suche beenden, doch es gab immer einen weiteren Berg am Horizont. Das Stier-Koan war das letzte, an dem er arbeiten wollte. Er musste unbedingt die Antwort wissen. Kannte ich sie?
«Dein Stier-Koan ist ein überbewertetes Koan», ließ ich Ben wissen. «Es ist nicht wie das Koan Mu oder das Geräusch einer klatschenden Hand. Das Schwanz-des-Stiers-Koan hat nichts mit dem Nichts zu tun. Es weist nicht auf die große Leere hin. Es umfasst nicht das ganze Herz-Sutra in einer einzigen Negation. Es ist dein letztes Koan, und es ist unbedeutend.»
«Woher weißt du das?», fragte Ben. «Hast du das verdammte Ding gelöst?»
«Aber da gibt es nichts zu lösen», sagte ich. «Es ist bloß die kleine Illustration eines Problems, das nicht verschwinden wird. Weißt du, wofür ‹Schwanz› in der chinesischen Mythologie steht?»
«Für etwas zum Wedeln?»
Ich schüttelte den Kopf. Wäre dies Sanzen gewesen mit mir als Zen-Meister, der auf einer Plattform auf seinem Stapel Kissen thront, und mit Ben als Schüler, unterwürfig unten auf der Tatami, hätte ich meine kleine Glocke ergriffen und sie geschüttelt, und er hätte sich dreimal ausstrecken und fortgehen müssen, um am nächsten Tag früh und munter wieder zurück zu sein.
«Dicht dran», sagte ich. «Es ist etwas, mit dem man steckenbleibt. Der Begriff ‹Schwanz› in der fernöstlichen Symbolik bedeutet ‹Ego›, ‹Persönlichkeit›. Der Schwanz steht für ‹Ichsein›, und kein fleischgewordener Geist, ob er als Dalai Lama oder Allen Ginsberg, Christus, du, der letzte US-Präsident oder ich daherkommt, kann der Persönlichkeit entkommen, mit der wir nun einmal zufällig ausgestattet sind. Von der Wiege bis zur Bahre, sie ist immer da, verändert sich ständig, aber verschwindet nie ganz. Die Sorge um unsere eigene Person hält uns zwangsläufig zurück. Ich werde mir meinen Schwanz nicht abschneiden, bestenfalls kann ich versuchen, der Tatsache gewahr zu werden, dass ich von dem Anhängsel festgehalten werde.»
«Hast du das irgendwo gelesen?»
Klar hatte ich das irgendwo gelesen. Zen hält nicht viel von Büchern, aber es waren vierzigtausend Zen-Bücher in Asien erhältlich, bevor der Westen anfing, diese Zahl zu vervielfachen. Die meisten «offiziellen» Zen-Bücher, d.h. die meisten von qualifizierten Meistern veröffentlichten Abhandlungen zählen Koans auf und erklären sie irgendwie, ein paar ganz offen. Da gibt es THE SOUND OF ONE HAND, 281 Koans und ihre Antworten, ein 1916 von einem echten Zen-Meister verfasstes Werk, kommentiert seither von mehreren anderen echten Zen-Meistern (einige sagen, es könne nicht schaden, andere meinen, es sollte verbrannt werden), übersetzt von dem Gelehrten Yoel Hoffmann, verlegt von Basic Books in New York, 1975. Die ursprüngliche Version dieses verräterischen Buchs wurde von mehreren Zen-Meistern aus Tokio aufgekauft und vernichtet, aber der Herausgeber druckte neue Auflagen. Es gab, und es gibt immer noch, THE GREEN GROTTO RECORD mit hundert von den Zen-Meistern Engo und Dai-e aus dem zehnten und elften Jahrhundert erläuterten Koans, erhältlich in wenigstens zwei englischen Übersetzungen. Es gibt das MUMONKAN (Die torlose Schranke) und das HEKIGANROKU (Niederschrift von der Smaragdenen Felswand), zwei klassische Koansammlungen. Große Büffelstiere und ihre hinderlichen Schwänze werden in diesen Arbeiten dargestellt.
«Es war Senseis Abschieds-Koan», sagte ich zu Ben. «Er verabschiedete sich von uns, seinen ersten Schülern, die er in Japan kennengelernt hatte und die ihm hier draußen in die Einsiedelei von Sorry folgten. Es zeigt, dass Zen-Lehrer Egos haben und dass er keine Ausnahme war. Sen-sei wollte uns mitteilen, dass alles, was er so offenkundig falsch gemacht hatte, unvermeidlich war. Er entschuldigte seine misslungene Show hier. Er zeigte uns am Beispiel des Stierschwanzes, der nie durch das Licht des Erleuchtungsfensters gelangen würde, dass ein Teil von ihm im Schlamm festsaß.»
«Wie lautet also die richtige Antwort?», fragte Ben, denn alle «kleinen» Koans haben eine einzige richtige Antwort. Die muss man bei der Rinzai-Sekte, der Sensei angehörte, dem Lehrer geben, der einen aus der bis dahin erreichten Ebene der Einsicht entlässt und einem das nächste «kleine» Koan aufgibt, das einen weiteren Teilaspekt von Mu, der torlosen Schranke, dem Gegenstand des wirklichen, grundlegenden Rätsels, klären könnte. («Hat auch ein Hund Buddha-Wesen?», fragte der Mönch den Priester Joshu. Der Priester sagte «Mu», das bedeutet «nein».)
Die richtige Antwort?
«Du machst Folgendes», sagte ich zu Ben, «du schiebst dich auf den Knien ein wenig näher an die Plattform heran, lächelst höflich, und dann greifst du hinter Sensei und ziehst mit einem so gewaltigen Ruck an seinem Gewand, dass er beinahe hintenüberkippt, und du sagst: ‹Also, du hängst selbst ziemlich fest, stimmt’s, alter Knabe?›»
«Das ist alles?»
Das war alles.
Es war Zeit, die Pagode zu verlassen. Ben zog seine Schneeschuhe an und begleitete mich ein Stück auf dem Weg nach Sorry. «Dann war es also Senseis Abschieds-Koan, wie? Sein Ego hatte ihm ein hübsches Bein gestellt, seine Karriere als Lehrer zunichte gemacht, und er würde nicht mehr unsere Zeit und Mühe verschwenden? Oder seine?»
«Vielleicht», sagte ich.
«Du weißt es nicht sicher?»
Ich sagte, ich hätte es erfunden. Ich wisse nichts sicher. Und ich wünschte Ben-san «Buddha zum Gruße». Er kehrte um. Es hatte wieder heftig zu schneien begonnen.
2Was geschah mit Harry?
Manche Leute haben eine besondere Begabung fürs Zen-Studium. Sie lernen in einem Jahr Japanisch und/oder Chinesisch, bewegen sich nie während der Meditation und sehen, im Falle uniformierter Mönche, gut aus in Roben, die sie selbst flicken. Sie sind Naturbegabungen. Sie wissen Dinge, bevor man sie ihnen sagt.